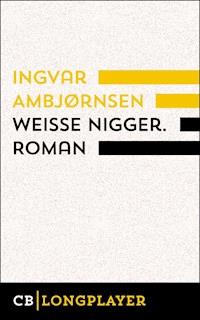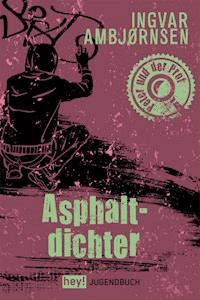3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Elling-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der 1. Teil der Elling-Tetralogie vom norwegischen Kultautor Ingvar Ambjörnsen Schauplatz ist eine Plattenbausiedlung am Rande von Oslo, Ambjörnsens Held ein zweiunddreißigjähriger Frührentner – Elling. Nach dem Tod seiner Mutter installiert er ein teures Fernglas in seiner Wohnung, richtet es auf den Nachbarblock und verfolgt Abend für Abend, was sich hinter den erleuchteten Fenstern abspielt. Er beobachtet kleine entlarvende Details, verpaßt den Personen Namen, Geschichten und Lebensläufe, dichtet Handlungen und Gespräche. Seine Phantasien werden immer absurder, seine Spekulationen immer abenteuerlicher – doch die eigene Wirklichkeit holt ihn am Ende ein. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Ähnliche
Ingvar Ambjörnsen
Ausblick auf das Paradies
Ein Elling-Roman
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
FISCHER E-Books
Inhalt
MUTTER STARB. Das Ganze lief sehr undramatisch ab. Wenn sich ein Wort wie »undramatisch« für den Übergang in die Große Ungewißheit, ins Absolute, überhaupt verwenden läßt. Doch, das geht. Erst kürzlich habe ich im Arbeiderbladet über eine Frau aus Beirut gelesen. Man hatte sie zu Tode gefoltert, indem man ihr eine Ratte in den Unterleib zwang, die sich mit ihren gelben Nagezähnen selbst den Weg aus dem Körper heraus bahnen mußte. Einen solchen Tod kann man mit Fug und Recht als dramatisch bezeichnen, anders als das Einschlafen in einem frischgemachten Krankenhausbett, ohne erwähnenswerte Schmerzen. Der Krebs hatte sich in ihrer Leber festgesetzt, es gab keine Heilungsmöglichkeit, wie die Ärzte sagten, aber sie kümmerten sich gut um sie, als es soweit war.
Sie starb am 11. November. Ich habe vergessen, was das für ein Wochentag war. Gegen neun Uhr morgens rief jemand vom Krankenhaus an und sagte, ich müsse sofort kommen. Als ich dort eintraf, war alles vorbei. Sie hatten sie schon zurechtgemacht; ich weiß noch, daß sie ganz klein aussah, wie eine Wachspuppe. Sie sagten, ich solle nicht traurig sein, weil ich nicht rechtzeitig gekommen sei; sie sei nicht mehr wach geworden, sondern vom Schlaf direkt in den Tod übergegangen.
Danach ging ich hinaus in den Regen. Es war windstill, der Regen fiel gleichmäßig und dicht, ziellos ging ich durch die Straßen unten in der Innenstadt; ich weinte nicht, ich war nicht einmal besonders traurig, und gerade dafür schämte ich mich ein bißchen. Aber abgesehen von diesem Schuldgefühl, das mich übrigens nicht besonders quälte, das muß ich zugeben, fühlte ich mich nur leer. Nicht leer im negativen Sinn, nicht so, wie dieses Wort verwendet wird, wenn Sinnlosigkeit geschildert werden soll – was ich fühlte, war Leere als Zustand vollkommener Neutralität. Ich muß zwar gedacht haben, das tut man wohl immer, aber ich weiß nicht mehr, was. Ich blieb vor der Dagbladet-Redaktion stehen und ließ meinen Blick über die Zeitungsseiten in den Schaukästen wandern, aber ich weiß nicht mehr, was dort stand, ich glaube nicht, daß ich richtig gelesen habe.
Die Reaktionen kamen erst später, zu Hause. Himmel, ich hatte schließlich ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, kein hysterisches, kein gefährliches, so, wie ich es in Büchern gelesen oder im Kino gesehen hatte – aber trotzdem ließ sich nicht leugnen, daß es mein Leben, also zweiunddreißig Jahre lang, nur sie und mich gegeben hatte. Meinen Vater habe ich nicht gekannt, er starb vier Wochen vor meiner Geburt bei einem Arbeitsunfall. Für mich gab es ihn nur in Mutters Erinnerungen, und erst als Erwachsenem wurde mir klar, daß ich ihn vermißte. Er wurde der Mann, mit dem Mutter auf den vergilbten Bildern im Fotoalbum zusammen war; der Mann in Kniebundhosen und Strickstrümpfen im Winter ’46, der Mann in dunkler Wollbadehose mit weißem Seitenstreifen, der im Sommer ’50, irgendwo auf Snarøya, meine Mutter lächelnd in den Arm genommen hatte. Ein Hochzeitsfoto der beiden existierte nicht, jedenfalls nicht bei uns zu Hause; ich weiß nicht, wieso. Vater wurde zu einem Gespenst, einer Macht, die unter einem polierten Stein auf dem Vestre-Aker-Friedhof hauste – Mutter wurde zu einer Frau, die sich in sich zurückzog und mich mitnahm. Sie war Einzelkind. Ich war Einzelkind. Es kam nie jemand zu Besuch.
Ich saß im leeren Wohnzimmer. Das Arbeiderbladet lag aufgeschlagen auf dem Tisch, daneben stand eine halbleere Tasse Tee. Alles genauso, wie ich es einige Stunden zuvor, nach dem kurzen Anruf, verlassen hatte. Es erschien mir ganz und gar unwirklich, daß ich nie mehr Mutters vorsichtige Schritte auf der Treppe hören sollte, ihren Schlüssel im Schloß, das Geräusch der Einkaufstaschen, die in der Diele auf den Boden gesetzt wurden, ihre Stimme, die mir – während sie ihren Mantel aufhängte – von dort draußen irgend etwas erzählte, was ihr im Supermarkt oder auf dem Hin- oder Rückweg passiert war. Ja, unwirklich.
Einige Tage später rief ich bei der Heilsarmee an. Noch am selben Nachmittag kamen drei Männer und nahmen Mutters Kleider und Schlafzimmermöbel mit. Als ich danach in dem leeren weißen Zimmer stand, empfand ich eine tiefe Ruhe. Das Unwirkliche war wirklich geworden.
In der Nacht ging ich, nachdem ich den Fernseher ausgeschaltet hatte, wieder in Mutters Zimmer. Ich machte kein Licht an. Der Mond nahm ab, war aber immer noch groß; blaues Licht fiel auf die weißen Flächen. Ich trat ans Fenster und blickte auf Blocks und Wald, auf die Satellitenstadt, in der ich aufgewachsen war und in der ich fast jeden Tag meines Lebens verbracht hatte. Seltsam. Drei Zimmer und Küche, nicht allzu weit von Oslo entfernt. Siebzehn Minuten mit der U-Bahn, um genau zu sein. Vierundsechzig Treppenstufen bis nach unten zur Haustür. Sechs Minuten ruhiger Spaziergang zur U-Bahn-Station (persönlicher Rekord: 1:47). Hätte mich vorher irgendwer gefragt, hätte ich, ohne zu zögern, behauptet, jeden Millimeter der kleinen Wohnung zu kennen, über jeden Winkel und jede Ecke Rechenschaft ablegen zu können. Und dennoch: Als ich nun in Mutters Zimmer stand und auf die Blocks dort unten am Hang blickte, ging mir auf, daß ich genaugenommen als kleiner Junge zuletzt einen Fuß in diesen Raum gesetzt hatte; als kleiner Junge, der bei Mutter schläft, wenn ihm die Schatten an den Wänden seines Kinderzimmers allzu große Angst machen. Jetzt, da die Vorhänge fehlten und es in dem Zimmer keinen einzigen Gegenstand mehr gab, ging mir auf, daß ich die Blocks dort draußen, diese vertraute Landschaft aus harten grauen Winkeln vor dunklen, wogenden Tannen, die Asphaltschlingungen der Gehwege und die Leuchtpunkte der Laternen aus einem neuen, kühnen Blickwinkel sah. Ich habe keine Ahnung, wieso mir das Wort »kühn« einfiel, aber das tat es nun einmal. Mein Leben barg ein neues Zimmer und eine neue Möglichkeit, die Umwelt zu betrachten, eine Umwelt, von der ich längst akzeptiert hatte, daß es sich dabei um ein Bild des absoluten Stillstandes handelte. Sicher, ich hatte Kinder aufwachsen und Familien zu- oder wegziehen sehen. Aber der Rahmen all dessen, die Geometrie, in der die Menschen ihre Leben lebten, war im großen und ganzen unverändert geblieben. Von der U-Bahn nach Hause. Von zu Hause zur U-Bahn. Vom Supermarkt nach Hause. Von zu Hause zum Supermarkt. Vom Supermarkt nach Hause. Dieselben Winkel, dieselben Flächen. Der Ausblick vom Wohnzimmer, von meinem Zimmer oder von der Küche: Nur die wechselnden Jahreszeiten konnten für Überraschungen sorgen – in Form plötzlicher Schneegestöber Ende April oder warmen Sonnenscheins im Oktober. Manchmal hatte ich das Gefühl, daß nur ein Orkan mich aus meinem Trott reißen könnte, dann überwältigte mich die Freude über einen Sonnenstreifen, der plötzlich über die Querwand des Nachbarblocks huschte. So, wie ich jetzt hier stand, mitten in dem dunklen Zimmer, mit schlaff herunterhängenden Armen, und sah, hatte ich fast das Gefühl, der Satellitenstadt einen Teil ihres Geheimnisses zu entringen; ich verspürte aus Gründen, von denen ich zu dem Zeitpunkt nichts ahnte, die mein Unterbewußtsein aber stark beeinflußt haben müssen, ein klares Gefühl der Kontrolle.
Und ich dachte: Jetzt ist Schluß. Jetzt fängt es an. So ist es, wenn jemand stirbt und uns an einem Kreuzweg unserer eigenen inneren Landschaft zurückläßt.
Es hört sich vielleicht seltsam an, aber ich glaube, die Tatsache, daß ich mit Mutters Tod so gut fertig wurde, hat recht viel mit Gro Harlem Brundtland zu tun. Noch am selben Abend erschien – während meine Gedanken unablässig um diese kleine Frau kreisten, die ich so ausdruckslos und kalt unten im Krankenhaus hatte liegen sehen – Gro in den Nachrichten und später noch in einer Diskussionsrunde. Ihr Anblick hat immer schon beruhigend auf mich gewirkt. Unkonzentriert, wie ich war, begriff ich nicht, warum sie im Fernsehen auftrat, aber sie war da, sie übermittelte mir durch ihre Anwesenheit eine Art heimlicher Botschaft, einen Gruß speziell an mich, der besagte, daß das Gastspiel der Menschen hier auf Erden zwar unbestreitbar flüchtig ist, daß es aber unter uns doch Persönlichkeiten gibt, die anderen den Glauben an das Beständige, das Felsenfeste vermitteln können. Und das tun sie in der Regel durch ihre bloße Anwesenheit.
Gro im Regen. Gro im Wind. Gro in der Sonne und Gro im Schatten. Mit festem Fleisch, wie eine Seelöwin. Vor allem aber sicher. Als Mutter starb, lenkte Gro das Land. Das macht sie auch heute. Im Moment ist es einfach unvorstellbar, daß das Land von einem anderen Menschen gelenkt werden könnte als Gro. Andererseits bin ich davon überzeugt, daß die Sicherheit, die sie mir und anderen gibt – und das schon lange –, nicht notwendigerweise auf ihrer Regierungsmacht beruht. Die bloße Gewißheit, daß Gro da ist, irgendwo draußen in der Dunkelheit, reicht aus. Stürzt ihre Regierung und stoßt sie hinaus in die Kälte! Solange sie da ist, furchtlos und mit ihrer unermüdlichen Tatkraft, repräsentiert sie eine Sicherheit im immer chaotischer werdenden politischen Bild – sie kann jederzeit zurückkehren. Sie ist wie eine Bärin, die Junge im Bau hat. Sie kann zwar auf dem Heimweg mit der Beute aufgehalten werden, aber es ist nur eine Frage der Zeit, eines vorübergehenden Aufschubs, wann sie ihren rechtmäßigen Platz wieder einnehmen wird. Gro Harlem Brundtland ist nicht dazu geschaffen, ihr Berufsleben in einer Arztpraxis zu verbringen. Nicht dazu geschaffen, Rotzgören »Aaa« sagen zu lassen oder alternden Männern den Zeigefinger ins Rektum zu schieben, um festzustellen, ob die Prostatadrüse angeschwollen ist. Gro ist die geborene Führerin, und sie ist klug genug, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Gro ist kein Machtmensch. Gro ist Macht. Mensch.
Ich dagegen bin Sammler. Als Kind habe ich Briefmarken und Münzen, Kronkorken und Vogeleier gesammelt. Als junger Mann fing ich an, Gro Harlem Brundtland zu sammeln. Ich kenne ihren Lebenslauf in- und auswendig, aber mich interessieren die Berichte über ihre Person und die politischen Informationen nicht. Was ich sammle und sorgfältig aus Zeitungen und Zeitschriften ausschneide, sind Bilder von ihr, Gros Miene, ihre Haltung. Ich habe Gro in jeder Art von Wind und Wetter, ich habe sie im politischen Sturm des Parlaments und im wilden Wind Finnmarks. Ich habe Gro in Rio, ich habe Gro in Wien und in Odda. Ich habe Gro in Bluse und Rock, in Freizeithose und Pullover, ich habe sie im Ballkleid und in samischer Tracht. Und ich habe sie im Gummianzug. Auf dem Surfbrett. Gro in herausfordernder Positur, während sie das Gewicht ihres Körpers quer vor den Wind legt – hier stellt sie das Symbol ihrer selbst dar. Sie ist die Frau gegen den Wind, die Frau, die sich dort am wohlsten fühlt, wo der Sturm am wildesten tobt. Ich weiß nicht mehr so recht, woher ich das Bild habe, ich glaube, es war irgendwann in den achtziger Jahren im Dagbladet. Ich habe es aus praktischen Gründen in Plastikfolie eingeschweißt: Gro Harlem Brundtlands kräftige Hinterpartie, verhüllt nur von einer dünnen Gummihaut, ist ein Anblick, der an die rechte Hand eines alleinstehenden Mannes appelliert. Übrigens berühre ich mich nicht allzu oft auf diese Weise. Es gibt mir das Gefühl zu verschwenden, etwas von mir selbst wegzuwerfen. Und ich war immer ein vorsichtiger Junge. Genügsam. Ich kaufe nicht Bjellands Makrelen in Tomate, wenn eine andere Sorte fünfzig Öre billiger ist. Makrele in Tomate ist Makrele in Tomate. Früher habe ich geraucht. Damit habe ich aufgehört. Als junger Mann habe ich am Wochenende manchmal getrunken. Jetzt trinke ich manchmal zu Silvester. Ich kaufe neues Brot, wenn das alte aufgegessen ist, nicht, wenn das alte trocken ist. Ich komme gut zurecht mit meiner Rente.
Drei Tage nach Mutters Tod, am 14. November also, fand ich mich selbst in ihrem leeren Schlafzimmer wieder. Ich sage: »Ich fand mich selbst wieder«, weil genau das passiert ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich hineingeraten bin, und ebensowenig, warum. Ich weiß nur, daß ich dort stand, so in etwa in der Mitte des Zimmers. Wie beim letztenmal war es dunkel, und diesmal sperrten Regen und Nebel auch das blaue Licht des Mondes aus. Novemberwetter. Naß. Grau. Unten auf den Gehwegen war kein Mensch zu sehen. Es wäre fast ein bißchen unheimlich gewesen, hätten mich nicht von gegenüber Hunderte von Lichtquadraten angestarrt. Fenster. Fenster zum Abend, zur Welt. Oder umgekehrt. Fenster, die zu den Menschen führten. Zu Familien. Alleinstehenden, Alten und Jungen. Es war irgendwie zu einer beliebten Vorstellung geworden, daß es nahezu erniedrigend sei, in einem Block zu wohnen. Damals, in den fünfziger Jahren, als die Blocks an diesem sanften Hang hochgezogen wurden, galten sie als der Stolz der Nation. Sie waren die Früchte, die die Sozialdemokratie dem Volk servierte. Jetzt, in den neunziger Jahren, waren sie offenbar nicht mehr gut genug. Immer wieder stolperte ich in der Presse, sogar im Arbeiderbladet, über Aussagen, die sich nicht anders deuten ließen als so, daß es im Oberstübchen der Menschen, die in einem Block wohnten, nicht besonders gut aussehen könne. Zwischen den Zeilen standen sie als arme Würstchen da. Seit Jahren ärgerte ich mich schon über die Herabwürdigung, ja, das Lächerlichmachen von Hunderttausenden von Menschen in diesem Lande, denn ich selbst hatte hier draußen eine gute Jugend gehabt. Daß ich mein Leben lang ein ziemlicher Eigenbrötler gewesen war, wußte ich. Aber ich habe immer eine Bindung an die Menschen empfunden, mit denen zusammen ich hier wohne, und ich empfinde sie noch. Wir sind einander rein physisch nahe; fast 40000 sind hier übereinander und nebeneinander verstaut, dünne Wände trennen unsere Leben, und wir sind rasch mit den WC-Gewohnheiten unserer neuen Nachbarn vertraut. Aber gleichzeitig ist es auch kein Problem, den Abstand zu wahren, den wir brauchen, um unser Privatleben in den richtigen Griff zu bekommen. Und so erfüllte mich, während ich dort stand und das Licht in den Fenstern betrachtete, eine Wärme, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Hinter jedem einzelnen dieser leuchtenden Quadrate befanden sich genau solche Zimmer, wie ich selbst sie bewohnte, und dennoch tat sich Vielfalt vor mir auf. Der Rahmen war derselbe. Aber wie wir unsere Leben lebten, das war unterschiedlich, so unterschiedlich! Und ich ertappte mich bei dem Wunsch, daß auch Gro hier leben sollte, im selben Rahmen wie wir, daß sie unter denselben Bedingungen anwesend sein sollte wie wir 40000 hier draußen am Waldrand. Ich gehöre nicht zu jenem quengelnden Teil der Bevölkerung, der Gro und den anderen Parteispitzen ihre Villen mißgönnt, dieser Wunsch überkam mich nur, weil ich diese Gemeinschaft so gern mit ihr geteilt hätte; ich wollte, daß sie hier stand – genau so wie ich – und wir dachte!
Aus diesem Ostfenster konnte ich acht Blocks einsehen. Jeder mit zweiundvierzig Wohnungen, verteilt auf drei Etagen. Vier standen im Seljeveien, den Mutter »Essensweg« getauft hatte, weil er zum Supermarkt führte. Die anderen vier standen weiter unten, im Grevlingstien, aber ich konnte doch zwischen den Querwänden der oberen jeweils einen halben der unteren Blocks sehen. Ich wollte gerade die Fenster zählen, hinter denen Licht brannte, als ich zum erstenmal Rigemor Jølsen erblickte. Daß gerade sie mir auffiel, hatte zweifellos etwas mit Mutter zu tun. Denn im zweiten Stock eines der Blocks unten im Grevlingstien stand eine ältere Frau und zupfte verwelkte Blätter oder Blüten von einer Topfblume auf der Fensterbank. Und während sie diese durch und durch alltägliche Handlung ausführte, legte sie den Kopf etwas schräg, so wie Mutter es immer gemacht hatte, wenn sie ihre Begonien versorgte und mit ihnen plauderte. Ich war betroffen. Ich glaubte natürlich nicht, daß Mutter da unten im zweiten Stock im Grevlingstien stand, aber für zwei Sekunden geriet ich aus dem Gleichgewicht. Dann schaltete mein Gehirn sich ein und deutete das Bild, das ich sah. Ihre Gesichtszüge konnte ich auf diese Entfernung nicht erkennen, nur ihre friedliche Silhouette, ihre vorsichtigen Handbewegungen. Daß diese Frau Rigemor Jølsen hieß, wußte ich zu dem Zeitpunkt durchaus noch nicht. Aber für einen Augenblick sah ich eine wunderbare Möglichkeit, meine Tage zu füllen – ganz zu schweigen von den langen Abenden und Nächten –, und zwar mit etwas, das das Ausschneiden und Einkleben von Gro-Harlem-Brundtland-Bildern weit übertraf (ich füllte gerade mein neunzehntes Gro-Album). Mein Respekt und mein Interesse für Gro würden bestehen bleiben, das war klar. Aber mir ging auf, daß ich jetzt die Möglichkeit hatte, ganz neu anzufangen, eine neue Seite aufzuschlagen, sozusagen, und mir nach und nach eine Sammlung von Informationen über eine von meinen Leuten aufzubauen, über eine Mitbewohnerin. Früher hatte ich niemals solche Bedürfnisse verspürt, und daß sie jetzt auftauchten, hatte sicher etwas mit Mutters Fortgehen zu tun. Während Gro mir als das sichere, aber dennoch ferne Ideal erschienen war, hatte Mutter (ohne daß ich überhaupt darüber nachgedacht hatte) eine physische Nähe gewährleistet, die ich nun vermißte. Ich wollte niemanden in meiner Nähe haben, das nicht. Ich wollte nicht angefaßt, gestreichelt werden. Und vor allem wollte ich meine Nähe nicht anderen aufzwingen. Aber der Gedanke an die Frau, die dort unten stand und verwelkte Blüten und Blätter von einer Topfpflanze zupfte, erregte mich auf eine seltsame Weise. Ein ganzes Leben lag hinter ihr. Erlebnisse. Erfahrungen. Und jetzt war sie so nahe bei mir – und gleichzeitig so weit weg. Sie konnte mich nicht sehen. Wieder hatte ich dieses Gefühl von Kontrolle. Und Kontrolle erschien mir ungeheuer wichtig. Mutters Tod hatte einen neuen weißen Raum geöffnet. Und es war nun an mir, ihn Stück für Stück mit etwas anzufüllen, das außerhalb meiner selbst lag.
Ich ging gründlich ans Werk. Ich bin gründlich. Mutter hat immer gesagt: »Elling«, hat sie gesagt, »man kann über dich sagen, was man will, aber gründlich bist du.« Wie recht sie doch hatte! Und deshalb konnte am nächsten Morgen keine Rede von einer oberflächlichen Dusche sein; vielmehr nahm ich eine energische und totale Reinigung meines Körpers vor. Erst ein stundenlanges Bad, so heiß, daß es an Folter grenzte. Ich benutzte den Rest des Badesalzes, das ich Mutter zu Weihnachten geschenkt hatte. Es schäumte so schön im Wasser und duftete nach Blumen. Nach dem Einweichen schrubbte ich mich so heftig, daß ich unter der Bürste stöhnte. Dann die Dusche. Von kochend heiß zu klirrend kalt. Immer wieder. Und zum Schluß: Mutters großes Badetuch und dann ausschließlich saubere Kleidung. Sogar nagelneue Socken.
Die Mundhöhle: nach gründlichem Zähneputzen mit Vademecum gereinigt.
Ich hatte keine Ahnung gehabt, daß es so viele verschiedene Typen von Ferngläsern und Teleskopen zu kaufen gibt. Geradezu lachhaft. Ein reichhaltiges Angebot in der Hauptstadt des Landes ist gut und schön, aber das hier! Es gab große Ferngläser und kleine Ferngläser, es gab sehr große Ferngläser und sehr kleine Ferngläser und sogar ein senfgelbes. Und es gab Teleskope, so riesig, daß sie aussahen wie eine Bazooka oder so was. Zuerst ging ich zwei Stunden lang durch die Läden im Zentrum und sammelte Kataloge. Dann wanderte ich in Mutters Lieblingscafé, Konditorei Halvorsen, wo ich die Kataloge bei einer Kanne Tee und einem Krabbenbrot durchsah. (Was hat eine Zitronenscheibe auf einem Krabbenbrot zu suchen?)
Verhältnismäßig schnell ging mir auf, daß ich ein starkes Teleskop auf einem Stativ benötigen würde. Ich entschied mich für ein Tasco zu fast zehntausend Kronen, ein koreanisches Produkt, zu dem ich sofort Vertrauen faßte. Nachdem das Teleskop gekauft war und wie ein bleiernes Versprechen in meiner Schultertasche lag, ging ich ins größte Schreibwarengeschäft der Stadt und kaufte zwei dicke Bücher, wie sie zur Buchführung verwendet werden, und einen hübschen Füllfederhalter.
Die weiteren Arbeiten beanspruchten zwei volle Tage. Ein Nachbar half mir, Vaters alten Schreibtisch vom Dachboden zu holen. Nachdem ich ihn weiß angestrichen hatte, schob ich ihn in Mutters Schlafzimmer, in die am weitesten vom Fenster entfernte Ecke. Später holte ich das Material für die »Brücke« aus dem Keller. Acht Weinkisten von der guten alten Sorte, die Onkel Alf – längst tot – als Bücherregal benutzt hatte. Dann die breiten Eichenbretter, mit denen Vater offenbar große Pläne in Richtung Schrankbau gehabt hatte; Mutter hatte es später nicht übers Herz gebracht, sie wegzugeben. Die Brücke war nach einigen wenigen Hammerschlägen fertiggestellt. Natürlich konnten die Nachbarn das hören, aber was ist schließlich natürlicher, als daß ein junger Mann gewisse Veränderungen in der Wohnung vornimmt, nachdem seine Mutter gestorben ist? Das Ergebnis fiel besser aus, als ich zu hoffen gewagt hatte. Mitten im Zimmer befand sich nun eine etwa einen halben Meter hohe Plattform. Darauf hatte ich Mutters alten Sessel gestellt. Und vor dem Sessel, auf dem alten Telefontisch aus der Diele, stand – das Teleskop. So saß ich im Sessel hoch genug; mein Blick fiel perfekt auf die acht Blocks am Hang unter mir. Abends und nachts, wenn es dunkel war, würde niemand mich von da unten entdecken können. Ich ging im Grunde davon aus, daß mich auch bei Tageslicht von dort aus niemand sehen konnte, aber das würde ich noch herausfinden. Solange ich meine Beobachtungen abends, nach Einbruch der Dunkelheit, anstellte und kein Licht anmachte, würde ich mich so sicher fühlen können wie ein Tier in warmem Bau tief unter der Erde. Und diese Sicherheit war von allergrößter Wichtigkeit. »Auf frischer Tat ertappt zu werden« (wie es heißt), mit einem Teleskop, das auf ein Nachbarfenster gerichtet ist, konnte leicht zu Mißverständnissen führen. Man würde mir womöglich sexuelle Motive unterstellen, mich als miesen kleinen Spanner ansehen. Beim bloßen Gedanken daran stülpte sich mir vor Ekel der Magen um.
Mit einer gewissen Andacht machte ich mich auf, ihren Namen einzuholen. Denn dies war der Anfang, der eigentliche Anfang von allem. (Ich war noch immer makellos rein, denn ich hatte dem Toilettenbesuch eine glühendheiße Dusche folgen lassen.) Kurz nach halb sieben verließ ich den Block, es war dunkel, in mir zitterte eine steigende Spannung, was den Namen betraf, aber auch auf das, was der Abend mir an Details über das Leben dieser älteren Frau bringen würde.
Zuerst machte ich einen langen Spaziergang. Wollte die Spannung wohl bis zum Äußersten steigern. Erst ins Zentrum, dann vorbei am Sportplatz und dem stillgelegten Hof, den die Jugend neuerdings als MC-Treffpunkt benutzte. Dann weiter durch den Wald. Hier folgte ich dem Weg mit den Lichtmasten, dem Weg, der in richtigen Schneewintern die Bezeichnung »Lichtloipe« trug. Wenn ich an meine Kindheit zurückdachte, dann schien es jeden Winter geschneit zu haben, der Schnee war meistens Ende Oktober gekommen. Aber jetzt gab es grüne Winter, und auf den Dachböden vermoderten Skier und Schlitten, die nicht zum Einsatz kamen. Waren diese milden Winter die Folge von Treibhauseffekt und Ozonloch? Die Forscher wußten das wohl nicht so recht, wenn ich dem Arbeiderbladet glauben wollte. Ich selbst sah das alles völlig gelassen. Ich hatte mein eigenes Leben zu leben, ich kam nicht eine Sekunde lang auf die Idee, hysterisch zu werden, selbst wenn sich herausstellen sollte, daß die Durchschnittstemperatur auf dem Globus um ein oder zwei Grad gestiegen war. Eis und Schnee hatte ich sowieso nie gemocht, und wenn ich überhaupt als Kind die Lichtloipe gelaufen war, dann hatten mich verständnislose Sportlehrer dazu gezwungen. Als Letzter durchs Ziel, mit hängender Zunge – das war Elling! Jubel bei den anderen, weil das As in Erdkunde abermals bewiesen hatte, daß es keine Ahnung hatte, wie man mit seinem eigenen Körper umgeht. Jetzt konnte ich über das alles nur schmunzeln. Ja, ich schmunzelte im Gehen, ich trug weder dem Sportlehrer noch meinen Mitschülern etwas nach, aber damals hatte es natürlich weh getan.
Ich war an diesem Abend überhaupt versöhnlich gestimmt; ich verfügte über ein Geheimnis, das mir die Kraft gab, um über Bubenstreiche und die Torheit der Erwachsenen hinwegzusehen. Mit einem Lächeln dachte ich daran, wie die großen Jungen in der siebten Klasse meinen Kopf in die Kloschüssel gedrückt hatten, um mir »die Schuppen wegzuspülen«, und ich hätte fast laut losgelacht, als ich daran dachte, wie Lehrer Bragesen mir danach einen Brief mit nach Hause gegeben hatte, weil ich mitten im Winter mit nassen Haaren im Klassenzimmer erschienen war. Jaja. Bragesen war tot, und die großen Jungs waren geschieden und alkoholisiert. Gunnar hatte sogar einen anderen großen Jungen umgebracht und saß im Gefängnis. Das war also im Grunde erledigt. Ich lachte zwar nicht laut, aber ich schmunzelte und verzieh; genauer gesagt: Ich übte allem und allen gegenüber Nachsicht.
Grevlingstien – Dachsweg. Ein guter Name. Viele mögen Dachse nicht, aber ich habe diese Ansicht nie geteilt. Ganz im Gegenteil, möchte ich fast sagen. Der Block war wie mein eigener. Zweiter Stock, Aufgang B. Wenn die Namensschilder an den Klingelknöpfen richtig angebracht waren, dann hieß sie Rigemor Jølsen. Ich sagte das leise vor mich hin: »Rigemor Jølsen. R-i-g-e-m-o-r J-ø-l-s-e-n.« Und blitzschnell: »Rigemorjølsen.« Sicherheitshalber ging ich in den zweiten Stock und warf rasch einen Blick auf den Namen, der – in ein Messingschild eingraviert – an der Tür stand. Doch. Rigemor Jølsen. Hinter dieser Tür lebte Rigemor Jølsen ihr Leben; genau hier, im zweiten Stock im Grevlingstien 17 B, zupfte sie verwelkte Blätter von ihren Topfblumen, wobei sie den Kopf leicht schräg legte – genau wie meine Mutter.
Ruhig ging ich die Treppe hinunter und aus dem Haus.
Aus irgendeinem Grund standen mir Tränen in den Augen. Rigemor Jølsen, dachte ich. Das kriegen wir schon hin. Darauf kannst du dich verlassen.
Ich kochte mir reichlich Tee und füllte ihn in die Thermoskanne. Darjeeling, das weiß ich noch. Dann nahm ich die Thermoskanne und den großen weißen Becher, den Mutter mir zum 22. Geburtstag geschenkt hatte, und bezog auf der Brücke Posten.
Sie saß auf ihrem Sofa und sah fern. Es war wirklich phantastisch. Nicht, daß sie auf dem Sofa saß, nicht, daß sie fernsah. Das Phantastische war, daß ich den Eindruck hatte, sie beinahe an der Hand halten zu können; daß sie so nahe war, daß ich mir mit Leichtigkeit vorstellen konnte, sie atmen zu hören. Was war dieses Teleskop von einer Qualität, einer Präzision! Im übrigen war es auch ziemlich phantastisch, daß sie auf dem Sofa saß und fernsah. Sie saß auf dem Sofa und sah fern, mit einer Selbstverständlichkeit und einer Ruhe, die mich verwirrten, aber ich sah bald ein, daß diese Verwirrung das Ergebnis meines eigenen Empfindens war, praktisch direkt vor ihrem Fenster zu stehen. Mein Gehirn deutete das Bild so, und mein Unterbewußtsein konnte nicht hinnehmen, daß sie mich nicht ansah, mit Augen, in denen Angst und Verwirrung standen.
Ich schätzte ihr Alter auf vielleicht Ende Sechzig. Ihre Haare waren dunkel, fast schwarz, und stark von Grau durchsetzt. Ein rundes Gesicht, weiche Züge. Großzügige Büste, aber hier hatte Gro einen Vorsprung. Wie Rigemor Jølsens Hinterteil sich im Gummianzug machen würde, konnte ich natürlich nicht sagen. Nun gut. Das war also Rigemor Jølsens physische Erscheinung – in groben Zügen. Ihre Augenfarbe, die Größe ihrer Hände und Finger – das alles würde ich später herausfinden müssen. Was sie dachte und fühlte, meinte, vermutete und hoffte, ebenfalls. Aber das Leben, das sie in dieser Wohnung von 65 Quadratmetern lebte, hatte ich bereits jetzt, nach nur ein oder zwei Minuten, ein wenig im Griff. Jetzt saß sie zum Beispiel vor dem Fernseher. An einem Dienstag abend um fünf vor neun saß Rigemor Jølsen vor dem Fernseher. Ergebnis eines festen Entschlusses oder einfach nur alte Gewohnheit? Unmöglich, das mit Sicherheit zu sagen. Aber bald, nach zwei Wochen, würde ich ein Muster erkennen können. Es würde mich sicher ein wenig enttäuschen, sie jeden Abend um diese Zeit so zu sehen, denn das hätte eine gewisse Resignation in Rigemor Jølsens Leben zum Ausdruck gebracht, hätte signalisiert, daß sie sich im Grunde aufgegeben hatte und alles seinen Gang gehen ließ.
Ich stand auf, ging ins Wohnzimmer und holte das Arbeiderbladet. Im NRK lief gerade ein Naturprogramm: »Auf Wegen und Fährten in Sarangesi.« Es gab natürlich schier ungezählte Möglichkeiten, seit alle erdenklichen Fernsehsender auch in Norwegen Einzug gehalten hatten, aber ich tippte doch eher darauf, daß Rigemor Jølsen sich entweder bewußt für den Norwegischen Rundfunk entschieden hatte oder aus irgendeiner mehr oder weniger trägen Gewohnheit an unserem staatlichen Sender hing. Außerdem mögen alle alten Menschen Tiere, das hatte ich irgendwo gelesen, und dann sieht man natürlich hin, wenn das Fernsehteam auf den Wegen von Sarangesi loswandert, wo möglicherweise Gnu, Löwe, Giraffe, Pavian und Nashorn auftauchen. Ich schaltete den Fernseher ein. Doch. Die Giraffe war schon zur Stelle. Unter einem von diesen witzigen Bäumen mit platter Krone. Knabberte mit weichem Maul am Blattwerk herum. Ab und zu war die berühmte blaue Zunge zu sehen. Kleine, lächerliche Hörner, bedeckt von kurzem Fell. Und dann das Nashorn. Ein drohender Schatten im Busch. Mutter mit Kind sogar. Ein femininer Landtorpedo von gut und gern einer Tonne Gewicht, der den Fotografen giftig mustert. Ich drehte den Ton hoch und setzte mich wieder auf die Brücke.
»Dieses junge Nashornweibchen ist schon seit über einer Woche von den Leuten im Dorf beobachtet worden …«
Rigemor Jølsen saß vornübergebeugt auf dem Sofa, und jetzt fiel mir auf, daß vor ihr auf dem Tisch eine Tasse Tee oder Kaffee stand. Wußte auch Rigemor Jølsen jetzt, daß gerade dieses Weibchen, dieses junge Nashornweibchen, seit über einer Woche von den Leuten im Dorf beobachtet worden war? Dachte sie wie ich: In welchem Dorf? Von was für Leuten? Oder wußte sie das alles schon, da sie die Sendung von Anfang an verfolgt hatte, statt mitten in der Szene mit der knabbernden Giraffe einzuschalten? Wie erlebte sie den Anblick der jungen Nashornmutter mit den mißtrauischen, rotgeränderten Augen? War sie selbst Mutter? Sehr wahrscheinlich. Ja, sie war Mutter, dafür entschied ich mich ganz einfach. Mutter von mehreren Kindern. Kindern wie die Orgelpfeifen. Außerdem hatte sie den Krieg erlebt. Da war es doch klar, daß der Anblick dieses jungen Tierweibchens, Typ Nashorn mit Kind, auf sie anders wirkte als auf mich. Die beiden hatten das Erlebnis der schmerzhaften Geburt gemeinsam, das war das eine. Aber Rigemor Jølsen hatte aufgrund ihrer Kriegserfahrung auch eine Ahnung davon, was es für ein Gefühl war, einem Feind, bei dem man nicht wußte, wie man sich verhalten sollte, von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Hatte Rigemor Jølsen hinter ihrem Küchenvorhang, aus ihrem ganz privaten Busch heraus, zu den Deutschen hinausgespäht, während sich ein oder zwei Kinder an ihren aus einem alten Kleid gearbeiteten Rock klammerten? Davon war ich überzeugt. Aber – und das mußte ich mir wirklich klarmachen: Es war nicht hier gewesen. Rigemor Jølsen, die zweifellos einige Erfahrungen mit einem jungen Nashornweibchen aus Sarangesi teilte, hatte diese Erfahrungen nicht im Grevlingstien 17 B gemacht. Woher aber kam Rigemor Jølsen? Es mußte spannend sein, sie im Supermarkt um ein halbes Pfund Hack und hundert Gramm Cervelat bitten zu hören.
»Die Weibchen gehen auf die Jagd«, sagte der Kommentator im Wohnzimmer. Jetzt waren die Löwen an der Reihe, das war klar. Rigemor Jølsen lehnte sich weiter zurück. Der Kommentator nahm kein Blatt vor den Mund. Die alten Männchen, die sich in den Dornbüschen fläzten, bekamen zu hören, was er von ihnen hielt. Auf humoristische Weise natürlich, schließlich sollte hier nicht die Natur kritisiert werden. Aber in dem harmlosen Tonfall, der leicht säuerlichen Ironie, schwang Ernst mit, ein nicht ausgesprochenes Stichwort, das die Frauen in den Blocks sicher registrierten. Ich konnte die beißenden Bemerkungen, die in diesem Augenblick an vor sich hindösende Ehemänner und träge, pubertierende Söhne gerichtet wurden, förmlich hören. Und von mir aus gern, das möchte ich nur gesagt haben.
Dann ging Rigemor Jølsen. Sie nahm ihre Tasse und ging in die Küche. In der Küche waren die Vorhänge zugezogen, ich registrierte ihren Schatten hinter roten Blumen auf weißem Grund. Was sie jetzt tat, konnte ich mir nur ausmalen. Zentrale Frage: Warum hat sie die Vorhänge in der Küche geschlossen, während sie sich im Wohnzimmer in aller Öffentlichkeit Fernsehaufnahmen aus Sarangesi ansieht? Ein Zufall? Gut möglich. Aber es gab noch eine andere Möglichkeit, nämlich, daß Rigemor Jølsen die gefährlichen Dinge in der Küche erledigte, während sie durch die Offenheit im Wohnzimmer der ganzen Nachbarschaft signalisierte: DURCHSCHNITT. Bei »gefährlich« dachte ich natürlich nicht an irgendwelche Extreme. Ich war überzeugt davon, daß sie ihr Wohnzimmer und Sarangesi nicht verlassen hatte, um in der Küche Zeitzünderbomben zu fabrizieren. Ich glaubte nicht einmal, daß sie nur mal eben ihre Mauser laden wollte. Nein. Mit »gefährlich« meine ich einfach das, was sich nicht gehört