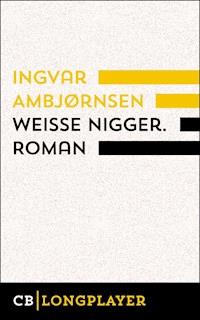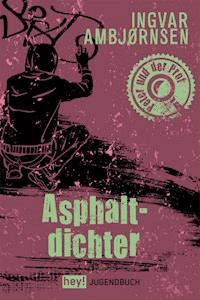3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Elling-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der 3. Teil der Elling-Tetralogie vom norwegischen Kultautor Ingvar Ambjörnsen Elling, ein liebenswerter Kerl mit einer kleinen, aber wundervollen Macke, zieht mit Kjell Bjarne in eine eigene Dreizimmer-Wohnung. Zaghaft wagen sie die ersten Schritte in die Selbständigkeit, nachdem sie die Psychiatrie verlassen haben. Zu ihrem Leben gehört auch Frank, der zuständige Sozialarbeiter, den Elling nicht ausstehen kann, weil er so ein «Gemeindeschnüffler» ist. Dramatik kommt ins Geschehen, als sie eines Tages auf der Treppe ihres Hauses Reidun Nordsletten kennenlernen, in die sich Kjell auf der Stelle verliebt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Ähnliche
Ingvar Ambjörnsen
Blutsbrüder
Ein Elling-Roman
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
FISCHER E-Books
Inhalt
1
«Als kleiner Junge habe ich schrecklich gern Johannisbeeren gegessen», sagte Kjell Bjarne. «Aber jetzt kann ich die nicht mehr ausstehen.»
Er sagte es auf eine Weise, die mir klarmachen sollte, daß seither etwas geschehen war. Unter anderem hatte er ein halbes Leben hinter sich gebracht. Und irgendwo unterwegs war ihm der Sinn für diese säuerlichen roten Beeren abhanden gekommen.
Ich selbst habe nichts gegen Johannisbeeren. Was die Zeit mir genommen hat, ist ein gut Teil der Fähigkeit, es mir gemütlich zu machen. Als Junge habe ich das Leben einfach angenehmer gefunden. Aber das sagte ich nicht. Das hätte ihn nur verwirrt. Außerdem ist es seltsam. Wenn man etwas ausspricht, wird es irgendwie doppelt so wahr. In diesem Fall nur halb so angenehm.
Außerdem hatte ich eigentlich keinen besonderen Grund, mich zu beklagen. Wirklich nicht. In Wahrheit war ich wohl eher ein verwöhnter junger Mann. Wie so viele andere junge Männer in diesem Land. Wir müssen gar nicht bis zu den Negern in Afrika gehen, um Leute zu finden, denen es schlechter geht als uns. Es reicht, einen Blick auf die Neger in Oslo zu werfen, dann wissen wir, was Sache ist. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß sie wie Nigger behandelt werden. Sogar von der Polizei oder vielleicht vor allem von der Polizei. Komm her, Bimbo, sagt die Polizei. Zeig uns doch mal deinen falschen Paß. So steht es jedenfalls immer wieder in den Zeitungen.
Kjell Bjarne stand am Fenster und starrte hinunter auf die Straße. Ich fragte mich, was er wohl gesehen haben mochte, irgend etwas mußte ihn ja plötzlich auf den Gedanken gebracht haben, daß er keine Johannisbeeren mehr mochte. Aber ich wußte, daß es keinen Sinn hätte, ihn zu fragen. Wahrscheinlich hatte er überhaupt nichts gesehen, was eine Assoziation mit dem Thema «Johannisbeeren» logisch erklärt hätte. Nicht einmal einen roten VW. Er hatte ganz einfach drauflosgeredet, ganz ohne Sinn und Verstand. So war er nun einmal. Bei unserer ersten Begegnung hatte er mich gefragt, ob ich Ahnung von Kühen hätte. Was nicht der Fall war. Und als ich ihn fragte, warum er mir gerade diese Frage gestellt habe, hatte er geantwortet, er habe keine Ahnung. Er wisse es ganz einfach nicht. Ich hatte meine Zeit gebraucht, um an ihn heranzukommen. Und noch länger, ehe ich es gewagt hatte, ihn an mich heranzulassen.
Inzwischen hatten wir unser Blut vermischt. Unfreiwillig zwar, aber wir hatten unser Blut vermischt. Jetzt waren wir Blutsbrüder.
«Setz dich», sagte ich. «Lunger nicht immer am Fenster rum.»
Ich wußte nur zu gut, wie leicht wir in einen toten Kolk geraten, wenn wir versuchen, vom Fenster einer kleinen Wohnung aus die Wirklichkeit zu studieren. Ehe wir uns versehen, sind wir aus der Wirklichkeit ausgestiegen. Und wir beide arbeiteten jetzt an einem gemeinsamen Projekt. Wir wollten mit allen Mitteln versuchen, in die Wirklichkeit einzusteigen. Am Alltag teilzunehmen, gewissermaßen. Und da lagen die Stolpersteine dicht an dicht, so dicht wie die Minen an der Front von Verdun.
«Setz dich!» sagte ich noch einmal.
Das machte er. Er setzte sich auf die Sofakante und starrte seine beiden riesigen Hände an. Ich hatte den Verdacht, daß er ahnte, was jetzt kommen würde.
«Du weißt, was heute für ein Tag ist», sagte ich erbarmungslos.
«Donnerstag.»
«Heute ist Donnerstag, der fünfzehnte», sagte ich. «Das bedeutet, daß Frank kommt.»
Kjell Bjarne rieb sich mit den Fäusten die Schläfen. Ein sicherer Hinweis auf Unsicherheit und Schuldbewußtsein.
«Tut mir leid», sagte ich. «Aber ich muß mit ihm darüber sprechen. Wenn du nicht mit diesen idiotischen Sextelefonen aufhören kannst, dann sind wir unseren Apparat los. Dann können wir ihn uns nicht mehr leisten, so einfach ist das.»
Kjell Bjarne ließ seine Fäuste sinken und starrte sie an. «Hab keinen Arsch angerufen.»
«Nein», sagte ich. «Sondern ein Tonband. Du hast ein Tonband angerufen, wo dir eine Frauenstimme erzählt, daß sie sich nach deinem Körper sehnt. Daß sie davon träumt, was du alles mit ihr anstellst. Ich habe dich heute nacht gehört! Ich habe gehört, daß du aufgestanden bist und dich ans Telefon gesetzt hast.»
Er atmete schwer. «Sag Frank nichts!»
Sein Hundeblick war einfach nicht auszuhalten. Er sah aus wie ein Cockerspaniel, dem nach vierzehntägigem Fasten sein Filetsteak weggenommen worden ist. Aber es hatte keinen Sinn, jetzt weich zu werden und nachzugeben. Durch intensives Telefontraining hatte ich mich endlich mit diesem praktischen Instrument angefreundet, und ich wollte es um jeden Preis behalten. Ich war ganz einfach zum Telefonierer geworden. Ich wollte nicht hinnehmen, daß Kjell Bjarne das alles ruinierte. Unsere letzte Telefonrechnung war astronomisch hoch gewesen. Wir hatten danach einen halben Monat von trockenem Brot und Tütensuppen gelebt. Frank hatte gesagt, das geschähe uns recht. Das sei eine geniale Lehre für uns gewesen. Die Entscheidung liegt bei euch, hatte Frank gesagt. Mösengerede oder richtiges Essen. Bei eurer Rente könntet ihr eigentlich ganz gut leben. Es kommt nur darauf an, wie ihr eure Kronen ausgebt.
Und damit hatte er recht. Die Verantwortung lag bei uns. Das hatte ich im Kurzentrum Brøynes gelernt, wo Kjell Bjarne und ich uns kennengelernt hatten.
Das heißt, die Verantwortung lag bei mir. Ich war in unserer Zweier-WG für die Finanzen zuständig. Kjell Bjarne verlor einfach den Kopf, wenn er Geld in die Finger bekam. Zum Ausgleich war er ein guter Koch. In der Küche regierte deshalb er. Ich machte die Buchführung, und Kjell Bjarne kochte und briet. Das war schon in Ordnung. Frank bezeichnete uns gern als «zwei umtriebige Junggesellen», wenn er in Scherzlaune war.
Kjell Bjarne bat mich noch einmal, Frank nichts zu sagen.
Das konnte ich ihm aber nicht versprechen. Die Denunziantenrolle liegt mir unendlich fern, aber in diesem Fall war schließlich von Denunziation nicht die Rede, fand ich. Es ging um eine Vereinbarung, die eingehalten werden mußte. Und diese Vereinbarung war, daß wir über Unregelmäßigkeiten und Mißstimmungen mit Frank sprachen, um die Luft zu reinigen, damit das Leben in seiner ganzen alltäglichen Normalität weitergehen konnte. Und zur Normalität gehört ein Telefon. So ist es nun einmal.
Es war harte Arbeit gewesen, mich mit diesem Gerät anzufreunden. In all den Jahren, die Mutter und ich in einer Art bebender Zweisamkeit verbracht hatten, hatte sie das Wort geführt, wenn die Außenwelt sich meldete oder mit Hilfe der Erfindung des alten Bell angesprochen werden mußte. Mir fiel es schwer, einen vernünftigen Dialog zu führen, wenn ich nicht sehen konnte, mit wem ich da sprach. Ich verlor so leicht den Faden, denn die ganze Zeit stellte ich mir vor, wie mein Gegenüber wohl aussah, was in dem Zimmer passierte, in dem dieser Mensch sich aufhielt. Wenn ich mit Bekannten sprach, dann durchwühlte ich meine Erinnerungen, um jeden Zug im Gesicht dieses Menschen so genau wie möglich zu rekonstruieren. Handelte es sich um Unbekannte, dann stand in der Regel alles Kopf, und meine Phantasie drehte vollständig durch. Ich konnte mich einer Stimme gegenüber einfach nicht verhalten. Um überhaupt zu verstehen, was hier gesagt wurde, mußte ich mir einen Menschen aus Fleisch und Blut vorstellen. Einmal, als ich allein zu Hause war und eine mir völlig unbekannte Frau aus dem Sozialamt anrief, hatte ich aufgeben und auflegen müssen. Eine brennende Niederlage, die nicht ohne Nachspiel blieb. Aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was sie wohl anhatte und wie sie frisiert war. Ein Teil meines Gehirns zauberte mir das Bild einer jungen attraktiven Frau mit dunkler Pagenfrisur vor. Einen richtigen Leckerbissen, der gerade erst Examen gemacht hatte. Gerade Nase und volle rote Lippen. Anspruchsvoll und nachgiebig zugleich. Aber über dieses Bild schob ein anderer Teil meines Bewußtseins noch eins. Ich sah ein schweißverklebtes altes Gesicht. Offene Poren in ungesunder fahler Haut. Einen stechenden Blick, der gerade etwas durchbohrte, das ich nicht genau erkennen konnte, das mir aber als unanständig, vielleicht sogar bedrohlich erschien. Eine unzüchtige Skulptur aus dem alten Griechenland auf ihrem Schreibtisch zum Beispiel. Ich hatte aufgelegt, wie gesagt. Ich wurde ausgiebig heruntergeputzt, als Mutter nach Hause kam, und seither steckte ich mir meistens in jedes Ohr einen Zeigefinger, wenn das Telefon klingelte.
Aber mit Franks Hilfe war das alles viel besser geworden. Er brachte mir bei, mich zu entspannen. Mit dem Telefon zu spielen. Als erstes kauften wir eine zehn Meter lange Schnur, und nun konnte ich mich mit dem Apparat frei durchs Zimmer bewegen. Ich konnte sogar ins Nebenzimmer gehen. Zu Hause hatte das Telefon immer an seinem festen Platz gestanden. Nämlich auf einem niedrigen Tisch neben dem Fernseher. Die Leitung hatte gerade bis zur Steckdose in der Wand gereicht. Weder Mutter noch ich wäre je auf den Gedanken gekommen, die Telefonkultur nachzuahmen, die wir durch die vielen Fernsehfilme aus den USA kennenlernten, in denen die Leute ruhelos von einem Zimmer zum anderen wanderten und dabei mit schleppender Stimme ihre Gespräche führten. Oder sich ganz einfach auf einer rosa Bettdecke räkelten, Schnaps tranken und mit ihrem Flirt in Illinois plauderten. Mutter, die das Telefon ja als Neuerrungenschaft erlebt hatte, bewahrte zeitlebens ihren Respekt vor dieser Erfindung. Wenn das Telefon schellte, dann ließ sie alles stehen und liegen. Sie stürzte los und schien schreckliche Angst zu haben, sie könne irgend etwas Lebenswichtiges verpassen. Und dann blieb sie in Habachtstellung, bis das Gespräch zu Ende war. Ich habe sie nie im Sitzen telefonieren sehen, ich glaube fast, das wäre ihr als Kränkung für Bell oder vielleicht auch für die Person am anderen Ende der Leitung vorgekommen. Als in unserer neuen Wohnung der Telefonanschluß gelegt wurde, war Kjell Bjarne noch nicht eingezogen. Mir kam es ganz natürlich vor, das alte System mit der kurzen Leitung und dem Telefon neben dem Fernseher zu kopieren. Und Kjell Bjarne akzeptierte das, wie er auch sonst fast alles akzeptierte. Ich kann mich nicht einmal erinnern, ob wir über die Sache überhaupt gesprochen haben.
Am Anfang forderte Frank mich zu einer Art Trockentraining auf. Ich sollte so tun, als ob ich mit jemandem spräche, während ich die lange Leitung hinter mir her von einem Zimmer ins andere zog. Vom Wohnzimmer in die Küche. Von der Küche ins Schlafzimmer. Ich kam mir natürlich wie ein Idiot vor und wartete immer mit dem Training, bis Kjell Bjarne das Haus verlassen hatte. Er kannte mein Problem zwar und wußte, wie mir zumute war. Aber ich fand es doch nicht richtig, ihn bei meinen konstruierten Gesprächen mit meiner verstorbenen Mutter oder dem Vater zuhören zu lassen, den ich viel zu früh verloren hatte. Ganz zu schweigen von meinen Strafpredigten für diverse Politiker und meinen Zärtlichkeitsbekundungen für nicht existierende Frauen. Ich lief hin und her und war je nach Stimmung wütend oder zärtlich. Und nach und nach gefiel mir das sogar. In der zweiten Trainingsphase rief Frank zu einem vorher verabredeten Zeitpunkt an. Anfangs war ich steif und angespannt und wollte überhaupt nichts sagen. Aber langsam merkte ich, wie meine Kiefermuskeln sich entspannten und wie die Wörter aus mir heraussickerten. Es war eine große Hilfe, daß ich Frank zu Hause besuchen und mir das Arbeitszimmer ansehen durfte, in dem sein Telefon stand. Bei seinem nächsten Anruf war mein Kopf nicht mehr mit so vielen störenden Vorstellungen beschäftigt. Jetzt wußte ich immerhin, daß er bei unserem Gespräch in dem blauen Sessel an seinem Schreibtisch saß und auf den Garten blickte, in dem die Apfelbäume in Reih und Glied standen. Aber Frank meinte, ich solle das nicht so wichtig nehmen. Ich solle lieber versuchen, meine Phantasie ein wenig abzuschalten und mich scharf auf das Gespräch zu konzentrieren. Mir anhören, was da gesagt wurde. Er fing deshalb an, mich zu ganz willkürlich gewählten Zeitpunkten aus Telefonzellen überall in der Stadt anzurufen. Langsam legte sich meine Phobie, und ich erreichte ein Stadium, in dem meine Stimme sich am Hörer erstaunlich fest anhörte. Ich stellte mich mit vollem Namen vor. Ich brachte mein Begehr vor, oder ich hörte aufmerksam zu, was mein Gegenüber zu sagen hatte. Die Vorstellung, den Hörer auf die Gabel zu knallen und das Gespräch zu unterbrechen, kam mir ausgesprochen blödsinnig vor.
Anfangs hatten wir beide diese Sextelefone angerufen. Das muß ich zugeben. Während der Zeit, die Kjell Bjarne und ich in Brøynes verbracht hatten, hatte dieser besondere Telefonservice eine rasante Entwicklung durchgemacht, und wir erlagen ganz einfach der Versuchung, jetzt, da wir unseren eigenen Anschluß hatten und niemand uns auf frischer Tat ertappen konnte. Es gab zwei verschiedene Systeme, wie sich herausstellte. Eins, bei dem wir uns mit einer quicklebendigen Frau unterhielten, und ein etwas billigeres, bei dem ein Band mit einem weiblichen Monolog abgespielt wurde. Die erste Variante kam aus naheliegenden Gründen nicht in Frage. Wir machten zwei Versuche mit Kjell Bjarne als Wortführer, aber dabei kamen wir über Räuspern und Gestammel nicht hinaus. Er wußte eben auch nicht, wie er mit einer solchen Situation umgehen sollte. Aber mit den ablaufenden Bändern hatten wir eine Zeitlang viel Spaß. Bei meiner verhältnismäßig gut entwickelten Phantasie war es kein Problem für mich, Patricia auf dem Diwan vor mir zu sehen, wo sie stöhnend die Verwendung von Bananen und anderen zufällig herumliegenden Gegenständen schilderte. Und was diese Mädels für eine Sprache hatten! Wir wären fast rot geworden, wenn wir so, jeder an seiner Seite, die Köpfe gegen den Hörer preßten. Eine benutzte den Telefonhörer als Massagestab, wir hörten das knisternde Geräusch von Plastik auf gekräuselten Schamhaaren, und im Hintergrund hörten wir die Frau mit tränenerstickter Stimme nach mehr schreien. Kjell Bjarne und ich waren vor Erregung wie gelähmt.
Aber wie gesagt: Eines Tages kam die Rechnung. Und erst jetzt ging mir, und damit uns beiden, wirklich auf, an welch frauenfeindlicher Schweinerei wir uns da beteiligt hatten. Dreitausend Kronen sind viel Geld für zwei Frührentner, die für ein Videogerät sparen. Ich rechnete aus, daß das Videoprojekt damit um ein halbes Jahr aufgeschoben werden mußte, und diese Auskunft ließ dann auch Kjell Bjarne den Ernst der Lage erkennen. Das hatte ich jedenfalls geglaubt. Bis zur vergangenen Nacht.
«Wenn du mich bei Frank verpfeifst, kannst du dir selber dein Essen kochen», drohte Kjell Bjarne. «Dann ziehe ich woanders hin.»
«Wenn du nicht mit diesem Unfug aufhörst, können wir uns nichts mehr zum Kochen kaufen», erwiderte ich. «Und wo willst du denn überhaupt hinziehen? Du hast das Konto doch um zweitausend überzogen. Nicht mal die Heilsarmee würde dich nehmen. Du säufst schließlich nicht. Machst du das schon lange hinter meinem Rücken?»
«Nein. Aber letzte Nacht konnte ich nicht schlafen. War total traurig, weil ich so viele miese Gedanken hatte.»
«Nur dieses eine Mal? Sag mir das ganz ehrlich; wenn die Rechnung kommt, bist du ja doch entlarvt.»
«Nur dieses eine Mal, und dann noch einmal.»
«Na gut», sagte ich großzügig. «Ich werde nichts sagen. Aber du mußt mir versprechen, daß du mit Frank über deine miesen Gedanken sprichst.»
«Wieso denn?» Er schielte düster zu mir herüber, aber ich sah doch, wie erleichtert er war.
«Du kannst dir nicht jedesmal sündhaft teure Schweinesprüche anhören, wenn du Angst kriegst», sagte ich.
«Hatte keine Angst. War sauer auf meine Mutter.»
«Ist egal. Die Einheiten kosten immer gleich viel, ob du nun Angst hast oder wütend bist. Ruf lieber die Telefonseelsorge an. Die sind gratis, glaube ich.»
«Das ist aber nicht dasselbe.»
«Wer weiß», sagte ich. «In der Kirche ist viel passiert, seit wir beide konfirmiert worden sind. Wenn wir den Zeitungen glauben dürfen, dann kriegst du vielleicht eine lesbische Pastorin an die Strippe. Und wenn du ihr von deiner gemeinen Mutter erzählst, kannst du sie vielleicht auch ein bißchen zum Stöhnen bringen.»
Jetzt waren wir wieder Blutsbrüder. Wir lachten wie Blutsbrüder. Laut und schrill.
Kjell Bjarne ging in die Küche. Ich hörte, wie er sich an Konservendosen zu schaffen machte; dabei murmelte er etwas über lesbische Pastorinnen.
«Rentierfrikadellen oder Speckklöße?»
«Rentierfrikadellen und Speckklöße», johlte ich. Aus irgendeinem Grund war ich in tollkühner Laune und schlug mit der Zeitung um mich.
Frank kommt wie abgemacht um sieben. Sieben s.t., wie er sagt. Wenn er im Hinterhof durch das Tor kommt, stehen Kjell Bjarne und ich schon im ersten Stock am Küchenfenster. Wir heben die Hände zum Gruß, und Frank grüßt zurück. Mich durchläuft ein warmer Schauer, wenn wir uns begrüßen, und ich weiß, daß es Kjell Bjarne auch so geht. Ein Gefühl von warmer Kameradschaft.
Aber das war nicht immer so. Anfangs haben wir Frank gehaßt. Wir konnten ganze Abende herumsitzen und uns ausmalen, wie wir ihn zu Tode quälen wollten. Wir sahen ihn vor uns, wie er mitten im Winter an Handschellen hinter der Bahn nach Bergen hergeschleift wurde. Oder im Säurebad weinte. Allein, mit gefolterten Pitbulls.
Nur Phantasien und leeres Gerede, natürlich. Es war nicht Kjell Bjarnes oder mein Stil, andere als uns selbst zu mißhandeln.
Aber er mischte sich eben überall ein. Frank mischte sich in alles ein, was wir sagten oder taten. Es war unerträglich! Nichts war gut genug, und wenn ich ein seltenes Mal den Mut faßte, ihm klarzumachen, was ich davon hielt, dann sagte er ganz einfach, ich sollte die Klappe halten. Es war eine böse Zeit, und oft sehnte ich mich nach dem Erholungsheim Brøynes zurück, wo die liebevolle Schwester Gunn regiert hatte. Ich schrieb ihr, daß ich in einer Art Hölle gelandet sei, aber sie antwortete nur, ich solle nicht so entsetzlich übertreiben und ansonsten guten Willen zeigen. Und bald würde doch mein guter Freund Kjell Bjarne nachkommen. Sie sollte von ihm grüßen.
Übertreiben? Guten Willen zeigen, wenn Frank meine Ideale verspottete und meinen Sinn für Ästhetik verhöhnte? Sollte ich in dieser Wohnung leben oder vielleicht er? Wie er die Zimmer in seinem eigenen Haus anstrich, war seine Sache – aber dann mußte es anstandshalber auch meine Sache sein, wie es bei mir aussah. Ich wollte die ganze Wohnung apfelsinengelb streichen, und damit basta. Ich kaufte für die Hälfte meines Einrichtungsgeldes orange Farbe. Und hatte noch nicht einmal den ersten Eimer geöffnet, als Frank auch schon ungebeten angetanzt kam und alles beschlagnahmte. Weiß, meinte er und tauschte vor meinen Augen jeden einzelnen Liter Farbe um. Ich mußte sogar beim Eimertragen helfen. Und neben Frank im Laden stehen, während er und der Verkäufer, übrigens ein unerträglicher Rotz, Witze über meine Farbwahl rissen. Als ich ihm eine winzig kleine Lektion über demokratisches Denken erteilen wollte, lachte er mir mitten ins Gesicht und sagte, das alles sei doch schon seit einer Ewigkeit aus der Mode. Hier bestimme er. Und die Wohnung gehöre durchaus nicht mir, sondern der Stadt Oslo, und bei der habe er sehr wohl allerlei zu sagen.
Das verletzte mich. Ich dachte gern an die Wohnung als meine Wohnung. Als unsere. Meine und Kjell Bjarnes. Kjell Bjarne schrieb mir aus Brøynes und erkundigte sich nach dem Stand der Renovierungsarbeiten. Ich antwortete, es liefe überhaupt nicht. Ein gewisser Frank stelle sich pausenlos quer. Die Idee, im Wohnzimmer einen hängenden Garten anzulegen, könnten wir uns gleich abschminken. Frank hatte darüber nicht einmal diskutieren wollen.
Franks Schritte auf der Treppe. Außer Frank ist mir nie ein Mann begegnet, der so konsequent alle Treppen hochrennt. Je länger und steiler die Treppen sind, desto besser. Frank rennt. Und dann sein vertrautes Klingelsignal: dreimal kurz, einmal lang. Das geheime Signal der Widerstandsgruppe. Ich nickte Kjell Bjarne zu, und der lief in die Diele, um die Tür aufzumachen. Ich hörte, wie sie miteinander redeten und sich gegenseitig in den Rücken stupsten, und mir traten Tränen in die Augen. Daß ich das alles erleben durfte! Eine saftige, unsentimentale Kameradschaft! Ich fuhr mir rasch mit einem Geschirrtuch durchs Gesicht und ging ins Wohnzimmer.
Frank war nicht einmal außer Atem. Er hatte eine Kondition wie ein Gepard. Er ließ sich aufs Sofa fallen und kratzte sich in seinem ergrauenden Schnurrbart.
«Alles in Ordnung, Elling?»
Ich versicherte ihm, das Leben sei in fast perfektem Gleichgewicht. Ich sagte nichts davon, daß ich Gemütlichkeit und Freuden meiner Kindheit vermißte. Das hätte er doch nicht verstanden. Gewisse Räume müssen verschlossen bleiben, selbst für enge Freunde, die bei der Stadt Oslo angestellt sind.
«Schön», sagte er. «Und bei euch ist ja besser aufgeräumt als bei mir zu Hause, soviel ich sehen kann.» Sein Blick wanderte suchend durchs Wohnzimmer.
Ja, das stimmt. Es war aufgeräumt. Bei meinem Aufenthalt in Brøynes hatte ich nämlich so manchen Trick gelernt, was das Ordnunghalten angeht. Es war mir wirklich wichtig, daß alles ordentlich war. Wenn man sich nicht vor Wischlappen und heißem Wasser scheut, dann steigt die Gemütlichkeit um mehrere Grad.
«Wie geht’s denn Janne?» fragte Kjell Bjarne und bohrte in der Nase.
«Gut, glaube ich», antwortete Frank. «Sie ist auf Mallorca. Nur für eine Woche, kommt am Freitag wieder.»
«Allein?» fragte Kjell Bjarne.
«Ja, ich kann mir doch nicht freinehmen. Ich muß dafür sorgen, daß Typen wie ihr sich nicht gegenseitig umbringen. Letzte Woche hat ein Dussel oben in Bjølsen versucht, sich durch die Wand einen Weg zu seinen Nachbarn zu schlagen.»
«Aber so sind wir doch nicht!» sagte Kjell Bjarne.
«Und was habt ihr seit dem letzten Mal so gemacht?» fragte Frank, als hätte er Kjell Bjarnes Einwand nicht gehört. «Habt ihr euch ein wenig die Wirklichkeit angesehen, oder habt ihr nur in der Bude gesessen und die Decke angestarrt?»
«Wenn ich mit einer Dame zusammen wäre, würde ich sie nicht allein ins Ausland fahren lassen», sagte Kjell Bjarne. «Dann würde sie’s mit mir zu tun kriegen.»
«Was faselst du denn da, du Nilpferd? Wer behauptet denn, sie hätte mich gefragt? Ich habe gefragt, ob ihr seit dem letzten Mal an der frischen Luft gewesen seid!»
Ach, was für eine große Klappe. Aber inzwischen kannte ich ihn. Ich hatte gemerkt, daß er das Thema Janne so schnell wie möglich fallenlassen wollte. Kjell Bjarne hatte recht. Eine gesunde Beziehung verträgt es nicht, wenn einer in Urlaub fährt, ohne den anderen zu fragen. Das ist einfach nicht richtig. Und jetzt spielte Frank sich auf und gab sich alle Mühe, seine Verzweiflung zu verbergen. Er tat mir richtig leid. Jeder Idiot mußte sich doch vorstellen können, welchen Versuchungen Janne auf Mallorca ausgesetzt war. Ich war selbst in Spanien gewesen und wußte Bescheid. Die billigen Pauschalreisen sind nicht zur Erhaltung der Monogamie erfunden worden, das steht fest. Den ganzen Tag ist der Bär los. Ich zwang mich, ein Bild von Janne mit der lokalen Fußballmannschaft zu vergessen.
«Möchtest du eine Cola?» fragte Kjell Bjarne.
«Herrgott, ihr seid wirklich hoffnungslos. Ja, ich will eine Cola! Habt ihr in den letzten vierzehn Tagen irgend etwas unternommen?»
Jetzt hätte ich gern gelogen. Ich wußte nämlich, was er hören wollte. Wir sollten von ausgiebigen kommunikativen Aktivitäten erzählen. Er wünschte sich einen Alltag, in dem Kjell Bjarne und ich in der Stadt herumjuxten und am laufenden Band neue Kontakte knüpften. Einen neuen Freund nach dem anderen auftaten. Selbstsicheres Auftreten in Kneipen und Cafés. Zwei gewinnende Wesen, deren erbarmungsloser Charme einfach alle zur Strecke brachte.
Aber so waren wir nun einmal nicht. Kjell Bjarne und ich waren nicht so. Wir waren eher von der ängstlichen Sorte. Der Lärm der Gaststätten schüchterte uns ein. Und da wir so gut wie nichts über unsere Nachbarn wußten, wollten wir im Treppenhaus lieber nicht gesehen werden. In unserer Wohnung fühlten wir uns am sichersten. War das denn wirklich so schlimm?
«Ich kauf doch immer im Supermarkt für uns ein», sagte Kjell Bjarne und stellte ein Glas und anderthalb Liter Cola vor Frank auf den Tisch. «Und da sitzt ein Typ an der Kasse, der grüßt mich inzwischen, glaube ich. P. Jonnson, heißt er. So Mitte Zwanzig, glaube ich.»
Frank applaudierte schlaff und drehte den Verschluß von der Colaflasche. «Kannst du dich nicht setzen, Elling? Statt dazustehen und mich anzustarren? Das macht mich ganz nervös.»
Ich setzte mich und gab mir alle Mühe, ihm nicht direkt ins Gesicht zu sehen.
«Und du?»
«Ich?»
«Warst du auch schon mal im Supermarkt?»
Ich erklärte ihm, daß das Einkaufen in Kjell Bjarnes Ressort fiele. Und daß ich bisher nie ein Wort über P. Jonnson gehört hätte.
Frank kippte seine Cola und rülpste. «Das reicht nicht, Jungs. Ihr zeigt doch überhaupt keine Initiative!»
«Was sollen wir denn machen?» fragte ich. Ich merkte, daß ein gerechter Zorn meine Stimme zittern ließ. «Sollen wir auf der Straße Leute überfallen und zu uns nach Hause schleifen?»
Frank schob das Glas weg und erhob sich. «Gehen wir ins Kino», sagte er.
Wir sahen uns «Über Storch und Stein» an. Ein ziemlich blödsinniger Film, wie ich fand. Es geht um ein junges Paar, das keine Kinder bekommen kann. Irgendwas stimmt mit seinen Spermien nicht. Aber Kinder wollen und müssen sie haben. Schließlich wird das fast zu einer fixen Idee. Eines Tages kommen sie auf die Schnapsidee, daß sie allein in die Stadt gehen und sich mit irgendeinem Trottel paaren soll. Und als dieser Trottel in Gestalt eines unsympathischen Lyrikers auftauchte, hatte ich die Nase voll. Der restliche Film bestand aus Eifersucht und Verwicklungen, das können wir uns ja denken. Und darüber lachten die Leute lauthals. Ich weiß wirklich nicht. Ich halte mich doch für einen modernen Großstadtmenschen, mit allem, was an liberaler Einstellung und Weltoffenheit dazugehört. Aber ich weigere mich, der Auflösung aller Normen auch noch zu applaudieren. Was mich an diesem Film am meisten ärgerte, war, daß er da endete, wo er eigentlich hätte anfangen müssen. Das Paar saß nicht mit einem Kind da, sondern mit drei! Mit Drillingen. Einer ganzen Trilogie, die ein mittelmäßiger Lyriker, den sie nicht einmal kannte, dieser Frau in den Unterleib geschrieben hatte. Und ihr Gatte, den sie ja eigentlich liebte, saß mit blödem Lächeln daneben. Ihm doch egal, oder so. Er war zwar eifersüchtig gewesen, als die Frau seines Lebens wie besessen versucht hatte, aus dem Poeten so viele brauchbare Samenzellen wie nur möglich herauszuquetschen. Aber jetzt waren die Kinder auf der Welt, und da war doch alles in schönster Ordnung. Was für ein Unsinn! Man brauchte wirklich kein Experte für die männliche Psyche zu sein, um zu begreifen, daß dieser eine Beischlaf, diese bewußte Paarung, für den Rest ihres Lebens gegen die Gattin verwendet werden würde. Wann immer unser Mann sich vom Leben schlecht behandelt fühlte, würde er ihr die Geschichte des dichtenden Zuchtbullen auftischen. Sie ihrerseits würde immer wieder betonen, daß sie absolut nichts von der Sache gehabt habe, sie sei nicht einmal zum Orgasmus gekommen, und wenn sie die Wahrheit sagen sollte, dann sei der Piephahn des Poeten winzig klein gewesen. Sie hatte kaum gespürt, daß er am Werk war, und sie hatte während der ganzen Veranstaltung die Decke angestarrt und sich um keinen Preis von ihm küssen lassen.
Was ihr natürlich nicht helfen würde. Auch die verständlichste Notlüge, die schrecklichsten Tränenausbrüche würden nichts an der Tatsache ändern können, daß die drei Kinder nicht das Resultat der gegenseitigen Liebe der beiden Hauptpersonen waren. Am Ende des Filmes sehen wir eine konstruierte Kernfamilie. Ein falsches Bild. Nicht mehr und nicht weniger.
«Der beste Film, den ich je gesehen habe», sagte Kjell Bjarne, als wir wieder auf der Straße standen.
Es war immer das gleiche mit Kjell Bjarne. Wann immer wir mit Frank ins Kino gingen, sah Kjell Bjarne den besten Film, den er je gesehen hatte. Besonders überzeugend wirkte er, wenn er einen Moment lang einen nackten Frauenleib gesehen hatte. Dann zitterte seine Stimme. So wie jetzt. Für zwei Sekunden hatten wir zusehen dürfen, wie Anneke von der Lippe ihre weiße Hinterpartie gezeigt hatte. Für meinen Geschmack war diese Szene viel zu kurz gewesen, um den Film über den Sumpf zu erheben, in den er nun einmal gehörte.
«Witzig», sagte Frank. «Oder was, Elling?»
Oder was? Ich erklärte Frank und Kjell Bjarne, was ich von der Zeit hielt, in der wir lebten. Und vom norwegischen Kino, das keine moralische Anstalt mehr sein wollte. Meiner Ansicht nach trugen die Kulturarbeiter in unserem Land eine gewisse Verantwortung.
«Meine Güte», sagte Frank. «Das war eine Komödie!»
Kjell Bjarne lachte. «Hast du nicht kapiert, daß das witzig war, Mann?»
«Ich hab kapiert, daß das nicht witzig war», fauchte ich ihn an. «Und du hast überhaupt nichts kapiert!»
«Hast du ja wohl keine Ahnung von!» sagte Kjell Bjarne. «Ich kapier genau das, was mir paßt.»
«Große Klasse», sagte Frank, «nur gut, wenn die Kultur zu solchem Engagement führt.»
Ich sagte nichts mehr. Bei jedem Kinobesuch kam das gleiche oberflächliche Gefasel. Kjell Bjarne hatte den besten Film aller Zeiten gesehen, und auch Frank konnte meine Einwände nicht verstehen.
«Für dich ist aber auch nichts gut genug», sagte Kjell Bjarne. «Immer hast du irgendwas auszusetzen!»
Ich gab keine Antwort. Es hat keinen Sinn, Kjell Bjarne zu widersprechen, wenn er in dieser Stimmung ist.
«Es ist erst neun», sagte Frank. «Ich gebe eine Pizza aus.»
Ich wäre lieber nach Hause gegangen, um noch ein wenig in den wissenschaftlichen Illustrierten zu blättern, die ich mir jetzt immer kaufte, aber ich sah ein, daß das unhöflich gewesen wäre. Und außerdem: Was ist denn natürlicher, als nach dem Kino mit zwei alten Kumpels noch eine Pizza zu essen? Es kam mir irgendwie richtig vor. Ein knuspriges Stück italienischen Gebäcks, während die Unterhaltung entspannt dahinfließt.
«Mega!» sagte Kjell Bjarne. In Oslo hatte er sich sehr schnell einen jugendlichen Jargon zugelegt, der kein bißchen zu ihm paßte. Es war so, als ob der konservative Politiker Kare Willoch plötzlich vulgäre Sprüche klopfte.
Wir gingen in Peppes Pizza und bestellten eine große mit Schinken und Peperoni, nachdem wir darüber abgestimmt hatten. Zwei gegen einen. Wie immer. Ich hätte lieber Thunfisch gehabt. Komisch übrigens, wie leicht man sich daran gewöhnt, überfahren zu werden, wenn man sich erst einmal Freunde zulegt. Anfangs hatte ich mich mit Zähnen und Klauen widersetzt, um meine Minderheitenrechte geltend zu machen. Jetzt merkte ich immer häufiger, wie eine milde Resignation mein Adrenalin verdünnte. Wir hatten den richtigen Tonfall gefunden. Wir kannten einander in- und auswendig. Wenn drei erwachsene Mannsbilder einen Zug durch die Gemeinde unternehmen, so wie wir das zweimal im Monat machten, dann ist ihr Tonfall gern ein bißchen rauh. Das wußte ich jetzt. Und es gefiel mir.
Als die dampfende Pizza auf dem Tisch stand, sagte Frank: «Ja, ehe ich’s vergesse … ich habe mich seit letztem Mal erkundigt. Wenn ihr euch eine Katze zulegen wollt, dann ist das kein Problem.»
Kjell Bjarne und ich starrten einander an.
2
Es war ein ganz normales zweistöckiges Reihenhaus mit brauner Holzverkleidung. Meine Hände waren schweißnaß, mein Herz hämmerte wild. Ich hatte noch nie einen wildfremden Menschen besucht. Als ich nun zu Kjell Bjarne hinüberlinste, ging mir auf, daß auch er damit keine Erfahrung hatte. Er schien große Lust zu haben, sich mit den Fäusten die Schläfen zu reiben. Aber das tat er nicht. In der rechten Hand hielt er den grauen Katzenkorb, die linke war in seiner Jackentasche vergraben.
«Jaja», sagte er. «Jetzt können wir nicht mehr zurück, Kumpel.»
Und wie immer machte das Wort «Kumpel» mir Mut. Ich wuchs an diesem Wort. Und noch ehe ich Piep sagen konnte, war mir auch schon ein «na los, Alter» oder so herausgerutscht, und ich steuerte auf die kurze Treppe zu. Ich übernahm die Verantwortung. Ich handelte. Als mein Zeigefinger auf den Klingelknopf drückte, brach in mir eine Lawine los. In einem Moment des Schwindels ging mir auf, daß ich nun, in der Mitte des Lebens, wiedergeboren werden sollte. Daß der Mann, der jetzt wild auf die Klingel drückte, ja, der nicht nachgeben würde, solange die Tür nicht geöffnet war, nicht der war, der vierunddreißig Jahre lang zusammen mit seiner Mutter ein beschütztes Dasein gefristet hatte. Der Mann hier auf der Treppe hatte dem Alltag gegenüber eine viel offensivere Einstellung. Jetzt hatte er zum Beispiel beschlossen, sich eine Katze zuzulegen. Die Katze mußte her. Zuerst das genaue Studium der Kleinanzeigenspalten in den Zeitungen. Gerade diese Aktivität hatte mich an alte Zeiten erinnert. Daran, wie ich in meinem Kinderzimmer Arbeiderbladet durchgekämmt hatte. Mit meinem bohrenden Blick, dem kein einziges Komma entging. Acht Wochen alte Katzenbabys wegzugeben. Der Anruf. Der endgültige Bruch mit meinem alten Ich. Ja, so und so sei der Name. Ausgedörrter Mund, aber sichere Stimme. Ob es zutreffe, daß unter dieser Nummer kleine Katzen zu vergeben seien?
«Aber mein lieber junger Mann!» Aus der Türöffnung starrte mich eine kleine Frau an.
Ich ließ die Klingel los.
«Guten Tag», sagte Kjell Bjarne. «Wir wollen eine Katze holen. Mein Kumpel hat gestern angerufen.»
Ich nahm ihre Hand und stellte mich vor.
Sie lachte. «Waren Sie das, der so viele seltsame Dinge gesagt hat? Kommen Sie rein!»
Seltsame Dinge? War es denn seltsam, daß ich ihr einiges über mich erzählen wollte, ehe sie mir ein unschuldiges Leben übergab, ein Leben, das sich in ihrer Obhut befand? Es ist doch eine Verantwortung, wenn man ein Tier zu sich nimmt. Und das gilt sicher auch für den Menschen, der ein Tier weggibt. Man gibt ja ein Tier wohl keinem Menschen, zu dem man nicht volles Vertrauen hat. Deshalb hatte ich ihr genau auseinandergelegt, daß ich kein Psychopath mit einer hungrigen Boa constrictor unter dem Bett war. Ich hatte erklärt, daß jetzt einer meiner allerinnigsten Wünsche in Erfüllung gehen würde. Schon als Junge hatte ich mich nach der Zuneigung eines Tieres gesehnt, aber die lächerlichen Regeln eines Wohnblocks im Osten der Stadt hatten das nicht gestattet. Jetzt wohnte ich mit einem guten Freund in einer Wohnung in Majorstuen, umgeben von Humanisten in Kniebundhosen. Die sahen die Beziehung zwischen Mensch und Tier anders. Mehrere von ihnen hatten Pudel oder Jagdhunde.
«Ihr möchtet sicher eine Tasse Kaffee?» fragte die Frau. «Und ein Stückchen Kuchen?»
«Ja, danke», sagte Kjell Bjarne, der noch immer den Katzenkorb in der Hand hielt.
Kuchen. Kaffee. Ich wollte meine Katze sehen!
Und dann sah ich sie. Sie waren überall. Ich hatte noch nie so viele Katzen auf einem Haufen gesehen. Eine große, gelbgestreifte lag oben auf dem Kühlschrank und starrte mich an. Vier schwarze lagen lässig auf dem Küchenschrank. Mitten auf dem Küchentisch lag ein Siamese und starrte durch mich und alle andere Materie hindurch. Und um die Füße der Frau, die sich inzwischen als Dagny Rimstad vorgestellt hatte, wuselten vier miauende halbwüchsige Tiere herum. Ihre rosa Arschlöcher leuchteten mir aus dem dunklen Fell entgegen.
«Setzt euch», sagte Dagny Rimstad. «Hat einer von euch schon mal eine Katze gehabt?»
Diese Frage konnten wir nur verneinen. Aber ich fügte hinzu, wir seien trotzdem gut vorbereitet. Wir hatten uns alle vorrätigen Bücher über Katzenhaltung aus der Bücherei ausgeliehen.
«Vergeßt den ganzen Kram», sagte Dagny. «Vor allem müßt ihr dafür sorgen, daß das Klo sauber ist. Der Rest ergibt sich aus dem gesunden Menschenverstand.» Sie stellte einen Teller mit einem halben Königskuchen auf den Tisch und schenkte uns aus einer Thermoskanne Kaffee ein. Eigentlich trinke ich keinen Kaffee, der macht mich nervös, aber ich fand doch, daß ich aus Höflichkeit ein wenig an diesem heißen Getränk nippen müßte. Der Siamese starrte mich mißtrauisch an, schnupperte aber dann doch neugierig an meinem ausgestreckten Zeigefinger.
«Wo ist unsere Katze?» fragte Kjell Bjarne mit vollem Mund.
«Seid ihr sicher, daß ihr nur eine wollt?» fragte Dagny. «Wenn ihr zwei nehmt, ist alles leichter. Dann spielen sie miteinander, wenn ihr bei der Arbeit seid.»
Ich wollte antworten, aber Kjell Bjarne kam mir zuvor.
«Haben beide keine Arbeit.»
Ich warf ihm einen warnenden Blick zu und sagte, daß wir uns natürlich überlegen würden, ob wir nicht zwei Katzen wollten. Arbeit oder nicht – wir hatten viel zu tun. Sehr viel sogar. Immer waren wir unterwegs, wir brauchten wirklich zwei. Um das Klo brauchte sie sich keine Gedanken zu machen, das stand zu Hause in der Diele. Ein fesches cremefarbenes Plastikteil. Mit Dach.
Dagny nickte zufrieden und verließ das Zimmer. Bald darauf kam sie mit einem großen Pappkarton zurück. Darin piepste und wuselte es, und die Mutter, eine große schwarzweiße Katze, folgte ihr auf dem Fuße.
Die Kleinen waren schwarzweiß, genau wie die Mutter. Sie hatten sich zu einem einzigen großen Klumpen aneinandergeschmiegt, deshalb konnte ich nicht sehen, wie viele es waren.
«Sechs», sagte Dagny, als ob sie meine Gedanken gelesen hätte. Sie setzte eins nach dem anderen auf den Boden, und die Mutter verpaßte ihnen gleich eine Katzenwäsche.
Kjell Bjarne lachte und zeigte auf eins der kleinen Viecher: «Wir nehmen den mit dem Schnurrbart, Elling! Nun sieh ihn dir bloß an!»
Doch. Witziger kleiner Heini. Weißes Gesicht, mit einem schiefen kleinen Hitlerschnauz unter der rosa Schnute. Aber mir ging es hier doch nicht um Jux und Gaudi. Dafür hatte ich zu lange auf diesen Tag gewartet. Seit fünfundzwanzig Jahren freute ich mich auf den Augenblick, da ich meine eigene Katze oder irgendein anderes warmblütiges Schmusetier heimführen könnte. Jetzt war es endlich soweit. Und deshalb ging es mir hier nicht um pigmentelle Possen. Ich wollte keine Katze, die die Leute zum Lachen brachte, sondern ein Tier von der Spezies Felis, das mir mit rätselhaftem Blick in die Augen starrte, wenn ich morgens aufwachte. Eine Katze, deren Blick meine Gedanken automatisch um die wesentlichen Fragen in diesem Leben kreisen ließ. Woher kommen wir? Wohin gehen wir?
Dagny Rimstad hielt uns derweil einen kleinen Vortrag. Sie behauptete noch einmal, daß zwei Katzen besser seien als eine, diesmal mit mehr Gewicht und Autorität als vorhin. Sie riet uns davon ab, von jedem Geschlecht eine zu nehmen, aus Gründen, die uns sicher klar seien. Und obwohl sie doch selbst eine Frau war, sagte sie ganz offen, daß zwei Katzen mehr Arbeit machten als zwei Kater. Kater könnten nun einmal nicht schwanger werden, und im Vergleich zur Sterilisation einer Katze sei eine Kastration eine Kleinigkeit.
Wir nickten und sagten aha. Kjell Bjarne hob mit zwei Fingern den kleinen Wicht mit dem Hitlerschnauz hoch und ließ ihn auf seiner riesigen Handfläche herumkrabbeln.
«Ja, dann nehmen wir eben kleine Jungs, Frau Rimstad», sagte er. «Oder ist das hier vielleicht eine junge Dame?»
«Nein, das ist ein Knabe», sagte Frau Rimstad. Sie sah sich das kleine Tier von hinten an.
«Uns tricksen Sie nicht aus.» Kjell Bjarne schmunzelte. «Bei dem ist doch wirklich nichts zu sehen.»
Um die Wahrheit zu sagen: Mir war das peinlich. Frau Rimstad zeigte und erklärte, und Kjell Bjarne hörte sich voller Interesse alles an. Um das Geschlecht von so kleinen Katzen zu ermitteln, muß man sich die Plazierung von zwei Löchern ansehen. Bei Katern sitzen die dichter beieinander als bei Katzen, und so weiter. Himmel, hier war die Rede von Tieren, von zwei winzigen Tieren sogar, und diese vielen genitalen Informationen von einer mir unbekannten Frau waren mir eben peinlich. Ich war daran ganz einfach nicht gewöhnt. Deshalb ließ ich mich vorsichtig auf die Knie sinken und wandte meine Aufmerksamkeit den anderen fünf Wuscheln und ihrer etwas reservierten Mutter zu. Und kaum hatte ich angefangen, der kleinen Familie gut zuzureden, als auch schon ein kleiner Heini aus der Gemeinschaft ausbrach und anfing, an meinem Finger zu nuckeln. Du meine Güte!
«Den müssen Sie nehmen», sagte Frau Rimstad. «Das ist der aktivste von allen. Und jetzt hat er sich für Sie entschieden.»
Für mich? Für Elling? Ich hätte vor Glück losbrüllen können! Es hatte im Laufe der Jahre wirklich nicht viele gegeben, weder Tiere noch Menschen, die diese Wahl getroffen hatten. Ich wollte den Kleinen weiter an meinem Finger herumkauen lassen, aber der Wicht rollte sich zu einem Ball und schlief auf meinem Schoß wie ein Stein ein. Fiel ganz einfach in Ohnmacht! Unter dem schwarzweißen Fell konnte ich sein kleines Herz arbeiten sehen.
«Das ist ganz normal!» erklärte Frau Rimstad, als sie meinen fragenden Blick sah. «Sie schlafen sogar mitten im Spielen ein. Sie laden ein paar Minuten lang die Batterien auf, und dann geht’s gleich wieder los.»
Nun gut. Ganz normal war es ja wohl kaum, sich auf dem Schoß eines Fremden schlafen zu legen. Das hier war ein Fall von blindem Vertrauen. Tiere verstehen mehr, als die Menschen ahnen. Sie wissen zum Beispiel sehr gut, wer ihnen wohlgesonnen ist. Das hatte sie ja selbst gesagt: Ich war der Auserwählte. Der Bevorzugte, gewissermaßen.
Kjell Bjarne hatte seinen Kater auf den Tisch gesetzt, wo der Kleine auf wackligen Beinen herumstapfte und an den Kuchenkrümeln roch. «Pfeffer», sagte er.
Wir sahen ihn an.
«Der soll Pfeffer heißen.»