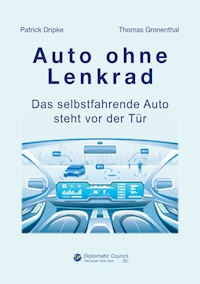
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Auto, wie wir es kennen, fährt seinem Ende entgegen. Die Branche steht vor einer grundlegenden Veränderung, vergleichbar mit dem Wechsel von der Pferdekutsche zum Automobil. Es genügt, sich einen Wagen vorzustellen, der kein Lenkrad mehr besitzt, um die Auswirkungen der anstehenden Veränderungen zu erkennen. Die Autoren des vorliegenden Buches beschreiben die Autowelt der Zukunft, in der wir unsere Wagen nicht mehr selbst lenken. Sie skizzieren eine Vision, die sicherlich vielen Autofahrern heute noch erschreckend erscheint, und auf die wir dennoch unaufhaltsam zusteuern. Es sind Autos, die ohne Lenkrad, ohne Gas- oder Bremspedale auskommen, und die uns wie von Geisterhand überall hinbringen, wohin wir möchten. Die Ingredienzien dieser neuen Autowelt sind elektrische Antriebe und Batterien, eine schier unglaubliche Computerleistung, Sensoren und Software sowie Künstliche Intelligenz. Hinzu kommt eine digitale Rundum-Vernetzung, die uns in unserem Wagen niemals alleine lässt. Das Automobil als Symbol der Freiheit nähert sich seinem Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Sobald die Aufsichtsbehörden sich damit abgefunden haben, dass wir kein Lenkrad haben, werden wir das einfach streichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Lenkrad abgeschafft wird, liegt bei 100 Prozent. Die Verbraucher werden es verlangen.“
Elon Musk, 2021
„Wir haben jetzt die – vielleicht letzte – Chance, in der Welt der Datenökonomie eine bedeutende Rolle zu spielen.“
Herbert Diess, 2021
„Wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen.“
Angela Merkel, 2020
Inhalt
Autos wie Kinder – ein Vorwort
Auto ohne Lenkrad
Dramatischer Abschied von den „stinkenden Kisten“
Verkehrsinfarkt vs. Massentransport
Stau 38-mal um die Erde
Stauhauptstadt Berlin
Kostenfreier ÖPNV als Abhilfe
Singapur gegen Tesla
E-Laster und Platooning
Japan setzt auf den Massentransport
China fährt mit dem Zug davon
Die Vision von der autofreien Stadt
Das Umweltbundesamt träumt
Tesla, Google, Amazon, Apple…China
Tesla Roadster der Erste und der Zweite
Auto mit Raumfahrtantrieb
Google und Amazon übernehmen das Auto
Apple und der Billionen-Markt
Apple hat keine Ahnung – na und?
Chinesische Autohersteller auf dem Vormarsch
Das autonome Automobil
Mehr Mobilität
Fahrassistenzsysteme
Elektronik tötet
Autonomes Versagen
Der Fünfstufenplan zur Autonomie
Autonome Autos
Die moralische Maschine
Auto mit Gewissenskonflikten
Aggressiver Autopilot
Mit oder ohne Lidar
BMW will Plattform für autonomes Fahren
Mercedes gibt sich selbstbewusst
Gewalt gegen Blech
Deutschland hinkt beim Autonom hinterher
Deutsche Autobauer siegesgewiss
Sedric heißt der neue VW
Hightech-Projekt Artemis
Projekt Apollon: VW und Audi arbeiten zusammen
Von der Software bis zum Türgriff
Auto mit Satellitenanschluss
Erster autonomer Laster in Europa
E-Roller voraus
Hersteller rücken zusammen
Hilfe, es fehlen Chips… und Batterien, und Software
Gesetze für autonomes Fahren
Das Auto der Zukunft
96 Prozent Standdienst
Carsharing boomt
Der Gett-Flop von VW und die Alternativen
Das mobile Familienmitglied
Viel Geld für´s Kind
Vernetzung total
Wir werden bevormundet
Datensammler Automobil
Trends der 2020er
Neues Design für die Generation E
Herausforderungen der deutschen Autoindustrie
2040 Autofahren nur noch mit Sondergenehmigung
Ausblick
Über der Stadt: Flugtaxis
EASA bereitet Senkrechtstarter vor
Das fliegende Auto
Die Technik wird über-, der Mensch unterschätzt
Über die Autoren
Patrick Dripke
Thomas Gronenthal
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Autos wie Kinder – ein Vorwort
1,6 Milliarden Fahrzeuge gibt es rund um den Erdball. Jedes Jahr werden etwa 80 Millionen neue produziert – ungefähr so viele, wie Kinder jedes Jahr geboren werden.1 Sie alle, die Wagenbesitzer und die Kinder, werden von der anstehenden automobilen Revolution betroffen sein.
Das Auto der Zukunft wird nicht einfach ein Wagen sein, wie wir ihn heute kennen, nur mit einem E-Motor statt einem Benzin- oder Dieselmotor. Bei der Software wird es sich nicht einfach um verbesserte Assistenzsysteme handeln, wie sie derzeit schon in vielen Wagen üblich sind. Sondern es wird grundlegend anders sein und in ein völlig anderes Ökosystem eingebettet sein. Man mag an den Unterschied zwischen einem Tasten- oder gar einem Wählscheibentelefon aus alten Zeiten und einem modernen Smartphone mit seiner App-Ökonomie denken.
Auto ohne Lenkrad
Es genügt vielleicht schon, sich ein Auto vorzustellen, das kein Lenkrad mehr besitzt, um sich die Implikationen der anstehenden Veränderungen zu verdeutlichen. Viele von uns beschleicht derzeit sicherlich ein mulmiges Gefühl, sich ein Auto auszumalen, das „niemand“ lenkt. Es erscheint uns sehr fraglich, ob wir uns in einem solchen Wagen sicher fühlen würden. Viele werden sagen: Auf keinen Fall werde ich mich auf eine Fahrt in einem fahrerlosen Automobil einlassen. Doch genau das wird bald Realität werden. Und nach ein paar Jahren Eingewöhnung werden wir uns gar nicht mehr vorstellen können, in einen Wagen einzusteigen, der „nur“ von einem Menschen gefahren wird. Die Fahrt mit einem menschlichen Fahrer wird uns zu ungewohnt, zu unsicher und zu unbequem vorkommen. Selber zu fahren wird in Zukunft zu einem Abenteuer, das nur noch auf eigens dafür vorgesehenen Pisten erlaubt sein wird, wie auf einem Abenteuerspielplatz. Der Normalfall wird das autonome Automobil sein, das eigenständig fährt und lenkt, das Routinearbeiten wie Tanken, Abholen oder Hinbringen selbstständig erledigt. Natürlich findet dieser Wandel nicht von heute auf morgen statt – aber unendlich lange wird diese Veränderung auch nicht dauern.
In diesem Sinne nehmen wir mit diesem Buch Abschied von einer Ära. So in etwa muss es gewesen sein, als unsere Groß- und Urgroßeltern den Wandel von der Kutsche zum Automobil erlebten, wie es der Schriftsteller Hans Fallada in seinem Roman „Der eiserne Gustav“ so anschaulich und melancholisch beschrieben hat.2
Dramatischer Abschied von den „stinkenden Kisten“
Die „stinkenden Kisten“, die man mit röhrendem Sound durch die Gegend „heizen“ konnte, nähern sich ihrem Ende. Es ist ein dramatischer Abschied, wie das Dieseldesaster mit seinem Netz aus Lug und Betrug auf beinahe schon tragische Weise zeigt. Die meisten von uns gehören zu den Betroffenen, denn wir fahren noch einen Benziner oder einen Diesel. Damit verbunden ist die Ungewissheit, wie lange man damit noch in welche Städte oder Regionen fahren darf. Wer schon mit einem E-Auto auf die neue Seite gewechselt ist, kämpft dort vermutlich mit den Herausforderungen einer Technologie, die noch am Anfang steht. Die Frage nach der verbleibenden Reichweite ist im aktuellen E-Zeitalter wie ein Damoklesschwert, das über jeder längeren Reise schwebt. So oder ähnlich werden unsere Groß- und Urgroßeltern ihre Anfänge mit dem Automobil erlebt haben.
Die Autoren dieses Werkes hegen keine Zweifel, dass wir alle diese Herausforderungen überwinden werden auf dem Weg in eine neue automobile Gesellschaft.
Patrick Dripke, Thomas Gronenthal
Verkehrsinfarkt vs. Massentransport
Selbst Fans der automobilen Freude wird genau diese Freude am Fahren immer häufiger genommen – nämlich dann, wenn sie im Stau stehen. Man mag dem autonom fahrenden Automobil, neuen Antriebsformen wie dem E-Auto und der Forderung nach der Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) oder sonstigen Massentransportmitteln kritisch gegenüberstehen und die Vision von der autofreien Stadt eher als Horror denn als Segen begreifen, aber die Tatsache, dass es in den Städten und auf den Straßen zu viele – viel zu viele – Autos gibt, die mehr oder minder permanent Staus verursachen, lässt sich kaum bestreiten.
Stau 38-mal um die Erde
Es ist neben dem Gewinnstreben auch die Vision einer neuen mobilen Welt, die Tesla, VW und sicherlich auch die meisten anderen Automobilhersteller antreibt. Sauberer, sicherer und natürlich staufrei – so lautet die Vorstellung.
Die Staus in Deutschland erreichten 2018 einen Negativrekord, hat der ADAC ermittelt. Alle 745.00 einzelnen Staus des Jahres aneinandergereiht ergäben eine Gesamtlänge, die 38-mal um die Erde reichen würden. Das kam mehr als 2.000 Staus pro Tag gleich. Gegenüber dem Vorjahr entsprach dies einer Verschlechterung um drei Prozent. Die Staulängen stiegen um fünf Prozent, insgesamt rund 1,5 Millionen Kilometer Blech an Blech. Die Autofahrer – oder sollte man besser Autosteher sagen – waren 459.000 Stunden im Jahr zum Stillstand gezwungen.
Schuld sind die Baustellen, die Schulferien und immer mehr Autos. Tatsächlich zählte die Bundesanstalt für Straßenwesen 2018 etwa drei Prozent mehr Baustellen als im Jahr zuvor. Die Kfz-Fahrleistung stieg um 0,4 Prozent an. Der staureichste Tag des Jahres 2018, der 28. Juni, war in der Tat dadurch gekennzeichnet, dass in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gleichzeitig die Sommerferien begannen. Allein an diesem Tag staute sich der Verkehr in Deutschland auf insgesamt 13.000 Kilometern.
Aber tragen wirklich die Baustellen- und Ferienplaner die Hauptschuld am zunehmenden Verkehrskollaps in Deutschland? Diese Erklärung wäre wohl doch zu einfach. Ohne Baustellen hätten wir marode Straßen, die kaum für Tempo 130, aber sicherlich nicht für Tempo 180 oder noch schneller geeignet wären. Wer erleben will, in welch erbärmlichem Zustand sich ein Straßennetz befindet, an dem kaum gebaut wird, kann dies in weiten Teilen der USA in Augenschein nehmen. Und bei der Ferienplanung haben wir in Deutschland mit den nach Bundesländern versetzten Terminen schon ein ausgeklügeltes System, im Unterschied etwa zu Frankreich, wo das gesamte Land praktisch zeitgleich in den Urlaub fährt.
Könnte man immer mehr Autobahnen bauen? Natürlich, aber wie viele? Und natürlich sind nicht nur die Autobahnen verstopft, sondern ebenso stark die Ballungszentren und Innenstädte. Auch dort immer mehr Straßen, immer mehr Parkplätze? Wer über diese Fragen nachdenkt, sollte zumindest in Erwägung ziehen, dass es statt „immer mehr“ auch ein „anders“ geben könnte.
Stauhauptstadt Berlin
Berlin ist nicht nur politisch die Bundeshauptstadt, sondern auch die Stauhauptstadt Deutschlands. 2018 verbrachte der Berliner Autofahrer durchschnittlich 154 Stunden im zähfließenden Verkehr oder im Stau. Das entsprach knapp einer halben Stunde am Tag oder beinahe 20 Arbeitstagen pro Jahr.3 Ein Jahr später, 2019, stieg die Gesamtdauer der gemeldeten Staus in Berlin sogar um rund 50 Prozent auf 22.299 Stunden. Damit rangierte Berlin gemessen an der Länge seines Autobahnnetzes erneut auf Platz Eins der bundesweiten ADAC-Staubilanz. Immerhin: 2020 kam es zu einer Halbierung der Staus beinahe in ganz Deutschland aufgrund der Pandemielage.4
Doch zuvor war angesichts des Staufrusts die Empörung zu verstehen, als die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther im Frühjahr 2019 forderte: „Wir möchten, dass die Menschen ihr Auto abschaffen“. Statt mit dem Auto sollten die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder in Sharing-Fahrzeugen ihre Alltagswege zurücklegen. Mehr Autos vertrage Berlin nicht und auf dem durch Fahrzeuge blockierten Flächen könnten besser Wohnhäuser oder Naherholungsparks errichtet werden.5 „Das alte Mobilitätskonzept der autogerechten Stadt stößt an seine Grenzen“, sprach die Berliner Verkehrssenatorin aus, was wohl der ideologischen Linie einer ganzen Politikerkaste entsprach. Dazu passte ihre Aussage „Der Verbrennungsmotor hat ausgedient und wird sehr schnell ersetzt werden.“ Vor allem S- und U-Bahnen sollten als Ersatz dienen, mit größeren Flotten, erweiterten Strecken und höherer Taktung. Allein dafür wollte Berlin in den nächsten Jahren rund 28 Milliarden Euro aufwenden. Das stellte eine klare verkehrspolitische Ansage dar – allerdings eine gegen das Auto.
Kostenfreier ÖPNV als Abhilfe
Die Fahrverbote in der City brachten seit Anfang 2019 immer mehr Städte in die Bredouille. Nicht nur die Verärgerung der Einwohner, die nicht mehr in ihre Stadt durften, war groß, auch der Einzelhandel und das urbane Leben liefen Gefahr, Schaden zu nehmen, wenn die Dieselkäufer außen vor blieben. Vor diesem Hintergrund gewann das Stichwort „fahrscheinloser ÖPNV“ an Bedeutung, also die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Wegweisend war Ulm: Dort beschlossen die Stadtväter, dass Busse und Bahnen neun Monate lange zumindest an Samstagen ohne Fahrschein genutzt werden durften; später wurde das Angebot bis Ende 2022 ausgeweitet.6 Andere Kommunen dürften folgen – auch, um ihre Innenstädte nach den Coronajahren 2020/21 wieder zu beleben.
Ob der Ansatz genügt, um Deutschlands Automobilisten dauerhaft zu ÖPNV-Freunden umzuerziehen, ist allerdings zweifelhaft. Doch nach der Coronakrise 2020/21 stellt sich ohnehin die Frage, welche Anziehungskraft die Innenstädte noch haben werden, selbst bei kostenlosem ÖPNV.
Zudem steht ohnehin nur rund 27 Millionen Bundesbürgern in Großstädten und Metropolregionen ein guter öffentlicher Personennahverkehr zur Verfügung. Für rund 55 Millionen Menschen, die im Umland oder im ländlichen Raum wohnen, ist das Angebot deutlich geringer und oft nicht ausreichend. Zwar gibt es in Deutschland ein dichtes Netz von 230.000 Haltestellen für Bus und Bahnen, doch weniger als die Hälfte wird auf dem Land stündlich oder häufiger bedient.7 Der Ausbau in der Fläche lässt also zu wünschen übrig. Eine eventuelle Personalknappheit dürfte künftig kein Problem mehr darstellen: 2021 fuhren bereits die ersten S-Bahnen in Deutschland autonom. Zwar befand sich weiterhin noch ein Zugtriebführer am Fahrstand, aber nur, um bei Notfällen eingreifen zu können. Es ist wohl absehbar, dass diese Position künftig durch Kameras und KI-Software ersetzt werden wird. Mit Stand 2021 fuhren die S-Bahnen auf dem Rangiergleis beim Wenden schon ganz ohne Personal.8
Somit gilt es die Frage zu beantworten, in welchem Ausmaß der Individualverkehr überhaupt noch gewünscht ist, oder nicht besser Massentransportmitteln wie Bussen und Bahnen der Vorzug zu geben ist. Asien, allen voran Japan, China und der Stadtstaat Singapur, sind Vorreiter auf dem Weg zur Abschaffung oder zumindest Eindämmung des Individualverkehrs, wie an anderer Stelle in diesem Buch dargestellt wird.
Singapur gegen Tesla
Die Konfrontation zwischen dem asiatischen Stadtstaat Singapur und Tesla könnte als Indiz dafür gewertet werden, dass immer mehr Autos keine Lösung für die Umwelt- und Verkehrsprobleme darstellen – auch nicht, wenn sie elektrisch betrieben werden. Tesla sei ein Lebensstil, den man nicht wünsche, ließ die Regierung Singapurs Tesla-Chef Elon Musk wissen. Ausgerechnet im wohlhabenden, fortschrittlichen und umweltbewussten Singapur war Tesla, die Verheißung schicken und umweltfreundlichen Lebensstils, unerwünscht. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Elektroautos insgesamt eher Teil des Problems als der Lösung sind, wenn es um saubere und menschenfreundliche Städte überall auf der Welt geht?
Statt den Individualverkehr mit Autos gleich welcher Antriebsart zu fördern, forciert Singapur seit Jahrzehnten den öffentlichen Nahverkehr. Bereits seit 1990 gibt es Zulassungsbeschränkungen für Neuwagen, wie übrigens auch in einer wachsenden Anzahl chinesischer Metropolen. Singapur geht dabei einen klaren Weg: Die Lizenzen und Steuern für private Pkw wurden derart erhöht, dass sie für viele Menschen unerschwinglich geworden sind. Bezeichnend für diese Politik ist, dass selbst Tesla trotz abgasfreien Fahrens mit einer CO2-Steuer belegt wurde mit der Begründung, dass man auch die Produktion der Batterien berücksichtigen müsse. Laut Bloomberg ist Singapur „der teuerste Ort der Welt, wenn man ein Auto besitzen will“. Ein Auto gleich welchen Herstellers kostet dort etwa drei- bis viermal soviel wie in jedem anderen Land. Das Vorgehen wirkt: Lediglich elf Prozent der Haushalte in Singapur besitzen einen eigenen Wagen. Im Gegenzug investiert die Regierung Singapurs kräftig in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs.9 Beim Vergleich mit anderen Ländern ist allerdings zu bedenken: Singapur ist ein Stadtstaat, die Entfernungen sind durchweg gering.
E-Laster und Platooning
Die Elektromobilität macht bei den Pkw nicht halt, sondern schickt sich an, auch Busse und Lastwagen zu erobern. Mit viel medialer Aufmerksamkeit stellte Tesla im November 2017 einen elektrischen Sattelschlepper vor. Bei den Unternehmen kam das gut an. UPS bestellte 125 E-Schlepper bei Tesla, Pepsi 100 Fahrzeuge, Anheuser-Busch 40 Trucks und weitere kleinere Aufträge kamen von Walmart und DHL.
Die E-Riesen der Straße benötigen zum Laden allerdings auch riesige Ladestationen. Megacharger nennt Tesla die Lademammuts und verspricht, ein Netz der Lkw-Charger sukzessive aufzubauen. Am Rande der Vorstellung wurde allerdings klar, dass die Lkw-Kunden bei den Stationen, die an ihren eigenen Standorten errichtet werden, einen Teil der Kosten selbst tragen müssen. Hängt der Tesla-Laster am Megacharger, solle er binnen 30 Minuten soweit geladen werden, dass er damit beachtliche 630 Kilometer weit fahren kann.
Später stellte sich heraus, dass der E-Sattelschlepper auch an normalen Tesla-Ladestationen, den Superchargern, mit Strom versorgt werden kann. An fünf Superchargern zusammen lässt sich der E-Sattelschlepper laden. Sollte das Netz der Lkw-Stationen also nicht schnell genug aufgebaut werden, müssen sich Tesla-Fahrer künftig womöglich über zugeparkte Ladestationen ärgern, die von den Trucks blockiert werden.





























