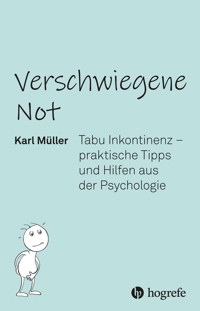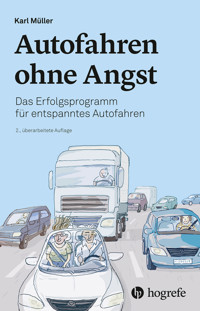
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Endlich entspannt und sicher am Steuer sitzen! Haben Sie Angst vor Autobahnen, Staus, Tunneln oder Brücken? Fürchten Sie sich vor hohen Geschwindigkeiten, dem Überholen oder engen Baustellen? Leiden Sie beim Fahren unter Herzrasen, Luftnot oder Schwindel? Damit sind Sie nicht alleine: Mehrere Millionen Menschen leiden unter Angstzuständen beim Autofahren. Dabei ist es oftmals nicht die Angst vor dem Fahren selbst: Angststörungen, wie z.B. soziale Ängste, Höhenangst oder Unfalltraumata, können sich ebenfalls massiv auf das Autofahren auswirken. Die zweite, überarbeitete Auflage dieses hilfreichen Ratgebers beinhaltet nicht nur zahlreiche Tipps und Lösungen zur Bewältigung von alltäglichen Ängsten beim Autofahren, sondern bietet auch einen fundierten Überblick über die wichtigsten Angststörungen, die ein Auslöser sein können. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Panikattacken und den damit verbundenen, bedrohlichen oder als peinlich empfundenen Körperreaktionen. Die zugrunde liegenden Ängste können verstanden und mithilfe der vorgeschlagenen Übungen bewältigt werden. Das Buch richtet sich an ängstliche Autofahrer, Wiedereinsteiger nach einer langen Fahrpause und Menschen mit Angststörungen. Fahrschülern und Fahrlehrern werden zahlreiche Möglichkeiten für angstfreie und effektivere Fahrstunden sowie eine erfolgreiche Fahrprüfung aufgezeigt. Die gezielten Hilfen für die Behandlung von Angststörungen, die sich auf das Autofahren erstrecken, eignen sich auch für die Anwendung während einer Therapie. Der Autor ist Diplompsychologe und Verhaltenstherapeut und arbeitet seit vielen Jahren mit Angstfahrschulen zusammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Karl Müller
Autofahren ohne Angst
Das Erfolgsprogramm für entspanntes Autofahren
2., überarbeitete Auflage
Autofahren ohne Angst
Karl Müller
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br.; Prof. Dr. Martina Zemp, Wien
Karl Müller
https://www.autofahrenohneangst.com
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri, Lisa Maria Pilhofer
Bearbeitung: Gisela Fichtl, München
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung und -gestaltung: Claude Borer, Riehen
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2021
© 2021 Hogrefe Verlag, Bern
© 2008/2013 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96076-0)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76076-6)
ISBN 978-3-456-86076-3
http://doi.org/10.1024/86076-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Vorwort
1 Erste Einschätzung – wo liegt mein Problem?
1.1 Richtige Diagnose, gezieltes Üben, erfolgreiche Behandlung
1.2 Herzrasen, Schwindel, Luftnot. Horror Autobahn
1.3 Angst vor Kritik, Beobachtung, Fehlern und Blamage
1.4 Angst vor Parkhäusern, Tunneln und Staus
1.5 Vermeiden von Brücken und Bergfahrten
1.6 Ein Leben voller Sorgen und Gefahr – generalisierte Angst
1.7 Kontrolle, Kontrolle – die Zwangsstörung
1.8 Ängste und Traumatisierung nach einem Unfall
1.9 Ängstlich und unsicher – Fahrangst und Fahrphobie
1.9.1 Unsicherheit und Ängstlichkeit beim Fahren
1.9.2 Lange Fahrpausen – Wiedereinsteiger
2 Das Autofahren – Auslöser und Quelle von Angst
2.1 Ängste beim Autofahren – ein Tabuthema?
2.2 Anspannung und Angst im Autofahreralltag
2.2.1 Was setzt Autofahrer unter Stress?
2.2.2 Was verunsichert Fahrschülerinnen und Fahrschüler?
2.3 Wie häufig sind Ängste beim Autofahren?
3 Entstehung von Ängsten
3.1 Angst als Lebensretter
3.2 Angst verstehen
3.3 Vorsicht und Aufmerksamkeit
3.4 Normale und übermäßige Angst
3.4.1 Alltägliche Ängste
3.4.2 Übermäßige Angst
3.5 Ursachen der Ängste
3.5.1 Wie sich Erfahrungen und Gelerntes dem Gedächtnis einprägen
3.5.2 Wie sich Ängste festsetzen und verstärken
4 Methoden der Angstbewältigung
4.1 Grundprinzipien der Angstbewältigung
4.2 Die Kontrolle zurückgewinnen durch Konfrontation
4.3 Zehn Regeln im Umgang mit Angst
4.4 Übertreiben statt vermeiden
4.5 Die Macht der Gedanken
4.5.1 Die drei großen A – Akzeptanz, Alternativen, andere Bewertung
4.5.2 Sorgen- und Grübelkontrolle
4.5.3 Das Kopfkino nutzen
4.5.4 Virtuelle Expositionstherapie – Behandlung im Fahrsimulator
4.6 Eigene Stärken, Erfolge und Ressourcen
4.7 Positive Erlebnisse übertragen
4.8 Veränderung der Lebenssituation statt Konfrontation
5 Ängste bewältigen, entspannt fahren
5.1 Panikstörung und Agoraphobie: Herzrasen, Schwindel, Luftnot, Flüchten.
5.1.1 Wie erkennt man eine Panikstörung und Agoraphobie?
5.1.2 Entstehung und Verlauf
5.1.3 Die Ursachen
5.1.4 Hilfen und Tipps
5.2 Den Kopf nicht verlieren: Angst vor Fehlern und Kritik – Soziale Phobie
5.2.1 Soziale Ängste erkennen
5.2.2 Die Auswirkungen sozialer Ängste beim Autofahren
5.2.3 Die Ursachen sozialer Ängste
5.2.4 Hilfen und Tipps
5.3 Unfälle und ihre Folgen – Hilfen
5.3.1 Die posttraumatische Belastungsstörung
5.3.2 Hilfreiches Verhalten nach einem Unfall
5.4 Keine Umwege mehr: Tunnel und Brücken
5.4.1 Klaustrophobie
5.4.2 Akrophobie
5.5 Sorgen und Ängste in jeder Lebenslage
5.5.1 Ursachen
5.5.2 Generalisierte Angst beim Autofahren
5.6 Zwangserkrankungen
6 Körperreaktionen bei Angst und Panik
6.1 Atemnot, Herzrasen, Schwindel – lebensbedrohlich oder Angst?
6.1.1 Atemnot, Kloß im Hals – die Atmung bei Panikattacken
6.1.2 Schwindel, Angst vor Ohnmacht und Kontrollverlust
6.1.3 Übelkeit, Stuhl- und Harndrang, Zittern
6.1.4 Gefühl der Unwirklichkeit, Angst vor Kontrollverlust
6.1.5 Herzrasen, Druck auf der Brust
6.2 Schnelle Hilfe bei Panik
6.2.1 Übung: Beruhigende Atmung
6.2.2 Körperliches Training gegen die Angst
6.2.3 Entspannung der Muskulatur
6.3 Umgang mit „peinlichen“ Symptomen
6.4 Körperliche und psychische Folgen von Dauerstress und Lebenskrisen
6.5 Wenn die Panik beim Fahren zu stark wird
6.5.1 Kann ich einen Unfall verursachen?
6.5.2 Kann ein Panikanfall den Führerschein kosten?
6.5.3 Was können Sie selbst bei starker Panik tun?
6.6 Medikamente gegen Angst
6.7 Verhaltenstherapie, Fahrschule oder Selbsthilfe?
6.7.1 Welche Therapie hilft?
6.7.2 Was tun, wenn eine Verhaltenstherapie nötig ist?
6.7.3 Wie lange dauert eine Verhaltenstherapie?
6.8 Für Therapeuten: Expositionstherapie und -analyse
7 Fahrschule und Fahrpraxis
7.1 Erfolgreich die Fahrschule bewältigen
7.1.1 Die Fahrlehrer
7.1.2 Die erste Fahrstunde
7.1.3 Umgang mit Anweisungen und Kritik
7.1.4 Selbständigkeit
7.1.5 Der periphere Blick beim Autofahren
7.1.6 Umgang mit Fehlern und Ängsten
7.1.7 Menschen, die sich nicht trauen, den Führerschein zu machen
7.2 Tipps für die Fahrprüfung
7.2.1 Der Prüfungserfolg entscheidet sich vor der Prüfung
7.3 Was raten Fahrlehrer und Prüfer?
7.3.1 Interviews mit Fahrlehrern
7.3.2 Optimaler Verlauf des Lernprogramms
7.3.3 Mentales Training
7.3.4 Vorschläge und Tipps für Fahrlehrer und -lehrerinnen
7.3.5 Die Prüfer
7.4 Allein fahren lernen und Wiedereinstieg nach einer Pause
7.4.1 Führerschein bestanden – allein fahren lernen
7.4.2 Schwierige Situationen in der Fahrpraxis
7.4.3 Die Auswirkungen übermäßiger Ängste beim Alleinfahren
7.4.4 Hilfen und Tipps für Fahranfänger
7.4.5 Tipps für Angehörige, Freunde und Partner
7.4.6 Lange Fahrpause und mangelnde Fahrpraxis: Wiedereinstieg
7.5 Fahrer und Beifahrer: Der alltägliche Konflikt
7.6 Fahrschulen für Fahrängstliche
7.6.1 Voraussetzungen für Fahrlehrer
Anhang 1: Tipps und Thesen im Überblick
Anhang 2: Checklisten
Nützliche Adressen
Über den Autor
Literatur
Sachwortverzeichnis
|11|Vorbemerkung
Die in diesem Buch beschriebenen Hilfen und Tipps sind kein Ersatz für eine eventuell notwendige ärztliche und verhaltenstherapeutische Diagnostik und Behandlung. Insbesondere bei starken körperlichen Angstsymptomen, wie z. B. Schwindel, Herzrasen oder Luftnot, ist eine medizinische Abklärung unbedingt erforderlich. Bei psychischen und körperlichen Angstsymptomen, die neben dem Autofahren auch andere Lebensbereiche einschränken, ist anzuraten, einen Verhaltenstherapeuten oder eine Verhaltenstherapeutin zu konsultieren und sich gegebenenfalls behandeln zu lassen.
Manche der vorgeschlagenen Übungen und Tipps dürfen nur in Begleitung eines Therapeuten und eventuell in einem Fahrschulauto in Begleitung eines Fahrlehrers durchgeführt werden, vor allem wenn Sie sich beim Fahren durch Ihre Angst stark eingeschränkt und unsicher fühlen.
In anderen, weniger gravierenden Fällen, etwa bei mangelnder Fahrpraxis und nach langer Fahrpause, können auch Kurse und Fahrstunden in einer Fahrschule für Fahrängstliche oder einfach häufiges Üben mit einem geduldigen Beifahrer genügen.
Der besseren Lesbarkeit wegen wurde die übliche männliche Schreibform gewählt, selbstverständlich sind jeweils alle Geschlechter gemeint. Die Beispiele wurden anonymisiert und so verändert, dass die Identität der Betroffenen geschützt bleibt.
Die 2. Auflage von „Autofahren ohne Angst“ wurde völlig überarbeitet. Neue Kapitel sind hinzugekommen und der Schwerpunkt hat sich noch stärker auf das Verständnis und die Behandlung der meist zugrundeliegenden Angststörungen sowie der damit verbundenen Körperreaktionen verlagert.
|13|Vorwort
Leiden Sie unter Anfällen von Herzrasen, Luftnot oder Schwindel, wenn Sie auf der Autobahn fahren oder weit entfernt von Zuhause sind? Sind Ihre einzigen Gedanken „Wie komme ich hier weg?“ „Wo ist der nächste Arzt, das nächste Krankenhaus?“ „Wie komme ich schnell genug nach Hause?“ Sie verlieren den Kopf, wenn Sie Fehler machen, kritisiert werden, oder Autofahrer Sie von hinten bedrängen? Die Fahrprüfung bereitet Ihnen schlaflose Nächte? Nehmen Sie große Umwege in Kauf, um nicht durch Tunnels oder über hohe Brücken fahren zu müssen? Fahren Sie in dauernder Alarmbereitschaft, oder meiden Sie das Autofahren ganz, nachdem Sie einen Unfall erlitten haben? Viele Menschen werden durch solche Ängste beim Autofahren massiv eingeschränkt. Dahinter verbergen sich oft krankhafte Ängste, die sich sowohl auf das Autofahren als auch auf andere Lebensbereiche erstrecken.
Eine weitere große Gruppe sind Menschen mit leichteren Ängsten, mangelndem Selbstvertrauen oder auch einer Fahrphobie. Sie lassen deswegen lieber den Partner ans Steuer oder trauen sich nach langer Fahrpause das Autofahren nicht mehr zu. Dazu kommen die zahlreichen Fahrschüler, die sich beim Fahren schwertun und die Fahrprüfung fürchten. Zu prüfen wäre aber immer, ob dahinter eine Angststörung steckt, deren Ursache nicht beim Autofahren, sondern woanders liegt. Wenn ich übermäßig Angst habe, beobachtet und kritisiert zu werden, nutzen mir Fahrübungen wenig. Ich muss lernen, diese Angst zu bewältigen.
Die vielfältigen Probleme beim Autofahren haben ihre Ursachen überwiegend woanders, nämlich bei verschiedenen krankhaften Ängsten. Wenn ich unter einer Panikstörung leide und bei jedem schnellen Herzschlag befürchte, einen Herzinfarkt zu erleiden oder bei Schwin|14|delattacken einen Hirntumor zu haben, dann hat das mit einer Fahrangst eigentlich nichts zu tun. Ich fürchte das Fahren – etwa auf der Autobahn – nur, weil ich befürchte, nicht schnell genug das rettende Krankenhaus erreichen zu können.
Allerdings bergen auch das Auto selbst, das Fahren und bestimmte Verkehrssituationen zahlreiche angstauslösende Reize. Die Angst ist hier an Objekte und Situationen geknüpft, die evolutionsbiologisch für den Menschen gefährlich waren, etwa Gefühle der Enge, keine Fluchtmöglichkeit zu haben, verfolgt und bedrängt zu werden. In der Geschichte der Menschwerdung war es überlebenswichtig, dem Raubtier oder dem Stammeskrieger rechtzeitig entrinnen zu können. Diese Gefühle können plötzlich und unbewusst beim Autofahren aktiviert werden: ein Stau auf der Autobahn, der Drängler von hinten, der riesige Lastwagen neben sich beim Überholen. Hinzu kommen die komplexen, manchmal kaum überschaubaren Abläufe beim Fahren und die jederzeit reale Unfallgefahr. All das kann krankhafte Ängste auslösen und zu einem Teufelskreis aus Angst und Panik führen.
Ursache und Auslöser für Panikattacken beim Autofahren sind bei vielen Betroffenen andauernde Lebenskrisen und Belastungssituationen. Das ständig erhöhte, körperliche und psychische Spannungsniveau kann – wie bei einem überhitzten Kessel – in kritischen Situationen (z. B. Streit mit dem Partner beim Fahren) zu heftigen Angstsymptomen führen und der Beginn einer Angsterkrankung sein. Die körperlichen und psychischen Reaktionen sollten in diesen Fällen als Hilferuf und Warnsignal verstanden werden, dass vordringlich eine Lebensveränderung erforderlich ist. Die Ängste beim Autofahren können sehr quälend sein, sind hier jedoch eher eine Folge- und Begleiterscheinung einer belastenden Lebenssituation.
Fahrübungen zur Konfrontation in Begleitung eines Fahrlehrers oder einer Therapeutin sind dann zunächst eher nutzlos, häufig auch frustrierend, weil ja das eigentlich Problem weiterhin bestehen bleibt: etwa eine unglückliche Ehe, die Depressionen und körperliche Stressreaktionen oder die Angst, einen plötzlichen Herzinfarkt zu erleiden und nicht rechtzeitig die rettende Hilfe erreichen zu können.
Wissenschaftliche Studien ergaben, dass in Deutschland etwa 7 % der Bevölkerung, d. h. über fünf bis sechs Millionen Menschen, akut unter |15|einer gravierenden Angststörung leiden (Angenendt, Frommberger, Berger & Domschke, 2019). Das können u. a. Ängste wie Panikattacken und Agoraphobie, Klaustrophobie, generalisierte Angst, oder die Traumatisierung/Ängste nach einem Verkehrsunfall sein. Bei der Mehrzahl der Betroffenen erstrecken sich diese Ängste auch auf das Autofahren. Sie alle könnten, als Fahrer oder Beifahrer, sicherer und entspannter Auto fahren, wenn sie wüssten, was die eigentlichen Ursachen ihrer Probleme sind und was sie gezielt dagegen tun könnten.
Die Lektüre dieses Buches soll helfen, diese Ängste zu erkennen, besser zu verstehen und damit auch bewältigen zu können. Es bietet zahlreiche Hilfen, die auf diese speziellen Ängste und auf das Autofahren bezogen sind.
Das Buch richtet sich an alle Betroffenen, ihre Angehörigen, an Psychotherapeuten und Fahrlehrer. Nach meiner Kenntnis wird das Thema Angst, Scham und Vermeidung beim Autofahren in Therapien und in Fahrschulen eher beiläufig behandelt. Es ist zu Unrecht bislang kaum ein öffentliches Thema. Dabei suchen besonders Menschen, die unter einer krankhaften Angst leiden, häufig nur deswegen einen Therapeuten oder eine Therapeutin auf, weil sie durch ihre Ängste auch beim Autofahren massiv eingeschränkt werden. Sie befürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes oder Konflikte in der Partnerschaft und leiden unter ihren Einschränkungen. Ihnen möchte ich durch die vorgeschlagenen Hilfen Mut machen für ein angstfreies, entspanntes Autofahren.
Gleichzeitig hoffe ich, mit diesem Buch einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten. Menschen, die nicht von ihren Angstreaktionen in Anspruch genommen werden, fahren sicherlich aufmerksamer und mit mehr Übersicht im Verkehr.
Den Lesern, die sich noch unsicher sind, ob sie je wieder oder überhaupt Auto fahren sollen, sei geraten: Überprüfen Sie genau Ihre Motivation! In manchen Fällen kann es die Angst nehmen, wenn man dazu steht, nicht selbst fahren zu müssen. Es gibt auch öffentliche Verkehrsmittel. Allen anderen Lesern wünsche ich, dass Ihnen dieses Buch eine Hilfe ist, wieder entspannt am Steuer sitzen zu können.
Karl Müller
|17|1 Erste Einschätzung – wo liegt mein Problem?
Die folgenden Kapitel bieten eine erste Orientierung, welche Probleme bei Ihnen zutreffen könnten. Weitere Hinweise finden Sie unter den ausführlichen Checklisten (siehe Anhang 2: Checklisten). Haben Sie den Verdacht, unter einer der beschriebenen Angststörungen zu leiden, so finden Sie weitere Beschreibungen sowie Behandlungs- und Übungsmöglichkeiten in Kap. 5. Möglicherweise sollten Sie sich in verhaltenstherapeutische Behandlung begeben, um eine Diagnose fachlich abzuklären und Behandlungsvorschläge zu erhalten.
Körperliche Erkrankungen sollten trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Erfahrene Verhaltenstherapeuten werden das berücksichtigen und Sie ggf. zur Abklärung an die entsprechende Ärztin überweisen.
1.1 Richtige Diagnose, gezieltes Üben, erfolgreiche Behandlung
Wussten Sie, dass die meisten Menschen mit Flugangst gar nicht den möglichen Absturz fürchten? Fast alle meiner Patienten, die dieses Problem belastet, haben vielmehr Angst, im Flugzeug einen Panikanfall zu erleiden, keine Fluchtmöglichkeit zu haben und eingeschlossen zu sein, wenn Herzrasen, Schwindel oder Luftnot einsetzen. Ihre größte Sorge ist der Kontrollverlust, die Peinlichkeit, vielleicht ohnmächtig zu werden, sich erbrechen zu müssen, nicht schnell genug medizinische Hilfe zu erhalten. In Seminaren gegen Flugangst und in entsprechenden Selbsthilfebüchern wird jedoch vorrangig vermittelt, dass technisches Versagen und Abstürze kaum möglich sind. Danach werden einige Entspannungstechniken geübt.
|18|Ob diese Vorgehensweise Menschen nützt, die extreme Angst vor ihren eigenen Symptomen haben, die in Panik geraten, wenn sie dieser Situation nicht entfliehen können? Ich behaupte, dass diese Art der Angstbewältigung in solchen Fällen eher wenig hilft – und wenn, dann eher zufällig. Es käme vielmehr darauf an, sich mit der Angst vor bestimmten Körpersymptomen, der Angst an sich, zu konfrontieren, oder sich immer wieder Situationen auszusetzen, aus denen Flucht nur schwer möglich ist.
Dasselbe gilt fürs Autofahren. Bei schwerwiegenden Angststörungen hilft es nicht, immer wieder nur das Fahren zu üben. Vielmehr sollten die Ängste, die zu den Unsicherheiten führen, erkannt und eine entsprechende Behandlung durchgeführt werden. Dabei werden die Ursachen erforscht und vielleicht Übungen vorgegeben, die nichts mit dem Autofahren zu tun haben. Konfrontationsübungen mit dem Auto sind dann erst später erforderlich und begleiten die Maßnahmen.
Ich habe zahlreiche Menschen befragt, wie sie ihre Fahrschulausbildung erlebt haben. Ehemalige Fahrschüler, die fahrängstlich waren oder während der Ausbildung bestimmte Schwierigkeiten hatten, berichteten übereinstimmend Folgendes: Wenn es Probleme gab, wurden immer wieder bestimmte Verkehrssituationen geübt, z. B. Anfahren am Berg oder Fahrstreifenwechsel. Manchmal waren bis zur Fahrprüfung 60 bis 80 und mehr Stunden nötig. Das kostet viel Geld, macht das Lernen schwer und ist nicht besonders effektiv, wenn letztlich ganz andere Ursachen dahinterstecken, etwa eine soziale Phobie.
Natürlich werde ich beim Autofahren sicherer, wenn ich „überlerne“, d. h. einen bestimmten Vorgang immer und immer wieder übe. Aber welch ein enormer Zeitaufwand ist dafür nötig! Wie viele Frustrationen, wie viele unsichere und gefährliche Situationen muss ich ertragen, nur weil das wirkliche Problem nicht erkannt wurde?
Das Problem von Autofahrern und Fahrschülern sind oft nicht Fahrfehler, Unvermögen oder Ungeschicklichkeit, sondern dass sie bei Fehlern (die alle Anfänger machen!) und möglicher Kritik in Angst geraten, „kopflos“ reagieren. Vielleicht hat ein Autofahrer früher einen Unfall erlitten, bringt aber plötzlich auftretende Angstsymptome nicht bewusst mit der Situation von damals in Verbindung. Vielleicht fäht eine Autofahrerin sehr gut, hat aber große Angst vor Konflikten und fängt an, unsicher zu fahren, wenn sie von ihrem Beifahrer kritisiert wird.
|19|Wüssten die Fahrschüler, die Fahrlehrer, die Autofahrer oder Beifahrer, was sich hinter vermeintlichen Fahrfehlern und Unsicherheiten verbirgt, könnten sie viel zielgerichteter üben. Dazu kann es sogar notwendig sein, eine Fehlersituation nicht nur nicht zu vermeiden, sondern sie sogar absichtlich herbeizuführen. Mit dem Fahrschüler zu vereinbaren, dass er vorsätzlich zehnmal am Berg das Auto abwürgen soll, oder dass er sich eine Fahrstunde lang möglichst kritisieren lässt – zunächst natürlich sanft und „für nichts und wieder nichts“. Die Probleme können dann schneller, bzw. überhaupt erst, gelöst werden. Die Betroffenen können lernen, mit ihren Ängsten und den sie belastenden Situationen gelassener umzugehen und ihr wirkliches Geschick beim Autofahren zu zeigen. Vorausgesetzt, sie selbst, ihre Fahrlehrer oder ihre Partner erkennen die eigentlichen Ängste und Unsicherheiten und können diese zu bewältigen versuchen. Es würden viel Kummer, Geld und Zeit gespart.
1.2 Herzrasen, Schwindel, Luftnot. Horror Autobahn
Panikattacken und Agoraphobie
Die betroffenen Fahrer und Beifahrer haben panische Angst davor, beim Autofahren einen Anfall zu erleiden. Sie haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, plötzlich ohnmächtig oder verrückt zu werden oder zu sterben (Herzinfarkt, Hirntumor, Ersticken). Dazu tritt ein starker Drang auf, die Situation, in der man sich befindet, fluchtartig zu verlassen, um im Notfall schnell zu Hause, beim Arzt oder im Krankenhaus sein zu können. Besonders Autobahnen werden gemieden, da man nicht unmittelbar abfahren, stehenbleiben oder umkehren kann wie auf anderen Straßen und man gezwungen ist weiterzufahren.
Weite Plätze, Menschenmengen, Autobahnen, Staus, öffentliche Verkehrsmittel und größere Entfernungen von Zuhause werden gemieden, ebenso das Alleinsein und das allein Fahren. Viele Betroffene fahren nur noch in Begleitung, aus Furcht, hilflos einem vielleicht lebensbedrohlichen Anfall ausgeliefert zu sein. Die Gedanken und die Angst vor einem erneuten Anfall sind ständige Begleiter. Medizinische Untersuchungen blieben ohne Ergebnis.
|20|Wenn einige dieser Punkte und Symptome auf Sie zutreffen, leiden Sie vermutlich unter einer Panikstörung und Agoraphobie. Die beschriebenen Symptome sind nicht eingebildet und können sehr quälend sein. Sie sind aber die Folge der Panik und nicht die Folge einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Die frohe Botschaft: Ihr Leben ist nicht in Gefahr! Mir ist kein inneres Organ bekannt, das von sich aus zuverlässig erkennt, ob Sie sich auf einer Autobahn, in einer Menschenmenge, allein und/oder weit weg von Zuhause befinden, um genau dann Herzrasen, Schwindelattacken oder Luftnot zu entwickeln. Die nicht so frohe Botschaft: Diese Attacken sind für die Betroffenen quälend und fühlen sich oft schlimmer an als eine organische Erkrankung.
1.3 Angst vor Kritik, Beobachtung, Fehlern und Blamage
Nach einer Kritik der Fahrlehrerin oder eines Beifahrers sind Sie so verunsichert, dass oft gar nichts mehr geht. Die Blicke und die Beobachtung durch andere Menschen versetzen Sie in Spannung und Angst. Der Fahrprüfung gehen schlaflose Nächte voraus, die Prüfung selbst wird als Horror erlebt, „kopflos“ passieren Fehler, und manchmal muss die Prüfung abgebrochen werden. Viele meiden wegen ihrer Unsicherheit und der Angst vor Konflikten das Autofahren ganz, überlassen lieber der Partnerin oder dem Partner das Steuer. Die befürchtete Kritik, Konflikte, der Ärger anderer Autofahrer, die Scham wegen peinlicher Körperreaktionen, wie Schwitzen, Harndrang, Zittern oder Erröten, sind zu „stressig“. Wenn einige dieser Punkte auf Sie zutreffen, leiden Sie möglicherweise unter einer Sozialen Phobie.
Soziale Ängste/Soziale Phobie
Menschen mit dieser Angststörung haben eine übermäßige Angst vor negativen Bewertungen durch andere, das erstreckt sich auch auf das Autofahren. Sie trauen sich das Fahren nicht zu, befürchten, sich zu blamieren, geraten bei Fehlern, Kritik oder in schwierigen Verkehrssituationen in Anspannung oder Panik. Manche fürchten auch die begleitenden körperlichen Angstsymptome wie Schwitzen, Rotwerden, Zittern oder den Drang, |21|zur Toilette gehen zu müssen, also werden die entsprechenden Situationen gemieden. Manche begeben sich in medizinische Behandlung, weil sie meinen, nur das Schwitzen, das Zittern oder das Erröten sei ihr Problem.
1.4 Angst vor Parkhäusern, Tunneln und Staus
Klaustrophobie
Menschen, die unter einer Klaustrophobie leiden (Angst vor Enge, Eingeschlossen sein), fürchten Tunnel, enge Baustellen, Parkhäuser, die Nähe großer Lastwagen und Staus auf der Autobahn. Sie fühlen sich beengt und unwohl, wenn mehrere Menschen mit im Auto sitzen und achten in diesen Situationen auf Fluchtmöglichkeiten. Vor Reisen und vor längeren Fahrten werden weite Umwege geplant, um Tunnel zu vermeiden. Manche schnallen sich im Auto nicht an und riskieren damit ihr Leben.
Die Symptome erstrecken sich meist auch auf andere Bereiche: fensterlose Räume, Untersuchung in einem Kernspingerät, Fahrstühle, Aufenthalt mit vielen Menschen in einem Raum usw. Prüfen Sie sich mit Hilfe der Checkliste 1 in Anhang 2, und lesen Sie weiter bei Kap. 5.4. Manchmal können solche Ängste auch Anzeichen einer Panikstörung und Agoraphobie sein. Klaustrophobe Reaktionen treten oft zusammen mit Panikattacken auf. Gemeinsam ist beiden Angststörungen der starke Fluchtreflex in Situationen, die man tatsächlich oder vermeintlich nicht sofort verlassen kann.
Allerdings sind leichtere Ängste und eine hohe Anspannung bei Fahrten durch einen längeren Tunnel nicht ganz ungewöhnlich. Etwa die Hälfte aller Autofahrer gibt an, Angstgefühle in dieser Situation zu haben (siehe auch Kap. 2.3).
1.5 Vermeiden von Brücken und Bergfahrten
Höhenangst – Akrophobie, Brückenphobie
Brücken, hohe und offene Parkhäuser, Fahrten in die Berge, an steilen Abhängen entlang oder steile Abfahrten lösen starke Angstsymptome aus und |22|werden nach Möglichkeit gemieden. Neben dem Autofahren sind bei der Höhenphobie auch andere Lebensbereiche betroffen: Höhere Gebäude, offene Fahrstühle, der Blick aus höher gelegenen Fenstern, die Benutzung von Leitern werden gemieden. Ähnlich wie bei Phobien vor Tunneln werden mitunter lange Umwege geplant und auf sich genommen.
Es gibt auch, eher seltener, reine Brückenphobiker, z. B. mit der übermäßigen Angst, die Brücke könnte beim Darüberfahren einstürzen, oder man würde unwiderstehlich in die Tiefe gezogen. Nach meiner Praxiserfahrung treten Brücken- und Höhenphobie jedoch meist gemeinsam auf.
Menschen, die Höhenängste und die damit verbundenen Schwindelgefühle haben, leiden manchmal gleichzeitig unter Panikattacken und Agoraphobie. Überprüfen Sie sich zusätzlich mit Checkliste 1 in Anhang 2 und lesen Sie weiter in Kap. 5.4.
1.6 Ein Leben voller Sorgen und Gefahr – generalisierte Angst
Generalisierte Angst
Menschen mit dieser Angststörung befinden sich fast ständig in Anspannung und Angst, machen sich über alles Sorgen, befürchten mögliche Katastrophen in jeder Lebenslage, ihnen und ihrer Familie könnte etwas Schreckliches zustoßen. Man spricht hier von generalisierter Angst. Auch das Autofahren erleben sie in der Angst, ihnen selbst oder ihren Angehörigen könnte ein Unfall passieren. Das Steuer wird dem Partner überlassen, um die Verantwortung abzugeben, falls etwas passiert. Als Beifahrer machen sie den Fahrer auf alle möglichen Gefahren aufmerksam. Ist ein Familienmitglied mit dem Auto unterwegs, wird es – während der Fahrt – mit zahlreichen Handyanrufen traktiert, ob noch alles in Ordnung ist.
Im Alltag dominieren ebenfalls Katastrophenerwartungen, einem selbst oder den Angehörigen könne etwas Schreckliches zustoßen. Körperliche Symptome bei sich selbst und den Angehörigen sind Anzeichen einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die Kinder im Jugendalter könnten, |23|wenn sie das Haus verlassen, vergewaltigt werden, einen Unfall erleiden oder Rauschgiftsüchtige treffen. Bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei dem Besuch von Veranstaltungen droht ein Terroranschlag. Verhindern lässt sich das vermeintlich nur, wenn man die Angehörigen beständig und drastisch auf diese Gefahren aufmerksam macht und sich endlos rückversichert. Am besten wäre es, wenn alle das Haus/die Wohnung gar nicht erst verließen. Konsequent werden daher viele solcher Situationen nach Möglichkeit gemieden oder dem Partner, den Kindern mit drastischen Schilderungen der Gefahren auszureden versucht.
1.7 Kontrolle, Kontrolle – die Zwangsstörung
Zwangstörung
Sie tritt nicht ganz so häufig auf, wie die bereits genannten Angststörungen. Die Betroffenen leiden unter Zwangshandlungen und/oder Zwangsgedanken. Das sind aufdringliche, quälende und sich stereotyp wiederholende (Kontroll-)Handlungen und Gedanken, mit denen die Betroffenen einen vermeintlichen Schaden oder Unheil bei sich oder anderen abzuwehren versuchen.
Menschen mit einem Waschzwang werden z. B. von dem Gedanken und der Furcht beherrscht, sie könnten sich oder andere infiziert haben. Manche trauen sich nicht aus dem Haus, ohne viele Male alle Lichtschalter, Wasserhähne und die vermeintlich nicht verschlossene Tür kontrolliert zu haben. Bei manchen setzt sich der Gedanke fest, sie könnten ein Auto beschädigt oder einen Menschen angefahren haben, obwohl nichts geschehen ist. Diese Zwangsgedanken können so aufdringlich sein, dass die Betroffenen wieder und wieder zurückfahren, um zu kontrollieren, ob wirklich nichts geschehen ist. Generell ist beim Fahren der Blick eher in den Rückspiegel als auf die Straße gerichtet, aus Angst, man hätte einen Schaden verursacht oder jemanden angefahren.
Zwänge schränken immer sehr stark auch andere Lebensbereiche ein und können nur verhaltenstherapeutisch, ergänzend auch medikamentös, behandelt werden. Beim Autofahren hindern sie die Betroffenen da|24|ran, sich auf das Fahren und den Verkehr zu konzentrieren, und schränken damit auch die Sicherheit stark ein.
1.8 Ängste und Traumatisierung nach einem Unfall
Eine große Gruppe Fahrängstlicher bilden die Menschen mit Phobien und Ängsten nach einem Unfall. Die Belastungen und Folgen eines Unfalls sind für etwa ein Drittel der Unfallopfer so stark, dass man von einerposttraumatischen Belastungsstörung spricht. Das gilt für Menschen, die selbst in einen Unfall verwickelt waren oder einen Unfall miterleben mussten. Die Betroffenen haben oft Albträume, leiden unter Schlaflosigkeit, Schreckhaftigkeit und durchleben bestimmte Momente dieser schrecklichen Situation immer wieder (sogenannte Flashbacks).
Phobien und Ängste nach einem Unfall
Das Fahren und der Verkehr werden als bedrohlich erlebt und häufig ganz gemieden. Als Folge von Unfällen kommt es in speziellen Situationen, die an die Umstände beim Unfall erinnern, zu Anspannungs- und Angstgefühlen: z. B. hohe Geschwindigkeiten, rote Ampeln, unübersichtliche Kreuzungen, die Engegefühle, als man eingeklemmt war, laute Knirschgeräusche, Lastwagen, an denen man dicht vorbeifährt, die Farbe eines Autos. Den Betroffenen selbst muss das nicht immer bewusst sein! Auch als Beifahrer fallen Menschen mit Unfallängsten durch ihre Anspannung und Schreckhaftigkeit auf.
1.9 Ängstlich und unsicher – Fahrangst und Fahrphobie
Fahrangst und Fahrphobie
Bestimmte Ängste und eine mitunter hohe Anspannung beim Autofahren sind eigentlich normal. Das Fahren, unübersichtliche Verkehrssituationen, hohe Geschwindigkeiten sind ja tatsächlich potenziell gefährlich. Daneben gibt es auch spezifische Fahrängste oder sogar Fahrphobien, die nicht auf andere Angststörungen zurückzuführen sind. Wenn es aber zu übermäßigen Ängsten und einem umfassenden Vermeidungsverhalten kommt, so|25|dass das Autofahren überwiegend oder ganz gemieden wird, spricht man von einer Fahrphobie. Über die Häufigkeit der spezifischen Fahrphobie ist nichts bekannt.
1.9.1 Unsicherheit und Ängstlichkeit beim Fahren
Fahrängste an sich – zu unterscheiden von einer Phobie! – können dagegen von unterschiedlicher Intensität sein und sich nur auf bestimmte Situationen beziehen, wie hohe Geschwindigkeiten, Autobahnen, Autobahneinfahrten, beengte Situationen, etwa Baustellen und dichtes Auffahren. Das Fahren oder Mitfahren ist durchaus möglich, allerdings oft unter hoher Anspannung oder sogar in Angst.
Fahrängste und Fahrphobien treten auch als Folge und Begleiterscheinung anderer Angststörungen auf (siehe Vorwort). Allerdings stehen dann die eigentlichen Ängste im Zentrum der Behandlung und möglicher Übungen, z. B. die Angst vor vermeintlich gefährlichen Körperreaktionen, vor fehlenden Fluchtmöglichkeiten bzw. das nächste Krankenhaus nicht erreichen zu können. Sogenannte Fahr- und Verkehrsängste sind nach meiner Erfahrung meist ursächlich mit den oben aufgeführten Angststörungen, bzw. den Ängsten nach einem Unfall verknüpft. Im Falle einer sogenannten Fahrphobie sollte daher immer überprüft werden, ob sich diese vor dem Hintergrund anderer Ängste entwickelt hat.
1.9.2 Lange Fahrpausen – Wiedereinsteiger
Nicht krankhaft, aber doch sehr häufig ist die Unsicherheit und Angst nach langer Fahrpause und/oder aufgrund mangelnder Fahrpraxis. Manche Menschen sind vielleicht auch einfach überfordert angesichts der Vielzahl von Eindrücken, die im Straßenverkehr gleichzeitig und blitzschnell zu bewältigen sind, sowohl bei der Bedienung des Autos als auch bei der Bewältigung komplexer Verkehrssituationen. Sie befürchten in der Folge, die Kontrolle zu verlieren und in einen Unfall verwickelt zu werden. Wohl die Mehrzahl der Fahrschüler und Fahrschülerinnen ist nervös oder ängstlich vor und während der Fahrprüfung.
|26|Wer nach einer längeren Fahrpause und fehlender Routine zögert, sich wieder ans Steuer zu setzen und zunächst unsicher ist, reagiert normal. Der Verkehr und das Autofahren sind ja potenziell gefährlich, und sie bergen einige evolutionär nachvollziehbare „Urängste“. Zögern und Ängstlichkeit, wieder Auto zu fahren, sind also verständlich.
Hinweis
Checklisten zu Ihrem möglichen Problem finden Sie in Anhang 2. Erst die genaue Diagnose ermöglicht eine zielgerichtete Behandlung und erfolgreiches Üben.
|27|2 Das Autofahren – Auslöser und Quelle von Angst
Patienten berichten regelmäßig, dass ihre Angsterkrankung bei einer Autofahrt begonnen habe. Woran liegt es, dass manche der hier beschriebenen Ängste, die doch eigentlich ganz andere Ursachen haben, besonders und verstärkt beim Autofahren auftreten?
Eine einfache und sicher zutreffende Erklärung ist, dass das Autofahren ja tatsächlich Gefahren mit sich bringt und dass wir Menschen für die damit verbundenen Geschwindigkeiten eigentlich nicht konstruiert sind. Die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden oder einen Schaden zu verursachen, ist real. Täglich wird uns diese Tatsache über die Medien vor Augen geführt. Viele Menschen waren in ihrem Leben selbst in einen oder mehrere Unfälle verwickelt oder haben Angehörige oder Freunde, die von einem Unfall betroffen waren. Im Zusammenspiel mit Stresssituationen oder Belastungen ist das Spannungsniveau vieler Menschen beim Fahren und in bestimmten Verkehrssituationen dann auch besonders hoch. Und manchmal bringt ein kleiner Tropfen das Fass endgültig zum Überlaufen.
Eine weitere Ursache sind Reaktionen auf verschiedene „Eigenarten“ des Autos, des Fahrens und des Verkehrs, die auf unser biologisches Erbe zurückzuführen sind. Diese Faktoren können auch in anderen Lebenssituationen Ängste und Gefühle des Unwohlseins verursachen. Menschen reagieren potenziell mit Unbehagen auf Situationen der Enge (Auto, Gurt, Tunnel), wenn sie mit Menschen zu nahe beisammen sein müssen oder sich aus nächster Nähe beobachtet fühlen (Beifahrer, Fahrlehrer), wenn sie sich ihrer Fluchtmöglichkeiten beraubt sehen (Autobahn, Stau), wenn sie weit weg von ihrer vertrauten Umgebung sind (weite Reisen, fremde Orte), wenn sie hohen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind (Gefahr, Schwindelgefühle), wenn sie Fehler machen (passiert häufig beim |28|Fahren), oder wenn sie befürchten, in Konflikte zu geraten (andere Autofahrer, Beifahrer, Polizei). Zudem gibt es viele Menschen, die als Beifahrer unter Symptomen der Reisekrankheit, wie Schwindel und Übelkeit, leiden. Menschen, die sich bei solchen Symptomen übermäßig ängstlich selbst beobachten, z. B. bei einer Panikstörung und Agoraphobie, können dann auf solche alltäglichen und harmlosen Beschwerden mit Panikattacken reagieren.
Das Auto selbst, das Fahren, der Straßenverkehr und das Reisen vereinen einige potenziell Stress und Angst auslösende Faktoren, die auch zu unserem evolutionärem Erbe gehören und unser Leben schützen: u. a. Höhen, beengte Situationen und fehlende Fluchtmöglichkeiten, übermäßige Körperreaktionen und die Angst, die Zuneigung anderer zu verlieren oder gar nicht erst zu gewinnen, aus der Gemeinschaft ausgegrenzt zu werden. Und wir fürchten uns zurecht davor! Es ist also nicht verwunderlich, dass sich krankhafte Ängste gerade beim Autofahren entwickeln bzw. ausgelöst werden bzw. können.
2.1 Ängste beim Autofahren – ein Tabuthema?
Angst vor dem Autofahren war lange Zeit ein gesellschaftliches Tabuthema. Zum Zeitpunkt seiner Erstauflage war dieses Buch das erste zu diesem Thema, während es über Flugangst und deren Behandlung mindestens ein Dutzend Bücher gab. Ängste beim Autofahren wurden kaum untersucht oder publik gemacht.
Inzwischen hat sich das glücklicherweise geändert, u. a. nachdem sich zahlreiche Fahrschulen auf dieses Thema und das entsprechende Klientel spezialisiert haben. Leider mit einem irreführenden Nebeneffekt: Das Thema wird medial, von Verkehrspsychologen und von Fahrlehrern überwiegend unter dem Titel „Fahrangst“ und „Fahrphobie“ verhandelt. Das führt bei der Mehrzahl der Betroffenen jedoch völlig an den eigentlichen Problemen und Ursachen vorbei und macht zielgerichtete Hilfen in vielen Fällen erst gar nicht möglich.
Viele Menschen, die wegen Panikattacken oder anderen krankhaften Angststörungen in psychotherapeutischer Behandlung sind, werden |29|auch dort nur unzureichend behandelt. Nach meiner Kenntnis (informelle Umfrage) wird das Thema Angst beim Autofahren und die damit einhergehenden, oft massiven Einschränkungen eher beiläufig mitbehandelt, obwohl es für zahlreiche Betroffene mit der wichtigste Grund ist, überhaupt eine Therapie zu beginnen. Die erforderlichen Expositionsübungen „in vivo“ (also Übungen beim Autofahren unter realen Bedingungen) unter Begleitung der Therapeutin und/oder eines Fahrlehrers finden nur in den wenigsten Fällen statt.
In den Fahrschulen fallen meist nur prüfungsängstliche Fahrschüler auf, oder man ist verwundert und ungeduldig, wenn nach Fehlern gar nichts mehr läuft. Ängste werden in der Regel nicht erkannt und schon gar nicht in die Fahrschulausbildung einbezogen. Die Einschätzung lautet dann eher: „Der/die lernt es nie.“ Die soziale Umgebung bezeichnet die Betroffenen eben als schlechte Autofahrer bzw. Autofahrerinnen, und die Betroffenen selbst sehen es oft nicht anders.
Immer wieder erzählen mir Patienten, sie schämten sich für ihre Ängste, besonders auch für die beim Autofahren, und versuchten, sie zu verheimlichen. Angst vor dem Fliegen oder vor Schlangen? Kein Problem! Das kann jeder leicht zugeben; diese Ängste haben ja viele, sie gelten als normal. Aber Ängste und Unsicherheiten beim Autofahren? „Lächerlich, versteh ich nicht! Bleib einfach ruhig!“ Oder die Reaktionen bei Ängsten nach einem Unfall: „Ich fahr doch gar nicht so schnell, du brauchst keine Angst zu haben.“ Irgendwann möchte man dann gar nichts mehr sagen, schweigt lieber, fühlt sich unverstanden. Das gleiche gilt für die Angst im Auto, andere könnten die peinlichen Angstsymptome bemerken: den plötzlichen Schwindel, die Übelkeit, das Erröten, das übermäßige Schwitzen oder den plötzlichen und häufigen Drang, zur Toilette zu gehen. Wer würde das schon gerne zugeben?
Ein weiteres Problem, warum so wenig über die zugrundeliegenden Ängste beim Autofahren bekannt ist, liegt darin, dass sie weder von den Betroffenen selbst noch von ihrer Umgebung erkannt werden. Bei Panikattacken und Agoraphobie etwa richtet sich das Augenmerk von Betroffenen und Ärzten ausschließlich auf die körperlichen Angstsymptome bzw. eine vermutete organische Erkrankung. Zahlreiche, zum Teil aufwändige medizinische Untersuchungen bleiben ohne Befund, ohne zutreffende Diagnose – die Angststörung bleibt unerkannt.
|30|Gesellschaftlich werden Fehler und Unsicherheit beim Autofahren geächtet. Sie sind Anlass für Witze oder werden von Aggressionen, Ungeduld und Konflikten begleitet. Sätze wie „Die fährt wie der letzte Mensch!“ und „Der wird das Autofahren nie lernen“ sind uns allen wohlbekannt. Nicht zu vergessen die täglichen Wutausbrüche wie „Blödmann“ und „Idiot“, die Autofahrer anderen Autofahrern bei wirklichen oder vermeintlichen Fehlern hinterherrufen (auch der Autor bekennt sich hier schuldig). Wer würde unter solchen Voraussetzungen zugeben, dass er Probleme beim Autofahren hat?
2.2 Anspannung und Angst im Autofahreralltag
In Bezug auf ängstigende Situationen gibt es große Unterschiede zwischen Fahrschülern, „normalen“ Autofahrern und der großen Gruppe von Menschen mit krankhaften Ängsten. Manche Situationen, die bei der Fahrausbildung von den Betroffenen als sehr belastend erlebt werden, spielen im normalen Autofahrerleben nicht diese dominierende Rolle. Dazu gehören etwa die Reaktion auf Anweisungen, Kritik und die panische Angst, Fehler zu machen. Problemsituationen, die Autofahrer täglich unter Stress setzen, werden dagegen in der Fahrschulausbildung zum Teil wenig oder gar nicht geübt, häufig, weil es kaum Gelegenheiten dazu gibt, oft aber nur deswegen, weil dafür keine Zeit vorgesehen ist. Dies führt dann immer wieder dazu, dass Führerscheinneulinge nur unvollkommen auf schwierige Verkehrssituationen vorbereitet sind.
Dagegen leiden Menschen mit krankhaften Ängsten nicht nur in ihrem Alltag, sondern ebenso beim Fahren und als Beifahrer unter starken Ängsten, die häufig mit dem Fahren selbst nichts zu tun haben. Die Ursachen liegen in diesem Fall in der Regel woanders.
2.2.1 Was setzt Autofahrer unter Stress?
Die folgenden Situationen können Autofahrer in Stress versetzen (die Reihenfolge gibt nicht die Häufigkeit wieder):
jemand drängelt, fährt zu dicht auf,
riskante Überholmanöver,
|31|Angst auf der Autobahn: bei Autobahneinfahrten, engen Baustellen, Stau, Pannen,
Tunnel
hohe Geschwindigkeiten
Nachtfahrten, vor allem bei Regen und Nässe,
Polizeikontrollen, Polizeifahrzeuge, die vor oder hinter einem herfahren,
Motorradfahrer, die plötzlich und lautstark überholen,
Fahrten bei Eis, Schnee und Nebel.
Besonders häufig ist die Angst vor Fahrten auf der Autobahn, wo die besondere Verkehrssituation zum Weiterfahren zwingt. Ein Halt oder gar Flucht bei aufkommender Angst sind nicht immer möglich. Zudem sind die Geschwindigkeiten ungleich höher.
Die Situationen beim Fahren, die durchschnittlichen Autofahrern und Fahrschülern Stress bereiten, unterscheiden sich zum Teil erheblich. Es wäre sinnvoll, Fahrschüler noch besser auf diese und andere Situationen vorzubereiten, die im späteren Autofahrerleben Stress und Probleme bereiten: z. B. Fahrten bei Dunkelheit, bei Nässe und bei Schnee, das Überholen auf zweispurigen Straßen, plötzliche Bremsmanöver und das Alleinfahren (wie bei der Motorradausbildung).
2.2.2 Was verunsichert Fahrschülerinnen und Fahrschüler?
Folgende Punkte sind für viele Fahrschüler besonders problematisch und führen zu Unsicherheit und Angst:
die praktische Fahrprüfung,
die erste Fahrstunde,
Fahrstreifenwechsel, links abbiegen, große Kreuzungen,
dichter Verkehr,
Autobahneinfahrten, Autobahn, schnelles Fahren,
Anweisungen, Korrekturen und Kritik der Fahrlehrerin,
eigenständige und eigenverantwortliche Entscheidungen,
Einparken.
|32|Diese Einschätzung ergab sich aus der Befragung von Fahrschülern, ehemaligen Fahrschülerinnen und Fahrschullehrern. Die Aufzählung ist nicht unbedingt repräsentativ, gibt aber eine Tendenz wieder. Die meisten Fahrlehrer haben berichtet, dass die erste Fahrstunde, die ersten Autobahnfahrten, unübersichtliche Verkehrsverhältnisse und die Fahrprüfung bei fast allen Fahrschülern größeren Stress verursachten. Unsicherheit und Anspannung in diesen Situationen sind also durchaus normal. Dennoch sollte stets mitbedacht werden, dass hinter all diesen genannten Problempunkten und den entsprechenden Fahrunsicherheiten immer auch grundlegendere Ängste, erlittene Unfälle, Panikattacken oder soziale Ängste verborgen sein können.
2.3 Wie häufig sind Ängste beim Autofahren?
In der Süddeutschen Zeitung (Harloff, 2015) wird der ADAC genannt, der von ca. 1 Million Betroffener ausgeht. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um reine Fahrängste oder um Phobien handelt. Die Zahl wird durch keine Studie oder Umfrage belegt. In einer Forsa-Umfrage von 2016 gaben 9 % der Befragten an, als Fahrer oder Beifahrer Angst vor dem Autofahren zu haben (zitiert bei CosmosDirekt, 2020). Umgerechnet wären das ca. 7 Millionen Menschen in Deutschland.
Allein die Zahl der Menschen, die unter einer der eingangs genannten Phobien leiden, ist um ein Mehrfaches höher, als die vom ADAC angegebene Zahl Nach Schätzung des Autors sind mindestens drei bis vier Millionen Menschen in Deutschland im Verlaufe ihres Lebens von z. T. massiven Ängsten beim Autofahren betroffen. Viele der Betroffenen leiden nicht nur als Fahrer, sondern auch als Mit- und Beifahrer unter starken Ängsten beim Autofahren.
Aus den im Folgenden genannten Daten für die verschiedenen Angststörungen aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, lassen sich grobe Schätzwerte ableiten, wie viele Menschen gleichzeitig unter Ängsten beim Autofahren leiden. Der unten gebrauchte Begriff der 12-Monatsprävalenz bezieht sich darauf, wieviel Prozent der Bevölkerung im Verlaufe eines Jahres an einer dieser Phobien erkranken. Bezogen auf die Bevölkerungszahl, die 2019 in Deutschland bei ca. 83 Millio|33|nen lag, ergeben sich daraus grobe Schätzwerte für die genannten Angststörungen. Die Angaben der einzelnen Untersuchungen weichen zum Teil voneinander ab; ich habe jeweils nur die Mittelwerte bzw. die untersten Werte angenommen.
Panikstörung und Agoraphobie: Die 12-Monatsprävalenzen werden für die Panikstörung mit 2 % und für die Agoraphobie mit 4 % (Angenendt et al., 2019, S. 447) angegeben. Da diese Störungen meist gemeinsam auftreten, kann man von mindestens zwei bis drei Millionen Betroffenen ausgehen.
Aus der Praxiserfahrung und den Ausführungen in Fachbüchern ergibt sich, dass die Mehrzahl davon zugleich an starken Ängsten beim Autofahren leidet (Bandelow, 2004). Ich selbst habe in meiner Praxis in den letzten fünfzehn Jahren 182 Patienten mit den Diagnosen Panikstörung und/oder Agoraphobie behandelt. Davon hatten 159 Patienten, also 87 %, gleichzeitig starke Ängste auch beim Autofahren. Das heißt, bei vorsichtiger Schätzung kann man von etwa 1,5 Millionen Betroffenen ausgehen, die aufgrund der Diagnosen Panikstörung und Agoraphobie gleichzeitig auch unter übermäßigen Ängsten beim Autofahren leiden.
Traumatisierung und Ängste nach Unfällen: Im Jahr 2019 gab es 2,7 Millionen polizeilich erfasste Verkehrsunfälle, dabei wurden 384.000 Personen verletzt und etwa 3.059 getötet (Trapmann in Stuttgarter Nachrichten, 28.02.2020).
„Nach bisherigen Untersuchungen (...) ist wahrscheinlich mit psychischen Beeinträchtigungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen und (...) Vermeidungsverhalten bei bis zu einem Drittel der Verletzten zu rechnen“ (Frommberger, Nyberg, Angenendt, Lieb & Berger, 2004; S. 718). Dazu kommen die vielen Beifahrer und Fahrer, die körperlich nicht verletzt wurden, sowie die betroffenen Zuschauer und Helfer bei Unfällen – all diese Menschen werden häufig ebenfalls traumatisiert oder leiden danach unter phobischen Reaktionen in Bezug auf Autofahren und Verkehr. In einer Untersuchung wurde ermittelt, dass etwa 25 % der Bevölkerung Zeugen eines Unfalls waren und bei 7 % davon, d. h. über einer Million Menschen, das Risiko bestand, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken (Freyberger, Spitzer & Barnow, 2003).
Posttraumatische Belastungsstörungen und die Ängste nach einem Unfall belasten die Betroffenen oft über Jahre, manchmal ein ganzes Le|34|ben lang. Nimmt man hier die Population eines Fünf-Jahres-Zeitraums an, kommt man auf über eine Million Betroffene.
Generalisierte Angststörung: Bei einer Studie mit 18.000 Hausarztpatienten wurde festgestellt, dass 1,3 % von ihnen unter einer schweren generalisierten Angststörung litten, d. h. sie erfüllten sämtliche Diagnosekriterien (Siegl & Reinecker, 2004). Angenendt et al. gehen von einer Prävalenz von 2,2 % aus (Angenendt et al., 2019, S. 447). Hochgerechnet sind damit in Deutschland mindestens ein bis zwei Millionen Menschen von dieser Störung betroffen. Bei fast allen – ob als Fahrer oder als Beifahrer – treten diese Ängste auch in Bezug auf das Autofahren auf, dabei oft sogar besonders stark.
Soziale Ängste und Phobien: Wissenschaftliche Studien schätzen den Anteil von Betroffenen, die unter einer sozialen Phobie leiden, auf 3 bis 4 % (Stangier, Clark & Ehlers, 2006). Andere Autoren zitieren Studien, die sogar von einer Jahresprävalenz von ca. 8 % ausgehen (Alsleben & Hand, 2006) – das wären in Deutschland mehr als 6 Millionen Menschen. Ca. 2 % der Bevölkerung empfinden ihre sozialen Ängste als so schwerwiegend, dass sie sich in Behandlung begeben (Juster, Brown & Heimberg, 1996). Allerdings lässt sich bei sozialen Ängsten nur schwer sagen, inwieweit sich diese auch auf das Autofahren auswirken, da sehr verschiedene Bereiche und Verhaltensweisen betroffen sein können. Deshalb lassen sich hier kaum Schätzwerte angeben. Allerdings dürfte die Zahl der Betroffenen, die auch beim Autofahren bzw. in Gegenwart anderer Menschen (andere Autofahrer, Beifahrer) unsicher und ängstlich reagieren, hoch sein.
Eine größere Gruppe von Menschen leidet zwar nicht unter einer krankhaften sozialen Angst, ist aber generell unsicher und sozial etwas ängstlich. Es wird geschätzt, dass sich mindestens 20 % der Gesamtbevölkerung durch Sozialängste beeinträchtigt fühlen (Pfingsten, 2005). In den speziellen Fahrschulen für Fahrängstliche und bei den sogenannten „Wiedereinsteigern“ überwiegt vermutlich die Zahl der Menschen, die zur Gruppe der sozial ängstlichen und unsicheren Autofahrer gehören; die Mehrzahl von ihnen sind Frauen (Bäricke, 2006).
Klaustrophobie und Höhenphobie: Etwa 7 bis 8 % der Bevölkerung leiden unter einer Klaustrophobie (Öst, 2006). Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass bei den meisten der Betroffenen auch mehr oder weniger |35|starke Ängste in Tunneln auftreten. In Autorevue online wird eine repräsentative Umfrage der Prüforganisation Dekra zitiert, nach der 36 % der Männer und 67 % der Frauen angeben, Angstgefühle in Tunneln zu haben (Autorevue online, 05.03.2016). Die Gründe dafür können unterschiedlich sein: Die Angst vor dem Eingeschlossensein, der langen dunklen Röhre, die Befürchtung, man könne eine Panne haben, oder es könne ein Feuer ausbrechen.
Die Höhenphobie (Akrophobie) ist ebenfall weit verbreitet (Öst, 2006). In der Süddeutschen Zeitung wird eine Studie des französische Angstforschers C.Andre zitiert, nach der 20 % der mitteleuropäischen Bevölkerung unter „deutlicher Höhenangst“ leiden, 5,3 % seien sogar klinisch relevant (Prantl, 2010). Vermutlich gibt es aber bei beiden Ängsten starke Überschneidungen mit anderen Phobien (z. B. Agoraphobie), zudem ist unklar, inwieweit sich diese Ängste auch auf das Autofahren erstrecken. Eine Schätzung ist deshalb schwierig. Insgesamt dürfte aber die Zahl der Betroffenen, die unter einer spezifischen Klaustrophobie oder einer Höhenphobie leiden, ebenfalls bei ein bis zwei Millionen Menschen liegen. Zum Beispiel berichten Patienten, die unter einer Klaustrophobie leiden, fast immer auch von starken Ängsten vor Tunneln, Parkhäusern und Staus auf der Autobahn.
„Reine“ Fahrphobie (Amaxophobie): Schließlich lösen auch das Auto selbst, das Fahren und verschiedene Verkehrssituationen massive Ängste aus, und bestimmte Situationen oder das Autofahren an sich werden vermieden. Zahlenangaben darüber gibt es nicht, aber auch hier dürfte die Zahl der Betroffenen hoch sein.
Man kann diese Zahlen nun nicht einfach zusammenrechnen, da sich häufig Überschneidungen zwischen den genannten Angststörungen ergeben. Viele der Betroffenen zeigen „Mischformen“, sind gleichzeitig von mehreren Ängsten betroffen. Zum Beispiel ist eine Panikstörung oft mit sozialen Ängsten verbunden: Die körperlichen Angstsymptome werden nicht nur als lebensbedrohlich bewertet, sondern man empfindet sie auch als überaus peinlich, wenn sie von anderen bemerkt werden können. Klaustrophobie und der damit verbundene Fluchtreflex treten ebenfalls oft gemeinsam mit Panikattacken und einer Agoraphobie auf. Oder: Die Umstände und Angstreaktionen im Zusammenhang mit einem Unfall können nach meinen Erfahrungen noch Jahre später mit dazu beitra|36|gen, dass sich andere Angsterkrankungen entwickeln, etwa eine Panikstörung.
Grob geschätzt sind also in Deutschland mindestens drei bis vier Millionen Menschen eine Zeitlang oder dauerhaft wegen einer der genannten Phobien auch beim Autofahren erheblich eingeschränkt oder entwickeln deswegen zusätzlich Fahrängste. Viele der Betroffenen leiden beim Autofahren, als Fahrer oder Beifahrer, unter Panik oder starken Ängsten, viele meiden bestimmte Strecken (Autobahnen, weite Entfernungen) und schließlich das Fahren ganz.
Dazu kommt eine ebenfalls große Gruppe von Menschen mit leichteren Ängsten, Menschen, die in bestimmten Situationen beim Fahren unsicher, ängstlich und mit wenig Selbstvertrauen reagieren. Das betrifft u. a. Fahrschüler, viele Beifahrer sowie Menschen, die nach langer Fahrpause oder aufgrund mangelnder Fahrpraxis verunsichert sind. Die immer zahlreicher werdenden Fahrschulen für Fahrängstliche belegen dies. Untersuchungen oder Zahlenangaben über reine Fahrängste gibt es bislang meines Wissens nicht und sind wohl auch schwierig zu erheben. Z. B. ist die Angst vor Autobahnen weit verbreitet. Was sich dahinter verbirgt, ist oft nur schwer zu erkennen: Ist es die Angst vor dieser Situation an sich, sind es die hohen Geschwindigkeiten, ist es die Angst, dass vermeintlich lebensbedrohliche Körperreaktionen auftreten könnten, sind es klaustrophobe Reaktionen, d. h. die Angst, dieser Situation nicht entfliehen zu können, ist es eine generalisierte Angst oder die Angst, sich oder seinen Angehörigen einen Schaden zuzufügen?
Insgesamt deuten die genannten wissenschaftlichen Studien das Ausmaß an, wie verbreitet Ängste beim Autofahren sind. Erstaunlich, dass zu diesem Thema keine konkreten Untersuchungen existieren!
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Die Ängste im Auto und beim Fahren haben mit dem Autofahren an sich oder dem fahrerischen Können der Betroffenen ursächlich meist wenig zu tun. Das heißt, man sollte korrekterweise in vielen Fällen, in denen sich eine bestimmte Angststörung auch auf das Autofahren auswirkt, nicht von einer Fahrangst oder Fahrphobie sprechen. Wenn ich eine krankhafte Angst vor Spinnen habe und deswegen nicht in den Keller gehe, habe ich keine Kellerphobie, sondern eine Spinnenphobie.
|37|Allerdings können diese Ängste – die zum Teil massiv sind – die Konzentration, das Fahrvermögen und die Fahrsicherheit beeinflussen. Das wiederum führt dann zu einer gesteigerten Unsicherheit beim Autofahren, der Angst vor einem möglichen Kontrollverlust und damit unter Umständen auch zu Fahrängsten.
Wissenswert an den dargestellten Untersuchungsergebnissen ist zudem, dass bei den meisten der genannten Phobien der Anteil der Frauen deutlich höher ist als derjenige der Männer. „Das Verhältnis von Frauen zu Männern wird auf mindestens 2:1 geschätzt. Insbesondere die Agoraphobie weist mit 80 – 90 % einen hohen Anteil von Frauen gegenüber Männern auf.“ (Angenendt et al., 2019, S. 447) Das entspricht auch der Tatsache, dass es überwiegend Frauen sind, die wegen krankhafter Ängste in psychotherapeutische Praxen kommen oder sich wegen der damit verbundenen Fahrängste in speziellen Fahrschulen und Autoclubs für Fahrängstliche anmelden. Allerdings kann Letzteres auch daran liegen, dass sich das Angebot z. T. ausdrücklich und überwiegend an Frauen richtet.
|39|3 Entstehung von Ängsten
3.1 Angst als Lebensretter
Für die meisten Menschen ist das Autofahren eine normale Sache. Sie wachsen damit auf und denken nicht weiter darüber nach. Als Kind war ich begeistert, wenn mich mein Vater im Auto mitnahm, beim Fahren konnte es nicht schnell genug gehen. Noch größer war meine Begeisterung, als ich, mit 17 Jahren, sein Auto in die Garageneinfahrt fahren durfte, bis zur ersten Beule! Mein Glück war vollkommen, als ich die Führerscheinprüfung bestand und später meine erste große Fahrt unternahm. Angst hatte nur meine Mutter. Doch so selbstverständlich unser Verhältnis zum Auto und zum Autofahren erscheint, ist es nicht!
Als Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Autos mit Benzinmotor entwickelt wurden und über Land fuhren, löste das bei vielen Menschen Angst und Schrecken aus. Auf alten Bildern werden Szenen gezeigt, in denen Menschen mit schreckverzerrten Gesichtern vor den herannahenden Automobilen flüchten. Die Geschwindigkeit der ersten Autos betrug damals höchstens 20 bis 30 Stundenkilometer!
Solche Ängste empfinden wir in der Regel heute nicht mehr, weil wir mit dem Autofahren, mit der Geschwindigkeit, mit Flugzeugen und dem Fliegen groß geworden sind. Wir gehen schon als Kinder mit den Produkten der technischen Entwicklung um und haben uns von klein auf an sie gewöhnt. Erst wenn wir aus irgendwelchen Gründen Angst entwickeln, fangen wir an, darüber nachzudenken. Dabei ist die Angst vor großen Höhen, vor zu großer Geschwindigkeit, vor Dunkelheit, vor Gewalt zum Teil angeboren und durchaus sinnvoll.
|40|Im Laufe unserer Entwicklung lernen wir, mit diesen Ängsten umzugehen, wir „adaptieren“. Dabei lernen wir auch, mit möglichen Gefahren angemessen umzugehen. Angst ist eine wichtige biologische Einrichtung unseres Körpers, die im Laufe der Evolution unser Überleben gesichert hat und das Leben des Einzelnen schützt. Es ist wichtig, den Blick auf diese überlebensnotwendigen Funktionen der Angst zu richten.
Beispiel