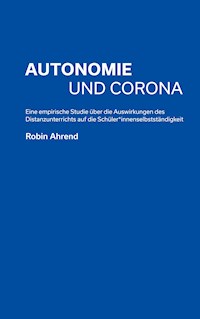
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Autonomie und Corona ist eine Studie, die die Auswirkungen des pandemiebedingten Distanzunterrichts auf die Selbstständigkeitsentwicklung von Schüler*innen einer rheinland-pfälzischen Gesamtschule untersucht. Hierzu wurden Schüler*innen der Jahrgangsstufe 7 einzeln zu ihrem schulischen Lernen außerhalb des Präsenzunterrichts befragt. Autonomie und Corona gibt darüber hinaus einen theoretischen Einblick in die historische Entwicklung des pädagogischen Autonomiekonzeptes, sowie Ansätze zur schulischen und familiären Autonomieförderung. Da sich die Studie der qualitativen Inhaltsanalyse als Forschungsmethode bedient, gibt Autonomie und Corona ebenfalls einen detaillierten Einblick in diese Form der empirischen Sozialforschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robin Ahrend studiert Englisch und Biologie für das Gymnasiallehramt an der Universität Koblenz-Landau.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Entwicklung des Autonomiekonzepts
1.1 Das Konzept von Autonomie im antiken Griechenland
1.2 Die aufklärerische Idee der individuellen Autonomie
1.3 Autonomie in der Pädagogik der Moderne
1.4 Reformpädagogische Ansätze zur Autonomie
1.5 Pädagogische Autonomie im Dritten Reich
1.6 Die Autonomiediskussion seit 1945
Zeitgenössische Erziehungs- und Bildungsansätze personaler Autonomie
2.1 Autonomieförderung im familiären Kontext
2.2 Autonomieförderung im schulischen Kontext
Methodologie empirischer Sozialforschung
3.1 Leitfadeninterviews
3.2 Datensicherung: Audioaufnahme und Transkription
3.3 Stichprobenziehung und Befragung von Minderjährigen
3.4 Qualitative Inhaltsanalyse
Darstellung der Forschungsergebnisse: Schüler*innenautonomie im Distanzunterricht
4.1 Deskription und Analyse der Forschungsergebnisse
4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
4.3 Reflexion der Methode
Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
Einleitung
Durch den Nachweis der ersten Erkrankung mit dem Virus SARS-CoV-2 in Deutschland am 27. Januar 2020 begann eine gesellschaftliche Krise mit weitreichenden Folgen für nahezu alle Bereiche der Gesellschaft. Durch das nicht absehbare Entwicklungsgeschehen der Infektionszahlen verfügten die Landesregierungen der Bundesländer, auf Rat der Kultusministerkonferenz, landesweite Schulschließungen ab dem 13. März 2020. Die Schulschließungen führten dazu, dass klassischer Schulunterricht, sogenannter Präsenzunterricht, durch andere Lernformen mittels digitaler Medien ersetzt und in den Distanzunterricht nach Hause verlagert wurde (vgl. Fickermann & Edelstein, 2020, S. 10). Ein solcher Distanzunterricht, der in politischen, wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussionen häufig als „Homeschooling“ bezeichnet wird, dient zur Aufrechterhaltung der Schulpflicht und ist in der Bundesrepublik Deutschland beispiellos, so Wacker et al. (vgl. 2020, S. 80). Der Begriff ist in diesem Zusammenhang jedoch mit Vorsicht zu behandeln, da ein „Homeschooling“, wie es beispielsweise in den Vereinigten Staaten praktiziert wird, indem die Eltern die Rolle der Lehrkraft übernehmen und über Lerninhalte und -formen entscheiden, nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland verboten ist (vgl. Fickermann & Edelstein, 2020, S. 23; Klieme, 2020, S. 117). Inhalte und Methoden werden im Distanzunterricht weiterhin von den Lehrer*innen bestimmt. Lediglich der Lernort hat sich durch die Schulschließungen geändert.
Nach der Erstellung eines schulischen Hygienekonzepts konnten die Schulen in Rheinland-Pfalz am 25. Mai 2020 wieder öffnen und die Schüler*innen, erst im Wechselunterricht mit halben Klassen und nach den Sommerferien wieder im Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygieneregeln, am geregelten Schulunterricht teilnehmen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mussten die Schulen bundesweit am 16. Dezember 2020 erneut schließen. Die Schüler*innen kehrten zurück in den Distanzunterricht. Dieses Mal für einen Zeitraum von etwa drei Monaten, bis am 8. März 2021 die ersten Schüler*innen in geteilten Klassen wieder in die Schule zurückkehren konnten.
Mit der Verschiebung des Lernortes von der Schule nach Hause, haben sich die Bedingungen für das schulische Lernen grundlegend geändert. Der lehrer*innenzentrierte Anteil des Lehr-Lernprozesses trat deutlich in den Hintergrund, während schüler*innenzentriertes, selbstgesteuertes Lernen in den Vordergrund trat und den hauptsächlichen Anteil des Lernens ausmachte. Diese umfänglichen strukturellen Änderungen müssen sich zwangsläufig im Lern- und Sozialverhalten der Schüler*innen bemerkbar machen, v.a. im Hinblick auf ihre Autonomie, die ein pädagogisches Zielkonzept darstellt (vgl. Rülcker, 1990a, S. 20).
Um die Auswirkungen des durch die Schulschließungen bedingten Distanzunterrichts auf die Schüler*innenautonomie zu analysieren, wurde eine Befragung an einer rheinland-pfälzischen Gesamtschule durchgeführt. Konkreter wurden vier Schüler*innen in teilstandardisierten Interviews, durch einen Lehramtsstudierenden der Universität Koblenz-Landau, zu ihrem Lernen im Distanzunterricht befragt. Die aus den Interviews gewonnenen Aussagen dienen als Grundlage für die Erörterung der Auswirkungen des Distanzlernens auf die Schüler*innenautonomie, die anhand der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt wird. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob es während des Distanzunterrichts gelungen ist, die Schüler*innen in ihrer Autonomieentwicklung zu fördern. Die Erkenntnisse dieser Studie im Hinblick auf die Schüler*innenautonomie dienen zum einen als Orientierungspunkt für die Weiterentwicklung des Distanzunterrichts, da wiederkehrende Schulschließungen durch den globalisierten Markt, den Klimawandel und damit die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, nicht auszuschließen sind, zum anderen um die Bedeutung der Autonomieförderung für den schulischen Unterricht insgesamt hervorzuheben.
In der vorliegenden Studie wird zunächst der Begriff der Autonomie anhand seiner historischen Entwicklung chronologisch geschildert. Daran schließen sich gegenwärtige pädagogische Vorstellungen im familiären und schulischen Umfeld, wie die Schüler*innenautonomie gefördert werden kann und welche Probleme sich dabei ergeben, an. Im Anschluss daran, wird das gewählte empirische Erhebungsverfahren der Leitfadeninterviews und die Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse aus den Schüler*inneninterviews dargestellt, analysiert und diskutiert.
1. Die Entwicklung des Autonomiekonzepts
Der Autonomiebegriff zeichnet sich zunächst durch „seine Wurzellosigkeit und Unschärfe aus“, wie Seidel (2016, S. 12) anmerkt. Der Autor schreibt, dass es sich bei der Autonomie um einen philosophischen Fachbegriff handle, dem viele Menschen mit Unwissen begegnen, da er im alltäglichen Sprachgebrauch nur selten bis gar nicht auftauche. Selbst in zahlreicher Fachliteratur scheint die Verwendung des Begriffs inkonsequent und unscharf. Normalsprachliche Formulierungen, mit denen man häufiger in Kontakt tritt, sind: „über etwas selbst bestimmen, ein eigenes Leben führen, eine eigene Entscheidung treffen, die Wahl haben, sich selbst beherrschen, die Kontrolle haben/ verlieren, […] eigenständig denken, selbstständig leben, seinen eigenen Weg gehen, etwas auf seine eigene Weise tun“ (Seidel, 2016, S. 13) und so weiter. Um die Facetten der individuellen Autonomie als personale Errungenschaft in ihrer Vielschichtigkeit verstehen zu können, ist die geschichtliche Entstehung dieses pädagogischen Konzeptes von großer Bedeutung. Die folgenden Unterkapitel sollen, angefangen im antiken Griechenland, über die aufklärerischen Ideen u.a. von Kant und Rousseau, und die Reformpädagogik bis hin zur Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Vielschichtigkeit in überschaubarer Weise abbilden.
1.1 Das Konzept von Autonomie im antiken Griechenland
Bevor sich der Begriff der Autonomie als pädagogische Zielvorstellung etablierte, wurde er in einem liberal-politischen Kontext genutzt. Autonomie bezeichnete die politische Unabhängigkeit griechischer Stadtstaaten, den Poleis (πόλεις), ihre Gesetze selbst verabschieden zu können und somit autonom zu handeln. Es ging also zunächst um die Frage der politischen Freiheit selbst- oder fremdbestimmter Poleis. Daher leitet sich dieser in vielfacher Weise heute genutzte Begriff von den Worten autos (αὐτός, selbst) und nomos (νόμος, Gesetz) ab, was als sich selbst Gesetze geben übersetzt werden kann (vgl. Dietz, 2013, S. 256). Aus juristischer Perspektive ist diese ursprüngliche Definition erhalten geblieben, wenn es beispielsweise um das Selbstverwaltungsrecht von Kommunen oder Hochschulen geht, oder im Staats- und Völkerrecht, wenn von der Souveränität der Staaten die Rede ist, in dessen andere Staaten nicht intervenieren dürfen (vgl. Zoglauer, 2010, S. 11).
Erst seit dem fünften Jahrhundert vor Christus existieren schriftliche Belege über die Ausweitung des politischen Autonomiebegriffs auf den Menschen. Zwar kann man hier Platon, Sophokles, Aristoteles oder Sokrates als Repräsentanten griechischer Philosophen nennen, die den Begriff vom Stadtstaat auf das Individuum ausweiteten, dennoch ist die Vorstellung personaler Autonomie stark an staatliche Gesetze und den Begriff der inneren Freiheit gebunden (vgl. Marshall, 1996, S. 85). Sokrates charakterisiert sie beispielsweise als Grundlage menschlicher Existenz: „Das Freie ist das, was über sich selbst herrscht […] Freiheit ist Führerschaft des Lebens, Selbstherrschaft über alles, Macht“ (Dietz, 2013, S. 257). Auch wenn die revolutionären Überlegungen des antiken Griechenlands den Ansatz innerer Freiheit manifestierten, haben sie ein Autonomiepostulat losgetreten, welches in späteren Epochen von der Pädagogik wieder aufgegriffen und als unveräußerliches Recht in das Grundgesetz aufgenommen wurde. Dietz (2013) schreibt, „was im alten Athen […] begonnen hatte, erhält im 20. Jahrhundert Verfassungsrang“ (S. 257).
1.2 Die aufklärerische Idee der individuellen Autonomie
Das Konzept individueller Autonomie, das in der westlichen Zivilisation als selbstverständliches Anrecht angesehen wird, wurde zunächst durch zahlreiche geistesgeschichtliche Strömungen geformt, bevor es Einzug in einen Gesetzesentwurf fand. Als eine der prägendsten Epochen nach den griechischen Überlegungen ist hier die Aufklärung zu nennen, seit der sich die Autonomie als fundamentaler Wert in liberaldemokratischen Gesellschaften etabliert hat. Bestimmend hierfür waren u.a. die Vorstellungen des deutschen Philosophen Immanuel Kant, der den Begriff der sittlichen Autonomie zum Grundbegriff seiner Ethik und Moralphilosophie machte. Er übertrug das Modell der politischrechtlichen Selbstgesetzgebung auf den individuellen Menschen, den er als selbst gesetzgebendes, moralisches Subjekt charakterisierte (vgl. Zoglauer, 2010, S. 11f).
Für Kant ist eine Person nur dann autonom, wenn sie sich ihre universellen, moralischen Gesetze selbst auferlegt und diese wiederum nicht von äußeren Faktoren, sondern von Rationalität geleitet werden. Das bedeutet im Gegenschluss, dass eine Person dann nicht autonom ist, also heteronom bestimmt wird, wenn ihre Entscheidungen und Handlungen von Faktoren wie politischen und religiösen Autoritäten, Konventionen, Zwängen oder sogar den eigenen Wünschen beeinflusst werden (vgl. Taylor, 2017). Um rational im Sinne Kants zu handeln, muss das menschliche Individuum nach allgemeingültigen Regeln leben, die unabhängig von den eigenen Wünschen, für alle gleichermaßen gültig sind. Diese Forderung drückt Kant in allgemeiner Form durch einen seiner kategorischen Imperative aus: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant, 1870, S. 44). Entscheidet sich jemand nach einer bestimmten Maxime, einem Leitsatz, zu handeln, so muss dieser zu jeder Zeit für jeden ähnlich situierten rationalen Akteur gültig sein. Taylor (2017) erklärt, dass Personen, die ihr Handeln durch den kategorischen Imperativ begründen, beispielsweise nicht in der Lage seien, zu ihrem eigenen Vorteil zu lügen. Sie können nämlich nicht wollen, dass Lügen zu einem allgemeinen moralischen Gesetz werden würde. In Übereinstimmung mit dem kategorischen Imperativ zu handeln, ist dann, nach Kant, Autonomie. Wenn eine so als autonom charakterisierte Person ihren Eigenwert anerkennt, muss sie den der anderen ebenfalls anerkennen. Kant formuliert seine Schlussfolgerung wie folgt: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“ (Kant, 1870, S. 53). Überwindet ein Mensch seine Neigungen und handelt nach moralischen Gesetzen der Vernunft, die er sich selbst auferlegt, ist er in diesem Sinne autonom (vgl. Giesinger, 2020, S. 235).
Nach der kantischen Auffassung ist der Mensch ein empirisches Wesen, welches einerseits den Naturgesetzen untergeordnet ist, andererseits aber auch die Fähigkeit besitzt, sich nach Gesetzen der moralischen Vernunft zu richten (vgl. Giesinger, 2020, S. 236). Wenn der Mensch diesen Naturgesetzen gänzlich unterworfen wäre, dann wäre er ausnahmslos heteronom und würde ausschließlich auf Umweltreize reagieren (vgl. Zoglauer, 2010, S. 13). Da der Mensch dies nicht vermag, ist er somit pädagogisch beeinflussbar. Durch Erziehung, so Kant, entgeht der Mensch seinen tierischen Trieben, die unabhängig von jeglichen Gesetzen auftreten. Um die Grundlage für die Erziehung zu autonomer Moralität zu schaffen, muss sich das zu erziehende Subjekt äußerlich an gewisse Regeln halten. Die Durchsetzung dieser Regeln kann nach Kant mit Disziplinierung und Zwang erreicht werden (vgl. Giesinger, 2020, S. 236). Dabei stellt sich Kant die Frage, „wie kultivire ich die Freyheit bei dem Zwange?“ (Kant, 1803, S. 27). Gleichzeitig sieht er die Problematik der Erziehung zwischen der Unterwerfung unter gesetzliche Zwänge und der Vereinbarkeit individueller Freiheit (vgl. Schaare, 1998, S. 108). Kant schreibt, dass man dem Subjekt beweisen muss, „daß man ihm einen Zwang auflegt, der es zum Gebrauche seiner eigenen Freyheit führt, daß man es kultivire, damit es einst frey seyn könne, d. h. nicht von der Vorsorge Anderer abhangen dürfe“ (Kant, 1803, S. 27). Dennoch war sich Kant darüber bewusst, dass Zwänge, Drohungen und Sanktionen gerade nicht bewirken, dass der Mensch aus eigener Einsicht moralisch richtig handelt (vgl. Giesinger, 2020, S. 236), sondern primär von äußeren Faktoren gesteuert wird. Hier lassen sich erste Züge zur Integration des zu erziehenden Subjekts in den Erziehungsprozess erkennen.
Neben Kants Idee von der Autonomie des Individuums rückten auch die individuellen Rechte des Kindes und die Anerkennung der besonderen Lebensphase in den Vordergrund. Hatte der Philosoph Johann A-mos Comenius bereits im 17. Jahrhundert den Stellenwert des Kindes anerkannt, sind es v.a. die Pädagogen Jean Jacques Rousseau und Johann Heinrich Pestalozzi, die der kindlichen Lebensstufe ihr eigenes Recht einräumten und dieses gegen religiöse und staatliche Ansprüche verteidigten (vgl. Schiess, 1973, S. 22f). Mit Rousseau und Pestalozzi hat ein reformierter Blickwechsel stattgefunden, der sich u.a. aus den fragwürdigen Machtverhältnissen seit der Renaissance und der Reformation herausgebildet hatte. Ihre pädagogischen Vorstellungen lösten sich von denen, dessen Konzepte die reine Loyalitätssicherung mittelalterlicher Privilegiengesellschaften vorsahen und sie erkannten die Besonderheiten der Kindheit und der Jugendphase (vgl. Schiess, 1973, S. 22f). In seinem Erziehungsroman Émile ou De l’éducation (zu deutsch: Émile oder Über die Erziehung) beschreibt Rousseau erstmals die eigenständige kindliche Existenz und dessen Entwicklungsprozesse nicht als transitive Stadien zu dem intendierten Ziel des Erwachsenseins, sondern er erkennt die Daseinsberechtigung der Kindheit an (vgl. Bast, 2000, S. 38). Stübig (2003) fasst den Inhalt dieses Romans wie folgt zusammen:
Der Knabe Émile wird von seinem Erzieher beobachtet und begleitet. Die Aufgabe dieses Erziehers besteht in der Entfaltung und Stärkung der Anlagen des Kindes. Er folgt in seinem Handeln keinen von außen gesetzten Zielen, sondern ausschließlich der kindlichen Entwicklung und bringt damit die Stärke des Kindes hervor; nicht äußerer Zwang, sondern das Kind selbst ist der leitende Maßstab, der es zur Mündigkeit und Selbstbestimmung führt (S. 10).
Rousseau sieht bei seiner kindorientierten Erziehung die Herauslösung aus gesellschaftlichen Lebensbezügen vor. Die Erziehung zur Autonomie, so Drieschner (2007), hat nach Rousseau den natürlichen Anlagen des Kindes zu folgen, d.h. dessen Vermögen und Begabungen zu fördern und zu fordern und damit dessen Eigenrecht gegen koventionelle Zwecke und Ziele zu verteidigen (vgl. S. 22). Die Vorstellung von Selbstständigkeit und personaler Autonomie steht nun religiöser Abhängigkeit aus mittelarterlichen Vorstellungen entgegen. Diese neuartige Sichtweise auf die Erziehung wird durch die Ausgliederung des Kindes oder des Jugendlichen aus der familiären Erwerbsarbeit ermöglicht und schafft einen Schutzraum für die erzieherische Ausrichtung an den Bedürfnissen der oder des Minderjährigen. Dies zeigte sich v.a. durch die Einrichtung von Kinder- und Jugendzimmern zusammen mit altersgerechtem Spielzeug und Literatur (vgl. Drieschner, 2007, S. 19f). Rousseau löste mit seinen Forderungen eine Bewegung aus, die noch nachdrücklicher von Pestalozzi thematisiert wurde.
Pestalozzi erkannte die Bedeutung der vertrauensvollen Beziehung zwischen Kind und Erzieher*innen. Letztere verstand er, wie Rousseau, nicht mehr als Beauftragte oder Repräsentat*innen staatlicher oder kirchlicher Mächte, sondern als Akteur*innen, die sich an den kindlichen Besonderheiten orientieren. Hier lassen sich erste Ansprüche herausarbeiten, die nicht nur eine Autonomie des Kindes, sondern auch eine Autonomie der Erziehenden fordern (vgl. Schiess, 1973, S. 44). Erziehung hatte nun nicht mehr stummen Gehorsam und Brechung des Willens zum Ziel, sondern orientierte sich an der Selbstständigkeit des zu erziehenden Subjekts, die zur sittlichen Autonomie führen sollte (vgl. Christman, 2020). Bast (2000) spricht von einem radikalen Wechsel der Blickrichtung zur „Pädagogik vom Kinde aus“ (S. 50). Während Pestalozzi sich lediglich auf eine familiäre Elementarbildung spezifiziert hat, so Schiess (1973), stößt Rousseau in seinen utopischen Vorstellungen von der vollständigen Herauslösung aus gesellschaftlichen Lebensbeziehungen auf unüberwindbare Hindernisse (vgl. S. 44). Inwieweit jene Konventionen für die Autonomieentwicklung unabdingbar sind, wird an anderer Stelle genauer erläutert. Dennoch verdanken wir der aufklärerischen Bewegung die Einrichtung der Schule für alle (vgl. Stübig, 2003, S. 10). Meyer-Drawe (2000) sieht die Wirksamkeit dieser Überlegungen der Aufklärung darin, dass Autonomie zu einem oppositionellen Begriff wurde. Der Begriff bot ein Gegenkonzept an, das sich gegen die vermeintlich unantastbaren Zwangsmechanismen richtete und gesellschaftliche Veränderungen plausibel machte (vgl. S. 8). Dieser Emanzipationsprozess führte u.a. durch Erkenntnisse der Naturwissenschaft und als Folge des neuen Selbstbewusstseins zur Verschiebung der Ideale von Kirche und der Vergangenheit in die Zukunft, auch wenn dieses vorgestellte Konzept noch nicht explizit als Autonomie bekannt war (vgl. Schiess, 1973, S. 15).
1.3 Autonomie in der Pädagogik der Moderne
Bevor wir uns der pädagogischen Diskussion zur Autonomie des 20. Jahrhunderts nähern, sind zunächst drei wichtige Pädagogen stellvertretend für das 19. Jahrhundert zu nennen. Wilhelm von Humboldt erkennt, ebenso wie die genannten Vertreter der Aufklärung, die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten als legitime Aufgabe der Erziehung an. Seine Individualpädagogik unterscheidet sich jedoch von eben diesen Ideen in der Hinsicht, dass „die dem Individuum gegenüberstehende Welt mit ihren kulturellen Inhalten das entscheidende didaktische Medium darstellen, den einzelnen zur sittlichen Vollkommenheit zu bilden“ (Bast, 2000, S. 51). Er versteht Bildung zwar als einen individuellen Lernprozess, dieser soll sich jedoch an der Gesellschaft orientieren. Laut seiner Auffassung ist derjenige Mensch gebildet, der „so viel Welt als möglich zu ergreifen, und so eng, als er nur kann, mit sich zu verbinden“ (Humboldt, 1793; 2017, S. 6) weiß. Auch wenn dieser Ansatz den Anschein erwecken mag, Humboldt orientiere sich an eben jenen konventionellen Leitbildern, die Rousseau und Pestaozzi ablehnten, soll Bildung nicht die bloße Enkulturation, sondern eine reflektierte Wahrnehmung und Inbeziehungsetzung zu sich selbst sein. So schreibt Humboldt: „Gelingende Bildung […] wird erreicht, wenn der Mensch aus dem Verstehen von Welt, in sich zurückkehrt“ (zitiert nach Drieschner, 2007, S. 20). Neben Humboldt beschäftigte sich auch Friedrich Schleiermacher mit der Individualpädagogik, die eng mit der Autonomie verknüpft ist. Schleiermacher fordert eine Pädagogik, die sich der Individualität des zu erziehenden Subjekts annimmt, versteht sie jedoch im Wesentlichen als eine klassisch objektive Aufgabe, um die Aufrechterhaltung und den Fortbestand der Kultur zu sichern (vgl. Bast, 2000, S. 55f).
Zurückgreifend auf die kantische Idee von Autonomie als durch Vernunft geleitetes Konzept, definiert der britische Philosoph John Stuart Mill Mitte des 19. Jahrhunderts den Autonomiebegriff nicht mehr, wie Kant, als rein moralisches Konstrukt. Nach seiner Auffassung muss der Mensch, um Herr seines eigenen Willens zu werden, seinen natürlichen Trieben und Wünschen folgen, die er als desires and impules beschreibt (vgl. Rössler, 2017, S. 33-36). Diese Annahme unterscheidet sich von Kants Konzept in der Hinsicht, dass autonome Personen durch Wünsche motiviert sein können, diese aber die eigenen sein müssen. Mills Darstellung von Autonomie ist in der heutigen normativen Ethik stärker vertreten, da sie als realistischer umzusetzen erscheint (vgl. Taylor, 2017).
1.4 Reformpädagogische Ansätze zur Autonomie
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Schule als eine Institution zur Vermittlung von Kulturgütern verstanden. Bildung, die auf Selbstbestimmung und Individualität abzielt, kann als eine Reaktion auf die Veränderungen des Arbeitslebens und familiärer Strukturen verstanden werden, die einen Gegenentwurf zu diesen etablierten Praktiken im Kaiserreich darstellten (vgl. Drieschner, 2007, S. 20-24). Als Ausgangspunkt der sich an das 19. Jahrhundert anschließenden reformpädagogischen Bewegung ist die prinzipielle Kritik an den traditionellen Erziehungsmethoden im Wilhelmischen Kaiserreich zu nennen. Sie stellt erstmals die individuellen Schüler*innen in das Zentrum von Unterricht und charakterisiert Schule als einen Ort, an dem eben jene selbsttätige Erfahrungen machen. Der selbsttätige Erziehungsprozess soll die Schüler*innen zur Selbstständigkeit führen. Dies sind die ersten expliziten Überlegungen, die die Selbstständigkeitsförderung an Schulen fordern und sich gegen die Konzepte der alten Lernschulen wenden (vgl. Stübig, 2003, S. 11). Als eine der bedeutensten Reformpädagog*innen ist die italienische Ärztin Maria Montessori zu nennen. Montessoris Grundhaltung beeinhaltet die Aktivierung verborgener Fähigkeiten und die Motivierung der Kinder. Sie sieht in ihren Aufgaben diese Kräfte zu wecken, die Kinder aus ihrer unmündigen Abhängigkeit von den Erwachsenen zu befreien und sie dadurch zu Autonomie zu führen. Diese Erziehung zur Selbstständigkeit vollzieht sich nur durch das eigene Tun der Kinder, die aus sich heraus aktiv ihren eigenen Zielvorstellungen folgen und aus ihren Ideen und Fähigkeiten Aktivitäten herausbilden (vgl. Becker-Textor, 2003). Das heißt jedoch keineswegs, dass die Erzieher*innen das Kind sich selbst überlassen, sondern, dass sie den eigenständigen Kindern helfen, Herausforderungen selbst zu bewältigen. Montessori orientiert sich an der kindlichen Forderung:
Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen (Montessori, 1941; 2015, S. 169).
Die Aufgabe der erziehenden Personen besteht nun darin, die für die Selbstständigkeitsförderung produktiven Lernumgebungen zu schaffen. Dies beeinhaltet das Schaffen eines lernfreundlichen, harmonischen Arbeitsklimas, die Kinder zu beobachten, deren Verhalten zu reflektieren und ggf. Korrekturen für darauffolgende Lernaktivitäten zu treffen. Zu diesem selbsttätigen Lernen gehört auch eine Anpassung der Erziehenden. Laut Montessori ist es für viele Erzieher*innen schwer vorstellbar, dass Kinder keine Hilfe benötigen um Fehlermanagement zu betreiben. Außerdem können viele Erzieher*innen den durch das Kind gewählten Weg, oder repetitiv ausgeführte Handlungen, nicht nachvollziehen. Erkennen die Erzieher*innen die Vorgehensweise eines Kindes als zwecklos an, wird diese meist unterdrückt. Das stellt nach Montessori einen erheblichen Erziehungsfehler dar (vgl. Becker-Textor, 2003).
Neben Montessori sind an dieser Stelle auch deutsche Vertreter*innen der Reformpädagogik zu nennen. Einer dieser Reformpädagog*innen ist Herman Nohl. Seiner Ansicht nach ergibt sich aus der neuentdeckten Autonomie des Kindes konsequenterweise die Autonomie der Pädagogik als eigenständiger Wissenschaftszweig, der sich den kindlichen Ansprüchen verpflichtet (vgl. Bast, 2000, S. 15). Nohl erkennt, seit seiner Zuwendung zur Pädagogik, die Bedeutung der Autonomie für die Theorie der Erziehung. Er betont v.a. die Bedeutung der Autonomie der Erzieher*innen, die sich nicht von gesellschaftlichen, staatlichen, religiösen oder wirtschaftlichen Interessen instrumentalisieren lassen dürfen. Die Erzieher*innen sind ausschließlich dem Wohl des Kindes verpflichtet und dienen dessen Mündigwerdung. Sie können sich dieser verantwortungsvollenen Aufgabe nur völlig frei und unvoreingenommen hingeben, wenn sie ohne Außeneinwirkung die notwenigen Freiheiten erhalten, pädagogisch Handeln zu können. Nohl versteht das Konzept jedoch nicht als absolute, sondern als relative Autonomie. Das bedeutet gerade nicht, dass sich die Erzieher*innen in ihren Tätigkeiten völlig von der Gesellschaft isolieren sollen, wie es Rousseau angenommen hatte, denn das ist in einem unlösbaren Zusammenhang zwischen Erziehung und dem kulturellen Ganzen nicht möglich. Sie sollen vielmehr das zu erziehende Subjekt von Übergriffen durch verschiedene Interessensgruppen wahren und die Interessen des Kindes vertreten (vgl. Bast, 2000, S. 20f).
Die Erzieher*innen müssen sich, nach Nohl, neutral gegenüber bestimmten Parteien verhalten und dürfen nicht versuchen die freie Entwicklung des Kindes zu beeinflussen. Nohl sieht die Aufgabe der Erzieher*innen in der Entwicklung der Selbstbestimmung des Kindes. Um Kinder und Jugendliche zu autonomen beurteilungs- und handlungsfähigen Subjekten zu machen, müssen die objektiven Lerninhalte gezielt eingesetzt, gewählt oder zurückgestellt werden. Diese Autonomieförderung erzielen die Erzieher*innen durch zurückhaltende, jedoch gezielte Führung, die nicht aus Angst vor Gewalt, sondern durch die Akzeptanz des Erwachsenenwillens hervorgerufen wird (vgl. Schiess, 1973, S. 29). Aus der Autonomie des Kindes und der Autonomie der Erzieher*innen ergibt sich für Nohl konsequenterweise auch die Autonomie der Bildungsinstitutionen.
Zur Zeit der Weimarer Republik wird die Frage nach der pädagogischen Autonomie zu einer der Grundfragen der Erziehungswissenschaften. Georg Geißler, ein Schüler von Herman Nohl, schreibt: „Wie in jedem anderen Kulturgebiet, so hängt auch bei der Pädagogik ihre ganze Mächtigkeit in erster Linie ab von der klaren […] Herausarbeitung ihrer selbstständigen Leistung innerhalb des Kulturganzen“ (Geißler, 1929, zitiert nach Schiess, 1973, S. 43). Der Selbstständigkeitsanspruch der Pädagogik richtet sich gegen diejenigen sozialen Kräfte, die versuchen dessen Eigenständigkeit zu unterdrücken (vgl. Berka, 2002, S. 31). Richten sich Nohl und Geißler v.a. nach dem Nachweis der Eigenständigkeit der Pädagogik, so ist es Wilhelm Flitner, der die besondere Stellung der Erzieher*innen erst durch den Konflikt zwischen den gesellschaftlichen Institutionen sieht. Die Erzieher*innen werden zu Anwält*innen der Kinder und vertreten deren Rechte (vgl. Schiess, 1973, S. 48). Daraus leitet Erich Weniger die relative Autonomie der Erziehung ab, die aus der Eigengesetzlichkeit der Erziehenden erwächst. Sie entspricht dem demokratischen Bildungsideal der Mündigwerdung und ist in der damaligen Reichsverfassung verankert. Die Diskussion um die Autonomie in der Pädagogik erlangte gegen Ende der Weimarer Republik ihren Höhepunkt, obwohl, wie oben dargestellt, dessen Vertreter*innen keine einheitliche Front bildeten. Das führte dazu, dass ihre Forderungen keine politische Resonanz erhielten und bis zur Gründung des Dritten Reiches keine gemeinsame Übereinkunft über die pädagogische Autonomie erzielt werden konnte (vgl. Schiess, 1973, S. 58f).
1.5 Pädagogische Autonomie im Dritten Reich
Mit der Machtergreifung im Jahr 1933 wurde die Diskussion über die Autonomie abrupt beendet (vgl. Schiess, 1973, S. 91). Der zu dieser Zeit in Deutschland beginnende Totalitarismus sah eine Gleichschaltung der Institutionen, so auch der Bildungseinrichtungen, vor. Die nationalsozialistische Weltanschaung war kompromisslos und akzeptierte keine andere pädagogische Ansicht, als die eigene. Der Richtungsgeber dieser völkischen Erziehung war Adolf Hitler:
Der völkische Staat hat […] seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie […] auf das Heranzüchten kerngesunder Körper (einzustellen). Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten. […] Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. […] Aber Beherrschung müßen sie lernen. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen können lernen (Hitler, Mein Kampf, 1933, zitiert nach Schiess, 1973, S. 90).
Hitler, so Schiess (1973), sah Erziehung lediglich als ein Mittel für seine politischen Ideologien. Für eine Pädagogik, die auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder eingeht, sie in ihren Fähigkeiten stärkt, sie zu selbstbestimmten Bürgern formt und ihre Lebensstufe wertschätzt, gibt es in einem solchen totalitären Regime keinen Platz (vgl. S. 93). Nationalsozialistische Erziehungsbeauftragte lehnten die Theorie der pädagogischen Autonomie einstimmig ab, da sie einer Epoche anzugehören schien, die das deutsche Volk schwäche (vgl. S. 92). Die pädagogische Arbeit im Dritten Reich legte ihre Erziehungsarbeit v.a. auf Heteronomie, also Fremdbestimmtheit aus. Sie stellt nach Kant das Gegenteil der Autonomie dar. Die nationalsozialistischen Pädagog*innen erkannten zwar das ungestörte körperliche und seelische Wachstum der Kinder in den ersten zehn Lebensjahren an, aber nur zu dem Zweck, den späteren, durch den „Führerbefehl“ erteilten, Aufgaben Folge zu leisten. Die Nationalsozialisten bereiteten die Jugend, die sie als „unverdorbenes Material“ bezeichneten, für die politsche Manipulation und propagandistische Zwecke vor (vgl. S. 93f). Hitler äußerte sich in einem Interview wie folgt dazu:





























