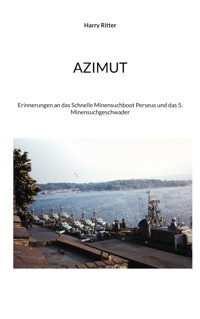
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Büchlein beinhaltet Erinnerungen an meine Zeit bei der Deutschen Bundesmarine in den Jahren 1977-79: Wie läuft man in Dänemark auf Grund? Wie verliert ein Minensuchboot dreihundert Meter Räumgerät nachts mitten auf der Ostsee? Wie vergisst man eines seiner Ruderblätter? Was passiert, wenn man sich als Maat ein Eis kauft? Was, um Himmels Willen, ist ein Azimut?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Den Wehrpflichtigen
bei der Deutschen Bundesmarine
gewidmet
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1: Die Grundausbildung
1.1
Dienstantritt
1.2
Dienstgrade
1.3
Ausbildung
1.4
Dienst und Freizeit
Kapitel 2: Der Maatenlehrgang
2.1
Die Marineortungsschule
2.2
Der Kümi
2.3
Erster Tenor
2.4
Frauen an Bord
2.5
Einsatzwünsche
Kapitel 3: Auf Perseus
3.1
Boot und Besatzung
3.2
Auf See
3.3
Im Hafen
3.4
Auf Reisen
3.5
In der Werft
3.6
Auf Manöver
3.7
Die Schneekatastrophe 1978/79
3.8
Der Frosch im Frühling
3.9
Speed
Schluss
Vorwort
Dieses Büchlein handelt über meine Dienstzeit bei der Deutschen Bundesmarine in den Jahren 1977 bis 1979. Von diesen zwei Jahren habe ich die längste Zeit an Bord des Schnellen Minensuchboots - oder abgekürzt SM-Boot - „Perseus“ zugebracht.
Die Perseus war in Olpenitz in der Nähe von Kappeln an der Schlei stationiert und mit zehn weiteren SM-Booten sowie dem Versorgungsschiff „Mosel“ Teil des 5. Minensuch-Geschwaders. Alle SM-Boote hatten Namen von Sternbildern, also außer Perseus noch „Orion“, „Wega“ etc. Die hier geschilderten Ereignisse haben sich tatsächlich so zugetragen. Den Marinehafen Olpenitz gibt es heute nicht mehr, er ist einem Ferienressort gewichen. Auch die gute alte Perseus existiert nicht mehr, sie wurde nach ihrer Ausmusterung zunächst noch Wohnschiff im Hamburger Hafen und hatte schließlich in dem Fernsehfilm „Schtonk“ einen kurzen Auftritt, bevor sie verschrottet wurde.
Einleitung
Dreiundachtzig Kilogramm. Mein Gewicht bei der Eingangsuntersuchung der Bundesmarine. Oder besser gesagt, meine Masse. Ganz ordentlich für meine Größe, 1,75 m. Aber ich hatte Leistungssport getrieben, früher mal. Gerudert, beim VWM. Das war der „Volkstümliche Wassersportverein Mannheim“. Ein kleiner Verein. Dafür aber im Besitz einer Ruder-, einer Kanu- und einer Schwimmabteilung. Und auch ein Motorboot nannte der Verein sein Eigen, das war aber ausschließlich dem Ruderertrainer vorbehalten.
Geschwommen wurde in der wärmeren Jahreszeit im Stollenwörthweiher, einem Gewässer im südlichen Mannheimer Vorort Neckarau, gepaddelt und gerudert am anderen Ende der Stadt, auf dem Altrhein zwischen den Stadtteilen Luzenberg und Sandhofen, dort liegt auch die Mündung des Altrheins in den Rhein. Hin und zurück waren das neun Kilometer, unser normales tägliches Trainingspensum unter der Woche, samstags und sonntags auch schon mal das Doppelte. Wir waren vier bis fünf „Rennruderer“, das heißt, wir nahmen regelmäßig an Wettbewerben teil. Training war an sechs Tagen in der Woche, ein Tag war Ruhetag. Im Winter wurde allerdings nur an den Wochenenden gerudert, unter der Woche fanden Krafttraining, Dauerläufe und Ballspiele statt. Gefahren bin ich zumeist im Einer und Doppelzweier, das sind sogenannte Skullboote, mit zwei Ruderblättern pro Mann, im Unterschied zu den Riemenbooten mit nur einem großen Ruder, dem Riemen, pro Ruderer.
Bei Wettbewerben hatten wir immer eine große Konkurrenz, zum Beispiel die „Amicitia“ am Neckar oder den „Mannheimer Ruderclub“ am Rhein, beides Vereine mit einer viel größeren Anzahl an Ruderern als unser VWM. Bei Regatten wurde ich komischerweise immer Zweiter, wobei zwischen drei und sechs Ruderer oder Mannschaften teilnahmen. Aber nur die Sieger bei solchen Vergleichen kamen weiter, also zum Beispiel zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften.
Vielleicht aus diesem Grund hab ich noch vor dem Abi mit dem Leistungssport als Rennruderer aufgehört, außerdem hatte ich schon damals ein Rückenleiden, das durch die Ruderei nicht gerade besser wurde.
Mein Faible oder ehemaliges solches für den Wassersport war aber keineswegs der Grund für meinen freiwilligen Eintritt bei der Bundesmarine. Auch habe ich dort nie gerudert oder gepaddelt und seltsamerweise noch nicht einmal gesegelt. Und auch schwimmen war ich lediglich in der Freizeit, meistens im schönen Wellenbad in Eckernförde, da die Ostsee den größten Teil des Jahres dafür zu kalt war. Wassersportarten waren auch keineswegs Einstel-lungslungsvoraussetzung für die Marine. Eigentlich war gar kein Sport vonnöten. Es gab natürlich Gründe für meine Verpflichtung zum „SaZ 2“, also zum Soldat auf Zeit für zwei Jahre. Das war die kürzeste Dauer, sich über die übliche Wehrdienstzeit hinaus zu verpflichten. Die Wehrpflicht betrug damals fünfzehn Monate, die zwei Jahre waren also nur neun Monate länger. Vor allem aber bekam man Geld. Endlich konnte ich mal regelmäßig richtiges Geld verdienen, gute Deutsche Mark. Die ersten sechs Monate gab´s allerdings nur Wehrsold, das waren so achtzig Märker alle vierzehn Tage. Die Einsparmaßnahmen wegen der geburtenstarken Generation der Baby-Boomer hatten auch die Bundeswehr bereits erfasst. Das hieß, die Arbeitgeber waren damals überall im Vorteil, es gab in allen Bereichen genügend Nachwuchs, und man konnte sich die Mitarbeiter aussuchen.
Ab dem siebten Monat ging es dann aber in die „Vollen“, das waren monatlich so um die tausend Mark. Und nach einem Jahr, nach der Beförderung zum Unteroffizier, waren es dann schon elfhundert. Plus Bordzulage.
Bordzulage wurde für jedenTag, den man ganz oder zum Teil auf See verbrachte, gezahlt. Wie viele Stunden und wie viel Geld pro Tag das waren, weiß ich nicht mehr so genau, aber mit etwa dreihundert Mark pro Monat konnte man im Durchschnitt schon rechnen. Außerdem erhielten wir pro Seetag zwei Schachteln Zigaretten für sechzig Pfennig pro Schachtel, zoll- und steuerfrei. Recht günstig, denn damals kostete eine Schachtel bereits drei DM. Mancher wurde so zum Raucher, der noch keiner war. Das hatte aber auch noch andere Gründe. Wer dennoch Nichtraucher blieb, nahm die Zigaretten trotzdem. Er konnte sie ja verkaufen, eintauschen oder verschenken. Außerdem erhielten wir noch die „Monatsflasche“. Das war eine Spirituosenflasche nach Wahl pro Monat, ebenfalls zoll- und steuerfrei. Gegenüber einer Landtätigkeit, militärisch korrekt „Landkommando“ genannt, bot die Verwendung an Bord also schon eine Menge Vorzüge.
Da man zudem Kost und Logis völlig umsonst erhielt, hatte ich bald das Geld zusammen für mein neues Motorrad, eine Suzuki GT 250. Mein altes und gleichzeitig erstes, eine Yamaha RD gleichen Hubraums, hatte ich, wenn auch unverschuldeter Weise, im Februar 1977 gecrasht. Die „Suzi“ war eine „Graue“, also ein Re-Import, neu für ganze 2390 Mark. Die Japaner lieferten nämlich in andere Länder, die damals anscheinend ärmer waren, günstiger als nach Deutschland, und das machten sich die Re-Importeure zu Nutze. Außerdem hab ich noch meinem Gitarrenlehrer dessen alten, aber noch rüstigen VW Käfer, Baujahr 1964, für 700 Mark abgekauft. Beide Fahrzeuge konnte ich mir bereits im März 1978 zulegen.
Meine Suzuki GT 250, Baujahr 1978
Zwischen der Abi-Prüfung im Mai und dem Dienstantritt bei der Bundeswehr lagen noch zwei Wochen auf Mallorca, das Geld dafür hatte ich von der Versicherung nach meinem Motorradunfall vom Februar erhalten. Damals gab zwar es noch keinen „Ballermann“, aber doch schon eine Vergnügungszeile in El Arenal.
Außerdem musste ich meinen Haarschnitt adaptieren. Die Zeit der Haarnetze bei der Bundeswehr war vorbei, also musste die schöne lange Lockenpracht runter.
Kapitel 1: Grundausbildung
1.1 Dienstantritt
Erster Juli 1977. Ich fahre mit dem Zug von Mannheim-Waldhof nach Bremerhaven. Auf der Ziegelsteinwand des Bahnhofsgebäudes Waldhof, heute längst abgerissen, ist noch ganz gut, wenn auch etwas verwaschen, „Räder müssen rollen für den Sieg“ zu lesen. Mein Vater hat mich zum Bahnhof begleitet. Er sieht recht traurig drein, für mich etwas überraschend, er sollte doch froh sein, dass ich endlich weg bin. Mir war im Gegenteil gar nicht traurig zumute. Denn eine Freundin hatte ich derzeit auch keine mehr, also auf zu neuen Ufern.
„Jung“, „Modern“, „Weltoffen“, mit dieser Inschrift empfing mich Bremerhaven auf dem dem Bahnhof gegenüberliegenden Gebäude. Die Häuser ringsum waren aus schönem rotem Backstein. Rechts vom Bahnhof ein Geschäft für „Ehehygiene“. Der Begriff erschien mir ungewohnt und so altbacken wie die Steine.
Vom Bahnhof Bremerhaven gönne ich mir noch eine Taxifahrt zu meinem ersten, etwa 20 km entfernten Einsatzort, einer Kaserne in Drangstedt.
Kennen Sie Drangstedt, Hymendorf, Flögeln und Fickmühlen?
Nein, diese vier Dörfer in der Nähe von Bederkesa am schönen Bederkesaer See kannte ich auch nicht bis zu jenem ersten Juli des Jahres 1977. Die Ortsnamen kamen mir zwar etwas seltsam vor, doch darauf, dass sich dies irgendwann irgendein Lustmolch ausgedacht haben könnte, bin ich nicht gekommen, bis es später mal jemand in einem Vortrag erwähnt hat.
In Drangstedt sollte nun also die Grundausbildung bei der Bundeswehr stattfinden, die auch „Grundi“ genannt wurde. Ja, diese gab es auch bei der Marine, nicht nur beim Heer, den „Stoppelhopsern“. Das Kriegshandwerk musste ja von der Pike an gelernt werden. Auch wenn damals das Wort „Krieg“ bei der Bundeswehr überhaupt nicht vorkam. Das war sogar völlig undenkbar, jenseits jeder Vorstellung. Es gab nur den Verteidigungsfall, den „V-Fall“, und die Streitkräfte durften zwingend nur zur Abwehr eines Angreifers eingesetzt werden. Trotzdem, oder gerade deswegen, war die Bundeswehr damals etwa fünfhunderttausend Mann stark und bestand größtenteils aus Wehrpflichtigen.
Zunächst ging es zur Einkleidung. Neben dem „passenden“ Stahlhelm und der blauen und weißen Marinekleidung mitsamt „Colani“ (blaues Jacket) und dem selbstzubindenden Knoten bekamen wir noch die olivgrüne des Heeres. Auch die schönen langen Unterhosen. Außerdem erhielt ich die obligatorische Gasmaske und zusätzlich eine Schießbrille mit der entsprechenden Sehstärke, ich war ja bereits seit einiger Zeit Brillenträger. An Schuhwerk gab es außer den Seestiefeln noch schwarze Halbschuhe und die sogenannten „Nullachter“, das waren eine Art Wanderstiefel. Insbesondere die olivgrüne Kleidung des Heeres wurde nun unsere zweite Haut für die nächsten drei Monate.
Drangstedt war Luftkurort. Unsere Kaserne, erzählte man uns, war früher ein Sanatorium für lungenkranke Kinder, vor allem Asthmatiker. Für mich gar nicht so schlecht, da ich damals mit einem alljährlich wiederkehrenden „Keuchhusten“, wie man es nannte, behaftet war. Davon sollte ich mich tatsächlich in den kommenden Wochen völlig auskurieren.





























