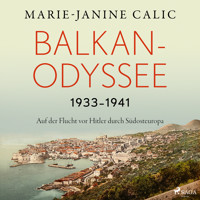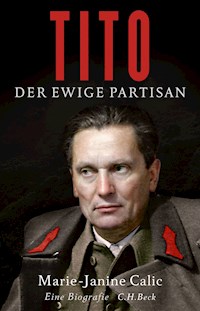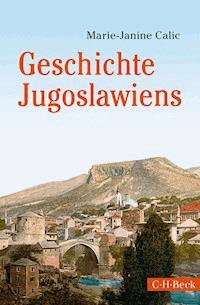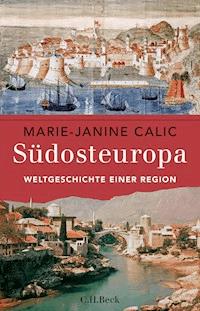23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Theaterstar Tilla Durieux, die Schriftsteller Manès Sperber und Ernst Toller, der Dramatiker Franz Theodor Csokor, der Maler Richard Ziegler und viele andere – sie alle flohen vor Hitler nach Südosteuropa und fanden dort Unterschlupf. Doch diese erste Balkanroute ist heute so gut wie vergessen. Marie-Janine Calic ruft sie in Erinnerung und erzählt berührende Geschichten von Mut und Menschlichkeit, von Elend und Verrat, von Rettung und Untergang.
Bei Hitlers Machtübernahme lag der Balkan für viele Verfolgte und Bedrohte "irgendwo da unten". Trotzdem flohen sie nicht nur in den demokratischen Westen und die kommunistische Sowjetunion, sondern auch in den vermeintlich rückständigen Südosten Europas, mindestens 55.000 allein nach Jugoslawien. Und ihren waren Juden und Nichtjuden, Konservative und Kommunisten, Zionisten und Internationalisten, Widerstandskämpfer und Unpolitische. Die Flucht auf der Balkonroute begann gleich Anfang 1933 mit den ersten Verfolgungswellen der Nationalsozialisten. 1938 ließen der "Anschluss" Österreichs und das Novemberpogrom den Strom der Flüchtenden schlagartig anschwellen, weil kaum noch andere Routen offenstanden. Doch als Italien Ende Oktober 1940 das Königreich Griechenland überfiel und Hitler den Angriff auf die Balkanländer plante, war plötzlich auch dieser letzte Fluchtweg verschlossen. Tausende saßen in der Falle. In der griechischen Sage endete die abenteuerliche Irrfahrt für den Helden glücklich - für viele der Balkan-Flüchtlinge tat sie das nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Marie-Janine Calic
BALKAN-ODYSSEE
1933–1941
Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa
C.H.BECK
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
VORWORT
FLUCHT
Berlin, 31. März 1933
Anhalter Bahnhof
Ein Theaterstar verlässt Berlin
«Der ewige Jude»
Auf Gedeih und Verderb
Heimatlos
Kommunist und Jude
«Hurra!!! Keine Deutsche mehr!!!»
Der Prophet in der Provinz
Ein Künstler und sein Paradies
Belgrad ruft
Leben und Sterben für die Wissenschaft
«Ich biete mich also an»
«Was mich nicht vernichtet, macht mich stärker»
Heimweh!
IRGENDWO DA UNTEN
«Die Gewährung von Asyl ist unsere Tradition»
«Mit phantastischer Herzlichkeit aufgenommen»
«Für Deutschland schon ein Emigrant»
«Großzügige Gastfreundschaft» gegenüber der
NSDAP
Das Klima ändert sich
Die Tragödie von Marseille
«Führer sehen dich an»
General Göring auf Hochzeitsreise
Der «Fall Blumenthal»
Um- und Abwege in Paris
Zaton Mali: Mikrokosmos des Exils
Mit dem Krokodil im Exil
Ein Dandy auf dem Maultier
«Noch nie war ich so einsam wie jetzt»
Pionier der Beat-Generation
Mit dem Kinderheim auf der Flucht
VERFOLGT UND VERTRIEBEN
Graz und Wien, 12. März 1938
«Jeder Tag eine Schreckensnachricht»
In Panik weg
Adolf Eichmann in Wien
Der «Judenschlepper» Josef Schleich
Schleichwege
(K)ein Paradies für Juden
Évian, 6. bis 15. Juli 1938
Wohin, wenn nicht nach Jugoslawien?
In der «Villa Lubienski»
«Die Arbeit liegt auf der Straße»
Voller «dummer Hoffnung»
«In unserem Staat unerwünscht»
Ein Vagabund in Sarajevo
«Beliebt bei älteren Damen und jüngeren Herrn»
«Heut wohnt Augustin nah beim Muezzin»
Letzter Ausweg: Albanien!
In König Zogus Land
«Einer humanitären Pflicht Genüge getan»
«Das fünfte Ufer»
RETTE SICH, WER KANN
Auf, nach Erez Israel!
Wege nach Palästina
Im Lager Golenić
Letzte Chance: Alija-Bet
Der Mossad in Aktion
«Wir sitzen fest!»
Danzig, 1. September 1939: «Ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen»
Wien, Rotgasse, Dezember 1939
Auf der Donau
«Alle Hoffnungen ins Wasser gefallen»
Der Große Transport
DIE SCHLINGE ZIEHT SICH ZU
Schattenkriege
«Eine Haltung der Humanität»
Im «Athenée Palace»
Section D
Agent 6625
Verwirrspiel auf der Donau
«Alle Nerven zum Zerreißen gespannt»
Das Dilemma mit der «Darien»
In der «Höhle des Grauens»
«Heim ins Reich»
Hurrah – wir fahren!
Eine zweckmäßige Katastrophe
Die letzte Partie
Flucht aus Bukarest
Deutschland bereitet sich auf den Krieg vor
«Du weißt nicht, wann du abhauen musst»
Joškos Kinder
«DAS SPIEL IST AUS»
Endstation Enttäuschung
«Die Juden nehmen uns die Arbeitsplätze weg»
«Helft mir!»
Untergang
Belgrad, 27. März 1941: Zwischen Skylla und Charybdis
Aufbruch in letzter Sekunde
Feuersturm
Flucht aus Belgrad
Epilog: Was danach geschah
Die Geflüchteten aus Zaton Mali und Zagreb
Die Insassen des Kinderheims
Die Kladovo-Gruppe
Die Reisenden der «Atlantic»
Freunde und Helfer
Die Täter und ihre Kollaborateure
Die Geflüchteten im italienischen Machtbereich
Tilla Durieux und Ludwig Katzenellenbogen
ANHANG
Dank
Abkürzungen
Die wichtigsten Personen
Quellen
1. Archivquellen
2. Presse
Literatur
Anmerkungen
Berlin, 31. März 1933
Heimatlos
Belgrad ruft
«Die Gewährung von Asyl ist unsere Tradition»
Das Klima ändert sich
Zaton Mali: Mikrokosmos des Exils
Graz und Wien, 12. März 1938
(K)ein Paradies für Juden
«In unserem Staat unerwünscht»
Letzter Ausweg: Albanien!
Auf, nach Erez Israel!
«Wir sitzen fest!»
Schattenkriege
«Alle Nerven zum Zerreißen gespannt»
Die letzte Partie
Endstation Enttäuschung
Untergang
Epilog: Was danach geschah
Abbildungsnachweis
Personenregister
KARTEN
Zum Buch
Vita
Impressum
VORWORT
Bei Hitlers Machtübernahme lag der Balkan für viele Menschen «irgendwo da unten». Warum suchten zehntausende aus dem «Dritten Reich» Vertriebene und Verbannte – Schriftsteller, Künstler, Politiker, Gewerkschafter und rassistisch Verfolgte – ausgerechnet dort Zuflucht?
«Balkan-Odyssee» geht den Schicksalen deutschsprachiger Emigranten und Flüchtender in den Balkanländern in den Jahren 1933 bis 1941 nach. Die Exilforschung hat sie weitgehend übersehen. Doch viele Verfolgte retteten sich nicht in den demokratischen Westen, sondern in den vermeintlich rückständigen Osten, mindestens 55.000 allein nach Jugoslawien. Unter ihnen waren Juden und Nichtjuden, Künstler und Arbeiter, Konservative und Kommunisten, Zionisten und Internationalisten, Widerstandskämpfer und Unpolitische. Ihre einzige Gemeinsamkeit war, dass sie irgendwo auf dem Balkan strandeten, die meisten ohne Beziehungen, Sprachkenntnisse und Vermögen. Viele irrten jahrelang durch Europa und die Welt.
Häufig begann die Odyssee unmittelbar nach Hitlers Machtantritt. Motive und Umstände des Exils waren unterschiedlich. Den einen erschien eine waghalsige Flucht weniger gefährlich, als in Deutschland zu bleiben. Andere wollten die nationalsozialistische Gefahr lange nicht wahrhaben oder besaßen keine ausreichenden finanziellen Mittel, sich ihr zu entziehen. Wer zögerte oder einen günstigen Moment verpasste, kam in Lebensgefahr. Ein europäisches Land nach dem anderen verschloss in den dreißiger Jahren die Grenzen für die aus NS-Deutschland Vertriebenen. Bei Beginn des Zweiten Weltkriegs war Jugoslawien der letzte Staat in Europa, der den Aufenthalt oder wenigstens die Durchreise von Geflüchteten noch duldete. Tausende Verfolgte und Verzweifelte versuchten, über die Balkanroute einen rettenden Seehafen zu erreichen, um heimlich per Schiff nach Palästina oder nach Übersee zu entkommen.
Im Vordergrund des Buches stehen persönliche Erlebnisse und Erfahrungen des Exils. Neu erschlossene Quellen berichten von individuellen Motiven und Umständen der Flucht, beschreiben zudem die sich dramatisch verengenden Handlungsspielräume und eine wachsende Verzweiflung. Männer, Frauen und Kinder wurden von heute auf morgen aus ihrem gewohnten Leben geworfen, mussten unkalkulierbare Entscheidungen treffen und immer wieder weiterziehen. Ob und wie eine Flucht gelang, hing von unzähligen Faktoren ab: Geld, Beziehungen und nützlichen Bekanntschaften, schicksalshaften Fügungen sowie nicht zuletzt der Hilfsbereitschaft völlig fremder Menschen. In den allermeisten Fällen war es purer Zufall, ob sich in letzter Sekunde irgendwo ein rettender Durchschlupf fand oder ob man seinen Mördern in die Hände fiel.
Wir treffen den Theaterstar Tilla Durieux und den Schriftsteller Manès Sperber in Zagreb, den Maler Richard Ziegler auf der Insel Korčula sowie eine bunte Gesellschaft Berliner Emigranten im dalmatinischen Fischerdorf Zaton Mali, unter ihnen ein Schauspieler, ein Abtreibungsarzt und eine Heilpädagogin mit einem ganzen Kinderheim. William S. Burroughs, der Pionier der Beat-Generation, fand in der deutschen Emigrantenkolonie seine erste Frau. Der Krebsforscher Ferdinand Blumenthal, der Byzantinist Georg Ostrogorsky und andere Wissenschaftler konnten ihre Karrieren an der Universität Belgrad fortsetzen. Viele waren wie der Dramatiker Franz Theodor Csokor wiederholt gezwungen, ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzupacken und von Land zu Land weiterzuziehen.
Im Jahr 1938 ließen der «Anschluss» Österreichs und das Novemberpogrom den Strom der Flüchtenden nach Jugoslawien schlagartig anschwellen, viele kamen illegal ins Land. Der Grazer «Judentreiber» Josef Schleich machte daraus im Auftrag von SD und Gestapo ein lukratives Geschäftsmodell und schleuste hunderte Jüdinnen und Juden über die Grenze. Zeitgleich organisierte Ruth Klüger vom zionistischen Mossad in Bukarest die Auswanderung nach «Erez Israel». Wir verfolgen einzelne der (häufig seeuntüchtigen) Schiffe, die vollgepackt mit Menschen Kurs auf Palästina nahmen. Nicht wenige havarierten oder erlitten Pushbacks durch britisches Militär vor der Küste des Mandatsgebiets. Im Hintergrund entspann sich ein Wettstreit der Geheimdienste um die Kontrolle der Balkanländer, Monate bevor der erste Schuss fiel. So kommen auch die Entscheider, Exekutoren und Nutznießer der Verfolgung in den Blick: Politiker, Agentinnen, Spione, Schleuser und ihre Helfershelfer. Als Italien Ende Oktober 1940 das Königreich Griechenland überfiel und Hitler den Angriff im Südosten plante, war plötzlich auch die Balkanroute als letzter Fluchtweg verschlossen. Hunderte saßen auf den Schiffen in der Falle.
Zu Beginn der Recherche zu diesem Buch erschien es beinahe unmöglich, konkrete Personen zu identifizieren, deren Migrationsgeschichte sich aus den Quellen rekonstruieren lässt. Menschen auf der Flucht sind bestrebt, das liegt in der Natur der Sache, möglichst wenige Spuren zu hinterlassen. Alles, was nach außen dringt, könnte einem zum Verhängnis werden. Viele Betroffene haben jedoch Briefe geschrieben oder persönliche Aufzeichnungen verfasst, um sich Ängste und Sorgen von der Seele zu schreiben. Je weiter die Forschung voranschritt, desto mehr dieser sogenannten Ego-Dokumente tauchten aus der Dunkelkammer der Geschichte auf. Dies ermöglichte es, die Opferbiografien dem Vergessen zu entziehen und zugleich in exemplarischer Weise auch an die persönlichen Tragödien ungezählter Namenloser zu erinnern – und an die Hilfsbereitschaft vieler Einheimischer, die die Bedürftigen versorgten und versteckten. So handelt dieses Buch auch von Mut und Menschlichkeit jener, die selbst am allerwenigsten besaßen.
Da es nirgends geschlossene Archivbestände zu unserem Thema gibt, mussten die Quellen an vielen unterschiedlichen Orten aufgespürt werden. Am Ende konnten aber etliche Schätze gehoben und hier zum ersten Mal ausgewertet werden, darunter die Tagebücher der Schauspielerin Tilla Durieux und des Malers Richard Ziegler aus der Exilzeit, ebenso wie zeitgenössische Aufzeichnungen und Briefe unbekannterer Männer und Frauen. Diese subjektiv geprägten und womöglich durch fremde Überlieferungen verformten Darstellungen waren quellenkritisch zu überprüfen und in den größeren historischen Kontext einzuordnen. Dieser ließ sich zum Teil durch die Sekundärliteratur, vor allem aber durch die Akten der Flüchtlingsorganisationen, Außenministerien und Geheimdienste in verschiedenen Ländern rekonstruieren. Alles, was hier erzählt wird, das sei ausdrücklich betont, ist aus den primären Quellen gearbeitet. Nichts wurde erfunden und kein Zitat verändert, um den Erzählfluss oder Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Lediglich die Rechtschreibung wurde stillschweigend korrigiert.
Viele Betroffene sprachen von sich selbst als «Emigranten», obwohl dieser Begriff in manchen Ohren so klingt, als hätten sie ihre Heimat freiwillig verlassen, was nicht der Fall war. Zutreffender wäre es wohl, sie als «Exilanten» zu bezeichnen, was den Umstand von Vertreibung und Verbannung korrekter abbildet. Die Wissenschaft hat terminologische Unterschiede noch nicht abschließend geklärt. Ein Großteil der Fachliteratur verwendet – so wie unser Buch – «Emigration» und «Exil» tendenziell synonym.
Wenngleich die Dinge heute ganz anders liegen als in den dreißiger Jahren, drängen sich immer wieder bedrückende Parallelen zur Gegenwart auf. Wer sich mit Flucht und Exil beschäftigt, begegnet – damals wie heute – dem Mut der Verzweifelten, der skrupellosen Gier der Schleuser, lebensgefährlichen Grenzübertritten auf der Balkanroute, Überfahrten auf seeuntüchtigen Schiffen und Havarien sowie nicht zuletzt den Argumenten der Zielländer dafür, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen oder auf anderen Kontinenten unterzubringen.
Zu guter Letzt: «Odyssee» ist ein Quellenbegriff, der in sehr vielen Briefen und Berichten der Betroffenen auftaucht. In der griechischen Sage endete die abenteuerliche Irrfahrt für den Helden glücklich – für viele unserer Protagonisten tat sie das nicht.
FLUCHT
Berlin, 31. März 1933
Anhalter Bahnhof
Am letzten Abend des März 1933 drängten zu später Stunde noch viele Menschen in die Eingangshalle des Anhalter Bahnhofs. Hoch oben an der gelben Backsteinfassade rückten die Zeiger der großen Uhr beharrlich gegen 23 Uhr vor. Tilla Durieux wollte unbedingt noch den D-Zug nach Prag erreichen. Keine Viertelstunde zuvor war im Theater an der Stresemannstraße der Vorhang für Max Alsbergs Theaterstück «Konflikt» gefallen, in dem sie als gefeierter Bühnenstar eine Hauptrolle spielte.
Es war an diesem Freitagabend kühl geworden, der April kündigte sich mit wechselhaftem Wetter, auffrischenden westlichen Winden und leichten Schauern an. Vom Theater an der Stresemannstraße zum «Anhalter» am Askanischen Platz war es nur ein Katzensprung, auf den Straßen ging es lebendig zu. Restaurants und Hotels, Kinos, Kabaretts und Künstlercafés waren voll; die Menschen stimmten sich auf das Wochenende ein.
Schlank und hochgewachsen, mit alterslosem Gesicht, hätte man die zweiundfünfzigjährige Tilla Durieux für jünger gehalten. Mit eiligen, federnden Schritten steuerte sie auf die Empfangshalle mit den drei hohen Rundbögen und den beiden grün patinierten Kupferfiguren zu, den Allegorien von «Tag» und «Nacht». Der weit über die Grenzen der Hauptstadt bekannte «Anhalter» war einer der größten und höchsten Bahnhöfe auf europäischem Festland. Allein sein gewölbtes Wellblechdach überspannte eine Fläche, die noch breiter war als die Prachtstraße Unter den Linden. Der Repräsentationsbau aus der Gründerzeit galt als architektonisches Meisterwerk und Symbol des aufstrebenden Wirtschaftsbürgertums in der Hochmoderne.
Wie zu fast jeder Tages- und Nachtzeit herrschte auch an diesem Abend ein unfassbares Gewühl in der Eingangshalle. Dort glänzten warme Gold-, Beige- und Brauntöne auf geometrischen Mosaiken, mächtigen Bronzeleuchtern und einer geschwungenen hellen Marmortreppe. An den mit Terrakotten und Ornamenten verzierten Wänden prangten Medaillons mit Städtewappen; auf hohen, rotmarmorierten Doppelsäulen thronten Skulpturen, die Wissenschaft und Industrie verkörperten.
Anhalter Bahnhof, 1933
Stündlich ergossen sich Massen an Reisenden aus den Abteilwagen auf die Bahnsteige und in das hallenartige Vestibül, Abholer hielten Schilder mit den Namen von Hotels in die Höhe, Kofferträger und Wurstverkäufer riefen laut nach Kundschaft. Dazu schoben sich eine Menge Leute, die gar nicht abreisen wollten, durch den Bahnhof, und das nur, wie ein Lokaljournalist vom «Berliner Tageblatt» vermutete, um den «ludrigen Geruch des Abenteuers» zu schnuppern.[1]
Statt Fernweh und Reisefieber lagen heute Beängstigung und Besorgnis in der Luft. Die hohen elektrischen Bogenlampen, Produkt preußischer Ingenieurskunst, brachten schon seit Jahren kaum noch Licht in die Düsternis der riesigen Bahnhofshalle. Qualm und Ruß hatten die vormals warmgelben Klinker grau-schwarz verfärbt. Das Rattern und Pfeifen der Züge verschmolz mit dem Stimmengewirr zu einer undurchdringlichen Lärmkulisse. Und wenn die Lokomotiven rasselnd und zischend Dampf abließen, erfüllte der Geruch von Kohle und heißem Öl die «Mutterhöhle der Eisenbahn», wie sie der Philosoph Walter Benjamin nannte.
Tilla Durieux hastete am Eingang des «Excelsior»-Tunnels vorbei, des ehemals längsten Hoteltunnels der Welt, und drängelte sich zwischen Wärterhäuschen, Auskunftsschalter, Trinkwasserbrunnen, Zeitungskiosk und elektrischen Gepäckaufzügen zu den Sperren der Fahrkartenkontrolle durch. Mit knapper Not erreichte sie den Nachtexpress Berlin – Dresden – Prag – Wien, planmäßige Abfahrt 23:07 Uhr, Gleis 2. Dort wartete ihr Mann Lutz, der furchtbar aufgeregt war. Er hatte nur zwei leichte Handkoffer mit dem Nötigsten bei sich. Die Waggons waren voll besetzt, besorgte Mienen und verängstigte Blicke schlugen den beiden entgegen. Tilla Durieux sah etliche Bekannte in den Abteils, darunter die Theaterdirektoren Rudolf Bernauer und Carl Meinhard, den Essayisten und Theaterkritiker Alfred Polgar sowie den Chefredakteur des «Berliner Tageblattes» Theodor Wolff, mit dem sie befreundet war.[2] Ihr war sogleich klar, teilte sie ihrem Tagebuch mit, «dass eine entsetzliche Zeit kommt».[3]
Gerade schien sich das Leben nach schwierigen Jahren voller persönlicher und professioneller Krisen wieder einigermaßen zu normalisieren. Sie hatte eine hässliche Pressekampagne, einen Selbstmordversuch sowie den gesellschaftlichen Absturz und finanziellen Ruin ihres dritten Ehemannes Ludwig Katzenellenbogen überstanden. «Was war das für ein schreckliches Jahr?», schrieb sie am Silvestertag 1932 in ihren Kalender. «Aber es ist nun gut verlaufen, und alle schrecklichen Drohungen sind nicht wahr geworden.» Die Geldsorgen ließen nach, und auch die private Beziehung stabilisierte sich. Nach einer längeren Unterbrechung hatte sie wieder begonnen, Theater zu spielen, und erntete, wer hätte das gedacht, glänzende Kritiken. «Überhaupt, dieser Erfolg war von Gott gesandt. Habe uns damit sehr genützt.»[4]
Noch während sie an diesem 31. März auf der Bühne stand, erhielt Kurt Raeck, der Geschäftsführer des Theaters an der Stresemannstraße, eine telefonische Warnung. Ein SA-Mann drohte, das Theater gewaltsam zu schließen, wenn dort weiter Juden aufträten. Der Direktor, Alfred Fischer, hatte sich, weil er Jude war, bereits zuvor aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen. Denn auf die «Kulturjuden» in den Redaktionen, Verlagen und Schauspielstätten hatten es die Nationalsozialisten besonders abgesehen. Aber auch nach Tilla Durieux, die katholisch war, wollte sich der Anrufer gründlich erkundigen. Die Nationalsozialisten unterstellten ihr (fälschlich) eine kommunistische Gesinnung. Zudem war ihr prominenter Ehemann, der Unternehmer Ludwig Katzenellenbogen, jüdischer Herkunft, wenngleich längst protestantisch getauft. «Die Theater-Abteilung des Polizeipräsidiums riet zu einer vorübergehenden Schließung [des Theaters], da mit einer Störung zu rechnen sei», erklärte Raeck nach dem Krieg. Er sorgte dafür, dass die gefährdeten Mitglieder des Ensembles noch in derselben Nacht ausreisen konnten.[5]
Joseph Goebbels, Minister für Volksaufklärung und Propaganda, notierte an diesem letzten Abend im März befriedigt in sein Tagebuch, die Welt werde «morgen … ein Wunder sehen».[6] Die NSDAP hatte für den 1. April einen «Juden-Boykott» angekündigt und über die Presse erklären lassen, eine «letzte Frist» für «die noch in den Niederungen des Propagandageistes verharrenden Kreise des Auslandes», also die Kritiker der antijüdischen Maßnahmen, sei verstrichen.[7] Neben Theater- und Musikprogrammen klebten bereits antisemitische Aufrufe an den Litfaßsäulen. Erst eine Woche zuvor hatte am 23. März das Ermächtigungsgesetz den Reichstag passiert; die parlamentarische Demokratie war abgeschafft.
Die NSDAP hatte nie Zweifel daran gelassen, dass sie die Juden als Grundübel sämtlicher Probleme in der Welt betrachtete. In Deutschland lebten zu diesem Zeitpunkt rund 525.000 Jüdinnen und Juden, etwa ein Prozent der Bevölkerung. «Ohne Ausscheidung des Judentums und Überwindung seiner Wahnideen», erklärten die «Nationalsozialistischen Monatshefte» in ihrer Januarausgabe 1933, werde es «keine Genesung des deutschen Volkes» geben.[8] Seitdem schwoll die antisemitische Hetze an, es kam zu gewalttätigen Übergriffen. Über den Kurfürstendamm zogen Horden, die «Juden raus!» und «Juda verrecke!» brüllten. Jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien wurden verwüstet.
Viele bekannte Schauspieler, Kabarettisten, Theaterkritiker und Bühnenautoren verließen Deutschland, unter ihnen Alfred Kerr, Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann und Harry Graf Kessler. Erwin Piscator, Bertolt Brecht und Helene Weigel waren bereits am Morgen nach dem Reichstagsbrand geflohen; Max Reinhardt reiste wenig später ebenfalls aus. In den folgenden Monaten mussten bis zu sechzehntausend darstellende Künstler verschiedener Sparten aufgrund antisemitischer Gesetze ihren Beruf aufgeben.[9]
Dabei hatten es die Anhänger Hitlers zunächst schwer gehabt, sich in Berlin durchzusetzen, wo noch das liberale, progressive Klima der «Goldenen Zwanziger» nachhallte. Die nach London und New York drittgrößte Stadt der Welt wirkte auf Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle wie ein Magnet; die Zahl der Zeitungen, Verlage, Musik-, Film- und Sprechtheater, Varietés, Tanzcafés und Restaurants explodierte. Die bis dato muffige preußische Hauptstadt verwandelte sich in eine vibrierende Metropole, die alles Neue begierig und unersättlich aufnahm, und so zeigte sich Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik kosmopolitisch, avantgardistisch, schlaflos und ein bisschen dekadent. Erst als Reichskanzler Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannte und Joseph Goebbels einen Fackelzug durch das Brandenburger Tor schickte, schlug die Stimmung um. «Berlin ist heute Nacht in einer reinen Faschingsstimmung», notierte der Publizist Harry Graf Kessler. «SA- und SS-Trupps sowie uniformierter Stahlhelm durchziehen die Straßen … der ganze Platz ist gepfropft voll von Gaffern.»[10] Zahlreiche Oppositionelle, Theaterleute, Journalisten, Schriftsteller, Künstler und Rechtsanwälte flohen ins Exil. Als die Nationalsozialisten nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 systematisch Jagd auf Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter und bald auch auf Anhänger der «Systemparteien» machten, ließen immer mehr politisch Verfolgte Beruf, Wohnung und Besitz zurück, um über die nächste Grenze zu entkommen. Nicht wenige waren zugleich wegen ihrer jüdischen Herkunft in Gefahr. Bis Ende 1933 flohen etwa 3500 Personen wegen politischer und weitere 37.000 aufgrund antisemitischer Verfolgung aus Deutschland, die meisten nach Frankreich, Holland, Belgien, Österreich, die Tschechoslowakei und die Schweiz.[11]
Vom Hauptportal des Anhalter Bahnhofs bis zur Kreuzberger Hedemannstraße, wo die SA-Zentrale für Berlin-Brandenburg lag, waren es kaum zweihundert Meter. Die paramilitärische Kampftruppe der NSDAP hatte seit der Weimarer Zeit mit Straßen- und Saalschlachten sowie Bomben- und Mordanschlägen Angst und Schrecken verbreitet. Mittlerweile unterstanden Polizeiapparat und Sondereinheiten dem preußischen Innenminister Hermann Göring, der SA, SS und Sicherheitskräfte mit weitgehenden Vollmachten ausstattete, um die Stadt systematisch von unerwünschten Künstlern, Intellektuellen und politischen Gegnern zu «säubern». Politiker, Parteileute, Gewerkschafter, Schriftsteller und Journalisten mussten mit Racheakten und Verhaftung rechnen. SA-Trupps durchkämmten Straßen und Mietskasernen, ließen tausende in Folterkellern, «wilden» Gefängnissen und Konzentrationslagern verschwinden. Die Schreie der in der SA-Zentrale Gefangenen waren bis auf die Straße zu hören. Sie wurden bei den «Verhören» geschlagen, gefoltert und zu Scheinhinrichtungen abgeführt. Etwa fünfhundert bis sechshundert Oppositionelle wurden bereits in den ersten Wochen der NS-Herrschaft ermordet.
Als sich der Nachtexpress an diesem letzten Abend des März 1933 pünktlich in Bewegung setzte und im Schritttempo fauchend am Bahnhofsvorsteher mit der roten Mütze und dem erhobenen Abfahrtssignal vorbeirollte, gingen Seufzer der Erleichterung durch die Abteile. Aber die Anspannung blieb, zumal kurz vor Dresden ein Trupp Hilfspolizisten zustieg. Tilla Durieux war «halb tot vor Angst um Lutz», als die Männer «Gang frei – Konfession??» riefen.[12] «Wer nicht befriedigend Auskunft geben konnte, oder wem man nicht glaubte, der wurde aus dem Zug gezerrt», erinnerte sie sich. Da hieß es Nerven behalten. «Ich bezeichnete mich lächelnd als katholisch, und L.K., der protestantisch getauft war, verlor äußerlich nicht seine Ruhe.»[13] Seltsamerweise nahm keiner Anstoß an seinem jüdischen Namen. So verblieben die beiden mit wenigen anderen, eingeschüchtert und schweigend, im Zug. Etwa hundertfünfzig Männer, Frauen und Kinder mussten in dieser Nacht jedoch aussteigen, unter ihnen auch Beatrice Zweig, die zu ihrem Mann Arnold nach Prag reisen wollte. In einer SA-Kaserne verbrachte sie die Stunden bis zum Morgen, ehe man sie zurück nach Berlin schickte.[14] Tilla Durieux und Ludwig Katzenellenbogen aber zogen «mit zwei Handkoffern und den erlaubten zweihundert Mark pro Person … ins Ungewisse».[15]
Ein Theaterstar verlässt Berlin
Drei Jahrzehnte herausragender Bühnenerfolge lagen hinter Ottilie Helene Godeffroy, die 1880 in Wien zur Welt kam. Die Schauspielkunst war der Tochter eines viel beschäftigten Chemieprofessors und einer Pianistin keineswegs in die Wiege gelegt. Jedoch war ihr die gutbürgerliche Welt ihrer hysterischen Mutter und ihres unnahbaren Vaters früh zu eng geworden. Sie floh in kindliche Traumwelten und Rollenspiele. Den «guten Namen» der Familie musste sie aufgeben, um eine Bühnenausbildung durchzusetzen. Nach ihrer Großmutter väterlicherseits nannte sie sich nun Tilla Durieux.
«Keine Erscheinung für die Bühne», hatte ihr ein Theatermann zu Beginn ihrer Bühnenlaufbahn attestiert. Denn sie entsprach dem zeitgenössischen Schönheitsideal graziler blonder Feengestalten mit Kussmund nicht. Stattdessen, so schrieb ein Biograf: «großer Kopf mit hohen, slawischen Wangenknochen, vollen Lippen und einer ausgeprägten Nase; dazu Mandelaugen, ein dunkler Teint und ein Helm aus schwarzen Haaren».[16] Trotzdem, oder gerade deswegen, konnte sie mit ihrer außergewöhnlichen darstellerischen Begabung überzeugen. Die Hauptrolle der Salome, inszeniert von der Ikone des modernen Theaters Max Reinhardt, brachte der Dreiundzwanzigjährigen den Durchbruch zu einer der meistgefeierten Bühnen- und später Stummfilmschauspielerinnen ihrer Epoche. Mit ihrer weichen, biegsamen, fraulichen Erscheinung, den schlangenhaften Bewegungen sowie einer voll, geschmeidig und melodiös klingenden ausgebildeten Stimme verfügte sie über eine schier unbegrenzte Ausdrucksfähigkeit. Ein Kritiker lobte: «Diese Darstellerin kann königlich schön und hexenhaft hässlich aussehen.»[17]
Über die Jahre spielte sie in allen wichtigen Theatern Europas. Auch weil sie in erster Ehe mit einem Maler und in zweiter mit einem berühmten Kunsthändler verheiratet war, wurde sie zu der am häufigsten abgebildeten Frau ihrer Epoche. Sie stand den begehrtesten Malern und Bildhauern Modell, unter anderen Franz von Stuck, Auguste Renoir, Max Slevogt, Max Liebermann, Oskar Kokoschka und Ernst Barlach.[18]
Was Konservative, national Denkende und Nationalsozialisten seit langem störte, war ihre Verwurzelung in der kosmopolitischen Avantgarde. Die Durieux erschloss ihre Rollen durch den Verstand, durch «eine Intelligenz, die haarscharf sieht, blitzschnell erfasst und rücksichtslos die Konsequenzen zieht», so ein Kritiker.[19] Ihre Spielweise verzichtete auf Pomp und Pathos, strahlte vielmehr eine ihr eigene Nüchternheit und Kühle aus, die manche Kritiker zeitgemäß, andere allerdings seelenlos fanden. «Man kennt für das, was modern heißt, keine vollkommenere Vertreterin», befand der Schriftsteller Heinrich Mann. Sie schlüpfte in jede Rolle, war «Weltdame, Kaiserin, Luder, Heldin der Zeit und Heldin der Nerven».[20]
Mit dreiundzwanzig Jahren lernte sie den neun Jahre älteren Kunsthändler und -verleger Paul Cassirer kennen, um dessentwillen sie den Maler Eugen Spiro nach nur einjähriger Ehe verließ. Cassirer stammte aus einer vermögenden jüdischen Unternehmerfamilie aus Breslau, deren zahlreiche Nachkommen mittlerweile clanähnlich mit dem wilhelminischen Establishment in Berlin vernetzt waren. Der geschiedene Mittdreißiger imponierte mit sprühendem Intellekt und smarter Weltgewandtheit, etwas, wonach sich die junge Schauspielerin seit langem sehnte.[21] Der mondäne Kunsthändler, Liebhaber guter Weine und Zigarren, war ebenso geistreich und witzig wie eloquent und konnte eine ganze Abendgesellschaft stundenlang unterhalten. Zwischendurch pflegte er sein Gegenüber mit distanziertem, leicht abschätzigem, manchmal aber auch eher verschmitztem Blick aus den Augenwinkeln zu taxieren. Er war kräftig gebaut mit großem Kopf und breiter Stirn; die schmale Nase mit den weiten Nüstern gab ihm etwas Vogelartiges. Tilla war dem berühmten Mäzen der Moderne auf selbstzerstörerische Weise verfallen; 1910 haben die beiden nach jahrelanger Beziehung geheiratet.
Cassirer zählte zu den wichtigsten Förderern der Klassischen Moderne in Deutschland, einer Kunst, die manche Kreise als undeutsch, wenn nicht als «entartet» brandmarkten. Unter anderen stellte er Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Max Liebermann, Max Slevogt, Lovis Corinth, Edvard Munch und den damals noch verkannten Vincent van Gogh aus. So machte er die Impressionisten, die «französische Dreckkunst», wie schon Kaiser Wilhelm ätzte, ebenso wie nachfolgende Strömungen in Berlin salonfähig. In seinen Ausstellungs- und Verlagsräumen in der Victoriastraße 35 gingen Maler, Bildhauer, Dichter und Intellektuelle ein und aus, und wer im Berliner Großbürgertum auf sich zählte, kaufte bei Cassirer mindestens ein Gemälde. Aus der Zeit ihrer Ehe mit Cassirer stammte Tillas Privatsammlung moderner Kunst, deren Überbleibsel heute im Zagreber Stadtmuseum ausgestellt sind. «Das war für mich einer, der mich in eine andere Welt geführt hat, in die Welt, die ich mir erträumt habe, nämlich in die Welt der Kunst, der wirklichen Kunst.» Paul Cassirer wurde Tillas schonungslosester Kritiker und ehrgeizigster Förderer. «Ihm verdanke ich eigentlich alles, was ich bin und wurde.»[22]
Während des Ersten Weltkriegs wurden der Frontkämpfer Paul und seine Frau Tilla zu Pazifisten. Die Grande Dame des Berliner Theaterlebens hegte Sympathien für die Arbeiterbewegung, unterstützte Rosa Luxemburg und versteckte den wegen Hochverrats gesuchten Revolutionär und Schriftsteller Ernst Toller. Der sechsundzwanzigjährige Pazifist spielte eine führende Rolle in der Münchner Räterepublik und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD). Er und viele andere berühmte Sozialdemokraten und Sozialisten gingen bei Cassirer ein und aus, unter ihnen Rudolf Breitscheid, Rudolf Hilferding und Karl Kautsky. Der Durieux brachte das später gehässige Artikel in der braunen Presse sowie einen Eintrag in der Feindkartei des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) ein.[23]
Einer der Vorwürfe, den ihr die Rechte machte, war, dass sie Ende der zwanziger Jahre ein experimentelles Theaterprojekt förderte, das der junge Regisseur Erwin Piscator aufzog. Mit ihrer Unterstützung konnte er die Bühne am Nollendorfplatz mieten und dort gesellschaftskritische Stücke von Bertolt Brecht, Leo Lania und Egon Erwin Kisch aufführen. Piscators Inszenierungen, bei denen er Fotos und Filmausschnitte auf die Bühne projizierte, revolutionierten das Theatergeschehen wie sonst keine in ihrer Zeit.[24]
Während sich Paul Cassirer politisch in der USPD engagierte, trat die Durieux in keine Partei ein, wollte sich in kein weltanschauliches Korsett zwängen lassen.[25] Sie führte ein mondänes, luxuriöses und extravagantes Leben, steckte tief in gesellschaftlichen Konventionen. «Kommunist sein, heißt … Aufgeben aller Dinge, die wir besitzen, das einfachste und bescheidenste Leben führen.» Sie «tauge nicht zur Kommunistin», erklärte sie, denn «praktisch sind wir … noch nicht reif, um auf alles zu verzichten.» Kurzum: Mit zwei Häusern, zwei Autos und einem Papagei «kann man nicht Kommunist sein».[26]
Als Prototyp einer emanzipierten Neuen Frau war sie für konservative Kreise eine Reizfigur: Stark, unabhängig und beruflich erfolgreich, hielt sie Vorträge über die «Beseitigung der gesellschaftlichen Schranken».[27] Mit kurzen Haaren, Zigarette und Pariser Chic erschien sie als Rollenmodell wider die traditionelle Geschlechterordnung. Zeitschriften wie die «Bühne» und die «Moderne Welt» präsentierten sie als Trendsetterin. «Es wurde geradezu Mode, so auszusehen wie die Durieux», schrieb die Presse.[28]
Tilla Durieux und Paul Cassirer gehörten zu den aufregendsten und schillerndsten Paaren der Berliner Gesellschaft. Allerdings besaß der faszinierende Cassirer auch eine dunkle, narzisstische Seite, teils bedingt durch ein schweres Nervenleiden. Immer übermüdet und überreizt, konnte er jähzornig, herrisch, egoistisch und rücksichtslos sein; seine Lippen nahmen dann einen grausamen Zug an. Noch dazu war er ein notorischer Frauenheld; seine Eskapaden wirkten mit zunehmendem Alter grotesk. Vor allem seine Unzuverlässigkeit und Untreue zehrten an Tillas Nerven, auch wenn sie ihn liebte, «wie ein Mensch nur einmal lieben kann». Zuletzt erzeugten Pauls Launen und Extrovertiertheit in ihr Gefühle von Verlassenheit und Verrat. In ihren Erinnerungen schrieb sie, sie verdanke ihm «die schönsten … Stunden, … aber auch den tiefsten Kummer».[29]
«Der ewige Jude»
Tillas Ehe mit Paul Cassirer steckte in einer schweren Krise, als sie im Sommer 1925 Ludwig Katzenellenbogen näherkam, Generaldirektor des zweihundertfünfzig Millionen Reichsmark schweren Ostwerke-Schultheiß-Patzenhofer-Konzerns, einem der einflussreichsten Männer der deutschen Wirtschaft. Er stammte aus einer mittelständischen jüdischen Unternehmerfamilie aus Posen und war in der Inflationszeit mit Börsenspekulationen und Geschäftsbeteiligungen in Berlin reich geworden. Zu seinem Firmenimperium gehörten Hefe-, Sprit- und Zementfabriken, Glas- und Maschinenwerke, Mühlen und Bierbrauereien. Ende der zwanziger Jahre war er einer der reichsten Unternehmer in Deutschland. Seine Aktionäre strichen fünfzehn Prozent Dividende ein; sein privates Aktienvermögen wurde auf fünfundzwanzig Millionen Reichsmark geschätzt. Tilla bewunderte Lutzens «aufregendes Börsenspiel», bei dem man «mit kühlem Kopf» so viele verschiedene Fäden in der Hand halten musste und dabei unfassbar reich wurde.[30]
Ludwig Katzenellenbogen war ein gut aussehender, sympathischer Endvierziger mit einem freundlichen Gesicht; das dunkle, schüttere Haar trug er über hoher Stirn straff nach hinten gekämmt. Er war etwas kleiner als Tilla, aber ebenso sportlich. In seiner Freizeit traf man ihn häufig in Knickerbockern auf dem Golfplatz an. Mit seiner Frau Estella, Inhaberin mehrerer Blumengeschäfte, hatte er drei gemeinsame Kinder großgezogen. Wie viele andere deutschjüdische Bankiers- und Unternehmerfamilien, etwa die Mendelssohn, Oppenheim, Warschauer, Simson und Kempner, waren er und seine Frau zum Protestantismus übergetreten und erzogen Sohn und Töchter im christlichen Glauben.
Das Verhältnis der beiden Ehepaare aus der Berliner High Society begann rein geschäftlich und gesellschaftlich. Die kunstinteressierten Katzenellenbogens erwarben diverse Werke bei Paul Cassirer, obwohl sie, wie sich ihr Sohn mokierte, so gar nicht in ihre großbürgerliche Villa am Tiergarten voller neureicher Geschmacklosigkeiten passen wollten. Moderne Gemälde von Manet, Monet, Van Gogh und Cézanne hingen auf schokobraunen, dunkelgrünen und ockergelben Seidentapeten neben Schränken und Truhen aus Mahagoni und Palisander, Meißner Figurinen und chinesischen Fayencen.[31]
Der erfolgreiche Großindustrielle revanchierte sich für die Kunst mit praktischen Ratschlägen, wie das Vermögen des Ehepaares Cassirer-Durieux vorteilhaft anzulegen sei. Ansonsten machte er zunächst wenig Eindruck auf die berühmte Actrice; die beiden fanden kaum Gesprächsstoff. Erst nach und nach kamen sie sich näher, und sie gewann den reichen Unternehmer dafür, die revolutionäre Piscator-Bühne für eine Weile finanziell zu unterstützen.
Katzenellenbogen umwarb sie mit seiner ruhigen, ausgeglichenen Art. Er bot ihr eine Schulter zum Anlehnen und eine seelische Heimat, die sie in ihrer Ehe nicht mehr fand. Die beiden stürzten sich in eine Affäre, über die sich halb Berlin das Maul zerriss. Erst jetzt fasste Tilla Durieux den Mut, sich von dem einst so bewunderten Paul Cassirer zu trennen, mit dem sie sich einsam fühlte und dessen sexuelle Hyperaktivität, ausgefallenen erotischen und sadistischen Neigungen sie abstießen.[32] Ludwig Katzenellenbogen gab ihr stattdessen endlich wieder das Gefühl, gesehen, geachtet und geliebt zu werden. Eine Amour fou wie mit Cassirer kam ihr überhaupt nicht mehr in den Sinn.[33]
Noch lange hatte sie Gewissensbisse, weil sich der unter schweren Depressionen leidende Cassirer im Januar 1926 beim Scheidungstermin erschoss. Dann fielen auch noch seine Familie und die skandalhungrige Öffentlichkeit über sie her. «Neider und Hasser» krochen aus ihren Löchern, «man konnte sich nicht genugtun in Gehässigkeiten, übler Nachrede». Als sie sich mit dem Schlüsselroman «Eine Tür fällt ins Schloss» mit intimen Details den Kummer von der Seele schrieb, hagelte es Verrisse voller Spott und Häme. Bekannte zogen sich zurück, und solange der Sturm der Entrüstung durch den Boulevard fegte, blieben die Engagements aus.[34] Mit über fünfzig war sie für manche Rolle allerdings auch zu alt, und manchmal fragte sie sich, wie lange sie den Herausforderungen des Theaterdaseins noch gewachsen sein würde. Seit längerem fühlte sie sich erschöpft und ausgebrannt.
Obwohl bereits ganz Berlin über sein Verhältnis mit der prominenten Schauspielerin Durieux tuschelte, scheute Ludwig Katzenellenbogen die finanziellen Folgen einer Scheidung nicht weniger als den rufschädigenden Skandal. Der prominente Großindustrielle verkehrte in höchsten gesellschaftlichen Kreisen, das brachte gewisse Verpflichtungen mit sich. Geordnete Familienverhältnisse waren ebenso Grundlage des Erfolgs wie ein dichtes Netzwerk sozialer Beziehungen innerhalb der Berliner Wirtschafts- und Finanzelite. Aber Tilla, so schrieb sie, war «nicht für ein Verhältnis geschaffen, das sich nur auf einige Stunden des Tages beschränkte und geheim gehalten werden musste».[35] Sie war eifersüchtig auf die legitime Noch-Ehefrau Estella und gekränkt. Erst als sie mit Trennung drohte, ließ sich Lutz scheiden. Am 28. Februar 1930, um zwölf Uhr, wurde in London heimlich geheiratet, «nach vier Jahren Warten und Kummer – endlich», vertraute sie dem Tagebuch an. Aber es lag ein Schatten auf der Verbindung. «Mir war sehr traurig zu Mut … Warum nicht früher?»[36]
Tilla Durieux und Ludwig Katzenellenbogen, um 1930
Es waren noch keine drei Wochen seit der Hochzeit vergangen, da «fingen schon Schwierigkeiten an».[37] Während der Weltwirtschaftskrise war Lutzens Konzern ins Schlingern geraten. Als 1929 die Börsenkurse sanken, handelte er bei den Großbanken Millionenkredite und Stützungskäufe firmeneigener Aktien aus. Bald würde sich die Wirtschaft erholen, glaubte er, und so traf er eine risikoreiche Vereinbarung: Der Konzern werde die Anteile, die die Kreditinstitute zum Schein erwarben, um den Konkurs abzuwenden, unabhängig von der Kursentwicklung zu einem fixen Termin zum Einkaufspreis zurücknehmen. Dass dies gegen das Aktienrecht verstieß, störte weder ihn noch die Aufsichtsräte seiner Firma, geschweige denn die Direktoren der Banken, die mit solchen illegalen Transaktionen stattliche Gewinne machten.
Als sich die rasante Talfahrt der Börse beschleunigte, griff Katzenellenbogen zu weiteren Stützungskäufen. Im Herbst 1931 trat die Rücknahmegarantie der Aktien in Kraft, da waren sie nur noch einen Bruchteil ihres Einkaufspreises wert. Sechsunddreißig Millionen Reichsmark waren verbrannt. Auch das persönliche Vermögen Katzenellenbogens und das seiner Frau Tilla, auf das er sich unter einem Vorwand Zugriff verschafft hatte, reichten nicht aus, um die exorbitanten Schulden noch zu bedienen. So wurde der einst gefeierte Finanzjongleur gezwungen, den Ruin zu erklären und als Generaldirektor abzudanken. Dass die Bankdirektoren und Unternehmensvorstände von den Schiebereien gewusst hatten, half ihm nichts. Sie alle suchten einen Sündenbock und zeigten mit dem Finger allein auf Lutz. «Feige Hunde alle zusammen», empörte sich Tilla.[38]
Katzenellenbogen wurde verhaftet und daraufhin wegen Bilanzfälschung, Prospektbetrug und Untreue angeklagt. Er war verzweifelt, wusste weder ein noch aus und Tilla noch weniger. Jeder Tag brachte neue Hiobsbotschaften, alles Vermögen wurde gepfändet. «Bin fest entschlossen, … (m)einem Leben ein Ende zu machen, das zu schwer war und ist», schrieb sie im Oktober 1931 in ihr Tagebuch. «Hätte ich es nur schon früher getan. Aber man ist töricht und hofft.»[39] Denn während sie nach Wegen aus der Misere suchte, kam heraus, dass «Lutz mich wirklich belogen hat die ganzen Jahre», wenigstens in finanziellen Dingen.[40] Sie verbrachte ganze Tage bei Rechtsanwälten, verkaufte Bilder ihrer Sammlung, trieb hunderttausend Reichsmark Kaution auf. Manch einer riet ihr, die teuren Gemälde zu nehmen und fortzulaufen. Aber sie zögerte, «weil ich mich schämte, nach so kurzer Ehe, die soviel Staub aufgewirbelt hatte, die Segel zu streichen».[41] «Enttäuscht, belogen und betrogen wie noch nie im Leben», beschloss sie das Jahr 1931.[42]
Als Anfang 1932 der Prozess gegen Ludwig Katzenellenbogen und vier weitere mächtige Wirtschaftsführer begann, war Tilla Durieux die Erste, die im Moabiter Kriminalgericht durch die großen Flügeltüren schritt und im Zuschauerraum Platz nahm. «Mit angestrengter Spannung» verfolgte sie die Verhandlung, berichtete die Journalistin Ola Alsen. Meist hatte sie die Beine ganz untheatralisch übereinandergeschlagen, den Oberkörper ein wenig nach vorn gebeugt, die Hände ineinandergeschlungen. Stets brachte sie eine Thermoskanne mit Suppe mit, die Lutz in der Pause aus einer Aluminiumschüssel löffelte.[43]
Derweil drängelten sich zahlreiche Schaulustige und Journalisten im Foyer. Politik und Publikum suchten nach den Verantwortlichen für die Verwerfungen der Weltwirtschaftskrise.[44] Im März 1932 zählte Berlin mehr als sechshunderttausend Arbeitslose, jeder Zweite suchte einen Job, während die Zahlen weiter stiegen.[45] Die Weimarer Demokratie fand keine wirksame Rezeptur gegen die Misere, und da kam es den Gegnern der Republik gelegen, dass der Hauptangeklagte (obwohl längst konvertiert) als Jude galt.
Katzenellenbogen konnte zugleich das scheiternde System kapitalistischer Ausbeutung und das Schreckgespenst eines raffgierigen jüdischen Spekulanten repräsentieren. Die rechten Medien spießten das Zerrbild vom jüdischen «Aktienschieber», «Salonbolschewik und Finanzgauner» auf, der «mit erschwindeltem Gelde … Passionen der Frau Durieux» (die Piscator-Bühne) gesponsert habe. Die «Freiheit» zeichnete den Großindustriellen als gefallenen Repräsentanten des verrotteten Weimarer Systems, das die einfachen Leute ins Elend stieß.[46] Der antisemitische Publizist Johann von Leers, seit 1929 Mitglied der NSDAP, prangerte Ludwig Katzenellenbogen in seiner 1932 erschienenen Broschüre «Juden sehen Dich an» sogar mit einem Foto an.[47] Er schrieb, dass der «Fall Katzenellenbogen» die «Geldsackinteressen», das «Gift der Korruption» sowie eine «tiefe sittliche Erkrankung des Volkskörpers» zeige. Der Prozess diente ihm zur Generalabrechnung mit dem liberalen Wirtschaftssystem, weil «die Profitunmoral der kapitalistischen Gesellschaft jederzeit das Einfallstor für jüdische Korruption darstellt».[48]
Nach dem Machtantritt Hitlers griff die antisemitische Propaganda immer wieder auf Ludwig Katzenellenbogen zurück, um ihn als Vertreter einer jüdischen Ausbeuterelite zu brandmarken, die «an den leitenden Stellen des deutschen Wirtschaftslebens» saß.[49] So tauchte er im Begleitbuch zur Ausstellung «Der ‹ewige› Jude» auf, die 1937 in München und anschließend in zahlreichen anderen Städten gezeigt wurde. Es war eine der meistbesuchten Propagandaausstellungen in der NS-Zeit. Sie schilderte die Not und vermeintliche Verschwendung in der Weimarer Republik, hetzte gegen «verjudete» Gemälde und Skulpturen moderner Künstler sowie die angebliche Vorherrschaft jüdischer Rechtsanwälte und Wirtschaftsleute.
Katzenellenbogen vertrat seine Sache vor Gericht mit der «Geste der vollkommenen Unschuld und des guten Gewissens», schrieb die Presse. Tatsächlich hatte er nahezu sein gesamtes Vermögen verloren, zudem waren sein Amt als Generaldirektor und sein Ruf dahin.[50] «Er war zweifellos sein bester Verteidiger», fand auch die Journalistin Alsen. Sie würdigte Lutzens «bewundernswerte Haltung und Intelligenz». Nie habe er die Ruhe verloren, die Vorhaltungen geschickt pariert und dabei vollkommen aufrichtig gewirkt. «Man hatte bei ihm das absolute Gefühl, die Wahrheit zu hören.» Nur einmal, als er über seinen Sohn sprach, brach er in Tränen aus.[51] «Fange an, alles zu verzeihen», schrieb Tilla in ihr Tagebuch. «Habe große Zärtlichkeit für ihn. Armer Kerl.»[52]
Der Saal war überfüllt, als die bekanntesten Rechtsanwälte der Republik, Max Alsberg und Rudolf Dix, schließlich ihre Plädoyers hielten. Sie argumentierten, die Angeklagten hätten nichts gemacht, was im Wirtschaftsleben nicht gang und gäbe sei, und damit hatten sie sogar recht. Manch einer hatte in früheren Jahren mit gesetzwidrigen Machenschaften sein Geschäft retten können und wurde nie belangt. «Sein Misserfolg ist sein Verbrechen», schlussfolgerte die Presse.[53]
Für drei angeklagte Generaldirektoren endete der Prozess am 19. März 1932 mit einem Freispruch, ein weiterer erhielt eine geringfügige Geldstrafe. Lutz Katzenellenbogen wurde zu einer Zahlung von zehntausend Reichsmark sowie drei Monaten Gefängnis verurteilt, die er durch die U-Haft abgesessen hatte. Angesichts der in der Anklage erhobenen Vorwürfe war das am Ende wenig. Aber Lutz kehrte als gebrochener Mann in die Freiheit zurück. Erst an Heiligabend 1932 sprach er sich mit Tilla aus. «Lutz ist doch so, wie ich immer gehofft habe, nur eben schwach und verschüttet», hielt sie im Tagebuch fest. «Aber langsam rafft er sich auf, und der innerste Kern ist gut.»[54]
Auf Gedeih und Verderb
Seit ihrer überstürzten Flucht aus Berlin waren Tilla Durieux und Lutz Katzenellenbogen auf Gedeih und Verderb aneinandergekettet. «Am ersten Tag der Reise kam mir zum ersten Mal zum Bewusstsein, dass ich nun neben L.K. saß, den ich doch eigentlich Jahre vorher hatte verlassen wollen.» Aber das brachte sie nicht über sich, denn «er war zerbrochen und brauchte einen Menschen».[55]
So landete das Ehepaar Durieux-Katzenellenbogen zunächst in Prag, einer der ersten und häufigsten Anlaufstellen für Emigranten aus dem Reich. Die Tschechoslowakei hatte ihr demokratisches System – im Unterschied zu den meisten europäischen Staaten – beibehalten. Zudem verlangte sie von den Geflüchteten mit gültigem Pass kein Visum. Wer keinen hatte oder lieber unbemerkt einreisen wollte, marschierte durch bergiges, bewaldetes Gebiet über die Grenze, so wie der Schriftsteller Stefan Heym, der im März 1933 über einen verschneiten Kamm des Riesengebirges in das freundliche Nachbarland wortwörtlich einwanderte. Der tschechoslowakische Außenminister und spätere Präsident Edvard Beneš verteidigte im November 1933 im Parlament die liberale Migrationspolitik. Man werde noch stolz darauf sein, politischen Flüchtlingen aus Deutschland Asyl zu gewähren, und damit hatte er recht. Bis 1938 flohen bis zu zwanzigtausend Deutsche vor den Nationalsozialisten dorthin.[56] Viele dachten allerdings, nur die Tage um den antisemitischen «Boykott-Tag» herum im Ausland verbringen zu müssen, weil das Unwetter bald vorüberziehen werde. Tilla Durieux hingegen war nicht so optimistisch, erzählte sie später.[57]
Tatsächlich kam es am 1. April 1933 schlimmer als befürchtet. «Bereits um 8 Uhr morgens sah man die ersten Plakatträger, und gegen 10 Uhr klebten an den meisten jüdischen Geschäften die roten Anschläge mit der Aufschrift ‹Deutsche wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!›», berichtete die «Berliner Morgenpost». Größere SA- und SS-Kommandos stellten sicher, dass jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien schlossen und jüdische Besucher die Universität und die Preußische Staatsbibliothek nicht mehr betraten.[58] Derselben Ausgabe entnahmen die Leser, dass Hitler und Hindenburg die Ehrenbürgerwürde Berlins erhalten hatten, zudem gebe es ein neues, rückwirkend gültiges Gesetz, das «zum Schutz von Volk und Staat» die Todesstrafe vorsah.
Der gesamte Kultur- und Theaterbetrieb wurde nazifiziert. Hermann Göring übernahm als Preußischer Ministerpräsident die Berliner Bühnen und Joseph Goebbels die staatlichen Theater. Den Intendanten der Schauspielhäuser erklärte er: «Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählern-romantisch, sie wird sentimentalitätslos sachlich, sie wird national mit großem Pathos und sie wird gleichfalls verpflichtend und bindend sein, oder sie wird nicht sein.»[59] Modernes, geschweige denn experimentelles Theater würde es künftig nicht mehr geben. Na denn: «Prost!», schrieb Tilla in ihr Tagebuch.[60] Da der «Völkische Beobachter» Angriffe gegen sie druckte, gab es für die exilierte Schauspielerin kein Zurück nach Deutschland mehr. «Ich bin gänzlich mutlos, habe keine Kraft mehr», klagte sie am 2. Mai 1933 in ihren privaten Aufzeichnungen.
Die ersten Monate der Flucht mündeten für das Ehepaar Durieux-Katzenellenbogen in Verzweiflung. In Prag quartierten sich die beiden in einem billigen Hotel ein, es drückten finanzielle Sorgen. Zwar hatte das Gericht die Pfändungen von Tillas Besitz aufgehoben, aber um Anwälte und Gerichtskosten zu bezahlen, musste sie wertvolle Bilder und Schmuck verkaufen. Hinzu kam hässlicher Familienstreit über die finanziellen Folgen der Katzenellenbogen-Pleite. Im September 1933 schien alles verloren. «Wohin soll man gehen? Wie Geld machen?»[61]
Die einst so gefeierte Actrice versuchte, sich mit Gastspielen über Wasser zu halten, die sie durch die Schweiz, die Tschechoslowakei, Österreich und Jugoslawien führten. «Nur Augen zu und weiter stolpern. Vielleicht gibt Gott, dass ich im nächsten Jahr endlich krepiere, dann hätt’ ich endlich Ruh.»[62] Überraschenderweise hatte sie in Belgrad im Stück «Der Schatten» von Dario Niccodemi einen «unerhörten Erfolg. So ein Rasen noch nie gehört», hielt sie im Tagebuch fest. «Sehr begeistert» war das Publikum auch in Zagreb und in Linz. «Aber was nützt das.»[63]
Immerhin war am Ende der Theatersaison wieder etwas Geld in der Kasse, und so siedelte das Paar in die Schweiz über. Am Lago Maggiore hatten sich bereits etliche Künstler und Schriftsteller niedergelassen, unter ihnen Emil Ludwig, Viktoria Wolf und Erich Maria Remarque. Der Schriftsteller, den der Roman «Im Westen nichts Neues» reich gemacht hatte, war eine beliebte Anlaufstelle für Emigranten, vor allem mittellose. Tilla und Lutz mieteten sich in Ascona ein winziges Häuschen, Gläubiger und Steuerbehörden auf den Fersen. Allen Besitz in Deutschland, der nicht niet- und nagelfest war, versuchten sie zu verkaufen. Den Erlös ließen sie sich zwischen den Seiten nichtssagender Kataloge und Bücher per Post zuschicken. Van Goghs «Bahnübergang» ging in Remarques Sammlung über und schmückte fortan seine Villa.
Der Aufenthalt des Paares Durieux-Katzenellenbogen in der Schweiz war nicht von langer Dauer. Gegen Lutz lag ein Steckbrief vor, die eidgenössischen Behörden verweigerten ihm den Aufenthalt. Die beiden mussten das Land verlassen. «Sind außer uns. Was wird werden?»[64]
Heimatlos
Kommunist und Jude
Wie viele andere hatte sich auch der Psychologe und Therapeut Manès Sperber zunächst nicht entschließen können, Deutschland zu verlassen. Dabei war er als Jude und Kommunist besonders gefährdet. Am 15. März 1933 klingelte ihn ein Trupp SA-Leute und Polizisten in seiner Wohnung in der Berliner Künstlerkolonie Wilmersdorf aus dem Schlaf und nahm ihn fest. «Wenn Sie ein Köfferchen haben oder eine Aktenmappe, tun Sie Sachen hinein, die man für einige Tage braucht», sagte einer, ehe sein Kollege einwarf: «Kein Gepäck, Zahnbürste genügt … Alles ist zu viel für das Gesindel!»[1] Ein offener Lastwagen brachte ihn und etliche durch Schläge zugerichtete Männer ins Polizeigefängnis in «Schutzhaft». Als er dort zwischen mit Blut bespritzten Wänden in der Einzelzelle saß, machte er sich Vorwürfe. «Alles, was ich seit Monaten getan hatte, war unsinnig», warf er sich vor, «zuletzt der Entschluss, Deutschland nicht zu verlassen, sondern vorläufig dazubleiben.» Er malte sich Folter und Totschlag aus, verachtete sich wegen seiner Zögerlichkeit.[2]
Wie ein großer Teil der in Deutschland lebenden Juden war er unschlüssig gewesen, was die antisemitischen Übergriffe zu bedeuten hatten. Viele Menschen waren schließlich allein durch die NS-Rassepolitik als «Juden» markiert, während sie tatsächlich aus assimilierten oder zum Christentum konvertierten Familien stammten. Andere betrachteten sich zwar als «deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens», waren aber nicht besonders religiös und pflegten eventuell nur noch eine Familientradition. Es gab also viele Gründe zu finden, «dass die Nazis kein Recht hatten, uns ihre Perversion der Geschichte und Biologie aufzuzwingen», fasste der Historiker Peter Gay den Standpunkt seiner Eltern zusammen.[3] Und so mochte man sich gerne einreden, dass die Nationalsozialisten die Übergriffe einstellen würden, wenn sich ihr Siegestaumel erst einmal gelegt hätte.
Manès «Munjo» Sperber, Sohn eines Bankkaufmanns, war jetzt zweiunddreißig Jahre alt. Er wuchs in einer jüdischen Familie im ostgalizischen «Schtetl» Zabolotiv (Zablotów) auf, die streng nach der chassidischen Tradition des Glaubens und Betens lebte. Als jugendliche Leseratte entfernte er sich von der religiösen Hoffnung auf Erlösung vom irdischen Leiden und machte sich stattdessen zur Aufgabe, die Welt zu verbessern. «Unser messianisches Gegenstück hieß revolutionäre Aktivität», erklärte er.[4] Als sein Heimatort während des Ersten Weltkriegs wiederholt zur Kampfzone wurde, floh die Familie 1916 nach Wien. Dort erfuhr der Ostjude Sperber sozialen Abstieg und antisemitische Ablehnung, entdeckte aber auch neue geistige und politische Strömungen.
Als Halbwüchsiger kam er bei den jüdischen Pfadfindern der Haschomer Hazair (Der junge Wächter) mit marxistischen und zionistischen Ideen in Kontakt. Gemeinsam wanderte man durch den Wiener Wald, sang hebräische Lieder und studierte Palästinakunde. Aber man diskutierte auch sozialrevolutionäre Ideen. Sperber vertiefte sich in die Schriften Gustav Landauers, Otto Bauers, Max Adlers und der russischen Anarchisten, ehe er beschloss, selbst Revolutionär zu werden.
Damals lernte er junge Männer und Frauen kennen, die illegal über die polnische oder russische Grenze kamen, um im «gelobten Land» Palästina einen Kibbuz, den Nukleus eines künftigen jüdischen Staates, zu gründen. Er selbst fand das befremdlich und «dass es eine Vergeudung wäre, unsere Fähigkeiten und Begabungen verkümmern zu lassen, um Landarbeiter in einem zu erneuernden jüdischen Lande zu werden».[5] Er glaubte stattdessen, dass, wenn erst einmal die soziale Revolution vollendet und der neue Mensch herangebildet sei, sich auch in kurzer Zeit die jüdische Frage lösen und ein Staat Israel überflüssig sein würde.[6] Jahre später schrieb er in seiner Autobiografie, dass er sich dagegen wehre, die Last der jahrhundertelangen jüdischen Verfolgung mit sich herumzuschleppen. Er wolle «das Nachtragen verlernen» und lieber für «das weltumspannende Reich der Freiheit und Gleichheit für alle» kämpfen.[7] «Das Gewesene blieb unvergessen, natürlich. Aber wir gehörten der Zukunft.»[8]
Der leidenschaftliche Leser Sperber war, wie er selbst schrieb, besessen von der Psychologie, zu deren Gunsten er seinen Lebensplan, Schriftsteller zu werden, für die nächsten Jahre hintanstellte. Sein erster autobiografischer Roman, den er mit neunzehn verfasste, landete in der Schublade.
1921 besuchte er den ersten Kurs Alfred Adlers, des Begründers der Individualpsychologie, und kurz darauf begann er, selbst als Heilpädagoge und Therapeut zu arbeiten. Der Wiener Arzt hatte sich mit seinem Kollegen Sigmund Freud entzweit, weil ihn dessen Theorie des Unbewussten nicht überzeugte. Adler suchte die Ursache psychischer Störungen in den konkreten Lebensumständen, also der Gesellschaft. Nicht Triebhaftigkeit, wie Freud annahm, sondern Minderwertigkeitsgefühle und das Streben nach Geltung und Überlegenheit seien die wahren seelischen Antriebskräfte. Er gründete 1913 den Verein für Individualpsychologie und rückte Aufklärung, Erziehung und psychologische Prävention in den Mittelpunkt seines Wirkens. Im sozialdemokratisch regierten «Roten Wien» der Zwischenkriegszeit wurde die Individualpsychologie geradezu zum Gesellschaftsprogramm. Die Stadt finanzierte rund dreißig adlerianische Erziehungsberatungszentren für Eltern, Lehrer und alle anderen, die mit schwierigen Halbwüchsigen zu tun hatten.[9]
Sperber betrachtete sich als «Meisterschüler» Adlers, obwohl er nie ein akademisches Studium abschloss und in der individualpsychologischen Szene Wiens auch nur eine untergeordnete Rolle spielte.[10] Im Auftrag seines Lehrers zog er 1927 nach Berlin, um dort dessen psychologische Schule zu verbreiten. Er arbeitete als Therapeut und gab Kurse für Heimleiter, Fürsorgeerzieher und Sozialpädagogen, wobei er vor allem in die Arbeiterbewegung hineinwirken wollte. Während er eifrig Vorträge in der Berliner Gesellschaft für Individualpsychologie hielt, hoffte er, doch noch irgendwann Schriftsteller zu werden.
In Berlin trat er «wie viele besonders kluge, gebildete Männer», zu denen er unbedingt auch gehören wollte, in die KPD ein.[11] Sperber sah sich als Vordenker einer marxistischen Psychologie und Therapeut einer kranken Gesellschaft, die dem Nationalsozialismus anheimzufallen drohte. In großen Schritten entwickelte er sich zu einem unbeugsamen, linientreuen Stalinisten, einem, der «wusste und nicht wissen wollte», wie er erst viel später einsah.[12] Aber einer wie er, der aus dem jüdischen Milieu Polens, der Bukowina oder anderer östlicher Länder stammte, konnte sich durch die kommunistische Bewegung eine Ideologie und Lebensform aneignen, die ihn aus der geografischen Herkunft hinaushob und von familiären religiösen Verpflichtungen befreite.
Sperbers wachsende Ideologisierung führte 1930 zum Bruch mit Alfred Adler, der den Bolschewismus ablehnte und sich nicht von den marxistischen Individualpsychologen vereinnahmen lassen wollte. Der Wiener Arzt orientierte sich zunehmend auf die USA, wo seine Lehre auf große Resonanz stieß. 1933 siedelte er ganz dorthin über. Erst mehrere Jahrzehnte später revidierte Sperber sein kategorisches Urteil über Adler, den er ob der Zurückweisung «Sozialfaschist» schimpfte. Gekränkte Eitelkeit rangierte dabei offensichtlich noch vor inhaltlichen Differenzen.[13]
Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wohnte Sperber in der genossenschaftlichen Künstlerkolonie Wilmersdorf am Laubenheimer Platz. Dort konnten Autoren, Journalisten und Theaterleute – unter anderen Dinah Nelken, Ernst Busch, Alfred Kantorowicz und Ernst Bloch – günstig wohnen. Einer von ihnen, Gustav Regler, erinnerte sich: «Es waren billige Wohnungen, und doch bezahlte kaum einer seine Miete; weder die Gehälter noch die sogenannten Einkünfte der freien Berufe reichten aus. In den meisten Behausungen lag nur eine Matratze am Boden. Die Künstler aßen von Seifenkisten, über die sie Zeitungen gebreitet hatten.» Verhungern musste hingegen keiner, man half sich gegenseitig und «roch, wo einer Arbeit gehabt hatte und etwas Speck und Käse zu finden war».[14] Die Nazis nannten die Kolonie «Roter Block» – kein Wunder, dass sie dort als Erstes zugriffen.
Während Sperber im März 1933 im SA-Gefängnis am Alexanderplatz saß, beschloss er, sich in Zagreb niederzulassen, das er von Vortragsreisen kannte und wo er Freunde und Kollegen im bürgerlich-liberalen jüdischen Milieu besaß. Er hatte den südslawischen Vielvölkerstaat schon einige Jahre zuvor besucht; das Land und seine Menschen waren ihm sympathisch. Zudem gab es dort eine kommunistische Partei, in der er sich betätigen wollte.
Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen war 1918 aus ganz unterschiedlichen Gebieten geschaffen worden; die Bevölkerung war in ethnischer und religiöser Hinsicht bunt zusammengewürfelt. Serben, Kroaten und Slowenen hatten sich während des Ersten Weltkriegs auf eine gemeinsame parlamentarische Monarchie unter der serbischen Dynastie Karađorđević verständigt, dann aber über die innere Ordnung zerstritten. Kern des Problems waren die zentralistische Verfassung und die führende Stellung der Serben, die Beamtenapparat, Armee und König in das neue Gemeinwesen eingebracht hatten. Oppositionelle der Kroatischen Bauernpartei, die gegen die «großserbische Hegemonie» Sturm liefen, fielen 1928 einem nationalistischen Mordanschlag im Parlament zum Opfer. Daraufhin setzte König Alexander im Januar 1929 Verfassung und Pressefreiheit außer Kraft und ließ alle ethnopolitischen Parteien und Vereinigungen verbieten. Der Staat wurde in Jugoslawien umbenannt und nach dem französischen Modell in Departements bzw. Banschaften gegliedert. Aus der parlamentarischen Monarchie war nun eine Königsdiktatur geworden.
Für Flüchtende spielte das nationalistische Gezänk erst einmal keine Rolle. Sie konnten mit einem gültigen Pass problemlos nach Jugoslawien fahren. Man brauchte dafür lediglich ein Touristen- oder Einreisevisum. Wer länger als neunzig Tage bleiben wollte, stellte ein Aufenthaltsgesuch bei der zuständigen Gemeinde bzw. später beim jugoslawischen Innenministerium. Man konnte den Aufenthalt daraufhin immer wieder verlängern. Ausländer, die sich legal im Land aufhielten, durften sich frei bewegen und sogar einer Arbeit nachgehen. Und wer keinen gültigen Reisepass besaß oder staatenlos war, konnte einen «Toleranzaufenthalt» erwirken, sofern ein jugoslawischer Staatsbürger für den Unterhalt garantierte.[15]
Nach fünf quälenden Wochen hatten die Demarchen des polnischen Botschafters, die Sperbers Vater erwirkt hatte, bei den Behörden Erfolg. An Hitlers Geburtstag, dem 20. April 1933, wurde er überraschend entlassen, da er ausländischer Staatsbürger war. Die Auflage lautete, Deutschland unverzüglich zu verlassen. So bestieg Manès Sperber an einem düsteren, unangenehm warmen Apriltag den «Emigrantenzug» über Prag nach Wien. «Abgemagert wie einer, der nach einer schweren Operation das Spital zu früh verlassen hatte», beobachtete er die Mitreisenden. «Die meisten saßen im Coupé der zweiten Klasse, einige in der ersten und nicht wenig in der dritten Klasse. Hatte es der Zufall so gefügt, dass Bekannte im selben Wagen zu sitzen kamen, so taten sie, als ob sie einander nicht kennten.»[16] Jeder verhielt sich so, als könnte seine Anwesenheit unbemerkt bleiben, wenn er nur schweigend aus dem Fenster blickte und die Landschaft an sich vorbeiziehen ließ.
«Hurra!!! Keine Deutsche mehr!!!»
Als Tilla und Lutz die Ausweisung aus der Schweiz bevorstand, schlug sie vor, nach Zagreb auszuweichen. Sie kannte es von Gastspielen und aus den Erzählungen ihres Großvaters, der dort zu k. u. k. Zeiten studiert hatte. Sie selbst erinnerte sich an eine freundliche, saubere und pittoreske Stadt von überschaubarer Größe. Man könnte da erst einmal Quartier nehmen und würde dann weitersehen. Lutz war von dieser Idee nicht sonderlich begeistert, hatte aber auch keine bessere. Man wusste in Deutschland wenig über diesen seltsamen südslawischen Staat, der erst nach dem Ersten Weltkrieg auf der politischen Landkarte erschienen war, außer dass es dort billig war. Da Katzenellenbogen ein paar Aktien in dem Land besaß, könnte man mit ihnen hoffentlich den Lebensunterhalt bestreiten.[17]
Es stellte sich das Problem, dass ihre deutschen Pässe abgelaufen waren und dass sie im Ausland keine neuen bekommen konnten. In Deutschland wurde Lutz mittlerweile sogar steckbrieflich gesucht. Alle Anstrengungen, sich ein griechisches, polnisches, spanisches oder portugiesisches Reisedokument zu besorgen, scheiterten. «Ich bin von allem so nervös, dass ich nicht schlafe», notierte Tilla Durieux im März 1934. «Lutz verzweifelt».[18] Erst nach Monaten gelang es, von Honduras zwei Pässe à zweitausendvierhundert Schweizer Franken zu ergattern. Und die beste Nachricht war: Bei Erwerb einer anderen Nationalität erlosch die deutsche Staatsangehörigkeit. «Hurra!!! Keine Deutsche mehr!!!»[19]
Mitte 1934 siedelte das Paar schließlich nach Zagreb über. Damals «lag diese Stadt für die meisten Europäer in einer nebelhaften Ferne», schrieb die Durieux. «Man hielt sie entweder für einen Vorort von Wien oder von Prag. Das Land Jugoslawien aber steckte irgendwo – da unten – in einer Ecke, in der man sich nicht zurechtfand.» Die Freunde staunten über ihren Mut und prophezeiten, sie würden auf der Reise über den Karst von Räuberbanden überfallen werden.[20]
Auf die Wienerin Tilla Durieux wirkte Zagreb hingegen überhaupt nicht fremdartig. Kroatien hatte jahrhundertelang zur Habsburgermonarchie gehört. Die Kathedrale in der mittelalterlichen Oberstadt mit den zwei hohen Türmen im gotischen Stil, ein Bischofssitz, bezeugte die über tausend Jahre währende Zugehörigkeit zum lateinischen Kulturkreis. In der näheren Umgebung standen österreichisch wirkende Gebäude und Renaissance-Palais für Regierung, Parlament, Botschaften und wohlhabende Bürger. In der jüngeren Unterstadt herrschten repräsentative Boulevards und mehrstöckige Bürgerhäuser vor, die zu großen Teilen aus dem 19. Jahrhundert stammten. In beiden Teilen der Stadt gab es nette Gassen und Grünanlagen, die Menschen vergnügten sich in Cafés, Restaurants und Bars. Der 1933 aus Deutschland emigrierte Mathematiker Michael Golomb erinnerte sich an «eine schöne Oper, ein Theater, eine Konzerthalle und einige gute Museen. Es gab ausgezeichnete Restaurants, die sowohl Wiener als auch balkanische Küche servierten.» Er «mochte besonders die Cafés im Freien, wo man seinen Kaffee trinken und ein leckeres Eis essen und europäische Zeitungen lesen konnte».[21]
Zagreb präsentierte sich als moderne europäische Stadt. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt war sie durch den Zuzug vom Land auf mehr als hundertachtzigtausend Einwohner angewachsen. Industrie und Bankgewerbe, Handel und Handwerk, Straßenbahnen und Autoverkehr entwickelten sich in rasantem Tempo, und zur Architektur der Belle Époque kamen moderne Neubauten unter Einfluss von Le Corbusier hinzu. Besonders stolz war die Stadt auf das schicke Hotel «Esplanade», die Börse, den Flughafen und den ersten Zoo im südosteuropäischen Raum. Wie im westlichen Europa vergnügten sich die Menschen bei Tennis und Golf, Auto- und Motorradrennen, im Kino oder bei Jazz-konzerten; emanzipierte junge Frauen trugen Pariser Mode und Bubiköpfe. Trotzdem war Kroatien immer noch ein Bauernland. Tilla musste lachen, als sie mitten im Stadtzentrum «Truthähne auf ihrem Weg zum Bahnhof … über den Platz trippeln» sah. Es waren immer «je zwei und zwei brav ausgerichtet, hinterdrein ein Mann mit langem Stecken … oft zu 50 bis 100 Stück so artig und sittsam». Vor allem gefiel der Schauspielerin die breite, grüne Allee, die vom Bahnhof zum Hauptplatz führte, «mit lustigen Buden, an denen weiß und rot gekleidete Bäuerinnen alte Stickereien, selbstgewebtes Leinen, gestickte und gestrickte Babuschen und Opanken, nebst tausenderlei hübschen Kleinigkeiten, verkauften. Ihre weiß und rot gestickten Trachten und Strümpfe glänzten in der Sonne blitzsauber und unter den roten Kopftüchern guckten bildhübsche Gesichter hervor.»[22]
Hinter der pittoresken Kulisse lagerte allerdings sozialer Sprengstoff. Infolge der Weltwirtschaftskrise waren Produktion, Außenhandel sowie Löhne und Einkommen eingebrochen. Zehntausende waren arbeitslos und lebten von der Hand in den Mund. An den Rändern der Stadt uferten Siedlungen, in denen es nur ungepflasterte Wege, keine Straßenbeleuchtung, keine Wasserleitungen und keine Kanalisation gab. «Wenn es regnet, versinken die Straßen im Morast, man kommt kaum durch», beschwerte sich ein Zeitgenosse. Und «in den Sommermonaten ist die ganze Peripherie in Staubwolken gehüllt».[23]
Die Einkommen der Bauern waren besonders dramatisch gesunken. So war auch Tilla Durieux schockiert, wenn die Menschen auf dem Markt vor Armut aussahen «wie der Tod».[24] Viele fanden auf dem Land kein Auskommen mehr und strömten in die Stadt. Ein anderer Emigrant beobachtete zwischen den Buden barfüßige Männer, die nur zwei oder drei Zwiebelkränze anzubieten hatten, die ihnen um den Hals hingen. «Da brechen sie also bei Morgengrauen von ihrem Dorf auf, wandern bloßfüßig stundenlang zur Stadt und stehen geduldig den ganzen Tag lang mit ihrem Zwiebelkranz da.»[25]
Für Tilla Durieux und Ludwig Katzenellenbogen reichte das Einkommen zunächst für eine kleine möblierte Wohnung. «In dieser freundlichen und sauberen Stadt kam man uns gastfreundlich entgegen, so dass wir uns bald wohlzufühlen begannen», erinnerte sie sich.[26] Allerdings: Obwohl sie sparten, wo sie konnten, schmolz ihr kleines Kapital in Besorgnis erregender Geschwindigkeit zusammen. Schauspielern wollte oder konnte sie nicht mehr. Dem «Zagreber Morgenblatt» vertraute sie 1935 an, «dass es heute nicht opportun ist, Theater zu spielen». Kein Stück auf der Bühne komme mehr an das Drama der realen Gegenwart heran. «Wir dringen nicht mehr in das Herz der Menschen.» Daher tue man am besten, «sich wie eine Schnecke in sein Häuschen zurückzuziehen und zu warten».[27]
Als sie ihre Zagreber Wohnung aufgeben mussten, beschlossen sie, nach Abbazia (Opatija) umzuziehen, wo Lutz Katzenellenbogen geschäftliche Beziehungen aufnahm. Das mondäne, ehemals habsburgische Seebad lag im faschistischen Italien, das sich überraschend kulant gegenüber deutschen Emigranten verhielt. Eine relativ liberale Fremdengesetzgebung erleichterte Einreise, Niederlassung und Arbeitsaufnahme. So fanden die Geflüchteten aus Deutschland vielfältige Berufsmöglichkeiten vor, ehe auch Mussolini 1938 strenge Rassegesetze in Kraft setzte.[28]
Im Oktober 1935 wurde Lutz Teilhaber eines Hotels und Tilla zur Hotelière. Das sechsstöckige Kurhotel «Cristallo» mit seinen mehr als hundert Zimmern lag an der Uferpromenade des ehemals kaiserlichen Seebades von Abbazia, nur hatte es einst deutlich bessere Zeiten gesehen. Abgesehen vom fantastischen Meerblick war der weiße Prachtbau mit den großzügigen blauen Loggien heruntergekommen und schmierig. «Es war ein großes, aber gänzlich verwahrlostes Hotel, eine Wanzenburg», erinnerte sie sich.[29] Aber einmal auf Vordermann gebracht, bunt ausgemalt und modern eingerichtet, lockte es wieder Gäste an. Turbulente Liebesaffären, ein versuchter Selbstmord und die unerwartete Gier einiger besonders wohlhabender Urlauber, die vom kleinen Löffel bis zum Klopapier alles mitgehen ließen, waren überraschende Erfahrungen: «Ich lernte eine neue Seite der menschlichen Rasse, den Hotelgast, kennen.» Und, wer hätte das gedacht, plötzlich «sah unsere Zukunft ganz erfreulich aus».[30]
Tilla Durieux und Lutz Katzenellenbogen im Hotel «Cristallo», ca. 1938
Der Prophet in der Provinz
Manès Sperber stellte sich 1933 auf einen längeren Aufenthalt in Zagreb ein. Mit seiner Frau Mirjam Richter bezog er ein Turmhaus in der malerischen Visoka-Straße, einer schmalen, gepflasterten Sackgasse am obersten Ende der mittelalterlichen Altstadt. Er verdiente Geld, indem er Vorträge an der Volkshochschule hielt und in seiner Wohnung als Psychotherapeut praktizierte. Nebenbei vollendete er sein Buch «Individuum und Gemeinschaft. Versuch einer sozialen Charakterologie», eine sozialökonomische, politische und historische Deutung der Sozialpsychologie der Masse. Im Januar 1934 kam Sohn Vladimir Friedrich Uri (Vladim) zur Welt.