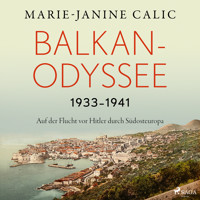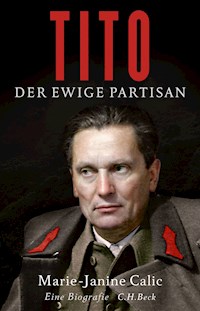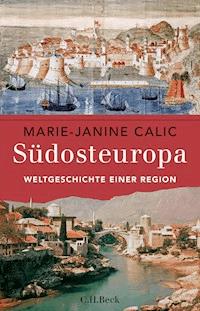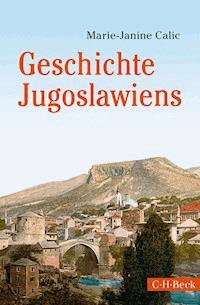
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Marie-Janine Calic schlägt in diesem Buch analytische Schneisen in die faszinierende Geschichte Jugoslawiens und legt die erste Gesamtdarstellung in deutscher Sprache seit der Auflösung des Vielvölkerstaates vor. Warum ist Jugoslawien zerfallen? War der gewaltsame Untergang unvermeidlich? Warum hat der heterogene Staat dann überhaupt so lange überlebt? Dieses Buch analysiert, warum und unter welchen Umständen Jugoslawien entstand, was den Vielvölkerstaat über siebzig Jahre zusammenhielt und weshalb er sich schließlich gewaltsam auflöste. Im Mittelpunkt stehen die um die Wende zum 20. Jahrhundert einsetzenden fundamentalen Wandlungsprozesse, die die Ideologien, politischen Systeme, wirtschaftlich-sozialen Beziehungen sowie die Lebensweisen in ganz Europa nachhaltig prägten und auch Jugoslawien im Laufe des 20. Jahrhunderts von einer Agrar- in eine moderne Industriegesellschaft verwandelten. Dadurch wird die jugoslawische Geschichte in die europäische Geschichte mit all ihren wechselseitigen Verflechtungen eingebettet und das Klischeebild des rückständigen, mit unauflösbaren Nationalitätenkonflikten belasteten Balkans korrigiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Marie-Janine Calic
GeschichteJUGOSLAWIENS
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Warum ist Jugoslawien zerfallen? War der gewaltsame Untergang unvermeidlich? Warum hat der heterogene Staat dann überhaupt so lange überlebt? Dieses Buch analysiert, warum und unter welchen Umständen Jugoslawien entstand, was den Vielvölkerstaat über siebzig Jahre zusammenhielt und weshalb er sich schließlich gewaltsam auflöste. Im Mittelpunkt stehen die um die Wende zum 20. Jahrhundert einsetzenden fundamentalen Wandlungsprozesse, die die Ideologien, politischen Systeme, wirtschaftlichsozialen Beziehungen sowie die Lebensweisen in ganz Europa nachhaltig prägten und auch Jugoslawien im Laufe des 20. Jahrhunderts von einer Agrar- in eine moderne Industriegesellschaft verwandelten. Dadurch wird die jugoslawische Geschichte in die europäische Geschichte mit all ihren wechselseitigen Verflechtungen eingebettet und das Klischeebild des rückständigen, mit unauflösbaren Nationalitätenkonflikten belasteten Balkans korrigiert.
Über die Autorin
Marie-Janine Calic ist Professorin für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zuletzt erschien von ihr bei C.H.Beck: Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region (2016).
Inhalt
Einleitung
ERSTER TEIL
Südslawische Bewegung und Staatsgründung (1878 bis 1918)
1. Die südslawischen Länder um 1900: Aufbruch in das neue Jahrhundert
2. Nationale Fragen (1875 bis 1903)
3. Radikalisierung (1903 bis 1912)
4. Die drei Balkankriege (1912/13 bis 1914/1918)
ZWEITER TEIL
Das Erste Jugoslawien (1918 bis 1941)
5. Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (1918 bis 1929)
6. Die 1920er Jahre: Tradition und Wandel
7. Das Königreich Jugoslawien (1929 bis 1941)
DRITTER TEIL
Der Zweite Weltkrieg (1941 bis 1945)
8. Besatzung, Kollaboration und Widerstand
9. Die 1940er Jahre: Totaler Krieg
VIERTER TEIL
Das sozialistische Jugoslawien (1945 bis 1980)
10. Die Konsolidierung der kommunistischen Herrschaft (1943 bis 1948)
11. Titos Sozialismus (1948 bis 1964)
12. Die 1960er Jahre: Übergang in die Industriegesellschaft
13. Reformen und Rivalitäten (1964 bis 1968)
14. Neuer Nationalismus (1967 bis 1971)
15. Nach dem Boom (1971 bis 1980)
FÜNFTER TEIL
Nach Tito (1980 bis 1991)
16. Die Krise der sozialistischen Moderne (1980 bis 1989)
17. Die 1980er Jahre: Anomie
18. Desintegration und Staatszerfall (1989 bis 1991)
SECHSTER TEIL
Untergang (1991 bis zur Gegenwart)
19. Der Nachfolgekrieg (1991 bis 1995)
20. Was von Jugoslawien übrig blieb
Schlussbetrachtung
ANHANG
Abkürzungen
Chronologie
Parteien, politische Organisationen und Zusammenschlüsse
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Tabellen
Personenregister
Karten
Einleitung
Warum ist Jugoslawien zerfallen? War der gewaltsame Untergang unvermeidlich? Warum hat der Vielvölkerstaat dann überhaupt so lange überlebt? Wurden die Menschen vielleicht nur Opfer nationalistischer Verführung? Und wie lässt sich die kurze Geschichte Jugoslawiens in das lange 20. Jahrhundert einordnen? Dieses Buch erzählt, warum und unter welchen Umständen Jugoslawien entstand, was den Vielvölkerstaat über 70 Jahre zusammenhielt und weshalb er sich schließlich gewaltsam auflöste. Es ist die Geschichte von Zuversicht und Zweifeln, von Fortschritt und Verfall, von Extremen und Exzessen, von Utopie und Untergang.
Kein europäisches Land war so bunt, vielseitig und kompliziert wie Jugoslawien. Wegen seiner turbulenten Geschichte gilt es als Inbegriff balkanischen Durch- und Gegeneinanders, als Symbol für das rückständige, barbarische und abstoßende Andere auf unserem vermeintlich so zivilisierten Kontinent. Wer gegen Ende des 19. Jahrhunderts im österreichischen Semlin mit dem Dampfschiff über die Donau nach Belgrad übersetzte oder mit der ungarischen Staatsbahn über die große eiserne Save-Brücke im Bahnhof von Bosnisch-Brod einfuhr, betrat eine fremdartige Welt, die geheimnisvoll, märchenhaft, zuweilen aber auch abstoßend und bedrohlich erschien.[1] Unter diesen Eindrücken wurde die Region konsequent aus dem europäischen Kontext herausgeschrieben, und bedauerlicherweise ist das mitunter bis heute so. Bei näherer Betrachtung verliert sich dann allerdings der Eindruck des Mysteriösen, weil auch der Balkan, im Guten wie im Schlechten, auf das Engste mit den europäischen Zeitläuften verflochten ist. Aber obwohl der Topos der strukturellen Andersartigkeit als «bequemes Vorurteil» entlarvt wurde, hält sich oft bar jeglicher Empirie die Vorstellung dauerhafter Rückständigkeit.[2]
Im Gegensatz dazu thematisiert dieses Buch die jugoslawische Geschichte aus der Perspektive der großen sozialen, wirtschaftlichen und intellektuellen Veränderungen, die ganz Europa an der Wende zum 20. Jahrhundert erfassten und die den Übergang zur modernen Industrie- und Massengesellschaft markierten. Die «große Beschleunigung» erreichte als erstes die westlichen Gesellschaften, strahlte bald aber auch auf die europäische Peripherie ab.[3] Es wird hier also nicht primär nach den Strukturen der longue durée und nach historischen Sonderwegen auf dem Balkan gefragt, sondern eher nach den übergreifenden Dynamiken des Wandels, nach Verflechtungen und Interaktionen, nach europäischen Gemeinsamkeiten und Parallelen im «langen 20. Jahrhundert».[4]
In Südosteuropa begann sich in den Jahrzehnten um 1900 die fundamentale Umgestaltung der Wirtschaft, der sozialen Beziehungen, kulturellen Äußerungen, Mentalitäten und des Alltagslebens bereits abzuzeichnen. Der ungestüme wissenschaftlich-technologische und ökonomische Fortschritt im Westen stellte auch die Balkanländer vor ungeahnte Herausforderungen. Zunehmender internationaler Wettbewerb und aggressiver Imperialismus machten die Überwindung der Rückständigkeit buchstäblich zu einer Überlebensfrage. Vor diesem Hintergrund konkretisierte sich die südslawische Idee, das Projekt einer gemeinsamen politischen Zukunft von kulturell verwandten Völkern. Denn die Befreiung aus der Fremdherrschaft, die Gründung Jugoslawiens, erschien als Voraussetzung einer selbstbestimmten europäischen Zukunft.
Zweimal, 1918 und 1945, wurde Jugoslawien unter ganz unterschiedlichen Systemvorgaben realisiert: zuerst als zentralistische, parlamentarische Monarchie, danach als sozialistische Föderation. Beide Modelle warfen vier grundsätzliche Probleme langer Dauer auf: die ungeklärte, sich immer wieder mit neuen Facetten artikulierende nationale Frage, Rückständigkeit und Armut in einer kleinbäuerlich geprägten Gesellschaft sowie die Abhängigkeit von auswärtigen, hegemonial-expansiven Macht- und Wirtschafts-interessen. Gewaltige historische und sozial-ökonomische Disparitäten kamen erschwerend hinzu, weil auf engem Raum verschiedene Traditionen und Entwicklungsmuster aufeinandertrafen.
Eine leitende Frage des Buches ist, wie man sich unter diesen Umständen zu unterschiedlichen Zeiten Entwicklung und Fortschritt vorstellte und mit welchen Mitteln man sie zu erreichen suchte. Immer mehr Angehörige der Eliten glaubten, in einem Zeitalter zu leben, in dem Tradition und Brauchtum, Patriarchat und überkommene Gemeinschaftsbeziehungen vergingen – und vergehen sollten, um an den Vorzügen der Moderne, also einer sich zunehmend technifizierenden Welt, teilzuhaben. Konkurrierende politische Kräfte und Intellektuelle fanden dann allerdings sehr unterschiedliche Antworten auf die Zwänge, Sehnsüchte und Herausforderungen einer sich dramatisch verändernden Welt. Welche Akteure trieben den sozialen Wandel voran und wie dachten sie sich die Gestaltung der Zukunft? Welche Alternativen zur westlichen Moderne standen zur Diskussion?
Mit diesem Ansatz nimmt das Buch Abstand von populären Erklärungen des jugoslawischen Problems, die strukturelle Faktoren wie ethnokulturelle Gegensätze und zivilisatorische Inkompatibilitäten in den Vordergrund rücken. Aber nicht balkannotorische Unverträglichkeit und ewiger Völkerhass unterliefen das Projekt südslawischer Gemeinschaftlichkeit, sondern, so die Kernthese, die Politisierung von Differenz in der modernen Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts. Völker, Nationen und Kulturen sind keine transhistorischen Entitäten, sondern selbst geschichtlichem Werden und Wandel unterworfen, und ebenso veränderten auch Konflikte ihren Sinn und ihre Gestalt. Wer, warum, unter welchen Umständen und wie ethnische Identität und Diversität zu einem Konfliktgegenstand machte, ist daher eine zentrale Frage dieses Buches. Es geht um Interessen, Weltauffassungen und Motive der Handelnden, um sozialökonomische Entwicklungen sowie nicht zuletzt um die kulturhistorischen Dimensionen kollektiver Erfahrungen, Erinnerungen und Geschichtsdeutungen.
Nur wenige Fachleute haben sich bislang an Gesamtdarstellungen Jugoslawiens versucht, die das gesamte 20. Jahrhundert umfassen. Während es in deutscher Sprache überhaupt nur eine einzige Monographie gibt, wird man im anglophonen Raum eher fündig.[5] Auch in den jugoslawischen Nachfolgestaaten ist die Literaturlage dürftig.[6] Schon vor dem Zerfallskrieg war es eine heikle Angelegenheit, die verschiedenen regionalen Perspektiven auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Der Wissenschaftsföderalismus gestattete jedem Volk seine individuelle Vergangenheitspolitik, seine nationalen Geschichtsbilder und Narrative. Zu einer von allen getragenen Meistererzählung ist es nie gekommen: Zu unterschiedlich, weil auch politisch aufgeladen, waren Deutungen und Darstellungen. Die mehrbändige «Geschichte der Völker Jugoslawiens» schaffte es wegen interpretatorischer Querelen nur bis zum Jahr 1800. Ebenso verschwand die «Geschichte der jugoslawischen kommunistischen Partei/BdKJ» im Orkus. Und besser erging es auch den historischen Einträgen in der Enzyklopädie Jugoslawiens nicht. Eine akzeptierte Erzählung der Entstehung Jugoslawiens, seiner historischen Entwicklung und seiner Probleme existierte zeit seines Bestehens nicht. Wer immer sich dennoch daran versuchte, endete im Kreuzfeuer der Kritik.[7]
Im krassen Gegensatz zu den spärlichen Gesamtdarstellungen steht die unüberschaubare Menge an Büchern und Aufsätzen, die vom Zerfallskrieg der 1990er Jahre handeln. Sie interpretieren die Geschichte Jugoslawiens meist aus der Perspektive seines blutigen Endes, analysieren Geburtsfehler und apostrophieren die südslawische Staatsschöpfung als künstlich, um die Unausweichlichkeit des Scheiterns zu untermauern. Jugoslawien erklärt sich jedoch nicht nur aus seinem Anfang oder Ende. Immerhin existierte der Staat gut 70 Jahre lang, weshalb die Frage, was seine Völker so lange zusammenhielt und was sie entzweite, auch durch den Untergang noch nicht obsolet wurde. Dieses Buch versucht, deterministischen Erklärungen aus dem Weg zu gehen und die Geschichte Jugoslawiens als grundsätzlich ergebnisoffenen Prozess zu verstehen.
Viele neuere Darstellungen befassen sich gar nicht mehr mit Jugoslawien, sondern nur noch mit seinen Nachfolgestaaten. Die heutige Existenz Sloweniens, Kroatiens oder Kosovos wird in die Vergangenheit zurückprojiziert, gleichsam als teleologischer Vorlauf zur Eigenstaatlichkeit. Interaktionen mit den Nachbarn kommen dann oft nur noch in Form von Konflikten und Kriegen vor, wobei die jugoslawische Periode auf eine kürzere, wenngleich nicht ganz unwesentliche Episode einer jahrhunderte-alten Nationalgeschichte zusammenschrumpft. Im Gegensatz dazu wird hier versucht, unterschiedliche landes- und nationalhistorische Perspektiven einzufangen und zueinander in Beziehung zu setzen, wodurch sich manche vermeintliche regionale Besonderheit relativiert. Einzelne Republiken und Völker konnten allerdings nur exemplarisch behandelt werden, schon um eine Balance zwischen Vielgestaltigkeit und Einheit zu finden. Als mikrohistorischer «roter Faden» steht immer wieder Ostbosnien im Mittelpunkt der Erzählung, das sprichwörtliche Herz Jugoslawiens, um das viele Parteien im Verlauf des 20. Jahrhunderts stritten.
Dieses Buch versteht sich als eine thematisch umfassende, jedoch kompakte Annäherung an einen komplexen, fast uferlosen und noch längst nicht erschöpfend erschlossenen Untersuchungsgegenstand. Es beruht zum Teil auf eigenen Forschungen, im Wesentlichen auf der weit verstreuten Sekundärliteratur. Publikationen über Spezialthemen und Teilepochen sind zahlreich, Synthesen jedoch selten, und an vielen Stellen klaffen erhebliche Forschungslücken, insbesondere was die Zeit nach 1945 anbelangt. Glücklicherweise haben die Jugoslawen zu allen Zeiten selber viel publiziert, und insbesondere über historische, soziologische und politikwissenschaftliche Fachzeitschriften ließ sich manche Lücke schließen.
Jede Gesamtdarstellung braucht eine Perspektive und einen Fluchtpunkt, die über die Auswahl von Themen und Fragestellung entscheiden, und deshalb kommt kein Narrativ ohne Verkürzungen und Verallgemeinerungen aus. Bestimmte Themen, die zum Grundstock der politischen Geschichte Jugoslawiens gehören, wurden knapp gehalten, um neben den Ereignissen und ihren Akteuren auch die tiefer liegenden sozial-ökonomischen und kulturellen Triebkräfte sowie den Alltag der einfachen Menschen zu beleuchten. Dem Charakter der Reihe entsprechend wechselt sich die chronologische Erzählung mit Querschnittsanalysen ab. Aus Platzgründen konnte auch nicht alle wichtige Literatur, die in diese Arbeit einfloss, in den Fußnoten einzeln nachgewiesen werden. Und oft ist der besseren Lesbarkeit wegen von «Jugoslawen» die Rede, also von Staatsbürgern ohne Ansehen ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Nur sofern es für die Erklärung gewisser Zusammenhänge relevant war, wie man sich identifizierte, wird die Nationalität aufgeschlüsselt.
Deutungen der jugoslawischen Vergangenheit sind bis heute sehr stark mit Emotionen befrachtet, Diskussionen werden häufig nicht mit sachlichen, sondern mit moralischen Argumenten geführt, und gegensätzliche Geschichtsdeutungen liefern Zündstoff für politische Auseinandersetzungen. Wer sich nicht eindeutig auf die eine oder andere Seite schlägt, setzt sich leicht unschönen Polemiken aus. Den Grundsätzen guten wissenschaftlichen Arbeitens folgend wird in dieser Darstellung versucht, verschiedene Perspektiven gegeneinander abzuwägen, auch wenn es der beschränkte Seitenumfang nicht zuließ, alle Theorien und Kontroversen im Detail auszuleuchten. Mit Alexis de Tocqueville hoffe ich, dieses Buch ohne Vorurteile geschrieben zu haben, jedoch nicht ohne Leidenschaft.
Dieses Buch entstand mit großzügiger Unterstützung des Freiburger Institute for Advanced Studies (FRIAS), das mir ein anderthalbjähriges Forschungsstipendium gewährte und die Freistellung von der Universität München finanzierte, wofür ich allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzlich danke. Karolina Novinšćak war bei der Literaturrecherche eine große Hilfe sowie Christian Haas bei der Formatierung des Manuskripts. Ulrich Herbert, der diese Gesamtdarstellung anregte, bin ich besonders verpflichtet.
München im Frühjahr 2018
ERSTER TEIL
Südslawische Bewegung und Staatsgründung(1878 bis 1918)
1. Die südslawischen Länder um 1900: Aufbruch in das neue Jahrhundert
Seit der Jahrhundertwende herrschte im gesamten südslawischen Raum Aufbruchstimmung. Selbst in entlegenen Winkeln wie der bosnischen Provinzstadt Višegrad, so schrieb ihr Chronist Ivo Andrić, «beschleunigten […] die Ereignisse ihren Lauf. […] Aufregende Nachrichten waren keine Seltenheiten und Ausnahmen mehr, sondern alltägliche Neuerungen und ein wahres Bedürfnis. Das ganze Leben wurde irgendwie ungestüm und rasend schneller, so wie das Wasser eines Baches seinen Lauf beschleunigt, ehe es über steile Felsen niederstürzt und zum Wasserfall wird.»[1] Noch war erst wenigen Zeitgenossen bewusst, dass sie in einer Epoche millenarischer Veränderungen lebten, dass aus den tiefen sozialen Umbrüchen auch geistige Innovation und politischer Impetus erwuchs. Der junge bosnische Revolutionär Vladimir Gaćinović jedenfalls hoffte, dass bald das alte Feudalsystem, die großen Sippschaften und der patriarchalische Geist seiner Heimat der Vergangenheit angehören, neue Ideen und ein starker Drang nach nationaler Vergemeinschaftung aufkommen würden.[2] Weil weite Teile des flachen Landes jedoch noch in jämmerlicher Armut und alten Traditionen verharrten, klang der Zusammenschluss der Südslawen in einem Staat manchem nur als ferne Zukunftsmusik. Noch war es alles andere als ausgemacht, dass sich ihre so ungleichen Heimatgebiete tatsächlich einmal zu einem politischen Gemeinwesen zusammenfinden würden. Wie kompliziert die Ausgangslage in Wahrheit war, wird deutlich, wenn man die historischen Landesteile Jugoslawiens retrospektiv im Zeitraffer durchstreift.
Die historischen Landesteile
Die fiktive Reise durch die südslawischen Länder um 1900 beginnt in den österreichischen Kronländern Krain, Steiermark, Kärnten, Görz, Istrien und Triest, wo rund 1,32 Millionen Slowenen zu Hause waren, das kleinste und westlichste Volk der späteren Staatsnationen Jugoslawiens. Sie machten hier ungefähr drei Viertel der Bevölkerung aus und lebten mit Deutschen, Italienern, Kroaten und anderen in Gemengelage zusammen. Als einziges Volk unter den Südslawen erlitten sie nie längere Phasen militärischer Bedrohung, kriegerischer Zerstörung oder gar Entvölkerung. Ihre Landwirtschaft war vielseitig und ertragreich, und auch Wohlstand und Bildungsniveau lagen höher als in den Nachbarregionen. Rund 500 Jahre habsburgischer Herrschaft schlugen sich sichtbar in der Architektur nieder, die noch heute durch und durch österreichisch wirkt. Noch war das slowenische Siedlungsgebiet administrativ zersplittert, aber auch früher hat es nie ein staatliches Gebilde namens Slowenien gegeben.[3]
Weiter westlich und südlich gingen die slowenischen Länder nahtlos in die Siedlungsgebiete der rund 2,9 Millionen Kroaten über, die ebenfalls zu Österreich-Ungarn gehörten.[4] Mehr noch als die der Slowenen vermittelten diese das Bild innerer Zerrissenheit: Es handelte sich um nicht weniger als sieben separate politisch-territoriale Einheiten innerhalb der Habsburger Monarchie mit jeweils sehr unterschiedlichen sozial-ökonomischen Strukturen, ethnischen Mischungen und kulturellen Prägungen. Kroatien-Slawonien besaß Autonomie innerhalb der ungarischen Reichshälfte. Istrien und Dalmatien standen dagegen unter direkter österreichischer, die Hafenstadt Rijeka als corpus separatum unter ungarischer Verwaltung. Kroaten lebten des Weiteren auch in Bosnien-Herzegowina und in Südungarn. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges gab es keine einzige Eisenbahnverbindung zwischen Kroatien, Dalmatien und Bosnien-Herzegowina.[5]
In den kroatischen Ländern flossen unterschiedlichste Kultureinflüsse ineinander. In den Städten Nord- und Ostkroatiens, etwa Zagreb, Varaždin und Osijek, zeigen noch heute die barocke Gestaltung der Adelssitze und Altstadtkerne, die Ausstattung von Stadtpalästen und Patrizierhäusern österreichisch-süddeutsche Merkmale. An der Küste, in Dalmatien und Istrien, verweist die Architektur der Städte, etwa in Pula, Split und Dubrovnik, auf einen antiken Ursprung sowie eine jahrhundertelange enge Verflechtung mit Kultur und Geschichte Venedigs, Florenz’ und Roms.[6]
Zu Kroatien-Slawonien gehörte seit 1881 auch das Gebiet der ehemaligen Militärgrenze (krajina), die sich rund 400 Jahre lang an Save und Donau entlang schlängelte, bis sie im äußersten Westen Bosniens nach Süden zur Adriaküste durchstieß. Um sein Reich militärisch vor der «Türkengefahr» abzuschirmen, hatte der Wiener Hof im 16. und 17. Jahrhundert hier serbische Flüchtlinge als freie Wehrbauern angesiedelt und eine Verwaltungseinheit mit ganz eigener Sozialordnung geschaffen.[7] Die Habsburger lockten auch nichtslawische Kolonisten an, darunter die deutschsprachigen Donauschwaben.
Jenseits der Militärgrenze lag Bosnien-Herzegowina, das der Berliner Kongress 1878 unter österreichisch-ungarische Okkupation stellte und nur formal unter der seit dem 15. Jahrhundert währenden Oberhoheit der Osmanen beließ. 1908 annektierte es der österreichische Kaiser dann im Handstreich. Dort erreichte man den islamisierten Teil des späteren Jugoslawien mit seiner autochthonen muslimischen Bevölkerung. Um 1900 lebten hier rund 1,6 Millionen orthodoxe (43 Prozent), muslimische (35 Prozent) und katholische Südslawen (21 Prozent), ferner Juden, Walachen, Türken, Roma und andere Minderheiten.
Die architektonische Kunst der türkischen Baumeister fiel als erstes ins Auge. In Sarajevo etwa überwältigte die Pracht einer der größten und kunstvollsten Moscheen, die der Islam auf europäischem Boden hinterließ. Weltberühmt wurde der kühne Schwung der steinernen Brücke über die Drina in Višegrad, die, so besagt ihre Inschrift, «nicht ihresgleichen hat auf der Welt».[8] Geschaffen im 16. Jahrhundert im Auftrag des Großwesirs Mehmet Pascha Sokolović, ein Kind der Region, verewigte Ivo Andrić dieses Überbleibsel west-östlicher Verzahnungen in seiner nobelpreisgekrönten Chronik.[9] Aber, ach, die Drina: Nachdem Türken und Österreicher sie zur Scheidelinie zwischen ihren Reichen erklärt hatten, wurde sie im 20. Jahrhundert zum heiß umkämpften Erinnerungsort. War der malerische Fluss Halt gebendes Rückgrat serbischen Siedlungsraumes über politische Grenzen hinweg oder unüberwindliche Wasserscheide zwischen katholischer und orthodoxer Zivilisation? Die Kommunisten erklärten sie später kurzerhand zum Symbol jugoslawischer Einigkeit.
Unter österreichisch-ungarischer Herrschaft kamen in ganz Bosnien-Herzegowina mitteleuropäische Architektureinflüsse hinzu. Sarajevo erhielt ein modernes Stadtzentrum mit repräsentativen Verwaltungsbauten, Theater und Hauptpost gleich neben der türkischen Altstadt mit dem Basarviertel, der čaršija, den zahlreichen Moscheen, Hamamen, Koranschulen, Derwisch-Klöstern und Karawansereien.[10] Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schrieb der Reisende Heinrich Renner, «sieht es hier viel türkischer aus als in Sofia und Phillipopel; noch immer überwiegt die Landestracht; Turban und Fez haben den Vorzug», trotz der bereits «überhandnehmenden» europäischen Kleidung.[11]
Das Reisen war in dieser Zeit übrigens recht beschwerlich. Der Weg per Kutsche, Karawane oder Pferd von Sarajevo in das rund 135 Kilometer entfernte Mostar war eine dreitägige Strapaze. Wer in entlegene Regionen vordringen wollte, musste einen der halsbrecherischen Reitsteige benutzen oder den Fußmarsch antreten.[12] Über Ostbosnien gelangte man daher nur nach beschwerlichem Aufstieg durch die Berge nach Montenegro, das seit 1878 unabhängig war. Hier konservierte die Abgeschiedenheit des Karstes seit Jahrhunderten die traditionelle Stammesordnung. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung waren orthodoxe Slawen, hinzu kamen wenige tausend türkische, albanische und slawische Muslime. Dieser Zwergstaat mit seinen rund 200.000 Einwohnern beflügelte die Phantasie ausländischer Besucher stets besonders: als Symbol für den unbändigen Freiheitswillen eines kleinen Bergvolks, als Heimstätte von Banditentum, Blutrache und Barbarei, nicht zuletzt als Bühne operettenhafter politischer Verhältnisse. Abgesehen von einem kurzen idyllischen Küstenstreifen waren die Lebensumstände ungnädig. Das Land war infrastrukturell kaum erschlossen, Viehzucht und dürftige Landwirtschaft warfen wenig ab, es herrschte unbeschreibliche Armut. Tief im Innern, erzählte der Montenegriner Milovan Djilas, ein Weggefährte Titos, war dieses Land «von extremer Kargheit und zehrender Stille», wo sich «alles Lebendige und alles, was Menschenhand erschaffen hat», verlor. «Es gibt keine Eiche, keine Weiß- oder Rotbuche, nur trockenes, sprödes, kaum grünes Gras […]. Alles ist Stein.»[13]
Hinab auf einer türkischen Straße, die in beschwerlichem Zickzack die zerklüfteten Berge durchquerte, erreichte man den südlichsten Punkt des späteren Jugoslawien, den Hafen von Bar, und, einige Kilometer weiter den Skutari-See, durch den später die albanische Grenze verlief. An der schmalen Küste überwog nun wieder mediterran-venezianisches Flair: Über Jahrhunderte öffnete sich hier die wichtigste und oft einzige Verbindung zum westlichen Europa.
Jenseits des Skutari-Sees erstreckten sich jene Regionen des späteren Jugoslawien, die noch bis 1912/13 zum Osmanischen Reich gehörten und als besonders arm und rückständig galten. Das 1879 geschaffene Verwaltungsgebiet (vilayet) Kosovo mit der Hauptstadt Üsküb/Skopje umfasste einen großen Teil des heutigen Kosovo und Makedoniens, um das sich die jungen Nationalstaaten Serbien, Griechenland und Bulgarien stritten. Mehr als 1,6 Millionen Einwohner bildeten ein einmaliges ethnisches und konfessionelles Durcheinander: Die Bevölkerung war etwa je zur Hälfte christlich und muslimisch und zerfiel in eine Vielzahl von Sprachgruppen.
Eine Sonderstellung nahm zu dieser Zeit der vorwiegend muslimisch besiedelte Verwaltungsdistrikt des Sandžak von Novi Pazar ein, der Serbien von Montenegro trennte. Der Berliner Kongress räumte 1878 dem österreichischen Kaiser das Recht ein, das strategisch wichtige Gebiet zu besetzen. 1913 wurde es zwischen Montenegro und Serbien aufgeteilt.
Serbien hatte sich 1815 durch zwei Aufstände in ein Fürstentum unter osmanischer Oberhoheit verwandelt. Es erlangte 1830 Autonomie und 1878 die Unabhängigkeit. 1900 lebten hier 2,5 Millionen Menschen, davon neun Zehntel Serben sowie Walachen, Roma und andere.[14] Weitere rund zwei Millionen Serben waren in der Habsburger Monarchie zu Hause. Im Norden, am Zusammenfluss von Save und Donau, erhob sich die ursprünglich orientalisch-balkanische Hauptstadt Belgrad, die die längste Zeit ihrer Geschichte eine strategisch wichtige Grenz- Militär-, Verwaltungs- und Handelsstadt war. Nach Abzug der Osmanen wurde sie vollständig im westlichen Stil Wiens und Pests rekonstruiert. Von da aus war es nur ein Katzensprung in die ungarische Vojvodina, von der in der Zeit der Aufklärung die serbische Nationalbewegung ausging. Infolge der habsburgischen Kolonialisierung bestand die Bevölkerung von 1,3 Millionen hier nun aus Magyaren (32 Prozent), Serben (29 Prozent), Deutschen (23 Prozent) und zahlreichen anderen Nationalitäten wie Kroaten, Rumänen und Ruthenen.[15]
Völker, Nationen, Identitäten
In den historischen Regionen des späteren Jugoslawien lebten um die Jahrhundertwende rund zwölf Millionen Menschen. Die Mehrheit waren katholische, orthodoxe und muslimische Südslawen sowie ein buntes Gemisch verschiedenster anderer Volks- und Religionsgruppen wie Türken, Albaner, Deutsche, Magyaren, Juden, Roma, Walachen und weitere.
Wie überall in Europa glaubten die südslawischen Eliten im 19. Jahrhundert, dass die sprachlichen und religiösen Gruppen zu modernen «Nationen» werden müssten, um politische Partizipation, kulturelle Rechte und soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. Allerdings: In den allermeisten Regionen war die ethnisch-konfessionelle Gemengelage, milde gesprochen, unübersichtlich. Sie erschien als Resultat komplexer Wanderungsbewegungen unterschiedlichen Ursprungs, religiöser Konversionen und kultureller Hybridisierungen verschiedenster Art, die das ethnische Mosaik im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder gründlich durchschüttelten und neu zusammensetzten. Deswegen spielten vielschichtige Kontakte, Kulturtransfers und -verflechtungen stets eine große Rolle. Eine «jugoslawische» Nation gab es um die Jahrhundertwende ebenso wenig wie ein einigermaßen klares Verständnis dessen, was es bedeutete, sich «Slowene», «Kroate» oder «Serbe» zu nennen. In der bäuerlichen Bevölkerung bildeten das Dorf und die Heimatregion, Sprache und Volkskultur sowie die Religion die wichtigsten lebensweltlichen Bezugspunkte. Zwar hatten im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts Vergemeinschaftungsprozesse begonnen, die aus traditionellen, interethnisch und regional geprägten Identitäten neue abstrakte, nationale Bewusstseinskategorien und Sinnzusammenhänge schufen. Keines der späteren Staatsvölker Jugoslawiens bildete um die Jahrhundertwende aber bereits eine integrierte Gemeinschaft. Das Entstehen der modernen Nationen beinhaltete langwierige, häufig widersprüchliche Prozesse mit durchaus offenem Ergebnis. Die Vorstellung einer durch Sprache, Kultur oder Herkunft objektivierbaren, transhistorischen Existenz der Völker ist zwar eine bis heute beliebte, jedoch historisch ganz unzutreffende Idee.
Vereinfacht gesagt lebten in den Ländern des späteren Jugoslawien um die Jahrhundertwende mehrheitlich Südslawen, die ihre sprachlich-kulturelle Verwandtschaft verband. Nach heutigem Verständnis wären dies Slowenen, Kroaten, Serben, Bosniaken, Montenegriner und Makedonier – in damaliger Lesart changierten diese Bezeichnungen hingegen noch zwischen ethnischen, nationalen, konfessionellen und regionalen Konnotationen, was – wie zu zeigen sein wird – wesentlich zum späteren jugoslawischen Problem beitrug.
Trotz der extremen politisch-territorialen und kulturhistorischen Disparitäten fühlten sich katholische, orthodoxe und muslimische Südslawen einander intuitiv verbunden. Dies lag auch daran, dass man sich problemlos miteinander verständigen konnte. Die meisten Kroaten sowie alle Serben, Montenegriner und Bosnier sprechen einen gemeinsamen Dialekt, das sogenannte Štokavische (nach dem Fragepronomen što für «was»).[16] Die Sprachreformer des 19. Jahrhunderts wählten diesen Dialekt 1850 im Wiener Abkommen als Grundlage einer gemeinsamen serbisch-kroatischen Standardsprache.[17] Die Idiome der Slowenen und Makedonier waren davon deutlich unterschiedlich und entwickelten sich später zu eigenen Literatursprachen.
Aufgeklärte Intellektuelle und Politiker waren daher der Meinung, dass man aus gemeinsamer Sprache und Kultur auch eine einheitliche südslawische Nation wiedererwecken (oder erst schaffen) könne, die auf gemeinsamer Abstammung, Sprache und Kultur beruhte. Sie glaubten an ein primordiales südslawisches Urvolk, das ein ungewolltes Schicksal auseinandergerissen und auf unterschiedliche Reiche verteilt hätte. Den Protagonisten der südslawischen Einheitsidee half eine begriffliche Unschärfe: Die Lokalsprachen kannten nur das Wort narod, das semantisch nicht zwischen «Volk» und «Nation» unterschied. Hierin lag eine kreativ nutzbare, aber auch gefährliche Ambivalenz. Andererseits fehlte ein volkstümlicher Name für jenes gemeinsame Idiom, das damals «Slawisch», «Kroatisch», «Serbisch», «Bosnisch» oder einfach «naški» (unsere Sprache) hieß. So gab es weder ein begriffliches Äquivalent zur Bezeichnung «Deutsch» oder «Französisch», welches lokale und regionale Varianten überwölbt hätte, noch einen gemeinsamen Kollektivbegriff für deren Sprecher und damit auch keine «positive Prädisposition» für eine südslawische Nationsbildung.[18]
In allen hier betrachteten Regionen existierten im ausgehenden 19. Jahrhundert aber bereits sprachlich-kulturell bestimmte Bewusstseinsformen, die man als protonational bezeichnen könnte.[19] Gruppenzugehörigkeiten formten sich in Abgrenzung von anderen Gemeinschaften und stützten sich auf variierende Merkmale, etwa Kultur und Sprache, zuweilen auch Religion, soziales Milieu und regionale Herkunft. Welches Kriterium bei der Selbstidentifizierung jeweils im Vordergrund stand, hing vom jeweiligen Umfeld ab, was das kroatische Beispiel illustriert.
Wer um die Jahrhundertwende in den kroatischen Ländern herumreiste und die Bauern nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit fragte, erhielt sehr unterschiedliche Antworten.[20] Die Selbstbezeichnung «Kroate» war bereits im Umlauf, wurde aber alternativ mal als ethnische, mal als regionale Kategorie benutzt. Gleichzeitig bezeichnete man sich – je nach Wohnort – als «Slawonier», «Dalmatiner» oder «Istrianer». «Noch ist die Arbeit der Vereinigung der Kroaten selbst in Kroatien noch nicht vollendet», klagte der kroatische Gelehrte Julije Benešić 1911. «Noch schämen sich die Knaben aus Syrmien, sich öffentlich als Kroaten zu bezeichnen.»[21]
Ein wichtiges Identitätsmerkmal sahen die Menschen intuitiv in der slawischen Sprache, aber nur sofern sie mit Deutschen, Ungarn oder Italienern zusammenlebten und es eine eindeutige Kommunikationsbarriere gab. Nur dann identifizierte man sich primär als «Slawe» oder «Kroate». In den multi-konfessionellen, jedoch sprachlich homogenen Milieus, etwa in Bosnien oder in Slawonien, trat dagegen die Religion als Abgrenzungsmerkmal in den Vordergrund. Da man sich ja im selben Dialekt wie Serben, Montenegriner und Bosnier verständigte, reichte das Sprachkriterium an sich nicht aus, um das kroatische Selbst zu definieren. Hier sah sich ein kroatischer Bauer primär als «Katholik», «Christ» oder «Lateiner».[22] Noch waren kroatische Nationalidentität und Katholizismus nicht identisch, denn schließlich waren ja auch Deutsche, Österreicher, Italiener und Magyaren katholisch. Erst deutlich später, in den 1920er Jahren, sollte durch die Aktivitäten des katholischen Klerus und der Bauernpartei die Integration der kroatischen Nation unter dem Rubrum des Katholizismus vollendet werden.
Im Gegensatz zum Katholizismus hat die orthodoxe Kirche auch in dieser Zeit schon als starker Faktor der nationalen Identifikation und Integration der Serben gewirkt. Dies besaß einen historischen Hintergrund: Zu osmanischer Zeit waren die Religionsgemeinschaften als rechtliche Entitäten mit gewissen Autonomierechten organisiert. Diese sogenannten Millets übten weitreichende Selbstverwaltungsrechte aus. So durfte die orthodoxe Kirche Würdenträger ernennen und das Eigentum der Kirchen, Klöster und Wohlfahrtseinrichtungen selbst verwalten. Auch Familien- und Erbrecht lagen in ihrer Hand. Die Osmanen gestatteten der serbischen orthodoxen Kirche zwischenzeitlich Eigenständigkeit (Autokephalie), ausgeübt durch das Patriarchat in Peć im Kosovo. Die serbische Kirche wurde zur alleinigen Hüterin der untergegangenen mittelalterlichen Staatstradition. Serbische Könige wurden als Heilige verehrt, hagiographische Texte erinnerten an das goldene Zeitalter und seinen Untergang, Bischöfe waren zugleich geistliche und politische Führer.
Inhaltlich und begrifflich wurde daher schon im vornationalen Zeitalter «orthodox» mit «serbisch» gleichgesetzt. Ende der 1880er Jahre notierte der serbische Geograph Vladimir Karić: Dem Serben «ist es sehr wichtig, sich ‹Christ› zu nennen, genauer ‹Orthodoxer›, und er geht dabei so weit, den Glauben nicht von seiner Nationalität zu unterscheiden, so dass er diesen ‹serbischen Glauben› nennt, und infolgedessen jeden Menschen gleich welcher Volkszugehörigkeit auch ‹Serbe› nennen möchte, wenn er nur orthodox ist.»[23] Aufgrund der orthodoxen Religion verstanden sich in dieser Zeit auch viele Montenegriner als Serben. Beide Völker waren aus dem ethnischen Substrat des mittelalterlichen serbischen Staates hervorgegangen. Hieraus resultierte die bis in die Gegenwart nachwirkende Spaltung und nur zögernde Affirmation der montenegrinischen Nation. Die Verschmelzung von «orthodox» mit «serbisch» blieb in vielen Regionen bis in die 1930er Jahre erhalten. Erst später im 20. Jahrhundert verschwand der religiöse Sinngehalt. «Serbisch» wurde ebenso wie «montenegrinisch» in separate nationale Kategorien umkodiert.
Ein in der europäischen Geschichte einmaliger Vorgang ist die Identitätsbildung der bosnischen und serbischen Muslime.[24] Sie sind die Nachfahren jener orthodoxen, katholischen und andersgläubigen Slawen, die zur Zeit der osmanischen Eroberung – zumeist freiwillig – zum Islam übertraten. Die Motive waren vielfältig und dürften in einer Mischung aus Abschreckung und Anreizen bestanden haben. Nichtmuslime waren mit geringeren Aufstiegschancen, höherer Steuerlast und rechtlicher Diskriminierung zum Beispiel beim Grundbesitz konfrontiert. Übertritte zum Islam gab es vor allem dort, wo sich die christlichen Kirchen noch nicht fest etabliert hatten oder stark um Macht und Einfluss konkurrierten. Alte Volksbräuche wurden bei Konversion einfach in andere Formen gegossen. Zuweilen sollen sich ganze Familien in einen muslimischen und einen christlichen Zweig gespalten haben – eine Art sozialer Rückversicherung, um für einen möglichen Machtwechsel gewappnet zu sein.[25] Außer in Bosnien-Herzegowina traten auch im Sandžak und Kosovo, in Montenegro und Makedonien Slawen zum Islam über.
Das entscheidende Kriterium, das die Muslime von anderen trennte, war der Islam, der zugleich soziale Identität formte, Normen und Werte definierte, aber auch religiöse und kulturelle Praktiken vorgab.[26] Um die Jahrhundertwende war die kollektive Identität der bosnischen Muslime noch primär religiös geprägt. Sie kämpften für religiöse und kulturelle Autonomie, nicht nationalpolitische Verwirklichung. Nur eine Minderheit räsonierte bereits über die Säkularisierung der muslimischen Gemeinschaft im Zeitalter der Moderne, also die Trennung von Glauben und Gesellschaft. Aber erst tief im 20. Jahrhundert konsolidierte sich ein nichtreligiöses, ethnisches Gruppenbewusstsein.
In Altserbien und Makedonien, die noch zum Osmanischen Reich gehörten, war die Verwirrung am größten, die nationale Identitätsbildung noch am wenigsten weit vorangeschritten. In der sprichwörtlichen makedonischen Obstschüssel (französisch macédoine) lebten sowohl slawisch- wie griechischsprachige Christen, türkisch- und albanischsprachige Muslime, Juden, Walachen und Roma. Wie viele es jeweils waren, war Gegenstand heftiger ethnographischer und politischer Kontroversen.[27]
Gemäß der alten islamischen Ordnung dominierte die Religion vor ethnischen Unterscheidungsmerkmalen. Slawen und Griechen, die dem orthodoxen Millet angehörten, war es deswegen vornehmlich wichtig, sich gegenüber den herrschenden Osmanen als «Christen» zu identifizieren. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spaltete sich durch den bulgarischen Kirchenkampf die übergeordnete christlich-orthodoxe Gemeinschaft entlang ethnisch-sprachlicher Kriterien in einen bulgarischen, griechischen und serbischen Teil. Es sollte aber noch einige Jahrzehnte dauern, bis die Menschen diese neuartigen Unterscheidungen verstanden, geschweige denn verinnerlichten. Den slawischsprachigen Bauern Makedoniens war ihre ethnische Zugehörigkeit völlig einerlei, bis sie mit Aufkommen der «makedonischen Frage» zum Objekt konkurrierender territorialer Ansprüche und ethnographischer Klassifikationen aus Serbien, Bulgarien und Griechenland wurden.[28] Eine eigenständige slawisch-makedonische Nationalidentität ließ sich zu diesem Zeitpunkt erst umrissartig erahnen.
Vorerst war es in Makedonien – wie übrigens in vielen kulturell heterogenen Grenzregionen wie der Vojvodina oder Istrien – üblich, seine Identität nach Opportunitätserwägungen zu wechseln. In Skopska Crna Gora bestätigten die Bauern mal, sie seien Serben, mal Bulgaren, je nachdem, wie die Frage formuliert war.[29] Der schwedische Professor Rudolf Kjellén betrachtete die Bevölkerung daher als «ein Mehl, aus dem man jeden Kuchen backen kann, den man nur will, wenn über die Staatsangehörigkeit einmal entschieden wird».[30]
Wie überall in Europa wurde die «Erfindung der Nation» maßgeblich durch Intellektuelle, Wissenschaftler, Politiker und Kirchenvertreter in Szene gesetzt. Auf der Mikroebene erschien sie vorerst nur als abstraktes Gebilde. Das Zusammenleben mit anderen Glaubensrichtungen war für viele eine alltägliche, sozial strukturierte und zumeist konfliktfreie Erfahrung. Jedem war immer klar, wer zu welcher Volksgruppe gehörte: Es wurde mit dem Namen, durch Kleidung, religiöse Praktiken und soziale Barrieren, etwa das Heiratsverbot zwischen Christen und Muslimen, nach außen kommuniziert.
Ebenso gehörten gegenseitiger Respekt und gutnachbarschaftliche Beziehungen zur dörflichen Gesellschaft. Geburt, Heirat und Tod, aber auch Hausbau und Ernte, waren Anlass öffentlicher Rituale und Feste, bei denen die Menschen sich ihrer Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Abhängigkeit versicherten. Man unterstützte sich über die Religionsgrenzen hinweg durch nachbarschaftliche Ernte- und Bauhilfe (moba und pozajmica) sowie kollektives Zusammensitzen und Arbeiten in der abendlichen Runde (sijelo).
Wie in vielen ländlichen Regionen Europas dominierte in der einfachen Bevölkerung die traditionelle Volksfrömmigkeit über kanonische Vorgaben, und auch insofern gab es viele Berührungspunkte. Zwar orientierte man sich an offiziellen Feiertagen, aber oft handelte es sich lediglich um christliche und islamische Überformungen urtümlicher Bräuche. In Serbien hatte sich der Klerus damit abgefunden, dass man eher in die Kirche ging, um sich mit anderen zu treffen, als um dem Gottesdienst beizuwohnen. Die Priester tolerierten einen «freieren Umgang» der Gläubigen mit Gott und Kirche, etwa den Kult mit Ahnen und Hausheiligen.[31] Sogar noch in den 1930er Jahren entdeckte eine Studie über den Belgrader Vorort Rakovica, dass es in keinem einzigen Haus eine Bibel oder ein Neues Testament gab, obgleich hier jeder an Gott glaubte. «Nicht nur konnten wir nirgends diese Bücher finden, sondern auch keinen einzigen Menschen, der etwas über sie gewusst hätte […]. Alle wissen nur, dass es Kirchenbücher gibt, aus denen der Pope Gebete vorliest.»[32]
Gerade die Volkstradition baute viele Brücken zwischen den Religionsgemeinschaften: Wer seelischen Beistand suchte oder für rasche Genesung betete, mochte morgens den Priester und, der Sicherheit halber, nachmittags den Hodscha aufsuchen. Und am 2. August feiern (bis heute) die Orthodoxen den Tag des heiligen Elias, den Ilindan, und die Muslime den Alidun, was auch eine Redensart aufnimmt: «Do podne Ilija, od podne Alija» (vormittags Elias, nachmittags Ali).[33]
Um die Jahrhundertwende war der Nationsbildungsprozess – mit gewissen Zeitverschiebungen – überall in der Region noch in vollem Gange. Die protonationalen Gemeinschaften (die späteren Serben, Kroaten, Muslime usw.) hatten sich noch nicht vollständig als moderne Nationen konstituiert, was zunächst einmal kein spezifisch südslawisches Phänomen ist. Auch in Frankreich, Deutschland und Italien mussten zu dieser Zeit einfache Bauern erst noch in Nationsangehörige verwandelt werden.[34] Anders als dort hatte die jahrhundertelange Fremdherrschaft einen Raum voller Ambivalenzen entstehen lassen, in dem sich sprachliche, religiöse und historisch-politische Identifikationsangebote überlagerten. Unter anderem gab es kein klares Verständnis dessen, was eine Nation ausmache, sei es die gemeinsame Sprache und Kultur (wie in Deutschland und Italien) oder die Staatstradition (wie in Frankreich). Neben der – durch Johann Gottlieb Herder – in den südslawischen Raum vermittelten Idee der Kulturnation, die auf eine südslawische Integration hinweisen mochte, existierte als Erbschaft der osmanischen Periode das Phänomen der Konfessionsnation, das bei gemeinsamer sprachlicher Basis Trennendes aus der Religionszugehörigkeit ableitete. Serben, Kroaten und Muslime sprachen (und sprechen) die gleiche Sprache, verstanden sich aber aufgrund des Glaubens zunehmend als Angehörige unterschiedlicher Völker. Trotz gemeinsamer kultureller und sprachlicher Grundlagen und enger räumlicher Verflechtung erzeugten die disparaten historisch-politischen Traditionen, vor allem die unterschiedlichen religiösen Sinnsysteme, zu tiefe Spaltungen, als dass ein integrales jugoslawisches Identifikationsangebot ohne Instrumentierung «von oben» hätte Raum greifen können. Erst 1918 entstand mit dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen eine starke Sozialisationsinstanz, die die südslawische Amalgamierung aktiv betrieb.
Bevölkerung und Familie
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erfuhren alle südslawischen Länder tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Veränderungen. Bevölkerungswachstum, agrarisch-industrielle Entwicklung sowie der Übergang zu geld- und marktwirtschaftlichen Beziehungen brachten die traditionelle dörfliche Sozialordnung in Bewegung. Nicht unerheblichen Anteil daran hatte die wirtschaftliche Dynamik, die sich in der Mitte und im Westen des Kontinents entfaltete und die in Form des Imperialismus in Erscheinung trat: Industriewaren mussten Absatzmärkte und akkumuliertes Kapital neue Investitionsmöglichkeiten finden. Eisenbahnbau, überregionale Märkte und das Vordringen der Geldökonomie veränderten frühere Formen des Wirtschaftens und sozialen Zusammenlebens, die ihrerseits neue Erfahrungen, Mentalitäten und Bewusstseinsformen hervorbrachten. Im Gegensatz zum westlichen Europa waren die Umrisse der modernen Industriegesellschaft allerdings erst schattenhaft zu erkennen.
Es gab aber auch innergesellschaftliche Dynamiken. So kam es zwischen 1880 und 1910 infolge sinkender Sterblichkeit zu einem rasanten Bevölkerungswachstum. Die höchsten Raten erreichten Serbien (mit 71,3 Prozent) und Bosnien-Herzegowina (63,9 Prozent), gefolgt von Kroatien und Slawonien (38,6 Prozent), Dalmatien (35,7 Prozent) und der Vojvodina (33,6 Prozent). Das Schlusslicht bildete Slowenien (9,4 Prozent).[35] Erst in der Zeit zwischen den Weltkriegen schloss sich die demographische Schere. Zusammen mit Russland und Ungarn wies Südosteuropa die höchsten Geburtenraten Europas auf.[36] Einer der Gründe für das starke demographische Wachstum lag in der ländlichen Großfamilie, der zadruga (Hauskommunion). Diese besondere Form der erweiterten Familie bildete – außer in Slowenien – den Kern der traditionellen Sozialordnung auf dem Lande.[37] Söhne und Enkel blieben mit ihren Familien im elterlichen Haushalt, während Töchter in andere Zadrugen einheirateten. Anders als im europäischen Westen, wo die Gründung eines Haushaltes eine Vollerwerbsstelle in Landwirtschaft oder Handwerk voraussetzte und viele Menschen deswegen spät oder gar nicht heirateten, konnte das sozial-ökonomische Netz der südslawischen Großfamilie zusätzliche Familienmitglieder immer leicht integrieren: Man heiratete jung und bekam viele Kinder. In Ost- und Südosteuropa fehlte der Sozialordnung also ein wichtiges Regulativ, das Westeuropa vor extremem Bevölkerungswachstum bewahrt hatte.
Anders als im Westen löste sich die traditionelle Einheit zwischen produktiven und reproduktiven Funktionen der Familie, zwischen Heim und Arbeitsstätte, erst zu dieser Zeit auf. Die Hauskommunion lebte und wirtschaftete im Kollektiv. Es gab keinerlei privates Eigentum, auch nicht an Geld. Oberhaupt war der Hausvater, der kraft seiner natürlichen Autorität Herr im Haus war. Er vertrat die Familie nach außen, regelte familiäre und wirtschaftliche Angelegenheiten und hatte in allen wichtigen Angelegenheiten das letzte Wort. Die Frauen hatten eine untergeordnete Stellung inne und besaßen praktisch keinerlei Rechte. In der patriarchalischen Gesellschaft bestimmten strenge Verhaltensregeln den Alltag und beschränkten die persönliche Freiheit des Individuums. Dort, wo wie in Montenegro und Kosovo der Staat nie recht Fuß gefasst hatte, herrschte ein strenger, archaischer Ehrenkodex, der auch die Blutrache einschloss.
Zeitversetzt und mit unterschiedlichem Tempo begannen die Zadrugen in den historischen Regionen zu zerfallen. Dabei spielten die wachsende Familiengröße, die allmähliche Ausdehnung der Marktwirtschaft, neue Erwerbsmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe sowie die Auflösung der patriarchalischen Ordnung eine Rolle. Immer mehr Haushalte spalteten sich, wahrscheinlich an einem kritischen Punkt von 20 bis 40 Mitgliedern.[38] Dies ging im Westen früher und schneller vor sich als im Osten und Süden. In Kroatien und Serbien lebte um 1890 immerhin noch ein Fünftel der Bevölkerung in der Großfamilie.
Sozialer und ökonomischer Wandel
Um die Jahrhundertwende lebten rund 85 Prozent der Bevölkerung in Kroatien-Slawonien, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina von der Landwirtschaft, nur ca. 10 Prozent verdienten ihren Unterhalt in Industrie, Handwerk und Handel, die übrigen in freien Berufen. Nur im heutigen Slowenien gehörten 1910 lediglich noch rund 66 Prozent zum Agrarsektor, 11 Prozent zu Bergbau und Industrie.[39]
Der südslawische Raum zerfiel in eine Vielzahl disparater agrarrechtlicher Systeme. In Österreich-Ungarn war 1848/49 die Grundherrschaft abgeschafft worden, so dass die Bauern Eigentümer des von ihnen bearbeiteten Landes wurden. Dies führte zu einer differenzierteren Besitz- und Sozialstruktur mit einigen moderneren landwirtschaftlichen Großbetrieben, einer wohlhabenden bäuerlichen Mittelschicht, aber auch wachsender Landarmut. Dies legte die Grundlagen für eine – wenn auch bescheidene – industrielle Entwicklung. Auch in Serbien war nach den Aufständen 1815 bis 1833 das Feudalsystem abgeschafft worden, und auch hier herrschte das Prinzip, dass das Land demjenigen gehören soll, der es bearbeitet. In den übrigen Landesteilen hielten sich dagegen feudale Abhängigkeitsverhältnisse unterschiedlicher Art: In Istrien und Dalmatien überlebte das Institut des Kolonats (oder težaština) und der Fron (kmetije), das den Bauern zu Abgaben (von einem Fünftel bis zur Hälfte des Ertrags) verpflichtete. Es existierte in vielen unterschiedlichen Varianten. Noch 1925 sollen bis zu 100.000 Bauernfamilien als Kolonen fremdes Land bewirtschaftet haben.[40] Auch in Bosnien-Herzegowina blieb mit dem čiftlik-System die feudale Agrarverfassung intakt. Mehr als die Hälfte der Familien, mehrheitlich orthodoxe und katholische Fronbauern, die Kmeten, war persönlich unfrei und zu drückender Abgabenlast (meist ein Drittel der Ernte) verpflichtet. Zwar stand ihnen das Recht zu, sich durch eine Ablöse freizukaufen. Anfang 1914 bewirtschafteten aber immer noch 93 336 Kmetenfamilien rund ein Drittel des gesamten kultivierbaren Landes.[41] Ähnliche urtümliche Abhängigkeitsverhältnisse herrschten auch in Makedonien und Kosovo.
Dort, wo Agrarreformen stattfanden, waren sie halbherzig und widersprüchlich. Die Gesetzgeber in Kroatien-Slawonien, Serbien und Montenegro versuchten, die Verarmung der Bauernschaft zu verhindern, indem sie am Prinzip des ungeteilten kollektiven Eigentums und der Solidarität der Familie auf Lebenszeit festhielten. In Serbien war die Separierung der Zadruga lediglich in Ausnahmefällen gestattet, und in Kroatien wurde diese 1889 nur dann erlaubt, wenn ein Mindestbesitz nicht unterschritten wurde. In die gleiche Richtung ging der Schutz der Heimstätte (okućje). Um die Bauernschaft vor Überschuldung und Notverkäufen zu bewahren, war in Serbien eine Mindestfläche von 3,45 Hektar einschließlich Wohnraum, Zugvieh und Inventar von hypothekarischer Belastung und Notverkäufen ausgeschlossen. Dies verhinderte die Mobilisierung von Boden und Arbeitskraft, die Ausbreitung marktwirtschaftlicher Beziehungen und damit die Differenzierung der Besitz- und Gesellschaftsstrukturen auf dem Lande.[42]
Aus diesen Gründen war das Agrarproblem um die Jahrhundertwende überall in der Region eine bleierne Last. Die Aufteilung der Großfamilien resultierte in fortschreitender Zersplitterung des Grundbesitzes, das Land wurde in kleine, unproduktive Parzellen aufgeteilt, Vieh und Gerät auseinandergerissen, nicht selten das ganze Haus Balken für Balken zerlegt. Mindestens ein Drittel der Bauern in der Region bewirtschaftete weniger als zwei Hektar Land, ein weiteres Drittel nur bis zu fünf Hektar. Nur in Zentralkroatien und in der Vojvodina gab es nennenswerten Großgrundbesitz, in Serbien, Dalmatien und Kärnten praktisch gar keinen.[43]
Ergebnis waren Verschuldung und Armut. Wer weniger als fünf Hektar bewirtschaftete, konnte gerade überleben, wer weniger als zwei Hektar besaß, litt große Not. 1910/12 konnten zwei Drittel der Bauern in Serbien das Existenzminimum nicht decken. Mehr als die Hälfte besaß kein Gespann, ein Drittel keinen Pflug und nicht mal ein Bett.[44] Auch in Kroatien-Slawonien, Dalmatien, Istrien und Bosnien-Herzegowina war die Armut unbeschreiblich. Ähnliche Lebenslagen und Krisenerfahrungen besaßen starken Anteil daran, die südslawischen Völker später politisch zusammenzuschmieden.
Auch die Agrarproduktivität war niedrig, viele Haushalte verharrten in der Subsistenzproduktion. Zwar drangen marktwirtschaftliche Beziehungen schrittweise auf das flache Land vor, zuerst in Südungarn, Syrmien und Slawonien, mit Verzögerung auch in Serbien und zuletzt in Bosnien-Herzegowina, Makedonien und Montenegro. Damit geriet der bäuerliche Haushalt allerdings auch in größere Abhängigkeit von Konjunkturschwankungen. Der Mehrheit fehlten das Kapital und die Kenntnisse, um die Landwirtschaft zu intensivieren. Bodennutzung und Anbautechnik blieben einseitig, Kunstdünger und modernes Ackergerät waren weithin unbekannt, ebenso Hackfrüchte und Industriepflanzen. Dies änderte sich erst in der Zeit zwischen den Weltkriegen.
Der Zuwachs an agrarischer Produktivität blieb weit hinter der dynamischen Bevölkerungszunahme zurück. Statt zur Intensivierung schritten die Bauern zur Extensivierung. Sie erschlossen Wälder und Weiden für den Anbau von Getreide, reduzierten die Vieh- zugunsten der Ackerwirtschaft und stellten ihre Ernährung von fleischlicher auf pflanzliche Nahrung um. Dennoch war die Versorgung mit Lebensmitteln prekär. In 28 Prozent der serbischen Bauernhaushalte fehlten in jedem Jahr schon Ende Oktober Lebensmittel, in weiteren 46 Prozent spätestens im Januar und Februar, was gravierende Auswirkungen auf Ernährung und Gesundheitszustand der Landbevölkerung hatte.[45] Mit rund hundertjähriger Verspätung traf der Fluch der ländlichen Überbevölkerung die südslawischen Länder zu einer Zeit, als er in weiten Teilen Europas längst gebrochen war.
Wie in vielen europäischen Gesellschaften suchten die Menschen in der Arbeitsmigration Auswege aus der Misere. Dabei knüpften sie an traditionelle Formen periodischer Wanderarbeit, die pečalba an. Aus Bosnien, Serbien, Montenegro, Kosovo und Makedonien machten sich am Vorabend des Ersten Weltkrieges jährlich rund 150.000 Männer auf den Weg, um sich als Wanderhandwerker, Lohnarbeiter oder Kleinstunternehmer in den Nachbarregionen zu verdingen. Auch Istrien und Dalmatien waren klassische Abwanderungsregionen.
Später als überall in Europa nahm die transkontinentale Arbeitsemigration erst in den 1880er Jahren bedeutende Ausmaße an. Mehr als eine halbe Million Südslawen brachen zwischen 1899 und 1913 in die Neue Welt auf, davon vier Fünftel aus der Habsburger Monarchie.[46] Da die überseeischen Einwanderungsländer aus konjunkturellen Gründen die Zuwanderung seit der Jahrhundertwende beschränkten, ergaben sich weit geringfügigere Entlastungen des Arbeitsmarktes, als dies in früheren Jahrzehnten etwa in Deutschland oder Skandinavien der Fall gewesen war. Das Gros der strukturell unterbeschäftigten Erwerbsuchenden blieb im eigenen Land.
Die niedrige Agrarproduktivität dämpfte die gewerblich-industrielle Entwicklung. Weder produzierte der landwirtschaftliche Export Gewinne, die in der Industrie hätten investiert werden können, noch entstand eine breitere Binnennachfrage nach Fertigprodukten auf dem Lande. Die Menschen waren schlicht zu arm, um sich mit Waren zu versorgen, die sie nicht selbst produzierten. Die Industrialisierung setzte in den südslawischen Ländern daher später, langsamer und in anderen Branchen ein als im Rest Europas. Während die Spätstarter Schweden und Dänemark im 19. Jahrhundert doch noch eine tragfähige Industrialisierung in Gang brachten, und auch Italien, Ungarn und Russland immerhin regionale Schwerpunkte ausbildeten, erfuhren die Balkanländer – gemeinsam mit Spanien und Portugal – bis zur Jahrhundertwende noch kein substantielles industrielles Wachstum.[47] Einen Industrialisierungsschub sollte es nicht vor den 1930er Jahren geben, der Umschlag zur Hochindustrialisierung fand erst nach 1945 statt.
Ursächlich war ein Bündel struktureller Faktoren: die rückständige Verkehrsinfrastruktur, die den Aufbau überregionaler Märkte behinderte, der chronische Kapitalmangel und das niedrige Bildungsniveau, nicht zuletzt die starke Konkurrenz aus den entwickelten Regionen der Habsburger Monarchie. Seit der Jahrhundertwende wuchsen Betriebe, Beschäftigte und Produktion von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau nun jährlich um über zehn Prozent, gleichwohl vergrößerte sich der Abstand zum übrigen Europa.[48] In Kroatien-Slawonien stieg die Zahl der Industriearbeiter zwischen 1890 und 1910 von 9832 auf 23 604. In Serbien vergrößerte sie sich trotz einer aktiven staatlichen Industriepolitik bis 1910 auf lediglich 16 095. In Bosnien-Herzegowina standen 1912/13 infolge der österreichungarischen Entwicklungspolitik mehr als 65.000 Industriearbeiter in Lohn und Brot.[49]
Da die protoindustriellen Gewerbe in der frühen Neuzeit schwach gewesen waren, entwickelte sich die Industrie in Südosteuropa seltener aus dem Verlagswesen als aus dem Handwerk. Nicht der Textilsektor (wie in England) oder die Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie (wie in Deutschland) standen am Anfang, sondern Landwirtschaft (Mühlen und Brauereien) und Forsten (Holzverarbeitung). 1910 erwirtschaftete die Nahrungsmittelbranche 55 Prozent des Wertes der Fabrikproduktion in Serbien, die Textilindustrie nur 8 Prozent. In Kroatien waren holzverarbeitende Zweige führend, erst ab 1900 trat eine stärkere Diversifizierung ein.[50] Wegen der geringen technologischen Anforderungen in diesen Sektoren blieb ein durch stärkere Nachfrage nach Maschinen ausgelöster Spin-off-Effekt aus. Die Schwerindustrie spielte vorerst noch eine untergeordnete Rolle, mit Ausnahme Bosnien-Herzegowinas, wo das österreichisch-ungarische Kolonialregime einen starken Schub auslöste.[51]
Leben in der Stadt
Die Urbanisierung blieb bis in die Zwischenkriegszeit hinein verhalten und stark agrarisch geprägt. Eisenbahnbau, Bergwerke und Fabriken zogen Arbeitsuchende vom Land an, Städte wuchsen und veränderten ihr Gesicht. Allerdings sind Qualifizierungen in Hinblick auf den Begriff der «Stadt» angebracht, die im Durchschnitt nur einige tausend Einwohner besaß. In den 30 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hat sich die Bevölkerung der Großstädte verdreifacht. Dennoch: Belgrad besaß 1900 nur 68 481 Einwohner, Zagreb 57 690, Sarajevo 38 035 (1895), Ljubljana 46.000 (1910). Der Zuzug vom Lande war immens, und dennoch lebten 1910 in Serbien erst 13,2 Prozent der Bevölkerung in Städten, in Kroatien nur 8,5 Prozent. Lediglich Russland und Finnland unterschritten diesen Wert.[52]
Die Zuwanderung vom Land veränderte aber Aussehen und Struktur der (Vor-)Städte: Je mehr Neuankömmlinge zuzogen, desto stärker drang die dörfliche Lebensweise in den städtischen Alltag ein. Die Masse der Städter lebte unter erbärmlichsten Bedingungen, und zwar in ebenerdigen, kleinen Gehöften, nicht in Mietskasernen und Hinterhäusern wie im Westen. Der Wohnraum war überteuert, überfüllt, schlecht zu belüften, verwahrlost und ohne sanitäre Einrichtungen. Eine größere Erhebung erwähnte 1906 «nur nebenbei […], dass eine enge Kausalverbindung zwischen dem Leben in solchen Wohnungen und den drei größten Feinden der Volksgesundheit besteht – der Tuberkulose, dem Alkoholismus und den Geschlechtskrankheiten».[53] Nur eine kleine wohlhabende Elite lebte in komfortablen Stadthäusern.
Nicht rauchende Schornsteine und proletarisches Elend prägten das Stadtbild, sondern die schäbigen Unterkünfte ehemaliger Landbewohner und Kleingewerbetreibender sowie eines wachsenden Heeres arbeitsuchender Tagelöhner.[54] In Zagreb, Sarajevo und Belgrad lebte jeder zweite Stadtbewohner noch von der Landwirtschaft. Viele bebauten in den Vororten Land, hielten Geflügel, Schweine oder eine Kuh. Dies ist vielleicht das herausragende Charakteristikum der südosteuropäischen Urbanisierungsgeschichte vor dem Zweiten Weltkrieg: Viele Städte waren in Wirklichkeit nicht mehr als riesige Dörfer, lediglich die Zentren von Ljubljana, Zagreb und Belgrad und weniger Mittelstädte machten «europäische» Metamorphosen durch.
In Serbien wurden ab den 1870er Jahren große Anstrengungen unternommen, die Spuren der osmanischen Vergangenheit zu beseitigen, damit, wie Stadtplaner Emilijan Josimović sich ausdrückte, die «Hauptstadt nicht die Form bewahrt, die ihr das Barbarentum gegeben hat».[55] Nach dem Vorbild Wiens und seiner Ringstraße wurde Belgrad restrukturiert. Lediglich die Zitadelle, zwei Moscheen und einige Brunnen mit türkischen Inschriften erinnerten dann noch an die 350 Jahre währende Osmanenzeit.[56] Beinahe zeitgleich mit den westeuropäischen Metropolen erhielt Belgrad in den 1890er Jahren elektrische Beleuchtung und Straßenbahn, nach 1900 auch Kanalisation und Wasserleitung.[57] Die Stadtplaner waren vom Wunsch getrieben, ungeachtet der bescheidenen Ausgangsvoraussetzungen mühselige Nachholprozesse einfach zu überspringen, quasi den «Flugzeugmotor auf den Ochsenkarren» zu spannen.[58] Belgrad wurde zum Paradigma der Moderne, zum Schaufenster einer Kultur, die den Westen mehr schlecht als recht imitierte.
Um die Jahrhundertwende veränderten sich Alltag und Gewohnheiten in den Städten mit rasender Geschwindigkeit, was zuallererst an der Verbreitung der Bürgertracht, dem gradjanski kostim, zu erkennen war. In Belgrad ersetzten Hüte und Filzkappen den traditionellen Fez. Anstelle des auf dem Dorf verbreiteten abendlichen Zusammensitzens kam in der Belgrader Oberschicht der elegante Empfangstag žur (jour de réception) in Mode.[59] Eine dünne urbane Oberschicht begann, europäische Formen der Geselligkeit und Lebensstile wie Salon, Freizeitgestaltung und Wohnkultur zu übernehmen.[60] Auch das bürgerlich-romantische Liebes- und Eheideal begann sich durchzusetzen.
Aber es gab auch Verschränkungen zwischen den fernen Welten von Stadt und Land. Lebensart, Moden und Umgangsformen drangen allmählich in den bäuerlichen Alltag ein. «Wo früher ein Holzbecher genügte, findet sich jetzt ein Glas; die Petroleumlampe ersetzt den bisher gebräuchlichen Kienspahn […], eisenbeschlagene europäische Bauernwagen verdrängen das alte prähistorische Vehikel mit den kreischenden Holzrädern.»[61] Trug man noch bis Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Lande die jeweilige lokale Volkstracht, zogen Männer und Frauen in den Städten bereits westeuropäische Kleidung an. Der Sittenwandel in den Städten strahlte dann auch auf die Provinz aus. Man begann, das geläufige «Du» durch das höflichere «Sie» zu ersetzen, und begrüßte sich neuerdings mit den Worten «dobar dan» (guten Tag) – auf «deutsche Art».[62]
Fortschritt und Verunsicherung
Der Wunsch nach nationaler Emanzipation war in nicht geringem Maß vom Bewusstsein der eigenen Rückständigkeit getrieben. Die Befreiung aus der Fremdherrschaft galt als Voraussetzung einer besseren Zukunft, quasi als entwicklungspolitische Überwindungsstrategie, die es den Völkern der Region erlauben sollte, endlich als gleichberechtigte Mitglieder an der europäischen Zivilisation teilzuhaben. Die Vorboten des neuen europäischen Zeitalters, wie technischer Fortschritt, bürgerliche Kultur und liberale Sozialmoral, brachen über die Bauerngesellschaften Südosteuropas nun aber sehr plötzlich herein, erschütterten hergebrachte Identitätsanker und wirbelten traditionelle Werte und Gesellschaftsbeziehungen durcheinander. Besonders die ehemals osmanisch regierten Länder erlebten zudem einen tiefen Traditionsbruch mit dem muslimischen Erbe, das Alltag und Gesellschaft vierhundert Jahre lang geprägt hatte und das nun durch neue Sinngehalte ersetzt werden musste. Dies dämpfte den Fortschrittsoptimismus und förderte eine beklemmende Verunsicherung in Bezug auf die Zukunft. Die Hauptfrage war, wie die eigene sozial-kulturelle Identität mit den neuen Herausforderungen zu vereinbaren war.
Seit der Aufklärung kultivierten die intellektuellen Eliten Südosteuropas die Idee gesellschaftlichen Fortschritts, den sie mit Begriffen von «Vernunft» und «Wissenschaft» identifizierten und mit «Europäisierung» gleichsetzten.[63] Träger dieser intellektuellen Verflechtung im 19. Jahrhundert waren die jungen Studenten, die höhere Schulen und Universitäten in Russland, Deutschland, Frankreich, Italien, Ungarn und Österreich besuchten. Durch sie wuchs im Lauf der Jahrzehnte eine europäisch orientierte Intelligenz heran, die mit den Ideen des Liberalismus, Sozialismus und russischen Populismus bekannt war.[64] Analog rezipierten die muslimischen Bildungsschichten islamische Ideologien und Bewegungen aus dem arabischen Raum, aus Asien und Russland.[65] Islamische Gelehrte setzten sich aber auch intensiv mit europäischer Philosophie, vor allem dem Rationalismus, auseinander. Wie konnten im Lichte des Niedergangs der osmanischen Macht die westlichen Errungenschaften in Verwaltung, Wirtschaft, Militär und Justiz erklärt werden?[66]
Die jüngeren Generationen hungerten nach allem, was half, Antworten auf die großen Fragen der neuen Zeit zu geben. Wie konnte der Fluch der Rückständigkeit überwunden, wie das geistig-technische Niveau Europas erreicht werden? Mit welchen Mitteln konnten der patriarchalische Geist bekämpft und das nationale Bewusstsein der Landbevölkerung geweckt werden? Wie würde man sich gegenüber den Interessen der Großmächte behaupten und wie das Gemeinwesen politisch organisieren?
Cum grano salis haben die gebildeten Schichten Südosteuropas alle großen intellektuellen und politischen Bewegungen Europas (respektive der islamischen Welt) mit- oder nachvollzogen. Dies steht im Widerspruch zu einem beliebten Stereotyp, das Ausbleiben von Reformation und Aufklärung auf dem Balkan habe spezifisch antiwestliche, modernisierungsfeindliche Orientierungen langer Dauer hervorgebracht.[67] Entscheidend war jedoch weniger die grundsätzliche zivilisatorische Verschiedenheit von lateinischem Westen und orthodoxem bzw. islamischem Osten, sondern die Tatsache, dass die Rezeption der großen Ideen unter vollständig anderen gesellschaftlichen Umständen stattfand. Um die Jahrhundertwende lebten noch mehr als vier Fünftel der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Wer unter den Bedingungen entstehender politischer Massenöffentlichkeiten breitere Resonanz finden wollte, musste zuallererst den Einstellungen, Werten und Interessen der Bauernschaft Rechnung tragen.
Bis dato hatte sich keine industrielle Gesellschaft nach westlichem Vorbild entwickeln können, wenngleich es bereits klare Anzeichen für eine allmähliche Verbürgerlichung der politischen Systeme, der Öffentlichkeiten, Nationalkulturen sowie der Lebensstile und Wertorientierungen in den Städten gab.[68] In Slowenien, Kroatien und Slawonien existierten hierfür die günstigsten Voraussetzungen: Aus den traditionellen städtischen Schichten, wohlhabenden Bauern, dem Adel, Handwerkern, Kaufleuten, Beamten und Offizieren konstituierte sich im 19. Jahrhundert ein schmales, ökonomisch fundiertes Bürgertum. Neu aufstrebende Wirtschaftskreise wünschten sich immer nachdrücklicher mehr rauchende Industrieschlote herbei. Auch ein neuartiges Vokabular hielt Einzug: «Produzenten», «Wettbewerb», «Konjunktur», «Kapitalismus» und «Arbeiterklasse».[69] In den ehemals osmanischen Bauerngesellschaften sah es anders aus, weil im Zuge der Entosmanisierung die mehrheitlich muslimischen städtischen Schichten abgewandert waren. Die bürgerliche Entwicklung musste hier, ebenso wie in Serbien, buchstäblich ex nihilo beginnen. In weniger als drei Generationen entstand eine neue gesellschaftliche Elite, die aus ärmlichen Verhältnissen vom Lande stammte, dann in höhere Posten im Staatsdienst oder in den freien Berufen aufstieg.
In allen südslawischen Ländern entpuppten sich die verbesserten Bildungschancen auf dem Lande und die größere regionale Mobilität der schulischen und universitären Jugend als starker Motor der geistigen, nationalen Erweckung. Die erste Generation der im Ausland Ausgebildeten trug bereits in den 1860er und 1870er Jahren die Ideen des Liberalismus nach Serbien, was auch das 1881 geschaffene politische System reflektierte. Sowohl die regierende Fortschrittspartei als auch die Liberalen favorisierten eine möglichst rasche Imitation des westlichen Entwicklungsweges, um die «Grenzen des veralteten patriarchalischen Serbien» zu sprengen.[70] Aber es war nur eine kleine Elite, die davon überzeugt war, man könne dem eigenen Land das europäische Fortschrittsmodell in einer Art «Revolution von oben» einfach überstülpen. Serbien fehlte das Unterfutter bürgerlicher Schichten, die die westliche Art der Modernisierung tiefer in der lokalen Gesellschaft hätten verankern können. 1900 gab es in Belgrad neben der königlichen Familie noch sechs weitere Millionäre, in Zürich hingegen 500.[71]
Nicht die Wirtschaft, sondern die politische Sphäre bildete daher jenen Aktionsraum, in der das Neue primär gestaltet wurde. Es gab in Serbien keine Partei, die sich nicht politische Freiheiten auf die Fahnen geschrieben hätte und gleichzeitig keine, die ein klares wirtschaftliches Reformprogramm vorgehabt hätte. So öffnete sich eine schwer überbrückbare Kluft zwischen politischer Modernität und ökonomischer Rückständigkeit. Das serbische «Tagblatt» (Dnevni list) illustrierte das folgendermaßen: «Nirgendwo sonst in der Welt gibt es die wundersame und absurde Situation, dass moderne Ideen über politischen und sozialen Fortschritt im Parlament von bäuerlichen Wucherern, ehemaligen Dorfgendarmen und analphabetischen […] Hühnerhändlern vertreten werden.»[72]
Alles Nachdenken über nachholende Entwicklung und Europäisierung fand vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Mächtekonkurrenz im imperialistischen Zeitalter statt. Zwar war der Balkan seit Jahrhunderten Adressat hegemonialer Machtprojektion gewesen. Durch Hochindustrialisierung und globale Wirtschaftsexpansion gewann diese im ausgehenden 19. Jahrhundert aber eine neue Qualität: Zunehmend ging es um die Sicherung von Absatzmärkten sowie neue kapitalintensive Investitionsmöglichkeiten. Handels- und Kreditpolitik sowie Eisenbahnbau schufen neue wirtschaftliche Abhängigkeiten, denen sich die jungen Balkanstaaten zunächst nur schwer entziehen konnten. Serbien hatte nach dem Berliner Kongress unvorteilhafte Verträge mit Österreich-Ungarn schließen müssen und steckte bald tief in der Schuldenfalle: Zwischen 1880 und 1914 wuchsen die Verbindlichkeiten von 16,5 Millionen auf 903,8 Millionen französische Francs.[73] Daher schwang in der Europäisierungsdebatte auch immer die Angst vor äußerer Abhängigkeit mit, was etwa der Streit über den Eisenbahnbau illustriert.
Anfang der 1880er Jahre waren Serbien und Montenegro die einzigen Länder in Europa ohne Schienennetz. Im Parlament war der Widerstand gegen den vom Berliner Kongress verordneten Eisenbahnbau dennoch heftig. War die serbische Gesellschaft überhaupt schon reif für die technologische Revolution, fragten die Abgeordneten. Und schuf die oktroyierte Modernisierung nicht absichtsvoll neue Abhängigkeiten von ausländischen Kreditgebern? Serbien werde «das gleiche Schicksal erleiden wie die Indianer nach der Entdeckung Amerikas», hieß es im Parlament, man denke an Kolumbus, der «die europäische Kultur nach Amerika brachte, aber mit ihr auch die Ketten der Sklaverei».[74]
In Serbien und Montenegro spalteten sich die Eliten vereinfacht gesagt in zwei Hauptrichtungen, die in etwa der Opposition zwischen «Liberalen» und «Konservativen» bzw. von «Westlern» und «Slawophilen» in Russland entsprach: eine europäisch-moderne und eine slawisch-traditionale.[75] Während die liberalen, staatsorientierten «Westler» auf die Trennung von Staat und Kirche sowie auf die Reform von Institutionen, Recht und Verfassung setzten, kultivierten die konservativen, gemeinschaftsorientierten «Traditionalisten» eher die autochthonen Wurzeln eines meta-historisch, naturgegeben und organisch gedachten Volkstums. Beide Strömungen hatten eine bessere Zukunft im Blick, wobei erstere stark auf den institutionellen Wandel, letztere eher auf den originären élan vital der Slawen abhob.[76]
Analog zerfiel die muslimische Intelligentsia in einen europäisch-laizistischen und einen islamisch-religiösen Flügel, ein Prozess, der sich in der gesamten islamischen Welt beobachten ließ.[77] Die einen hatten weltliche Schulen und europäische Universitäten besucht, opponierten gegen die traditionelle, religiöse Gelehrsamkeit und neigten einem säkularen, politisch determinierten Nationskonzept zu. Die Mehrheit hielt dagegen noch an der islamischen Prägung bosnisch-muslimischer kollektiver Identität fest. Denn die Muslime wurden durch das habsburgische Zivilisierungsprojekt buchstäblich in eine neue Welt katapultiert. Die bisherige, universal begriffene politische Legitimität des Islam musste einer aus dem Westen importierten, fremdbestimmten säkularen Staatsgewalt weichen, die nicht zuletzt seine sozial-kulturelle Basis fundamental erschütterte. Wie konnte das Neue mit dem Bewährten, der universale Modernisierungsanspruch mit der Bewahrung kulturell-religiöser Identität in Einklang gebracht werden?
Die reformistische Strömung des Salafiya, die dem wahren Islam durch Neuinterpretation der alten Quellen nachspürte und in diesen Jahren Verbreitung fand, öffnete den Weg für zwei unterschiedliche Anpassungsstrategien. Die eine postulierte die Kompatibilität des Islam mit der westlichen Rationalität und empfahl die «Modernisierung des Islam». Glaube und Wissenschaft, so das Argument, bildeten seit der frühen Zeit keine Gegensätze. Osman Nuri Hadžić beispielsweise entwarf 1894 in seiner Schrift «Islam und Kultur» ein rational-aufklärerisches Zukunftsmodell.[78] Die andere, zunächst schwächere, betonte Universalität und Werte der eigenen Religion und drang auf eine «Islamisierung der Moderne». In dieser Denktradition stand auch der Panislamismus, der seit Beginn des Jahrhunderts etwa in der Zeitschrift Behar («Blüte») ein Forum fand.[79]
Alle Diskurse über Zukunft, Modernität und Fortschritt verweisen auf eine enge Verbindung mit jenen über kulturelle Identität, kollektive Werte, nationale Selbstbehauptung und Würde. Wie überall in Europa riefen die neuen Herausforderungen heftige Gegenreaktionen hervor. Man kleidete Zukunftsängste und anti-moderne Reflexe in egalitäre Diskurse, beschwor bäuerliche Traditionen, lokale Selbstverwaltung und die Großfamilie, um gegen den umstürzlerischen Trend der neuen Zeit anzukämpfen. War nicht der künstliche Aufputz der Hauptstadt Belgrad, der in so krassem Gegensatz zur ärmlichen Lebenswelt der Masse stand, letztlich ein subversiver Anschlag auf die sozial gerechte serbische Agrargesellschaft? Weshalb sollte die Hauptstadt der Außenwelt Fortschritt und Hochkultur vorgaukeln, wo doch das platte Land in Wirklichkeit in Armut versank?[80]
Vor diesem Hintergrund formte sich um die Jahrhundertwende der Grundgegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen moderner, westlich geprägter Urbanität auf der einen Seite und dem Dorf, das in seiner traditionellen Sozialkultur verharrte, auf der anderen. Die Stadt kondensierte alle Hoffnungen und Ängste in Bezug auf die Moderne; sie war gleichzeitig Metapher für Fortschritt und Verfall, Versprechen einer besseren Zukunft wie Signal für den Rückzug der alten sozial-moralischen Ordnung. Mehr noch symbolisierte die Stadt-Land-Dichotomie auch die soziale Scheidelinie zwischen «Herren» und «Volk», zwischen den «Mantelträgern» (kaputaši) und jenen in der Bauerntracht.
Diese in ganz Europa typische Konfrontation von Eigenem und Fremdem, der vermeintlichen Sicherheit patriarchalischer Werte auf der einen Seite und den Verlockungen und Wagnissen urbaner Progressivität auf der anderen, dienten als Blaupause zahlreicher literarischer Werke.[81] Der häufig als kulturell fremdartig wahrgenommene «Fortschritt» radikalisierte Ängste vor Identitätsverlust und Sittenverfall, die sich in der serbischen Literatur eines Laza Kostić, Djura Jakšić oder Stevan Sremac bzw. auf bosnischer Seite bei Safet Beg Bašagić und Edhem Mulabdić artikulierten.[82] Stadt und Land fungierten dort als symbolische Repräsentation gegenläufiger Kräfte der Beharrung und des Wandels sowie widersprüchlicher Ängste: vor einem Rückfall in Atavismus und Barbarei auf der einen Seite und vor dem unwiederbringlichen Verlust des Bekannten und Bewährten auf der anderen. Eine ganze Legion von Ethnographen, Dorfforschern und Historikern setzte sich in Bewegung, um den wahren Wurzeln der serbischen, kroatischen und slowenischen Kultur nachzuspüren und die heile bäuerliche Gegenwelt zur rauen industriellen Gegenwart zu rekonstruieren. Modernität bedeutete häufig Fremdheit, ja Entfremdung, «etwas, das beseitigt werden sollte», wie sich ein Abgeordneter im serbischen Parlament ausdrückte.[83]
Sowohl die Liberalen wie die Radikalen in Serbien strebten danach, die Spannungen zwischen traditionellen Gesellschaftsstrukturen und patriarchalischen Werten auf der einen und den Anforderungen moderner Rechtsstaatlichkeit, Wirtschafts- und Regierungsführung auf der anderen Seite aufzulösen. Als Gesetzgeber griffen sie daher bei den Reformen von Agrar-, Familien-, Handels- und Gewerberecht immer wieder auf altes Gewohnheitsrecht zurück, um die bewährten und vertrauten dörflichen Sozialinstitutionen zu erhalten und so den Verwerfungen des Kapitalismus zu entgehen.[84] Dies stand ganz in Einklang mit dem Denken des Sozialisten Svetozar Marković, einem der bedeutendsten Intellektuellen Serbiens im 19. Jahrhundert. Unter Einfluss russischer Revolutionäre vertrat er einen agrarischen Sozialismus, der auf der Gesellschaftsordnung des Dorfes fußte und die Selbstverwaltung (samouprava) der traditionellen Großfamilie (zadruga) und der Gemeinde (opština) in den Mittelpunkt rückte. Kollektives Eigentum und Wirtschaften betrachtete er als menschlichere Alternative zum ausbeuterischen kapitalistischen Staat.[85] Auch die nachfolgende Politikergeneration meinte, Technik und Wissenschaft sollten gefördert, aber – so der Führer der «Radikalen Partei» Nikola Pašić – im «slawisch-serbischen Geist» genutzt werden.[86] Ganz ähnlich sahen das übrigens auch die Vorkämpfer der «Kroatischen Volksbauernpartei».
Auch die Mehrheit der muslimischen Intellektuellen entschied sich in Übereinstimmung mit türkischen und ägyptischen Autoren für eine pragmatische, selektive Übernahme europäischer Standards. So fanden die bosnischen geistlichen Führer etwa in klassischen Texten die Begründung für die Empfehlung an die Landsleute, den Militärdienst in der verhassten christlichen Armee anzutreten. Auch in anderen Fragen befürwortete man Kompromisse, etwa bei der Integration der Scharia in die habsburgische Jurisdiktion.[87]