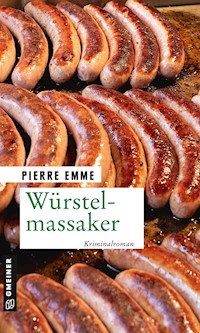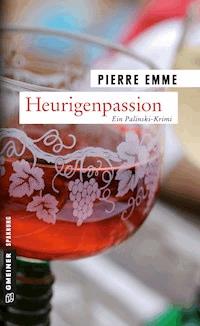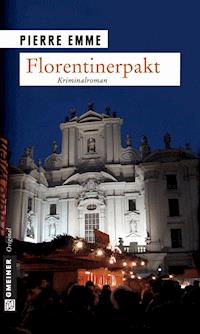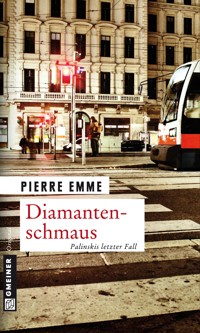Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Palinski
- Sprache: Deutsch
Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2008 wird der Schiedsrichter Arthur Mellnig in einem Schlafwagen in Zürich ermordet aufgefunden. Am Sitz der UEFA in Nyon herrscht große Aufregung: Mellnig wollte den Funktionären über einen streng vertraulichen, äußerst besorgniserregenden Vorfall berichten, der die gesamte EM gefährden könnte. Wer wusste davon? Auch die Deutsche Nationalmannschaft scheint in Gefahr: Zunächst verzögert sich der Abflug der Mannschaft von Frankfurt nach Wien wegen eines verdächtigen Gepäckstücks. Dann wird in der Nähe ihres Quartiers ein schwer verletzter Mann entdeckt, der wenig später stirbt. Und mittendrin steckt wieder einmal Wiens skurrilster Kriminologe: Mario Palinski hat von einem Attentat erfahren, das während des Spiels Deutschland - Österreich auf den Europäischen Ratspräsidenten verübt werden soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Emme
Ballsaison
Palinskis siebter Fall
Zum Buch
DAS SPIEL DES JAHRHUNDERTS Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2008 wird der Schiedsrichter Arthur Mellnig in einem Schlafwagen in Zürich ermordet aufgefunden. Am Sitz der UEFA in Nyon herrscht große Aufregung: Mellnig wollte den Funktionären über einen streng vertraulichen, äußerst besorgniserregenden Vorfall berichten, der die gesamte EM gefährden könnte. Wer wusste davon? Auch die Deutsche Nationalmannschaft scheint in Gefahr: Zunächst verzögert sich der Abflug der Mannschaft von Frankfurt nach Wien wegen eines verdächtigen Gepäckstücks. Dann wird in der Nähe ihres Quartiers ein schwer verletzter Mann entdeckt, der wenig später stirbt. Und mittendrin steckt wieder einmal Wiens skurrilster Kriminologe: Mario Palinski hat von einem Attentat erfahren, das während des Spiels Deutschland – Österreich auf den Europäischen Ratspräsidenten verübt werden soll.
Pierre Emme, geboren 1943, lebte bis zu seinem Tod im Juli 2008 als freier Autor bei Wien. Der promovierte Jurist konnte auf ein abwechslungsreiches Berufsleben zurückblicken und damit aus einem aus den unterschiedlichsten Quellen gespeisten Fundus an Erfahrungen und Erlebnissen schöpfen. Im Februar 2005 erschien mit »Pastetenlust« der erste Band seiner erfolgreichen Krimiserie um Mario Palinski, den Wiener Kult-Kriminologen mit der Vorliebe für kulinarische Genüsse.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Lutz Eberle
ISBN 978-3-8392-3070-1
Widmung
Meinem alten Freund Uwe V. Kohl gewidmet
Zitat
›Expect emotions‹
Offizielles Motto der EURO 2008 in Österreich und der Schweiz
Vorwort
Diesmal haben es die österreichischen Kicker tatsächlich geschafft, bei der Endrunde einer Fußballeuropameisterschaft dabei zu sein. Sie dürfen mit den besten Nationalteams des Kontinents um den Einzug in das Finale zittern, das am 29. Juni in Wien stattfinden wird. Ein jahrzehntelang unerfüllter Traum Fußballösterreichs wird damit endlich wahr.
Um dieses Ziel auch ganz sicher zu erreichen, hatten sich die dafür Verantwortlichen etwas einfallen lassen: In Erinnerung an den berühmten Ausspruch Maximilians I., der mit dem Motto ›Bella gerant alii, tu felix Austria nube‹ (›Andere mögen Kriege führen, Du, glückliches Österreich heirate‹) die habsburgische Heiratspolitik begründet hatte, bewarben sie sich um die Ausrichtung des immerhin drittgrößten Sportevents der Welt. Damit hatte Fußballösterreich dieses Mal jegliches Risiko, das nun mal in einer Qualifikationsrunde steckt, vermieden.
Und welch Wunder, die milden Fußballgötter zeigten tatsächlich Verständnis für den großen Wunsch der kleinen Alpenrepublik und beauftragten sie, die Europameisterschaft 2008 gemeinsam mit ihrem spielerisch derzeit stärkeren Nachbarn, der Schweiz, durchzuführen. Dann, als man offiziellerseits bereits begann, sich Sorgen um die Stimmung im Lande zu machen, so ohne rechte Begeisterung geht es ja beim Fußball nicht, sprangen die jungen Helden in die Bresche und sorgten mit einer exquisiten Performance und einem 4. Platz bei der U 20 Weltmeisterschaft im Juli 2007 in Kanada für eine zunächst vielleicht etwas enttäuschend erscheinende, tatsächlich aber für eine ausgezeichnete Platzierung.
Also wenn das kein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Fußballs gewesen ist!
Vor der sowohl sportlich als auch gesellschaftlich monströsen Kulisse der Fußballeuropameisterschaft 2008 spielt ›Ballsaison‹, der jüngste Krimi mit Mario Palinski. Dass der unkonventionelle Privatermittler im Vor- und Umfeld eines derartigen Großereignisses mehr gefordert wird als in einer seiner üblichen Arbeitswochen, liegt in der Natur der Sache. Auch wenn es manchmal ein wenig drunter und drüber zu gehen scheint, Palinski behält den Überblick, meistens zumindest und knüpft die scheinbar losen Fäden schließlich zusammen.
Einen der Höhepunkte und gleichzeitig das ultimative Finale des Romans bildet natürlich das unvermeidliche Kräftemessen des rot-weiß-roten Davids mit dem deutschen Goliath.
In ›Ballsaison‹ endet dieses aus österreichischer Sicht deutlich neurotische Züge aufweisende Aufeinandertreffen schließlich durchaus versöhnlich. Ob und inwieweit das auch im Rahmen der realen Fußball-EM der Fall sein wird, wird die Zukunft erweisen. Wünschen wird man sich das aber wohl noch dürfen.
Möge der Bessere siegen und der Beste Champion werden.
Wien, Februar 2008
Pierre Emme
2
Dienstag, 3. Juni, nachmittags
Die Nachricht von Arthur Mellnigs Tod hatte im Hauptquartier der UEFA eingeschlagen wie eine Bombe. Die Information war zuerst bei einer noch in Probezeit befind-lichen Mitarbeiterin im Generalsekretariat gelandet, die ihre Bedeutung zunächst nicht erkannte und sie erst mit einiger Verzögerung an ihren Chef weiterleitete.
Nun war der unnatürliche Tod eines Schiedsrichters, korrekter formuliert, eines UEFA-Schiedsrichters, schon an und für sich keine erfreuliche Angelegenheit. Und schon gar nicht einige Tage vor Beginn einer Megaveranstaltung der Art, wie sie nun bevorstand. Der Grund, warum sich die größtenteils in Nyon anwesenden Mitglieder der UEFA-Schiedsrichterkommission innerhalb einer knappen Stunde zu einer ersten Krisensitzung zusammenfanden, war aber ein ganz anderer.
Sportliche Großereignisse wie eine Fußballeuropameisterschaft setzten unvorstellbare Geldmengen in Bewegung. Darunter auch in Bereichen, die es Menschen ermöglichten, in kürzester Zeit viel Geld zu machen. Oder, die zumindest als Möglichkeit dafür angesehen wurden. Wie vor allem das schon immer und derzeit mehr denn je boomende Wettgeschäft.
Off- oder online, offiziell oder schwarz, in Zeiten wie diesen wurde gezockt, als ginge es um das ewige Leben und auch noch die Zeit danach.
Zur Durchsetzung egoistischer Interessen und zur Verbesserung der eigenen Chancen wurde dabei auch nicht auf den Einsatz krimineller Methoden verzichtet. Einzelne Fälle von Manipulationen und Wettbetrug im normalen Spielbetrieb waren ja aus der jüngeren Vergangenheit noch in Erinnerung.
Wenn aber jetzt schon Spiele wie ›Muttersberg gegen Grabanz‹ oder ähnliche Highlights von bestenfalls regionaler Bedeutung zigtausende Euro an Bestechungsgeldern zum Fließen brachten, um wie viel mehr war der globalen Wettmafia dann ein ›vorhersehbares‹ Ergebnis bei ›Italien gegen Spanien‹ oder ›Deutschland gegen England‹ wert?
›Wette‹ wurde definiert als ›unbestimmtes, in Zukunft liegendes Ereignis‹. Auf den Ausgang dieses unbestimmten Ereignisses wurde nun gewettet. Und je vorhersehbarer der Ausgang, desto geringer die Quote für den Fall, dass man mit seiner Einschätzung richtiglag.
Umgekehrt bedeutete das aber auch, dass die Quoten förmlich in das Universum schossen, falls man auf einen höchst unwahrscheinlichen, ja fast unmöglichen Ausgang setzte. Da war viel, sehr viel Musik drinnen.
Wie schön wäre es erst, dachten einige böse Buben, scheinbar höchst unwahrscheinlich, ja unmöglich erscheinende Ausgänge unbestimmter zukünftiger Ereignisse für eine ganz kleine, exklusive Gruppe ein wenig wahrscheinlicher, möglicher werden zu lassen. Nämlich indem man mittels entsprechenden Kapitaleinsatzes den Wettausgang beeinflusste. Bei den enormen möglichen Gewinnen geschickt manipulierter Wetten konnte man sich das schon einiges kosten lassen.
Hohe Gewinnchancen bei geringem Verlustrisiko, das machte das Zockerleben erst so richtig schön. Obwohl, mit Zocken hatte das dann eigentlich nichts mehr zu tun.
Auf jeden Fall fürchtete die Schiedsrichterkommission nichts mehr als schwarze Schafe in den eigenen Reihen. Referees, die in speziellen, heiklen Situationen durch eine Entscheidung wissentlich und willentlich ein Spiel in die eine oder andere Richtung hin beeinflussten. Die Zunft der Pfeifenmänner hatte ohnehin schon genug unter dem Stigma der Fehlpfiffe zu leiden, also den nach bestem Wissen und Gewissen erfolgenden Entscheidungen, die aber auf falschen Voraussetzungen fußten. Das war oft sehr hart für die betroffene Mannschaft, ja entscheidend.
Doch was half das Jammern: Shit happens nun einmal.
Gegen Geld ein Spiel zu verkaufen, war dagegen eine ganz andere Sache und geeignet, das gesamte Fußballbusiness in Misskredit zu bringen. Die leidige Affäre in Italien vor einigen Jahren war allen noch in schlechtester Erinnerung.
In so einem Fall konnte man gar nicht hart genug gegen die Verantwortlichen vorgehen.
Vor vier Tagen hatte sich Arthur Mellnig telefonisch mit Ian McBrody, dem schottischen Vertreter in der Kommission, in Verbindung gesetzt. Mellnig hatte den Briten bei einer Schulung kennengelernt und zu dem bulligen Spitzenschiedsrichter, den er als Vorbild ansah, Vertrauen gefasst. Nach Abschluss der Fortbildungsveranstaltung hatte McBrody den ehrgeizigen jungen Wiener eingeladen, sich doch bei Gelegenheit einmal bei ihm zu melden. Was Mellnig vor einigen Tagen auch getan hatte, wenn auch nicht ganz in der von dem Schotten ursprünglich gemeinten Unverbindlichkeit.
»Arthur war ganz aufgeregt und hat etwas von ›Die wollen die EM zerstören, die wollen tatsächlich unseren Sport kaputt machen‹ gestammelt«, musste der Schotte bereits zum dritten Mal wiederholen. Mehr wusste er auch nicht, denn Mellnig hatte sich geweigert, am Telefon darüber zu sprechen. Er hatte befürchtet, beobachtet und abgehört zu werden. Darum hatte er auch von einem Münzautomaten aus angerufen und sich sehr kurz gehalten.
Nach Rücksprache mit Generalsekretär de Graaf hatte McBrody den Österreicher aufgefordert, so rasch wie möglich nach Nyon zu kommen und zu berichten.
Betroffen bestätigte der korpulente Niederländer den letzten Satz des Schotten mit einem Kopfnicken. »Vielleicht hätten wir Vorsorge für seine Sicherheit treffen müssen«, räumte de Graaf ein, »aber wer hat schon ahnen können, dass diese Leute diesmal so weit gehen würden?«
»Nun ja«, gab der Römer Ernesto Baldini zu bedenken, »diesmal geht es eben nicht nur um ein paar geschobene Spiele der Serie A oder der Bundesliga, sondern um die Europameisterschaft. Je größer der Kuchen, desto schärfer das Kuchenmesser. Eine alte umbrische Bauernweisheit«, meckerte er lustlos. Was die anderen Anwesenden in dieser Situation als absolut unpassend empfanden.
»Aber wieso haben sich diese …, wer immer sie auch sein mögen, Personen gerade an Mellnig gewandt?«, grübelte McBrody. »Der Mann war lediglich auf der Standby-Liste für die Assistenten. Es besteht«, er korrigierte sich betroffen, »bestand lediglich eine minimale Chance, dass er überhaupt zum Einsatz kommen würde, geschweige denn bei einem bestimmten Spiel.«