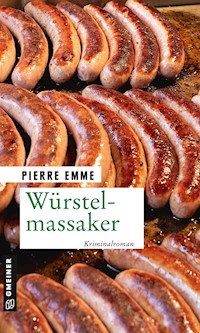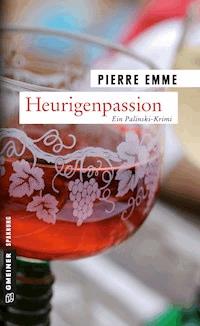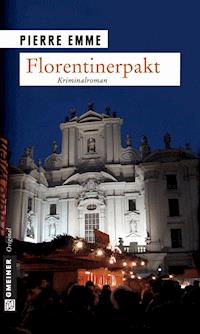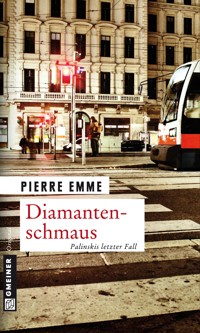Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Palinski
- Sprache: Deutsch
Den Samstag im September, an dem das traditionelle Döblinger Hauptstrassenfest stattfindet, wird Palinski nicht so schnell vergessen. Eigentlich will er sich nur den Preis für seinen 2. Platz im Schnitzelwettbewerb einer Fast-Food-Kette abholen, an dem er aus Jux teilgenommen hat. Stattdessen wird in seiner unmittelbaren Nähe eine Frau im Rollstuhl erschossen. Der anscheinend von einem Terroristen abgegebene Schuss hat allerdings dem Stadtrat für Tourismus gegolten, der die Siegerehrung vornehmen sollte. Eine Aufgabe, zu der sich der Politiker im gerade herrschenden Wahlkampf nur zu gerne bereit erklärt hatte. Dass am selben Tag auch der linke Ringfinger des entführten Kommerzialrats Eugen Filzmayer mit einer Lösegeldforderung bei der Familie aufgetaucht ist, geht im Trubel der Ereignisse auf dem Fest fast unter …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Emme
Schnitzelfarce
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
1
Der Gestank in dem Kellerabteil war atemberaubend. Kein Wunder, der alte Mann, der hier seit fünfzehn Tagen aufbewahrt wurde, hatte vor mehr als 72 Stunden das letzte Mal die Möglichkeit gehabt, sich notdürftig zu waschen. Seit seinem letzten Gang auf das total verdreckte WC waren auch schon fast 34 Stunden vergangen.
Den an sich rüstigen 76-Jährigen störte das aber nicht mehr sonderlich. Seit dem harten Schlag auf den Kopf und die dadurch bedingte schwere Verletzung seines Schädels war er die meiste Zeit bewusstlos gewesen. Er hatte noch nicht einmal richtig registriert, dass man ihm vor 28 Stunden den Ringfinger der linken Hand abgehackt hatte. Jenen Finger, an dem er den Siegelring seines Großvaters getragen hatte.
In den seltenen Momenten, in denen er aus den barmherzigen Tiefen seiner Ohnmacht auftauchte, brachte er keine klaren Gedanken mehr zustande. Lediglich Empfindungen, vor allem der dumpf pochende Schmerz in seiner linken Hand und der unangenehme salzig-metallische Geschmack in seiner ausgedörrten Mundhöhle beherrschten den spärlichen Rest seines schon wieder im Schwinden begriffenen Bewusstseins. Schemenhaft liefen verschiedene Bilder vor seinem geistigen Auge ab, die nur mehr zum geringeren Teil Gefühle bei ihm auslösten. Vor allem das kleine Mädchen, ihr Name war Miriam, da war er sich absolut sicher, tauchte immer auf. Sie schien sich auf etwas zu freuen, das mit ihm zu tun haben musste. Er versuchte sich zu erinnern, ihm fiel aber nicht ein, womit er ihr eine Freude hatte machen wollen.
Auch Magdalena verschaffte sich Präsenz, seine Frau, die schon vor längerer Zeit von ihm gegangen war. Ein dumpfes Krächzen seiner Stimme war der akustische Beweis dafür, dass ihn dieser Gedanke amüsierte. Wie hatte man mit ihm getrauert, als er plötzlich nach 37 gemeinsamen Jahren alleine zurückgeblieben war. Die hatten alle keine Ahnung gehabt, wie einsam ein Mann neben einer Frau wie seiner Magdalena hatte sein können. Zumindest die letzten zwanzig Jahre. Er hatte nie verstehen können, wie aus der entzückenden jungen Frau, die er geliebt und geheiratet hatte, eine derart herrschsüchtige, frustrierte und nervtötende Person hatte werden können. Die Seelenmesse zu ihren Ehren war für ihn vor allem auch der Startschuss für ein neues Leben gewesen. Ein Leben, das noch einige sehr schöne Augenblicke für ihn bereit gehalten und das er sehr genossen hatte. Und das jetzt langsam aber sicher zu Ende ging.
Er hatte keine Angst vor dem Tod, auch keine davor, nicht mehr zu leben. Auch die Schmerzen beim Sterben bereiteten ihm kein Kopfzerbrechen, denn viel peinigender als in den vergangenen Stunden konnten sie kaum mehr werden.
Das Einzige, was ihm als einigermaßen gläubigen Katholiken etwas Sorge bereitete, war der Gedanke, im Himmel möglicherweise wieder auf Magdalena zu treffen. Aber vielleicht kam er ja gar nicht in den Himmel. Oder Magdalena terrorisierte schon seit Jahren die armen Seelen im Fegefeuer. Und überhaupt, wer konnte schon sagen, ob die ganze Sache mit dem ewigen Leben überhaupt stimmte und nicht nur ein Marketinggag der Kirche war?
Er versuchte noch, sich bei Miriam dafür zu entschuldigen, dass er seine Zusage nicht würde einhalten können. Das letzte Bild, das er wahrnahm, war das seiner verständnisvoll lächelnden jüngsten Enkelin, die ihm offenbar verziehen hatte.
Dann stellte sein seit Jahren geschwächtes, schon bisher nur mehr unter Einsatz entsprechender Medikamente funktionierendes Herz seine Arbeit ein. Der alte Mann fiel endgültig in das tiefe, dunkle Loch, aus dem es kein zurück mehr gab. Der Tod trat exakt um 3.47 Uhr an diesem Samstagmorgen ein. Genau am fünfzehnten Tag nach der gewaltsamen Entführung des Mannes. Einer Entführung, von der bisher offiziell noch gar nichts bekannt war.
*
Palinski war heute noch früher aus den Federn gekrochen als sonst. Leichtsinnigerweise hatte er Wilma, der Mutter seiner beiden Kinder und »Frau, die er seit 24 Jahren nicht geheiratet hatte«, versprochen, einen Parkplatz für ihren PKW zu suchen. Am Tag des traditionellen Straßenfestes in der Döblinger Hauptstraße eine äußerst anspruchsvolle und zeitraubende Aufgabe. Immerhin mussten so an die vierhundert oder auch mehr Fahrzeuge, die üblicherweise zwischen Gürtel und Hofzeile abgestellt waren, dem temporären, bis 18 Uhr geltenden Halteverbot weichen.
Nach einigen erfolglosen Runden durch den Bezirk und den angrenzenden Alsergrund hatte er sich einen kräftigen Cappuccino in einem der wenigen um diese Tageszeit bereits geöffneten Kaffeehäuser genehmigt und nachgedacht.
Sobald man die Lösung für ein Problem hat, erscheint sie einem banal und selbstverständlich. Und man wundert sich, warum man nicht gleich darauf gekommen ist. So war es auch Palinski gegangen, als er den Wagen in die zum großen Supermarkt Ecke Hauptstraße/Billrothstraße gehörende Tiefgarage gelenkt und dort abgestellt hatte. Der Markt würde heute erst um 18 Uhr schließen. Wenn er um 17.30 Uhr durch die Garage kommen und dabei ein Parkticket ziehen würde, würde er nach dem Kauf von einem Kilogramm Orangen oder einer Flasche Sekt an der Kasse das Ausfahrtsticket bekommen, ohne etwas für die mehr als zehn Stunden Parken bezahlen zu müssen. Eine zwar nicht ganz saubere, aber recht elegante Lösung, fand Palinski. Und durchaus in der Toleranzbreite der heutigen Ellbogengesellschaft, an der er sich ohnehin kaum beteiligte, hatte er den Anflug schlechten Gewissens besänftigt.
Jetzt schlenderte er die knapp 200 Meter zu seiner Wohnung zurück und beobachtete die mobilen Kramer, die ihre Verkaufsstände aufbauten, um all das zum Kauf anzubieten, was schon im Vorjahr niemand hatte haben wollen.
Palinski erinnerte sich noch gut an das erste Fest dieser Art. Er wusste zwar nicht mehr genau, wie lange das schon her war. Es mussten so 12 bis 15 Jahre sein, schätzte er. Aber der Eindruck dieser damals vor allem von der Wohnbevölkerung getragenen Veranstaltung war noch ganz frisch. Natürlich hatte auch schon seinerzeit der Kommerz regiert. Die örtlichen Kaufleute hatten ihre unverkäuflichen Lagerbestände auf der Straße aufgebaut und verramscht. Daneben war aber genug Platz für die spontanen kleinen Flohmärkte der Kinder gewesen, die damit ihren Spaß gehabt und ihr Taschengeld aufgebessert hatten. Auf der für 12 Stunden zur Fußgängerzone mutierten Hauptstraße waren die Familien flaniert, hatten alte Freunde getroffen und neue Bekanntschaften gemacht. Alle hatten sich an dem Fest erfreut und einen schönen Tag genossen.
In den folgenden Jahren wurde der ›Sommerschlussverkaufs-Charakter‹ des Festes immer deutlicher. Als man vor einigen Jahren allen Ernstes begonnen hatte, von den Kindern Standmieten für ihre kleinen improvisierten Verkaufsstände zu verlangen, hatte der Kommerz endgültig gesiegt. Die zwei, drei Dutzend enttäuschter Kinderseelen würde man heute wohl hochtrabend als › psychischen Kollateralschaden‹ bezeichnen können.
Inzwischen hatte Palinski das beeindruckende, anfangs des 20. Jahrhunderts errichtete Bürgerhaus erreicht, in dem sich seine Wohnung befand. Er nahm auf der Bank im Innenhof Platz, die durch den Fall ›Lettenberg‹ zu einer bestimmten, jetzt aber schon wieder abnehmenden Berühmtheit gelangt war.
Stolz betrachtete er die links vom Eingang zur Stiege vier befindliche Tafel mit der Aufschrift ›Institut für Krimiliteranalogie‹, die er erst gestern montiert hatte. Damit hatte seine eigenartige Tätigkeit einen Namen bekommen, einen offiziösen Anstrich sozusagen. Palinski war zwar absolut sicher, dass sich kein Mensch etwas unter diesem vom ihm geschöpften Kunstwort vorstellen konnte, aber das war auch gar nicht notwendig. In dieser seltsamen Zeit, in der er lebte, waren schon wesentlich unverständlichere Begriffe zum Allgemeingut geworden. Es ging jetzt darum, selbst einmal drauf zu kommen, was er darunter verstand. Damit er es den paar Ehrlichen, die den Begriff hinterfragten, erklären konnte.
Eine ältere Frau näherte sich Palinski und blieb vor ihm stehen.
»Tschuidigen da Hea«, sagte sie mit unterwürfigem Ton, »oba i miassat gaunz dringend.« Unruhig stieg sie von einem Bein auf das andere.
Der aus seinen privatwissenschaftlichen Gedankengängen gerissene ›Institutsvorstand‹ stand entweder auf der Leitung oder wollte nicht verstehen. »Na, dann tun Sie halt«, entgegnete er unfreundlicher als es seine Art war. »Ich werde Sie nicht aufhalten.« Er mochte diese Standlerleute nicht, die ihm den Parkplatz wegnahmen und ihn zwangen, den Supermarkt an der nächsten Ecke zu bescheißen.
»Nau, Sie hom guat red’n«, der zunächst devote Ton hatte der natürlichen Hantigkeit der im Existenzkampf auf der Straße gestählten Frau Platz gemacht. »Kennan vur lochn. Oda woins wirkli, doß i do vur Ihna hinbrunz?«
Abrupt war Palinski von der Leitung gestoßen worden. »Hat man wieder einmal keine mobilen WC’s aufgestellt?«, wollte er wissen.
»Des was i net und des is ma a wurscht«, die Frau schien wirklich schon in argen Nöten zu sein. »Wauns no laung bled harum red’n, is e ollas z’spät.«
»Also gut«, Palinski hatte seine ursprüngliche Freundlichkeit wieder zurückgewonnen. Er stand auf und führte die Frau zu dem ebenerdig gelegenen Gangklo gegenüber seiner Wohnung. Mit einem kurzen, kräftigen Ruck öffnete er das stille Örtchen. Die einzig wirkungsvolle Methode, seit der Schlüssel irgendwann einmal verloren gegangen war.
»Wau«, jetzt lag Anerkennung in der Stimme der Frau, »Se san oba a ka schlechte Wüdsau.«
»Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Türe einfach nur angelehnt«, rief er der Frau nach. »Und dass Sie mir ja nicht alle Leute da hereinschicken.«
Im Hinausgehen wurde er daran erinnert, einmal gehört zu haben, dass die weibliche Blase größer war als die des Mannes. Das musste wohl stimmen, denn das von leisem, erleichtert klingenden Stöhnen begleitete Plätschern wollte überhaupt kein Ende mehr nehmen.
*
Warum sitze ich eigentlich wieder auf der Bank und nicht in meinem Büro? Na ja, die gute Frau sollte ja nicht unbedingt mitbekommen, wo sie mich bei künftigen Notfällen antreffen kann.
Ja, ist schon gut. Auch Ihnen einen angenehmen Tag. Komisch, der Gang der Frau war im Vergleich zu vorhin jetzt fast grazil. Trotz ihres beachtlichen Übergewichts.
Eigentlich bin ich noch gar nicht daran gewöhnt, jetzt sowohl eine Wohnung als auch ein Büro zu haben. Statt drei Räumen sechs und statt 38 m doppelt soviel Fläche. Das ist schon großartig. Die Chance auf die ›Zwillingswohnung‹ auf Stiege 3 habe ich mir wirklich nicht entgehen lassen können. Bad und WC indoor, eine kleine Küche, ja sogar eine Art Gästezimmer habe ich jetzt. Und je einen Eingang zur Wohnung und zum Institut. Sobald der Durchbruch durch die Wand zwischen dem Besprechungszimmer des Instituts und dem Schlafzimmer der Wohnung gemacht sein wird, brauche ich nicht einmal mehr das Haus verlassen, um von einem ins andere zu kommen.
Man kann es drehen wie man will, aber es geht aufwärts mit mir. Zumindest wirtschaftlich. Obwohl ich seit zwei Monaten keine Schundromane im 64-Seiten-Umfang mehr verfasst habe und darüber sehr froh bin, steht mir jetzt mehr Geld zur Verfügung als vorher. Deutlich mehr. Ich kann jetzt sogar wieder regelmäßig meinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Kindern nachkommen. Im vollen Umfang sogar. Ich habe gar nicht gewusst, dass es soviel Spaß macht zu zahlen.
Neben der Beratung der ›Global Films Enterprises‹ hat mir mein erstes Drehbuch überraschend viel Geld gebracht. Nach der Vorauszahlung im Frühjahr habe ich eigentlich nicht mehr mit so viel gerechnet. Angeblich soll im Herbst kommenden Jahres gedreht werden.
Darüber hinaus bedienen sich immer mehr TV-Anstalten und Verlage meiner Datenbank ›Crimes - facts + ideas‹ und bezahlen jeden vernünftigen Preis dafür. Also feilschen habe ich noch nie müssen. Gott sei Dank, denn das liegt mir gar nicht.
Wilma hat das noch nicht richtig mitbekommen. Zumindest ihre nach wie vor ungebrochene Vorliebe für gelegentliche Spitzen gegen meine ›Unfähigkeit‹ lassen keinen anderen Schluss zu. Na, sie wird auch noch drauf kommen. Wenn nicht, ist es auch egal. Früher, als diese Vorwürfe zumindest substanziell noch berechtigt waren, hat sie mich damit verletzten können. Jetzt nicht mehr.
Der Fall ›Lettenberg‹ hat mir wirklich sehr geholfen. Der gute ›Miki‹ Schneckenburger hat mich doch tatsächlich zu seinem Minister geschleppt und der hat mir seinen Dank für die wertvolle Mitarbeit ausgesprochen. Der Mann ist in Wirklichkeit wesentlich sympathischer als er im Fernsehen rüberkommt. Schade, dass ich mit seiner Weltanschauung über weite Strecken so überhaupt nichts anfangen kann.
Schließlich war die Sache mit dem Institut ja eigentlich die Idee von Doktor Fuscheé gewesen. »Wenn wir weiter mit Ihnen zusammenarbeiten wollen«, hat der Minister betont, »dann müssen wir das auf eine zumindest halboffizielle Basis stellen. Die Fülle an Verletzungen der Gesetze und Dienstvorschriften, wie sie in diesem Fall aufgetreten sind, können wir bei allem Erfolg kein zweites Mal tolerieren.«
Schneckenburger, immerhin der Vertreter des Ministers im Bundeskriminalamt hat dann etwas von einer ›Sachverständigenposition‹ ins Gespräch geworfen. Ein Stichwort, das sein oberster Chef sofort aufgegriffen hat.
»Gründen Sie irgendeinen Verein oder ein Institut, mit dem wir dann zusammen arbeiten können«, hat er mir empfohlen. »Wir arbeiten ja gelegentlich auch mit Rutengehern, Astrologen und ähnlichen pseudowissenschaftlichen Institutionen zusammen.«
Die letzte Äußerung des Ministers hätte mich fast zu einem harschen Widerspruch provoziert, was dem hohen Staatsdiener nicht entgangen war.
»Das war nicht abwertend gemeint«, hat er mich lachend zu beruhigen versucht, »meine Schwiegermutter legt mir mindestens einmal im Monat die Karten. Dabei ergeben sich immer wieder recht interessante Gesichtspunkte.«
Eigentlich war mir die Meinung des großen Machers scheißegal, aber er meinte es offenbar so, wie er es sagte. Das war mehr, als man allgemein von so jemandem erwarten durfte.
Gemeinsam mit Ministerialrat Schneckenburger und Inspektor Helmut Wallner habe ich dann den ›Verein für Krimiliteranalogie‹ gegründet. Das Schwierigste daran war, die beiden Vereinskollegen von meiner kühnen Wortschöpfung zu überzeugen. Ein hartes Stück Arbeit, aber nach mehr als sechs Stunden Diskussion haben sie zugestimmt. Immerhin ist ihnen ja auch nichts Besseres eingefallen.
Das Allerbeste war aber, dass der Verein jährlich mit 15.000Euro subventioniert werden soll. Dafür stelle ich der Polizei im Bedarfsfall bis zu 50 Stunden pro Monat meine Arbeitskraft und das Know-how meiner Datenbank ohne gesondertes Entgelt zur Verfügung. Nicht gerade ein fürstliches Honorar, aber hoffentlich eine sichere Basis für mein Institut. Das nennt man »Von der Wortschöpfung zur Wertschöpfung.«
Da kommt schon wieder so ein Kloaspirant auf mich zu. Was soll’s. In Ordnung, gehen Sie hinein, es ist die erste Türe rechts. Gerne geschehen.
Wenn ich noch lange hier sitzen bleibe, ende ich noch als Häuslfrau. Ob die wirklich immer scheißfreundlich sein müssen?
*
Da die Haushälterin an diesem wie an jedem Samstag frei hatte, wurde das Kuvert in der Auffahrt zur Garage erst gegen 9.30 Uhr gefunden. Dr. Kurt Suber, der 52-jährige Juniorchef der ›Alfons Filzmayer & Söhne AG‹ wäre fast über dieses ›gelbe Ding am Boden‹ gefahren, das keine zwei Meter vom Tor entfernt lag.
In Gedanken schon bei dem bevorstehenden Gespräch mit seinen neuen japanischen Partnern hatte er seinen moosgrünen Jaguar gerade noch rechtzeitig anhalten können. Beim Aussteigen hatte er so ein eigenartiges Gefühl im Magen. Aber das musste nichts bedeuten. Denn seit sein Schwiegervater Eugen Filzmayer, Seniorchef und Enkel des legendären Unternehmensgründers vor fünfzehn Tagen entführt worden war, stellte dieses Gefühl im Magen Subers Normalzustand dar. Vor allem der Umstand, dass die Familie trotz Erfüllung sämtlicher Forderungen noch immer nichts vom Alten gehört hatte, sorgte für eine permanente Stimmung nervösester Anspannung. Immerhin war die relativ bescheidene Lösegeldforderung in Höhe von 500 000 Euro bereits vor vier Tagen erfüllt worden.
Wenn Eugen Filzmayer nicht bald auftauchte, musste die Polizei wohl oder übel doch informiert werden. Auch wenn die Entführer dies ausdrücklich untersagt hatten.
Suber hob das unbeschriftete Kuvert im Format C 5 vorsichtig auf. Er hielt es an sein linkes Ohr und schüttelte es vorsichtig. Nichts Verdächtiges war zu hören. Beim Abtasten stellte er einen offenbar etwa 8 cm langen, eher schmalen Gegenstand mit einem festen runden Etwas an dem einen Ende fest. Das Ganze fühlte sich an wie eine Rolle Plastilin, an deren einem Ende ein Kronenkorken eingepresst war. Da hatte sich wohl einer der unmöglichen Freunde Violas einen Scherz erlaubt, versuchte er, sich zu beruhigen. Er würde wieder einmal ein ernstes Wort mit ihr sprechen müssen. Aber das musste warten, bis diese schlimme Situation ausgestanden war.
Ein Blick auf die Armbanduhr zeigte Suber, dass er sich langsam auf den Weg machen musste, wollte er nicht zu spät kommen. Japaner sollen ja hinsichtlich Pünktlichkeit besonders penibel sein, ging es ihm durch den Kopf. Er stieg wieder in seinen Wagen, legte den Umschlag auf den Beifahrersitz und startete. Während er noch die Handbremse löste und den Gang einlegte, gewann seine vom Gefühl im Magen unterstütze Neugier die Oberhand. Nach kurzem Zögern stellte er den Motor neuerlich ab und fuhr sich nervös durch die Haare. Dann nahm er das Kuvert wieder in die Hand und öffnete es kurz entschlossen.
Als Erstes fiel sein Blick auf die mit rotem Filzstift auf einem karierten, offenbar von einem Schreibblock stammenden Blatt Papier in Blockschrift verfasste Nachricht.
»Wenn Sie den Kommerzialrat lebend wider sehen wollen, müssen Sie noch einmal 87 000 Euro locker machen.«
Also, Rechtschreibung war nicht gerade die Stärke des Verfassers, schoss es Suber zwar sachlich zutreffend, angesichts der Umstände aber völlig unangebracht durch den Kopf. Dann nahm er sich das in einige Papiertaschentücher eingewickelte längliche Etwas vor. Während sein schon die ganze Zeit deutlich überhöhter Blutdruck lebensbedrohliche Werte annahm, wickelte er das Ding vorsichtig aus.
Nachdem die letzte Hülle gefallen war, konnte er gerade noch den Kopf nach rechts drehen und sich instinktiv ein wenig nach vorne beugen. Dann kam auch schon das komplette, heute ausnahmsweise von ihm selbst zubereitete Frühstück hoch und fiel ihm aus dem Gesicht. Doch seine schreckensgeweiteten Augen nahmen gar nicht wahr, wie der noch kaum zersetzte Inhalt seines Magens die feine, aus edelstem hellbraunen Rindsleder bestehende Tapezierung des Beifahrersitzes versaute. Und mit dem einmaligen, unverwechselbaren Geruch, der diesen edlen Wagen üblicherweise auszeichnete, war es jetzt auch ein für alle Mal vorbei.
Der knapp über der Fingerwurzel von der Hand abgetrennte, blutverkrustete Ringfinger, der Suber aus der unkontrolliert zitternden Hand gefallen war, konnte jedem gehören. Der darauf befindliche Siegelring mit dem typischen Jadestein und dem unverkennbaren AF für Alfons Filzmayer aber nur einem. Er stammte eindeutig und unzweifelhaft von der Hand seines Schwiegervaters. Was war da bloß schief gelaufen?
Als ihn seine Frau zehn Minuten später fand, heulte der auf seine kühle, überlegene Art sonst so stolze Kurt Suber noch immer wie ein kleines Kind. Es war auch Erika Suber-Filzmayer, die zwei Minuten später die Polizei verständigte.
*
Inspektor Helmut Wallner vom Kommissariat auf der Hohen Warte in Döbling fühlte sich ausnehmend gut. Nach zehn Tagen Dienst endlich wieder ein freier Tag und Franca war in Wien. Nicht nur das, sie war auch hier in seiner Wohnung. Die clevere Salzburger Kriminalbeamtin und der an sich schüchterne Inspektor waren seit dem Fall ›Lettenberg‹ ein Paar. Für das unter den Kollegen und Freunden der beiden kursierende Gerücht, dass es sich dabei um mehr als nur eine oberflächliche, auf Sex basierende Beziehung handelte, sprach, dass Franca dabei war, nach Wien zu übersiedeln.
Dank wohlwollender Vorgesetzter und zum Leidwesen ihrer bisherigen Kollegen war ihrem Gesuch nach Versetzung in die Bundeshauptstadt nach sensationell kurzer Zeit stattgegeben worden. Aber nicht nur das. Die Position als stellvertretende Leiterin der Kriminalabteilung im Kommissariat Josefstadt, die sie mit 1. Oktober übernehmen sollte, bedeutete auch einen echten Karrieresprung für die knapp 27-jährige Beamtin mit der Modelfigur.
Wallner stand gerade unter der Dusche und verlieh seiner Lebensfreude durch ein kräftiges, aber im Ton völlig daneben gehendes »Vincero, vincero« unüberhörbar Ausdruck. Seit ihn Franca mit ihrer Vorliebe für die italienische Oper angesteckt und ihm die Bedeutung von Kalafs optimistischen Ausbruchs eingedeutscht hatte, war »Nessun dorma« seine Lieblingsarie.
Gerade als er sich ein Dakapo zugestehen wollte, erschien Franca mit dem Handy. »Es ist Martin Sandegger und er sagt, es ist sehr wichtig«, unterband sie den erfahrungsgemäß zu erwartenden Widerspruch ihres duschenden Freundes. Dessen Reaktion auf ihre plötzliche, nur von einem knappen T-Shirt bedeckten physischen Präsenz ließ unübersehbar den Schluss zu, dass ihm der Sinn nach einer ganz anderen Tätigkeit stand als mit seinem Stellvertreter zu telefonieren. Auch wenn die Sache noch so wichtig war.
Franca, die ihren Helden nur zu gut kannte, schien durchaus angetan von dem, was sie sah. Trotzdem signalisierte sie mit gespielter Strenge Ablehnung, zumindest für den Augenblick.
»Etwas mehr Professionalität, mein Lieber«, ermahnte sie ihn mit einem Schmunzeln um den Mund. »Du weißt, wenn Martin einmal stört, dann muss es wirklich einen besonderen Grund dafür geben.« Sie hat ja Recht, wie meistens, dachte Wallner resignierend.
Schnell streifte er einen Bademantel über, ehe er das Mobiltelefon in die Hand nahm. »Was ist los, Martin«, meldete er sich. Franca, die ihn beobachtete, fand es beängstigend, gleichzeitig aber auch faszinierend, wie sich die entspannten Gesichtszüge des Mannes schlagartig verhärteten und einen konzentrierten Ausdruck annahmen. Wallner kommentierte das Gehörte lediglich mit einzelnen »Ahas« und »Hmms.« Dann meinte er nur »Wir sind in fünfzehn Minuten da« und beendete das Gespräch.
»Eine wirklich schlimme Sache« war der einzige Kommentar, den ihm Franca entlocken konnte. »Zieh dich rasch an, falls du mitkommen willst. Wir müssen zur Filzmayer Villa in der oberen Himmelstraße. Alles Weitere erzähle ich dir unterwegs.«
*
Palinski stand in seiner kleinen Küche und ging seinem jüngsten Hobby nach, dem Kochen. Er fand in dem gezielten Bearbeiten und Zusammenführen der verschiedenen Lebensmittel und Zutaten eine unwahrscheinliche Befriedigung und den idealen Ausgleich zu seinen sonstigen Tätigkeiten. Gleichzeitig war er fasziniert von den Parallelen zu seiner Arbeit, die ja auch aus einer ständig wechselnden Mischung aus Fakten und Intuition bestand. Nicht, dass er jetzt einen sonderlichen Aufwand für seine eigene Verpflegung trieb, wirklich nicht. Nach wie vor genoss er es überaus, von ›Mama Maria‹ im gegenüber liegenden Ristorante verwöhnt zu werden. Es machte ihm aber Spaß, für Wilma und die Kinder, für seine wenigen Freunde und die ›Kollegen‹ von der Polizei aufzukochen.
Ja, selbst die ›Haberertruppe‹ aus dem Café ›Kaiser‹ war schon einmal da gewesen und hatte seine ›Spareribs à la Mario‹ weggeputzt wie nichts. Seither nannte ihn der ›Oberlehrer‹ nur mehr ›Boküß‹ und mit der Zeit auch alle anderen. Obwohl kaum einer wusste warum. Palinski mochte das, auch wenn ihm durchaus bewusst war, dass und warum einige aus der Runde immer so blöd grinsten, wenn sein neuer Spitzname fiel.
Heute war aber ein ganz besonderer Tag für den begeisterten Hobbykoch. Von Entspannung konnte aber keine Rede sein, als er jetzt sein ›Palinski-Schnitzel‹ zubereitete. Ganz im Gegenteil. So was von aufgeregt war er nicht einmal gewesen, als er Sophie Lettenberg das Handwerk gelegt hatte. Der Teufel musste ihn geritten haben, als er sich vor etwas mehr als einem Monat zu dem von der expandierenden Fast-Food-Kette ›Wieners Beisl-Bar‹ ausgeschriebenen Schnitzelwettbewerb angemeldet hatte. Bei der vor einer Woche in der Filiale am Schottenring stattgefundenen Vorausscheidung war er unter die letzten acht Teilnehmer und damit ins Finale gekommen. Das heute im Rahmen der Eröffnung der neuesten ›Beisl-Bar‹-Filiale in der Döblinger Hauptstraße, Ecke Sommergasse steigen sollte. Ab 15 Uhr mussten alle Finalisten ihre Kreationen nochmals zubereiten und einer prominenten Jury präsentieren. Für 17.30 Uhr war dann die Siegerehrung vorgesehen, gleich nach den verschiedenen Ansprachen und der offiziellen Eröffnung durch Altbürgermeister Dr. Ladak.
Palinski konnte eigentlich nicht verstehen, wie ihm der Vorstoß unter die besten acht der, wie er gehört hatte, immerhin mehr als 150 Teilnehmer gelungen war. Im Grunde genommen war seine ›Schnitzelschöpfung‹ nichts anderes als ein Cordon bleu mit anderer Füllung. Er hatte das traditionelle Gespann Schinken und Käse einfach durch eine gut abgeschmeckte Mischung aus Schalotten, Champignons, Kräutern und einer kleinen, fein gehackten Chilischote ersetzt und der Mutation den Namen ›Schnitzel Diabolo‹ gegeben. Als sich etwas später herausstellte, dass diese Bezeichnung schon vergeben war, hatte er das unbestreitbar teuflisch scharfe Zeug in aller Bescheidenheit einfach ›Palinskis Schnitzel‹ genannt.
Der Gedanke, dass dieses Gericht möglicherweise schon in naher Zukunft in allen sechs bereits existenten und den zukünftigen Betrieben von ›Wieners Beisl-Bar‹ auf der Karte stehen könnte, erfüllte Palinski mit fast sinnlicher Lust. Wer konnte schon wissen, ob sein großer Wurf nicht bereits in wenigen Jahren den gleichen Stellenwert unter den ›Fast Foodern‹ dieser Welt haben würde wie heute der ›Big Mac‹ und der ›Super Whooper‹ oder wie das Zeug noch hieß? Sein Name den Menschen von Arizona bis Zaire, von Adelaide bis Zagreb ein unverwechselbarer Begriff sein würde?
Man konnte wirklich nicht behaupten, dass nüchterne Sachlichkeit und strikter Realitätsbezug Palinskis hervorragendste Eigenschaften waren. Wie hatte Harry in seiner knappen Art erst kürzlich so treffend zu Wilma gemeint? »Manchmal spinnt der Papa aber schon ganz ordentlich.«
Spinnen und blöd sein war aber nicht das Gleiche, schon gar nicht bei Palinski. Er betrachtete das richtige ›Spindisieren‹ nämlich als eine Art Philosophie, die einem das Leben einfacher machte. Da war vor allem die Vorfreude. Selbst in ihrer unrealistischsten Form machte sie viel Spaß. Spaß, den einem Niemand mehr wegnehmen konnte. Was für die meisten der berühmte ›Kick‹ beim Banji-Jumping war, war für ihn die Vorfreude z. B. auf den Literaturnobelpreis. Völlig unrealistisch, aber wirklich schön. Nach der Überreichung des Preises war er immer ganz glücklich und fest entschlossen, jetzt endlich mit seinem ›großen Roman‹ zu beginnen. Er hatte auch die Erfahrung gemacht, dass die gelegentlich nachfolgende reale Freude mit der vorher gehabten Vision davon meistens nicht mithalten hatte können.
Die erfreuliche Vorstellung vom Siegeszug seines kulinarischen Geniestreiches um die ganze Welt hatte Palinskis Nervosität völlig verdrängt. Wild entschlossen, heute den Sieg zu erringen oder zumindest einen Platz auf dem ›Stockerl‹ holte er das schön gleichmäßig gebräunte Schnitzel aus der Pfanne und legte es auf den vorbereiteten Teller. Mit diesem, Messer und Gabel sowie einer Flasche Mineralwasser machte er sich auf den Weg in sein altes ›Speisezimmer‹.
Gerade als er mit der systematischen Verätzung von Speiseröhre und Magenschleimhaut beginnen wollte, klingelte das Telefon auf dem Schreibtisch.
›Institut für Krimiliteranalogie, Palinski‹, es war das erste Mal, dass er sich so meldete. Diesmal war die Freude darüber fast so groß wie seine Vorstellung davon, stellte er erstaunt fest.
Es war Helmut Wallner, der Palinski mit knappen Worten über einen Entführungsfall der besonderen Art informierte. »Können wir heute noch darüber sprechen?«, wollte der Inspektor wissen. »Ich glaube, deine unorthodoxe Denkweise ist wieder einmal gefragt.«
Also war wieder business as usual angesagt, dachte Palinski. Auch gut, zuviel Vorfreude stumpfte ohnehin nur ab oder machte einen mit der Zeit ›gaga‹.
Sie verabredeten sich für 8 Uhr abends beim ›Zimmermann‹ in Salmannsdorf.
*
Inspektor Wallner, sein Stellvertreter Martin Sandegger und Franca Aigner saßen mit den meisten Mitgliedern der Familie Suber in dem als Bibliothek bezeichneten Raum der riesigen Villa. Herta, die eilig und zu ihrer großen Freude aus dem Ruhetag zurückgeholte Perle kochte fleißig Tee und Kaffee und Herr Kiefer, der Gärtner/Chauffeur servierte die Getränke mehr engagiert als gekonnt.
Die Leute von der Tatortgruppe waren fertig und packten bereits wieder ihre Sachen zusammen. Heinz Blum, der für die eiligst installierte Telefonüberwachung verantwortliche Techniker beendete eben den letzten Test und erklärte die Abhöranlage für einsatzbereit.
»Lassen Sie mich zusammenfassen«, Wallner blickte auf die voll beschriebenen Seiten seines Notizbuches. »Herr Filzmayer wurde bereits …«
»Das ist immer noch der Herr Kommerzialrat Filzmayer«, brummte Herta Dworack im Vorbeigehen leise, aber laut genug, dass alle es verstehen konnten.
»Lassen Sie das, Herta«, ermahnte Erika Suber-Filzmayer das treue Hausmonster, »jetzt ist wirklich keine Zeit für eine Diskussion über Titel und Ehrenbezeichnungen.«
»Wenn’s aber wahr ist«, gab sich die derart Gemaßregelte nicht so rasch geschlagen.
»Also gut«, zeigte sich Wallner einsichtig, »der Herr Kommerzialrat wurde bereits …«
» Doktor honoris causa ist er auch«, versuchte die Perle nochmals zu punkten.
»Ja, und Honorarkonsul von Mauritius auch, ich weiß«, der Inspektor war nicht nur ein geduldiger, sondern auch ein gut informierter Beamter, »und auch Universitätslektor. Falls Sie aber darauf bestehen sollten, dass ich den Entführten ständig mit all seinen Titeln anspreche, sitzen wir morgen noch hier und sind um keinen Schritt weiter gekommen.«
»Entschuldigen Sie«, steckte Herta zurück, »ich bin ja schon ruhig.« Sie konnte es sich aber nicht verkneifen, im Abgehen noch darauf hinzuweisen, dass »der Herr Kommerzialrat seine Tätigkeit an der Technischen Universität schon vor drei Jahren beendet hat.«
Kurt Suber schüttelte nur den Kopf und seine Frau erklärte entschuldigend, dass die Gute »schon seit ihrem 17. Lebensjahr im Hause ist und eben nicht anders kann.«
Kommerzialrat Filzmayer war also bereits gestern vor zwei Wochen verschwunden. Er hatte mittags sein Büro in der Wiener Innenstadt verlassen und die Absicht geäußert, sich nach einem kurzen Mittagessen in das Werk in Stadlau bringen zu lassen. Sein Chauffeur, der ihn um 14.30 Uhr vom Restaurant ›Tabakspfeife‹ abholen sollte, hatte vergebens gewartet. Nach zehn Minuten war er in das Lokal gegangen, um seinen sonst so pünktlichen Chef zu suchen. Doch hier hatte ihn an dem Tag noch niemand gesehen.
Inzwischen hatte Dr. Suber einen von einem kleinen Buben beim Portier abgegebenen Brief erhalten, in dem 500 000 Euro Lösegeld gefordert und vor der Verständigung der Polizei ausdrücklich gewarnt worden war. Der Brief war auf weißem, handelsüblichem 80-Gramm- Papier ausgedruckt worden, Schrifttyp Arial 11. Weitere Aufschlüsse dazu würde die Untersuchung durch das Kriminallabor bringen.
Die Modalitäten der Geldübergabe wurden mit einer Suber per Boten zugestellten Tonkassette am darauf folgenden Montag bekannt gegeben. Das Geld sollte in Scheinen zu zehn, zwanzig und fünfzig Euro in einer Sporttasche im linken Abfallbehälter bei der Einfahrt zum Parkplatz des Neustifter Friedhofs deponiert werden. Der Tag und die genaue Zeit sollten noch kurz vorher bekannt gegeben werden.
Dr. Suber hatte schließlich am Donnerstag auf dem Weg nach Hause die Anweisung über Handy erhalten, die Tasche an diesem Abend um exakt 23.15 Uhr zu hinterlegen. Was auch geschehen war.
Seither hatte die Familie nichts mehr in der Angelegenheit gehört. Weder von den Entführern noch von Eugen, pardon, von Kommerzialrat Eugen Filzmayer. Zumindest bis heute Morgen.
Plötzlich lag ein weiteres, in Form und Inhalt völlig vom ersten Erpresserbrief abweichendes Schreiben vor. Mit einer zusätzlichen Forderung und einer sehr eindringlichen Zahlungsermunterung in der Anlage. Wallner hatte zwar schon von abgehackten Körperteilen gehört, mit scheinbaren oder echten Trittbrettfahrern zu tun gehabt und damit auch mit zusätzlichen Geldforderungen. Ein Fall, der alle drei Merkmale vereinte, war ihm bisher aber noch nie untergekommen. Er hoffte stark auf Palinskis Datenbank.
Während Wallner sprach, beobachtete Franca Aigner aufmerksam das Verhalten der Anwesenden, das unterschiedlicher nicht hätte sein können.
Erika Suber-Filzmayer, die Tochter des Entführten wirkte sehr besorgt, aber durchaus gefasst. Ihr Mann machte einen fahrigen, ungemein nervösen Eindruck und zuckte bei den leisesten Geräuschen zusammen. Viola, die mittlere Tochter der Subers benahm sich so, als ob sie das Ganze eigentlich nichts anginge. Nur Miriam, die jüngste der drei Mädchen machte einen wirklich betroffenen Eindruck und weinte zwischendurch immer wieder leise vor sich hin. Und das nicht nur, weil der »Opa jetzt nicht mit mir am Mittwoch zum ›Riverdance‹- Gastspiel gehen wird«, wie er ihr offenbar versprochen hatte.
Susanne wieder, die Älteste aus dem Suber’schen Dreimäderlhaus, die die Nacht bei einer Freundin zwei Seitengassen weiter verbracht hatte, hatte es bisher noch nicht einmal der Mühe wert gefunden, nach Hause zu kommen, obwohl sie bereits vor mehr als zwei Stunden informiert worden war. Komische Familie, dachte Franca und hoffte, dass Helmut und sie das eines Tages besser hinbekommen würden.
»Jetzt müssen wir in die Wohnung ihres Vaters«, kündigte Inspektor Wallner an, »und mit Frau Beckmann sprechen.« Das war die bei Eugen Filzmayer wohnende Haushälterin. »Wird jemand von Ihnen mit uns kommen?«
Schlagartig konzentrierten sich die Blicke der Familie auf Herrn Kiefer, der auch ohne Worte verstand. Er stellte die Teekanne, mit der er eben nachschenken wollte, wieder ab. »Wenn Sie soweit sind, können wir fahren«, emotionslos deutete er zur Türe.
»Danke, Herr Kiefer. Einen Moment noch.« Wallner wandte sich an Kurt Suber. »Könnten Sie veranlassen, dass uns der Fahrer Ihres Vaters wie auch seine anderen engen Mitarbeiter so rasch wie möglich für eine Befragung zur Verfügung stehen? Es ist sicher angenehmer, wenn Sie das veranlassen, als wenn wir diese Personen zu Hause aufsuchen. Das macht möglicherweise einen schlechten Eindruck bei den Nachbarn.«
Suber nickte gedankenverloren. »Ich werde mich bemühen, die wichtigsten Mitarbeiter für morgen Vormittag in das Büro in der Singerstraße zu bestellen. Wäre das in Ordnung?«
Wallner blickte auf seine Uhr. Ein früheres Treffen war praktisch wohl kaum möglich. »9 Uhr morgen früh wäre gut«, meinte er. »Aber machen Sie den Leuten klar, dass wir sie ins Kommissariat bestellen müssten, falls sie nicht freiwillig zu diesem Termin erscheinen.«
»Wenn möglich, lassen Sie bitte auch eine Liste der in letzter Zeit gekündigten Mitarbeiter anfertigen. Solche Leute kommen manchmal auf so abwegige Ideen«, fügte Franca noch hinzu. Und Helmut Wallner musste wieder einmal anerkennen, dass seine Freundin auch beruflich große Klasse war.
2
»Wien ist anders.« Nicht mit »ß« oder »ss« im Verbum, sondern schlicht und einfach mit nur einem »s«. Soll also heißen, dass diese Stadt anders ist als Zürich, Berlin, Mailand oder Prag. Und jede andere Stadt auf dieser Welt. Dass Wien also vorgibt, anders zu sein als z. B. Berlin, bedeutet gleichzeitig, dass Berlin wiederum anders sein muss als Wien. Und damit auch jede andere Stadt. Denn es wird doch niemand ernsthaft behaupten wollen, dass Berlin nicht anders wäre als Zürich, Mailand oder Prag.
Niemand konnte sich aber damit ausreden, nicht vor der Andersartigkeit Wiens gewarnt worden zu sein. Wo und wie auch immer man nach Wien hereinkam, über die Autobahnen, den Flughafen oder die Bahnhöfe, überall fanden sich diese großen Tafeln, auf denen die für die Stadtverwaltung offenbar so wichtige Feststellung affichiert worden war.
Entweder waren alle, die in die Bundeshauptstadt strömten besonders mutig oder sie nahmen die Drohung nicht weiter ernst, denn es ist kein einziger Fall bekannt, in dem auch nur ein Besucher die ›andere Stadt‹ fluchtartig wieder verlassen hätte. Zumindest nicht sofort.
Dieser Tage war Wien aber anders ›anders‹ und damit auch tatsächlich. Zumindest ein bisschen. Schuld daran war die unheilvolle zeitliche und damit auch thematische Verquickung der letzten bürokratischen Dummheit aus Brüssel mit dem derzeit seiner heißen Phase zustrebenden Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlkampf. Und diese Dummheit hatte einen Namen. Sie hieß ›Neue EU-Gastronomierichtlinie‹.
Begonnen hatte die ganze Angelegenheit mit einem zunächst von den meisten Lesern noch milde belächelten Artikel im ›Neuen Wiener Tagblatt‹ vom 28. Juli.
»Neue EU-Gastronomierichtlinie Streit um Spezialitätenliste.«
Brüssel: Was zunächst eher operettenhaft anmutet, scheint sich tatsächlich in einen handfesten Streit zwischen Österreich und seinen Nachbarn Italien, Ungarn, der Tschechischen Republik und Deutschland auszuwachsen.
Dabei geht es um die Aufnahme der heimischen Gerichte ›Fiakergulasch, Schweinsbraten und Wiener Schnitzel‹ in die so genannte ›Spezialitätenliste‹, der Grundlage für die neue ›Europäische Speisenkarte‹.
Die Ungarn beanspruchen das Gulasch, der Schweinsbraten wird sowohl von den Bayern als auch den Tschechen als typisch für ihre Küche reklamiert. Am meisten gestritten wird aber um das Wiener Schnitzel, von dem die Italiener behaupten, dass es sich bloß um eine spezielle Form des ›Mailänder Schnitzels‹ handle. Dessen Rezept vom legendären Feldmarschall Radetzky gestohlen und gegen jedes Völkerrecht nach Wien entführt worden sei.
Mit Ausnahme der Italiener haben alle Verhandlungsteams bereits Kompromissbereitschaft signalisiert. Unsere südlichen Nachbarn dagegen bestehen auf ihrem Standpunkt und drohen mit ihrem Veto, falls Wien das Schnitzel nicht aufgibt. Ein gastronomiepolitisch einmaliger Eklat mit Auswirkungen auf die gesamte EU kann nicht ausgeschlossen werden.
Nachdem die ›BIB – Bin Im Bild‹, die auflagenstärkste Vertreterin der Yellow Press im Lande der Lipizzaner und Mozartkugeln die unheimliche Sprengkraft dieses Themas erkannt und zur Stopfung des traditionellen Sommerlochs für ihre Zwecke instrumentalisiert hatte, kam auch die Politik nicht mehr um dieses heiße Eisen herum. Als Erster wetterte der bis dahin unbekannte Falk Geyer, der Spitzenkandidat der erstmals antretenden Bürgerliste ›Wehrhafte Demokaten (WD)‹ gegen die ›Neu aufkeimenden Gemeinheiten der Welschen‹ und bewies damit eindrucksvoll die Richtigkeit zweier in diesem Konnex in den Medien vertretenen Thesen. Dass nämlich die Abkürzung WD der Gruppierung eigentlich für ›Wahrhafte Deppen‹ stand und dass die ›Wehrhaften Demokraten‹ nicht den rechten Rand des politischen Spektrums abdecken wollten, sondern der rechte Rand waren.
Natürlich blieb Falk Geyer - ein bisschen viel Vogel für einen einzigen Menschen, finden Sie nicht auch - nicht lange alleine. Innerhalb einer Woche hatte, die Grünen ausgenommen, jede in Wien wahlwerbende Partei zumindest einen eigenen Vogel, der sich für das Wiener Schnitzel ins Zeug legte, als ginge es um die Sanierung des Gesundheitssystems. Der berühmte Brecht’sche Sager ›Erst kommt das Fressen, dann die Moral‹, erlebte einige eigenwillige Interpretationen in diesen Tagen.