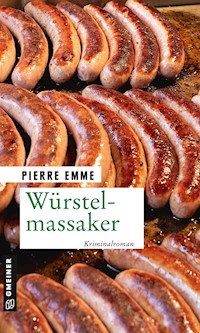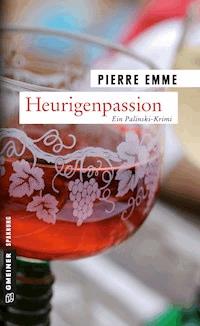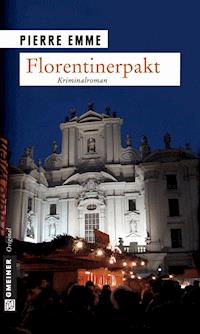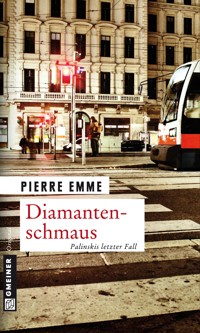Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Palinski
- Sprache: Deutsch
Das Viertel, in dem Mario Palinski lebt, ist in Aufruhr: Auf offener Straße wurde ein Liebespaar erschossen! Hauptverdächtiger ist der pensionierte Kriminalbeamte Albert Göllner, der normalerweise nachts mit seiner Schreckschusspistole für Sicherheit sorgt. Gleichzeitig erfährt Palinski, dass er eine Tochter hat, die im fernen Südtirol lebt: Silvana Sterzinger-Godaj stammt aus der berühmten Budapester Konditorendynastie der Godajs, deren süße Wunderwerke schon das österreichische Kaiserhaus verzückten. Als hervorragende Köchin und Patisseuse soll Silvana an der in Wien stattfindenden »Internationalen Kochkunstausstellung« mitwirken. Doch seit ihrer Ankunft vor zwei Tagen ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Als erfahrener Ermittler und besorgter Vater wittert Paliniski ein Komplott - und er soll Recht behalten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Emme
Tortenkomplott
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
1
Albert Göllner, ein 78-jähriger Kriminalbeamter in Pension, litt seit Jahren an Schlafstörungen. Mit dem Einschlafen klappte es noch ganz gut, aber nach zwei, spätestens drei Stunden wurde er regelmäßig wieder wach. Dann dauerte es immer längere Zeit, bis er gegen Morgen nochmals etwas einnickte.
Die nächtliche Wachphase lief meistens völlig gleich ab. Göllner pflegte es sich mit einem Häferl Tee in seinem Lieblingslehnstuhl am Fenster seiner Wohnung im zweiten Stockwerk gemütlich zu machen. Hier saß er einige Stunden mit einem starken Nachtglas und wachte über die Sicherheit und Nachtruhe seiner Mitbürger in diesem Abschnitt der Billrothstraße.
Diese Nachtwache war nicht nur der Spleen eines alten Mannes, dessen Schicksal ihn dorthin gebracht hatte, wo er heute war, sondern hatte sich in einigen konkreten Fällen als höchst sinnvoll und hilfreich erwiesen. So hatte Göllner beispielsweise durch laute Zurufe und das von einem Tonband stammende Geräusch eines Martinshorns einmal den Einbruch in ein Juweliergeschäft verhindert. Zweimal hatte er den Diebstahl eines Pkws schon im Ansatz unterbunden und ein anderes Mal einen gerade ausbrechenden Brand so rechtzeitig gemeldet, dass die Feuerwehr schon da war, ehe die Bewohner der betroffenen, auf der anderen Straßenseite liegenden Wohnung überhaupt bemerkt hatten, in welcher Gefahr sie sich befanden.
Was die hier wohnenden Menschen am meisten an Göllners schlafstörungsbedingtem Wirken schätzten, war die Sicherheit, die sie seit einigen Jahren empfanden. Und das völlig zu Recht. Denn nächtliche Belästigungen, insbesondere weiblicher Passanten, wie sie früher auch hier vorgekommen waren, gehörten fast zur Gänze der Vergangenheit an.
Selbst die meisten Gäste des schräg gegenübergelegenen Edel-Pubs mit seinem großen Gastgarten wussten über das wachsame ›Albert’sche Auge‹ Bescheid und hüteten sich, Göllner mit ihrem Verhalten beim und nach dem Verlassen der Gaststätte, zu früher mitunter äußerst radikalen Reaktionen zu provozieren. Denn der alte Polizist war anfänglich nicht davor zurückgeschreckt, einer lautstarken, erfolglos gebliebenen ›Abmahnung‹ aus dem zweiten Stock notfalls ein, zwei Warnschüsse aus einer Schreckschusspistole folgen zu lassen.
Eine auf den ersten Blick etwas archaisch wirkende, aber höchst effiziente Vorgangsweise, die anfänglich zu einiger Aufregung geführt hatte. Dank der guten Kontakte Göllners zu seinen ehemaligen Kollegen war diese Ballerei ohne Konsequenzen geblieben. Ja, da er versprochen hatte seine Schreckschusspistole nicht mehr zu benützen, hatte man ihm das geliebte Stück sogar gelassen. Auch, nachdem er sich hin und wieder nicht ganz an dieses Versprechen gehalten hatte.
Schließlich hatten sich die Bewohner der umliegenden Häuser an die gelegentlichen nächtlichen Kracher gewöhnt und diese letztlich als positiv empfunden. Waren sie doch hörbare Anzeichen dafür, dass der ›verrückte, alte Albert‹ aufmerksam über ihr Wohlergehen wachte und sie sicher schlafen konnten.
Jetzt war Mitte November. Es handelte sich übrigens um den mildesten November des letzten Jahrzehnts mit einer mittleren Temperatur, die vier Grad über dem langjährigen Durchschnitt lag. Bis heute zumindest.
Albert Göllner war während eines langweiligen Kriminalfilms, den er darüber hinaus bereits mehrmals gesehen hatte, eingeschlafen.
Auf das Fernsehen war doch immer Verlass, dachte er ironisch, als er kurz nach Mitternacht aufgewacht und gegen seine übliche Routine gleich ins Bett gegangen war.
Er hatte das Gefühl gehabt, rasch einschlafen zu können. Aber dann wollte es doch nicht so richtig damit klappen.
Erwartungsgemäß, wie Göllner fast versucht war zu sagen. Wie immer in diesem Zustand des um Einschlafen bemüht Seins drehten sich seine Gedanken unwillkürlich um seine Frau Else. Seine große Liebe, die nach 42 glücklichen gemeinsamen Jahren durch einen absolut sinnlosen Gewaltakt von seiner Seite gerissen worden war.
Else Göllner war nach dem Besuch bei einer kranken Freundin erst nach Mitternacht zu Fuß nach Hause aufgebrochen. Keine 50 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt war sie einer jungen Frau zu Hilfe geeilt, die von einem Betrunkenen handgreiflich belästigt worden war. Während die junge Frau die scharfe verbale Intervention der älteren Frau genützt hatte und davon gelaufen war, hatte der besoffene Schläger seine Aggressionen auf Else umgelenkt und sie mit einigen harten Fausthieben ins Gesicht und an der Schläfe getroffen. Dann hatte er die am Boden liegende Frau noch mit zwei, drei bösen Tritten an den Kopf und in den Oberkörper so schwer verletzt, dass sie trotz aller Bemühungen des bereits wenige Minuten später eingetroffenen Notarztes auf dem Weg ins nahe gelegene Allgemeine Krankenhaus verstorben war.
Für Göllner, der die Szene vom Fenster des Wohnzimmers aus hatte beobachten müssen und sich sofort nach der Verständigung des Notarztes auf die Straße begeben hatte, um den Totschläger zu stellen, war seine Welt innerhalb weniger Sekunden zusammengestürzt.
Nicht nur, dass seine Frau nicht mehr bei ihm war, machte ihm schrecklich zu schaffen. Seelisch wie auch ganz pragmatisch, denn Else hatte ihren Albert in jeder Hinsicht verwöhnt, vorne und hinten bedient und ihn keinen Handgriff im Haushalt machen lassen.
Was ihn mehr plagte, waren die Vorwürfe, die er sich seit damals immer wieder machte. Warum hatte er Else nicht von ihrer Freundin abgeholt oder war ihr zumindest ein Stück des Weges entgegengegangen? Er kannte die Antwort darauf. Es war sein verdammter Stolz gewesen, der ihn daran gehindert hatte. Bevor Else an diesem Abend gegen 19 Uhr die Wohnung verlassen hatte, hatten sie eine ihrer seltenen Auseinandersetzungen gehabt. Göllner hatte nämlich gefunden, dass Ingrid, das war die Freundin, Elses Gutmütigkeit nur ausnutzte und seine Frau sich das nicht gefallen lassen sollte.
Aber Elses hartnäckiger Art hatte er schließlich nichts entgegenzusetzen gehabt und so waren sie am letzten Abend ihres gemeinsamen Lebens im Streit geschieden. Immer wenn sich Göllner diese Situation vor Augen führte, trieb es ihm unwillkürlich die Tränen in die Augen.
Nicht zuletzt war sein Stolz als ehemaliger Polizist und Kriminalbeamter irreversibel verletzt worden. Denn dem Schwein, das ihm seine Else genommen hatte, war es gelungen, sich in den knapp 30 Sekunden, die Göllner von der Wohnung hinunter auf die Straße benötigt hatte, quasi in Luft aufzulösen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung war von dem Täter keine Spur zu entdecken gewesen und die Akte ›Else Göllner‹ hatte schlussendlich als ›unerledigt‹ abgelegt werden müssen.
Nach einem schweren Nervenzusammenbruch und einer mehr als achtmonatigen stationären psychiatrischen Behandlung war Göllner wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Damals hatte er begonnen, jede Nacht den von seiner Wohnung aus einsehbaren Teil der Billrothstraße zu überwachen. Wobei sein ganz besonderes Augenmerk Männern galt, die auch nur den geringsten Anschein erweckten, einem weiblichen Wesen zu nahe zu treten. Anfänglich hatte er nicht nur einmal zu seiner Schreckschusspistole gegriffen, um aus dem Pub kommende Paare, die sich mit Küsschen voneinander verabschieden wollten, sofort wieder auseinander zu treiben.
Göllner, vor dessen Augen die Ereignisse von vor neun Jahren abliefen, als ob sie gestern stattgefunden hätten, hörte plötzlich leise Hilferufe einer Frau. Das war neu, denn Else hatte damals und auch in seinen Träumen bisher noch nie um Hilfe gerufen. In diesem Punkt war die resolute Frau von einer einmaligen Sturheit gewesen. Mit jeder Situation hatte sie alleine fertig werden wollen, selbst wenn das Problem noch so schwierig gewesen war. Und bis auf einmal, das letzte Mal, war ihr das immer gelungen. Warum also rief sie jetzt plötzlich um Hilfe, ging es Göllner durch den Schlaf suchenden Kopf.
Plötzlich schoss er in die Höhe, die Realität der Nacht hatte ihn wieder. Das waren nicht Elses Hilferufe, sondern die einer fremden Frau. Einer Frau, die Hilfe gegen einen dieser schwer gestörten Machos benötigte, die er über alles hasste.
So rasch es ihm seine alten Knochen und abgenutzten Gelenke erlaubten, sprang er aus dem Bett und eilte zu seinem Beobachtungsposten am Fenster. Der Griff zu dem starken, das Restlicht nutzende Fernglas unterblieb diesmal, denn die Quelle der inzwischen verstummten Hilferufe war deutlich im Licht der Straßenbeleuchtung zu erkennen. Ein bulliger Mann hatte den Widerstand der etwas größeren, aber sehr zarten Frau offenbar schon soweit gebrochen, dass sie ihr verzweifeltes Schreien aufgegeben hatte. Wer weiß, was ihr diese Drecksau alles für den Fall angedroht hatte, dass sie nicht mit dem, um diese Tageszeit ohnehin nutzlosen, Geschrei aufhörte. Aber sofort.
Das Monster musste seine perverse Triebbefriedigung offenbar erstmals in dieser Gegend suchen, schoss es Göllner durch den Kopf. Anders schien es ihm nicht erklärbar, dass sich diese scheußliche Szene gerade auf der kleinen, unmittelbar vor seiner Wohnung liegenden Grünfläche abspielte. Diesem Minipark, in dem am Tag junge Mütter mit ihren Babys die Sonne genossen, sofern sie schien, und sich nachts die übervollen Besucher des ›Old Grenadier‹ Erleichterung verschafften. Wie auch immer.
Vieles hatte Göllner hier schon gesehen, eine Vergewaltigung noch nicht. Und seine grundsätzliche Abscheu gegen dieses Verbrechen wurde durch die Arroganz des Täters verstärkt, dies ausgerechnet hier, vor Göllners Augen zu tun. Doch er würde schon dafür sorgen, dass es bloß bei einem Versuch blieb.
Der ehemalige Polizist brüllte mit einer für sein Alter erstaunlich festen Stimme so laut wie möglich sein: „Lassen Sie sofort diese Frau in Ruhe, die Polizei ist schon verständigt«, in die Tiefe. Gleichzeitig schaltete er das kleine Tonbandgerät ein und ließ das Band mit der immer lauter werdenden Polizeisirene anlaufen.
Entweder hatte der Hormonstau dem Kerl da unten die Ohren verstopft oder er scherte sich ganz einfach nicht um die Göllnerschen Stör- und Verhinderungsversuche. Das Schwein machte weiter, als wäre nichts gewesen und schien die inzwischen völlig regungslos wirkende Frau gerade in den Hals beißen zu wollen. Halt, so nicht, bäumte sich alles in dem alten Mann auf. Nein, Wien durfte nicht Transsylvanien werden.
Gut, dann musste Göllner jetzt eben zum drastischsten ihm zur Verfügung stehenden Mittel greifen. Er machte einige Schritte in den Raum und holte seine mit Schreckschussmunition geladene Pistole aus einer Lade. Dann ging er zurück ans Fenster, streckte den Arm hinaus und gab eine letzte Warnung ab: »Sofort aufhören oder ich schieße.«
Als der Wüstling nicht einmal jetzt reagierte, ließ Göllner schließlich seine stärksten Argumente für eine sofortige Beendigung des scheußlichen Treibens da unten los. Er schoss einmal ungezielt in die Nacht hinaus und nach einigen Sekunden ein zweites Mal.
Komisch, dachte sich Göllner, dass ihm bisher nie das Echo aufgefallen war, das die Schüsse offenbar hervorriefen. Na ja, irgendwie logisch, die umliegenden Häuser waren mehrere Stockwerke hoch und reflektierten den Schall entsprechend. Wie hatte er das bisher bloß überhören können?
Der Vergewaltiger schien die Botschaft jetzt endlich verstanden zu haben. Er war nach rückwärts auf die hinter ihm stehende Bank gesunken und hatte die anscheinend nach wie vor völlig apathische Frau mit sich gerissen.
Da, endlich versuchte sie sich, von dem Mann zu lösen. Mühsam befreite sie sich aus seiner Umarmung und setzte sich leise wimmernd neben ihren Peiniger auf die Bank. Gleich darauf sank sie in sich zusammen, fiel zurück und verstummte.
Jetzt war es aber hoch an der Zeit, die Polizei zu rufen. Göllner stolperte zum Telefon und verständigte das Wachzimmer auf der Hohen Warte. Dann setzte er sich wieder ans Fenster und behielt die Bank im Auge. Eigenartig, dachte Göllner, dass das Schwein da unten keinerlei Versuch unternahm, den Ort des gerade noch verhinderten Verbrechens zu verlassen. Dem musste der Schock der Schüsse voll in die Glieder gefahren sein, dachte er zufrieden.
Bald war das Martinshorn des sich nähernden Polizeifahrzeuges zu vernehmen und Göllner begann sich anzuziehen, um zu den Kollegen auf die Straße zu gehen. Dieses Monster musste er sich unbedingt aus der Nähe ansehen.
Der 49-jährige Franz Harbeck, der in dem großen, an der anderen Ecke der Schegagasse liegenden Gemeindebau wohnte, war einer von mehreren Bewohnern, die die Schüsse gehört hatten. Na, da war der ›wachsame Albert‹ wieder einmal um unsere Sicherheit bemüht, schoss es ihm durch den verschlafenen Kopf. Dann drehte er sich zur Seite und schlief beruhigt weiter.
*
Es war kurz nach sieben Uhr Morgen. Palinski saß am Frühstückstisch und genoss den ersten Kaffee des Tages. Ihm gegenüber rutschte Wilma, die Frau, mit der er seit fast 25 Jahren lebte, die er aber noch immer nicht geheiratet hatte, nervös auf ihrem Sessel herum und bemühte sich um das, was die Franzosen so treffend Contenance nannten.
»Du bist mit Abstand die bestqualifizierte Kandidatin«, versuchte er die Mutter seiner beiden Kinder zu beruhigen, »und wirst daher das heutige Hearing bei der Schulbehörde als Siegerin verlassen.«
Wilma, die an einem Wiener Gymnasium Französisch unterrichtete, hatte sich um den durch die Pensionierung der bisherigen Direktorin per Jahresende frei werdenden Leitungsposten beworben und war wider Erwarten in die engere Auswahl gekommen.
»Du willst mir nur Mut machen«, widersprach die attraktive Frau , »und das ist sehr lieb von dir. Aber als parteilose Fachfrau, die nicht einmal in der Gewerkschaft ist, habe ich so gut wie keine Chance«, machte sich Wilma klein. »Der Doktor Reinberger ist eng mit der linken Reichshälfte verbandelt und die Frau Professor Gemser hat beste Kontakte ins Ministerium«, erklärte Wilma. »Dazu sollen beide auch noch gute Fachleute sein. Also, ich mache mir keine Hoffnungen auf die Position.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich vermute, dass die Gemser das Rennen machen wird, wegen des ›gender mainstreams‹.«
Palinski hatte diesen Begriff schon öfter gehört, aber noch immer keine ganz klare Vorstellung davon, was er eigentlich bedeutete.
»Also, wenn die Kommission nur einigermaßen bei Verstand ist, dann wird sie sich für dich entscheiden«, versuchte er Wilma aufzubauen. »Immerhin bist du auch eine Frau. Und vielleicht wollen sie kurz vor den Wahlen den Beweis antreten, dass diese Berufungen entgegen allgemeiner Ansicht doch objektiv und ohne politische Hintergedanken erfolgen.«
Das Schrillen des Festnetztelefons gab Wilma Gelegenheit, hochzufahren und ihre anhaltende Nervosität in Bewegungsenergie umzusetzen. Sie war gleich zurück und brachte Palinski das schnurlose Gerät. »Dein Freund Wallner«, flüsterte sie ihm zu. »Es scheint wieder einmal sehr dringend zu sein.«
»Guten Morgen, Helmut«, meldete sich Palinski, froh darüber, dass die etwas angespannte Atmosphäre im Raum durch den Anruf unterbrochen worden war. »Wie geht’s, wie steht’s?«
Der Oberinspektor ging auf die banale, scherzhaft gemeinte Floskel seines Freundes nicht ein, sondern schien selbst unter einer gewissen Spannung zu stehen.
»Wir haben zwei Tote«, meinte er nur knapp. »Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt darüber hinaus auch noch ein gewaltiges Problem auf uns zu. Es sieht ganz so aus, als ob der ›wachsame Albert‹ letzte Nacht ein Liebespaar erschossen hätte.«
Palinski hatte diesen Namen zwar schon gelegentlich aufgeschnappt, wusste aber nicht mehr damit anzufangen, als dass es sich dabei um einen etwas schrulligen, alten Mann, einen ehemaligen Polizisten handelte.
»Das ist zwar schlimm«, stimmte er der Einschätzung Wallners teilweise zu, »doch worin liegt das gewaltige Problem?«
»Man wird uns vorwerfen, dass wir Alberts Waffe nicht schon längst beschlagnahmt haben«, unkte der Oberinspektor. »Und das völlig zu Recht, wie es im Moment aussieht. Das ist eine lange, komplexe Geschichte. Kannst du heute Vormittag vorbeikommen? Ich bin fast sicher, dass wir deinen unkonventionellen Verstand und die Datenbank in diesem Fall gut werden brauchen können.«
Klar, dass Palinski konnte. »Gut, ich werde in einer Stunde bei dir sein.«
Wilma hatte schon von dem selbst ernannten Sicherheitschef des untersten Abschnittes der Billrothstraße gehört. Ja, sie wusste sogar einiges über die Motive des alten Herrn, die ihn zu diesem seit Jahren gezeigten Verhalten veranlasst haben mussten.
»Seine Frau soll quasi vor seinen Augen von einem Betrunkenen erschlagen worden sein und er konnte ihr nicht helfen«, in ihrer Stimme klangen gleichzeitig Abscheu und Mitgefühl mit. »Wer weiß, was er auf der Straße gesehen hat, das ihn zu dieser radikalen Vorgangsweise veranlasst hat?«, stellte sie in den Raum und Palinski fand, dass diese Frage durchaus angebracht war.
Ein Gutes hatte das schreckliche Ereignis aber auch. Durch die spekulative Erörterung des Themas vergaß Wilma ihre Nervosität. Und die Bedeutung des möglichen Direktionspostens hatte sich für sie wieder relativiert.
Als sie eine halbe Stunde später das Haus verließ, um sich dem Hearing zu stellen, tat sie das im Bewusstsein, dabei nichts verlieren, sondern bloß alles gewinnen zu können.
*
Dr. Walter Göllner war 42 Jahre alt, Rechtsanwalt und, wie der Nachname vermuten ließ, mit dem ›wachsamen Albert‹ verwandt. Er war der Sohn von Göllners früh verstorbenem, jüngerem Bruder Berthold und damit der Neffe des ehemaligen Polizeibeamten. Als sein Vater bei einem Bergunfall in den Hohen Tauern zu Tode gekommen war, war Walter erst 19 Jahre alt gewesen. Göllner war ihm seit damals mehr als nur Onkel, hatte sozusagen den Part des väterlichen Freundes und Mentors übernommen und damit gewisse Defizite der harten, lieblosen Mutter des Burschen ausgeglichen. Den Rest und mehr hatte die warmherzige Else, die es nie wirklich verwunden hatte, selbst keine Kinder bekommen zu können, beigesteuert.
Walter Göllner war nicht verheiratet, hatte aber eine feste Freundin, die seit mehr als drei Jahren mit ihm in einem ausgebauten Dachboden in der Hardtgasse zusammenlebte. Keine fünf Gehminuten von der Wohnung seines Onkels entfernt. Walter war schon am frühen Morgen vom Diensthabenden des Kommissariats Döbling telefonisch über das Geschehen informiert worden. Und obwohl es ihm an diesem Morgen besonders schwer zu fallen schien, so zeitig aus dem Bett zu kommen, stand Walter Göllner seinem Onkel bereits kurz danach zur Seite.
Es war absolut unüblich, dass die Polizei den Anwalt eines Tatverdächtigen von sich aus informierte und das schon bald nach ihrem Eintreffen am Tatort. Aber im Falle Albert Göllners war alles anders. Der Mann war 46 Jahre lang im Dienste der Wiener Polizei gestanden, die letzten 22 am Kommissariat Hohe Warte. Er war mit 64 Jahren als Leiter der Kriminalabteilung und damit als Vorvorgänger von Oberinspektor Helmut Wallner in Pension gegangen. Von den heute aktiven Beamten im Koat Hohe Warte hatten nur zwei noch unter Chefinspektor Göllner Dienst getan. Für alle, insbesondere auch die Jungen, war und blieb Göllner eine Legende, ein Vorbild und wurde wie eine Ikone verehrt.
Nachdem die Tatortgruppe und der Arzt die beiden Opfer untersucht, fotografiert und die Spuren in dem winzigen Park gesichert hatten, wurden die Opfer ins gerichtsmedizinische Institut gebracht. Die Karawane zog weiter und verlegte ihre Aktivitäten in die Wohnung Albert Göllners.
Hier, innerhalb der vier Wände, in der der beliebte und allseits geachtete, ehemalige Kriminalbeamte sein Leben verbrachte, wurde deutlich erkennbar, wie schwer es allen fiel, gegen einen der ihren zu ermitteln.
Entsprechend respektvoll, ja fast schüchtern gingen die Beamten zunächst bei ihrer Arbeit vor. Die Erhebungen wurden von Martin Sandegger geleitet, dem Stellvertreter Wallners, der sich als junger Kriminalbeamter seine ersten Sporen unter Göllner verdient hatte.
Ohne dass ein einziges Wort darüber gewechselt worden war, standen zwei Dinge für alle zweifelsfrei fest. Erstens, dass ihr Idol Göllner die beiden tödlichen Schüsse abgegeben haben musste. Der Tatverdächtige leugnete gar nicht, die in der Wohnung aufgefundene Pistole zweimal abgefeuert zu haben. Er bestritt allerdings, gezielt geschossen zu haben und beteuerte vor allem immer wieder, dass die Waffe lediglich mit Schreckschussmunition geladen gewesen wäre.
Dagegen sprach, dass sowohl der 28-jährige Mann, laut Führerschein ein gewisser Josef Hilbinger, als auch die 22-jährige Marika Estivan mausetot waren.
Der zentrale Kopfschuss beim männlichen Opfer und der in den Rücken der Frau eingedrungene, nur knapp am Herzen vorbei gegangene Schuss konnten immerhin zumindest theoretisch ein Zufall gewesen sein. Ein höchst ungewöhnlicher allerdings.
Weiterhin waren sich alle trotz der objektiven Beweise sicher, dass es sich bei dem tragischen Geschehen strafrechtlich bestenfalls um fahrlässige Tötung handeln konnte. Denn der Chefinspektor war nie und nimmer der Mann, der einen noch so miesen Verbrecher einfach abgeknallt hätte. Und schon gar nicht einer unschuldigen Frau, dem angeblichen Verbrechensopfer, das er ja schützen wollte, in den Rücken geschossen hätte. Nein, auch wenn die Beweise scheinbar eine völlig andere Sprache sprachen, Göllner war zweifellos das bedauernswerte Opfer eines unglaublichen Zusammentreffens mehrerer unglücklicher Zufälle geworden. Da musste die Polizei nach außen hin streng nach Gesetz vorgehen. Intern, dem ehemaligen Kollegen gegenüber war aber größtmögliche Schonung und Rücksichtnahme angesagt.
Das ging soweit, dass einer der beiden uniformierten Beamten frische Semmeln beim Bäcker besorgt hatte und jetzt in der Küche stand, um das Frühstück für Göllner zuzubereiten. Pfefferminztee, eine Buttersemmel und ein weiches Ei. Exakt vier Minuten, das verstand sich wohl von selbst.
Dr. Walter Göllner, der eigentlich auf Vertrags- und Familienrecht spezialisiert war, hatte vorsorglich bis auf Weiteres die Vertretung seines Onkels übernommen. Bei einem kurzen Vieraugen-Gespräch mit Martin Sandegger ließ der Anwalt durchblicken, dass sein Mandant seit dem schrecklichen Ende seiner Frau immer wieder Zeichen von Verwirrung gezeigt hätte und die gegenständliche Tat zweifellos in einem Augenblick temporärer Unzurechnungsfähigkeit begangen haben musste. Denn dass die tödlichen Schüsse von Onkel Albert abgegeben worden waren, stand angesichts der erdrückenden Beweislage für den Neffen außer Zweifel.
Jetzt hatte sich anscheinend auch der Leiter der Erhebung, der staubtrockene Sandegger, von der trotz der herrschenden Betroffenheit langsam eher an ein Kaffeehaus denn an eine polizeiliche Untersuchung erinnernden Atmosphäre in Göllners Wohnung anstecken lassen und mit einer Schale Kaffee zu dem Tatverdächtigen gesetzt.
»Mein Gott, Chefinspektor«, wandte er sich an den alten Herrn, »wie konnte denn bloß so etwas passieren?«
Der Angesprochene schien den Beamten nicht gehört zu haben, denn er starrte weiterhin auf einen unbestimmten Punkt in der Ferne, der weder für Sandegger noch für den neben seinem Onkel sitzenden Walter erkennbar war.
»Ich habe ihm vorhin ein Beruhigungsmittel gegeben«, sah sich der Anwalt veranlasst zu erklären. »Er war so aufgeregt, dass ich wegen seines hohen Blutdrucks Angst bekommen habe. Sein Arzt hat schon vor Jahren gewarnt, dass Onkel Albert einen Schlaganfall erleiden könnte. Ich bin nicht sicher, ob Sie in den nächsten Stunden eine vernünftige Aussage von ihm werden bekommen können.«
»Lass nur«, schaltete sich der Sedierte jetzt ein, »ich bin zwar ein wenig benebelt, aber ich kann hören, sehen und sprechen. Also behandle mich nicht wie jemanden, der nicht mehr Herr seiner Sinne ist.« Er blickte Sandegger direkt an.
»Dich kenne ich doch«, meinte er dann, »du bist doch der Martin. Der Nachname liegt mir auf der Zunge.«
»Sandegger«, half der Angesprochene aus, »Martin Sandegger. Ich habe das Vergnügen gehabt, fast zwei Jahre unter Ihnen zu arbeiten, ehe Sie in den Ruhestand getreten sind.«
»Richtig«, strahlte der alte Herr, der sich offensichtlich freute, ein bekanntes Gesicht von früher zu sehen. »Warst du nicht der, der den Brenek Charlie dingfest gemacht hat? Du weißt schon, den Bankräuber, der immer die Filialleiter auf dem Weg zur Arbeit abgepasst und sich von ihnen direkt zum Tresor hat bringen lassen.«
»Ja«, Sandegger strahlte und bewunderte das außergewöhnliche Gedächtnis seines ehemaligen Vorgesetzten. »Das war mein erster Erfolg auf der Hohen Warte.«
»Und was machst du jetzt hier?«, wollte Göllner wissen.
Sandegger blickte den Neffen des Tatverdächtigen fragend an, doch dieser zuckte nur mit den Achseln.
»Onkel, du weißt doch noch, dass du heute Nacht irrtümlich zwei Menschen auf der Straße erschossen hast«, Walter versuchte, dem verwirrten alten Mann die Wirklichkeit wieder in Erinnerung zu rufen. »Und Inspektor Sandegger leitet die Erhebung.«
»Aber das ist doch Unsinn«, begehrte der alte Herr auf, so sehr, wie ein unter starken Beruhigungsmitteln stehender Mensch eben in der Lage war. »Wie kann ich denn mit Schreckschussmunition jemanden töten? Ja, selbst wenn scharfe Munition in der Waffe gewesen wäre, ich habe doch bloß in die Luft geschossen.«
Sandegger, den normalerweise nicht so rasch etwas aus der Ruhe bringen konnte, war die Entwicklung des Gespräches erkennbar unangenehm.
»Es tut mit leid, Herr Göllner, aber Ihre Pistole war und ist noch immer mit scharfer Munition geladen«, stellte der Inspektor klar, der unbewusst von der, die Verbundenheit des Korps signalisierenden, Anrede ›Chefinspektor‹ zum nüchternen, sachlichen ›Herr‹ gewechselt hatte. Oder war es Absicht gewesen, um sich zumindest einen Rest an Distanz und Objektivität zu erhalten?
Wie auch immer, die geringfügige Veränderung in Diktion und Tonlage war dem alten Herrn nicht entgangen.
»Soll das heißen, dass Sie mir nicht glauben, Herr Kollege?« Göllner hatte den Kollegen besonders betont, um Sandegger zu einer deutlichen Stellungnahme zu zwingen.
Sandegger blickte seinen ehemaligen Chef lange an, ehe er sich aufs Eis begab. »Ich glaube Ihnen, Chefinspektor, aber ich glaube Ihnen nur, weil ich das auch möchte. Dem stehen zumindest derzeit einige Beweise gegenüber, die meinen Glauben objektiv als reines Wunschdenken erscheinen lassen.«
Göllners bisher wie versteinert wirkende Miene löste sich plötzlich in ein die wachsende Spannung wieder vernichtendes Lächeln auf.
»Du bist ein verdammt guter Kriminalist geworden, Martin«, erkannte der alte Fuchs an. »Und du bist in keiner einfachen Situation, aber du gehst die Sache völlig richtig an. Persönliche Gefühle haben keinen Platz bei einer Untersuchung wie dieser. Ich bin froh, dass du den Fall bearbeitest.«
Scheinbar unbeirrt fuhr Sandegger mit seinem Statement fort: »Ich verspreche Ihnen aber, dass wir sämtlichen, also selbst den unbedeutendst scheinenden Spuren nachgehen werden, die möglicherweise zu Ihrer Entlastung beitragen könnten. Sie können also mit einem Maximum an Fairness von meiner Seite rechnen.«
Göllner nickte zwei, drei Mal mit dem Kopf. »Mehr kann ich wirklich nicht erwarten. Und da ich weiß, was ich nicht getan habe, gibt es keinerlei Grund für mich, mir Sorgen zu machen. Ich vertraue Ihnen, Martin.«
Dr. Walter Göllner, ein guter Vertragsrechtler und leidlicher Spezialist für das Familienrecht, aber sonst kein allzu großes Licht, hatte anscheinend nicht ganz mitbekommen, was da zwischen seinem Onkel und dem Inspektor gelaufen war.
»Ich werde auf jeden Fall auf verminderte Zurechnungsfähigkeit plädieren«, warf er ein. »Damit kann ich ihn sicher vor dem Gefängnis bewahren«, meinte er Zustimmung heischend zu dem Inspektor.
»Ich denke nicht, dass es Ihrem Onkel nur darum geht, nicht ins Gefängnis zu müssen«, Sandegger bewegte nachdenklich seinen Kopf hin und her. »Wie ich ihn einschätze, geht es ihm darum, zweifelsfrei von jedem Verdacht freigesprochen zu werden. Da ich keinen Grund habe, an seinen Worten von vorhin zu zweifeln, werden wir das auch schaffen.«
»Aber…«, wollte der Anwalt einwenden, doch sein Mandant unterbrach ihn sofort.
»Lass es gut sein, Walter«, meinte der alte Herr, »Martin hat völlig recht. Du wirst schon früh genug mein Sachwalter werden. Ein wenig gedulden wirst du dich allerdings noch müssen.«
Dann nickte er dem Inspektor zu. »Gut, ich bin bereit.«
»Dann beginnen wir einfach«, meinte Sandegger. »Am besten, Sie erzählen mir einmal alles von Anfang an.«
*
Auf dem Weg zu seinem Treffen mit Oberinspektor Wallner hatte Palinski noch einen kurzen Abstecher in sein Büro in dem von ihm gegründeten ›Institut für Krimiliteranalogie‹ eingelegt. Dieses lag im Erdgeschoss des gegenüberliegenden Flügels des im Grundriss wie ein U aussehenden Zinshauses aus der Gründerzeit. Um von der Wohnung dort hinzugelangen, musste man lediglich den begrünten Innenhof queren und das Gebäude über die Stiege IV wieder betreten. Dabei kam man an jener Bank vorbei, auf der Palinski im Mai des Vorjahres die Leiche des berühmten Schauspielers Jürgen Lettenberg gefunden und damit seinen ersten Schritt aus der Theorie heraus in die reale Welt der Kriminalistik getan hatte.
Seit damals war die Verbrechenshäufigkeit in Döbling explosionsartig in die Höhe geschnellt und gar nicht wenige Leute hatten sich gefragt, ob und inwieweit Palinskis Wirken damit zu tun hatte. Immerhin schienen sich die unterschiedlichsten Gesetzesbrecher seither darum zu reißen, vom Erfolgsteam Wallner– Palinski aufgeblattelt zu werden.
Wahrscheinlich war es aber bloß so, dass sich die fettesten Motten eben um das stärkste Licht scharten.
Im Institut kümmerte sich Margit Waismeier, die junge Witwe eines im besagten Fall ›Lettenberg‹ zu Tode gekommenen Kriminalbeamten als Büroleiterin dynamisch und umsichtig um die administrativen Belange.
Palinskis Team wurde komplettiert durch Florian Nowotny, einen jungen Polizisten, der sich gleich nach dem Abschluss der Polizeiakademie vor einem Monat hatte freistellen lassen, um Jura zu studieren.
Dem Chef des Institutes mit dem fast unaussprechlichen Namen, dessen inhaltliche Bedeutung kaum jemand so richtig kannte, war der überaus intelligente und clevere Polizeischüler bei der Jagd nach dem ›Schlächter von Döbling‹ aufgefallen. Er hatte den jungen Kollegen ermuntert, seine Aufstiegschancen bei der Polizei durch ein abgeschlossenes Studium entscheidend zu verbessern und ihn in der Folge unter seine Fittiche genommen. Jetzt arbeitete Florian seit Anfang des Monats als Assistent Palinskis, der bei der Arbeitseinteilung strikt darauf achtete, dass die Erfordernisse des eben begonnenen Studiums nicht zu kurz kamen.
Der junge Mann bewohnte das Gästezimmer des Instituts und ermöglichte auf diesem Wege, einen Teil des in ihn investierten Geldes unter dem Titel ›Nachtwächter‹ steuerlich geltend zu machen.
Palinski hatte das Büro kurz nach 8.30 Uhr betreten. Das bedeutete, dass Margit, die ihre Arbeit um neun Uhr begann, noch nicht und Florian, der unterwegs zu einer Vorlesung war, nicht mehr da waren.
Auf dem Anrufbeantworter hatte sich ein gewisser Fritz Sterzinger verewigt, der mit unüberhörbarem Tiroler Zungenschlag um einen Rückruf unter der ebenfalls angegebenen Handynummer ersuchte. Der Zusatz: ›So bald wie nur möglich, denn es ist sehr wichtig‹, klang wahrhaftig beschwörend.
Gut, wenn es so dringend war, Palinski hatte die Nummer sofort eingetippt, dann lass es uns eben gleich hinter uns bringen.
Aber: ›Der Teilnehmer ist im Moment leider nicht erreichbar, bitte versuchen Sie es später nochmals‹, hatte ihm eine anonyme, etwas blechern klingende weibliche Stimme mitgeteilt.
Dann eben nicht, hatte sich Palinski gedacht. Dann musste der gute Fritz aus Kitz oder sonst wo im Heiligen Land Tirol eben noch etwas warten. »Wird schon nicht so wichtig sein.«
Jetzt saß er im Büro seines Freundes Helmut Wallner und ließ sich auf den letzten Wissensstand des Falles ›Albert Göllner‹ bringen.
»Der alte Herr ist nicht davon abzubringen, mit Schreckschussmunition und dazu noch ungezielt geschossen zu haben«, betonte der Oberinspektor bereits zum zweiten Mal. »Und wir können nur hoffen, dass er recht damit hat. Denn sonst kommen einige von uns, darunter auch ich, zumindest um ein Disziplinarverfahren nicht herum«, malte er schwarz. »Nicht auszuschließen ist außerdem eine strafrechtliche Verantwortung. Da kommt einiges auf uns zu«, er schüttelte den Kopf, »und nichts Gutes. Das kannst du mir glauben.«
»Du meinst, Ihr hättet dem Tatverdächtigen die Waffe schon nach der ersten Herumballerei abnehmen müssen«, fasste Palinski die leicht wehleidige Suada des Oberinspektors zusammen. »Und warum habt ihr das nicht getan?«
»Erstens steht der alte Göllner bei uns im Kommissariat quasi unter Denkmalschutz«, erklärte Wallner. »Zweitens hat er ja beim ersten Mal und auch in der Folge wirklich nur mit Schreckschussmunition Krach gemacht. Schlussendlich war er mit seinem Wachsamkeits-Spleen äußerst erfolgreich. Er hat immerhin dafür gesorgt, dass es in dem Grätzel, in dem er wohnt, in den letzten acht Jahren nicht einen einzigen Fall von Belästigung gegeben hat. Geschweige denn problematischere Gesetzesverletzungen. Die Leute, die dort wohnen, lieben ihn und sind froh, dass sie in der Nacht schlafen können, ohne Einbrüche, Autodiebstähle oder sonst was befürchten zu müssen. An seinen Geburtstagen wird er mit selbst gebackenen Torten überhäuft und zu Weihnachten mit Geschenken. Mit einem Wort, er ist eine Art Volksheld. Ein Heiliger, an dessen Bild man nicht kratzt.«
»Dass er nach dem schrecklichen Ende seiner Frau einen Nervenzusammenbruch hatte und seither noch immer traumatisiert ist, habt ihr aber schon gewusst. Oder?«
Damit hatte Palinski den Finger exakt auf den wunden Punkt in der höchst unangenehm zu werdenden Angelegenheit gelegt.
Entsprechend verlegen reagierte Wallner auf die exakte Feststellung des eigentlichen Fehlverhaltens seiner Behörde.
»Ihr könnt also nur hoffen, dass die Aussagen dieses Alberts zutreffen und er tatsächlich nur durch ungezielte Schüsse mit Knallkapseln die Vergewaltigung verhindern wollte«, machte Palinski das scheinbar Unmögliche zur Conditio sine qua non.
»Aber beim derzeitigen Erkenntnisstand ist das wohl auszuschließen.«
Betrübt nickte Wallner mit dem Kopf. »Wirst du uns helfen? Vielleicht findet sich ein vergleichbarer Fall oder irgendein sonstiger Hinweis in deiner Datenbank.«
»Na, was glaubst du? Werde ich oder werde ich nicht?«, flachste Palinski und grinste über das ganze Gesicht.
»Danke«, flüsterte Wallner erleichtert, »das werde ich dir nie vergessen.«
»Lass nur, wozu hat man denn Freunde?«
*
Wie Palinski richtig diagnostiziert hatte, war Fritz Sterzinger Tiroler. Allerdings einer, der südlich des Brenners zu Hause war. Sterzinger war 34 Jahre alt, Förster und Eigentümer des bekannten Fünf-Sterne-Hotels ›Rittener Hof‹ in der Nähe von Bozen.
Die traditionelle Luxusherberge, die bereits seit 1882 ihre Gäste nach allen Regeln der Gastfreundschaft verwöhnte, war heute neben ihrer märchenhaften, Ende des vergangenen Jahrhunderts errichteten Wellnesslandschaft vor allem für ihre exzellente Küche (3 Hauben, 2 Sterne) weit über die Grenzen Südtirols hinaus berühmt.
Das mit der Küche war aber nicht immer so gewesen. Bis vor etwa vier Jahren hatte man in diesem Hause zwar durchaus ordentlich gekocht, vor allem Tiroler und italienische Küche. Handfest, gutbürgerlich, aber ohne jedes Raffinement. Doch die Hotelgäste waren zufrieden. Wenn ihnen einmal nach kulinarischen Höchstleistungen war, dann fuhren sie eben ins ›Castel‹ im Dorf Tirol oder in die ›Rose‹ nach Eppan.
Dann hatte Sterzinger anlässlich eines Besuches bei Innsbrucker Freunden eine schicksalhafte Begegnung gehabt. Er hatte die damals 22-jährige Silvana Godaj auf einer Party kennengelernt und sich sofort in die nicht nur überaus hübsche, sondern auch hochintelligente Frau verliebt.
Silvana war absolvierte Hotelkauffrau und daher auch von ihrer Ausbildung her die ideale Partnerin für Sterzinger, der sich in seiner Rolle als Hotelier nicht so recht wohl fühlte und viel lieber seinem erlernten Traumberuf Förster nachgegangen wäre. Darüber hinaus war sie eine erstklassige Köchin und vor allem eine begnadete Patisseuse (oder wie immer die politisch korrekte Bezeichnung für einen weiblichen Konditor lautet).
Drei Monate später hatte Silvana Sterzinger-Godaj die Leitung des ›Rittener Hofs‹ übernommen. Die Führung des Doppelnamens war für sie kein emanzipatorischer Akt, das hatte die selbstbewusste, junge Frau nicht nötig. Nein, der Grund dafür war ein ganz anderer. Die Godajs waren eine alte, ungarische Konditorenfamilie mit Weltruf. Zu Zeiten der k. und k. Monarchie waren die ›Godaj-Torte‹ und der ›Godaj-Strudel‹ in den verschiedenen Geschmacksrichtungen nicht nur ein Begriff in Budapest, Wien und Prag, sondern auch in zahlreichen anderen europäischen Städten gewesen.
So hatte Antal Godaj, Silvanas Urururgroßvater beispielsweise zwei Mal monatlich zwei ›Godaj-Torten‹, mehrere Strudel und eine große Schachtel ›Godajs Spezialkonfekt‹ mit einem eigenen Kurier an den Wiener Hof schicken lassen müssen. Und wann immer sich seine Landesherrin Sissi auf ihrem Lieblingsschloss Gödöllö aufgehalten hatte, war auch der Ausnahmekonditor dorthin gepilgert, um sie höchstpersönlich mit seinen süßen Kreationen zu verwöhnen. Nicht die österreichische Kaiserin, wohlgemerkt, sondern die Königin von Ungarn.
Antals Sohn Istvan hatte dann die Idee, den Kuchentransport seines Vaters auszubauen und auf eine breite Basis zu stellen. Er hatte als Erster eine Art Mehlspeise-Versandhandel eingeführt, der sich zunächst sehr erfolgreich entwickelt und der Familie zu einigem Wohlstand verholfen hatte.
Der Erste Weltkrieg und die nachfolgenden schlechten Zeiten hatten Ferenc Godaj aber dazu gezwungen, das ambitionierte Geschäft wieder einzustellen.
In den folgenden Jahren war der traditionsreiche Name immer mehr in Vergessenheit geraten. Die kleine Konditorei in Budapest, die als Einzige von dem früheren ›süßen Imperium‹ übrig geblieben war, hatte den Godajs gerade so recht und schlecht das Überleben im Zweiten Weltkrieg und in den darauf folgenden Jahren kommunistischer Herrschaft ermöglicht.
1956 war Arpad Godaj mit seiner Frau Ildiko und der 3-jährigen Veronika über die zum Symbol für Freiheit gewordenen Brücke von Andau nach Österreich geflüchtet und hatte sich in Baden bei Wien niedergelassen.
Er hatte in einer kleinen Bäckerei Arbeit gefunden und dank seines künstlerischen Talents und handwerklichen Könnens dem Eigentümer schon nach einigen Monaten zu einem völlig unerwarteten wirtschaftlichen Aufschwung verholfen. Aus Dankbarkeit für den reichen Geldregen auf seine alten Tage hatte der kinderlose Bäcker drei Jahre später Arpad seinen Betrieb gegen eine satte, aber durchaus faire monatliche Leibrente überlassen und war nach Mallorca verzogen.
Einem neuerlichen Höhenflug der Konditorei ›Godaj‹ war somit nichts mehr im Wege gestanden. Wenn auch nur in bescheidenem Rahmen und auf die Region beschränkt.
Einige Zeit später war ein gewisser Viktor Laplan an Arpad herangetreten und hatte ihm eine überaus großzügige Summe für den Hälfteanteil an der Konditorei angeboten. Da der anscheinend über gewaltige Mittel verfügende Laplan darüber hinaus noch einen interessanten Expansionsplan vorgelegt und dem Konditor damit sozusagen die ›Unsterblichkeit‹ seines Namens garantiert hatte, hatte der letzte männliche Godaj nicht lange gezögert.
Ja, er hatte sogar zugestimmt, dass das gemeinsame Unternehmen Goday&Laplan heißen sollte. Immerhin existierte die Schreibweise des Namens mit einem y in einigen alten Unterlagen. Den dafür genannten Grund, nämlich, dass sich ›Goday‹ besser vermarkten lasse als ›Godaj‹, wie der Werbemensch Laplans behauptet hatte, hatte Arpad nie verstanden.
Aber der Erfolg bestätigte Laplans Konzept. Nach etwas mehr als einem Jahr gab es in ganz Österreich bereits 15 Konditoreien des Namens ›Goday Exklusiv‹, davon sieben alleine in Wien. 11 weitere Standorte befanden sich in verschiedenen Phasen zwischen Planung und Eröffnung. Und das Wichtigste war, die Menschen strömten in die hübschen, aber nicht zu gemütlich ausgestatteten Lokale, um sich den Wams mit all den dort angebotenen Köstlichkeiten voll zu schlagen.
Bald darauf war Viktor Laplan verstorben und sein Sohn Oskar hatte den frei gewordenen Platz in der Geschäftsleitung übernommen.
Nicht lange danach war es zwischen Oskar und Godaj zu erheblichen Auffassungsunterschieden über Produkt- und Sortimentspolitik gekommen. Arpad missfielen die immer häufiger gemachten Kompromisse, die aus Kostengründen eingegangen wurden und sich zwangsläufig auf die Qualität des Angebotes und des Services in den Lokalen auswirkten. Er litt sehr darunter, dass die Konditoreien, bisher Tempel der Patissierkunst, zunehmend zu ordinären Verkaufsstellen jeder Art von Handelswaren wurden. Er hatte zwar nichts gegen das Geldverdienen, aber so nicht. Nicht um jeden Preis.
Schließlich war das Gesprächsklima derart vergiftet, dass sich Arpad mit dem Gedanken auseinander zu setzen begann, Oskar unter Berufung auf einen entsprechenden Passus im Gesellschaftsvertrag die weitere Führung des Namens ›Goday‹ in der Firma zu verbieten. Notfalls auch gerichtlich.
Völlig unerwartet hatte er sich dann stillschweigend entschlossen, Laplan seinen Anteil zum Spottpreis von 2,2 Millionen Schilling zu verkaufen und unter Mitnahme fast des gesamten Betrages über Nacht spurlos zu verschwinden.
Einfach so und ohne seiner Frau und der inzwischen 17-jährigen Veronika nur ein Wort zu sagen.
Fritz Sterzinger schreckte aus seinen Gedanken hoch und blickte auf die Uhr. Es war kurz vor Mittag und der Zug, den er um 10.30 Uhr in Bozen bestiegen hatte, näherte sich langsam der Grenze am Brenner. In einer halben Stunde würde er Innsbruck erreichen. Sterzinger nahm sich vor, die Stunde Wartezeit auf den Anschlusszug nach Wien nicht nur für einen kleinen Imbiss zu nützen, sondern nochmals zu versuchen, diesen Herrn Palinski zu erreichen.
Warum meldete sich der Mensch nicht?
2
Die Befragung Albert Göllners durch Sandegger hatte keinerlei neue Erkenntnisse über den Tathergang gebracht. Sämtliche bisher bekannten Hinweise deuteten auf den alten Herrn als Todesschützen hin. Der blieb jedoch standhaft bei seiner ursprünglichen Version der Vorkommnisse. Er hatte im Halbschlaf Hilferufe gehört, war daraufhin zum Fenster geeilt und hatte gesehen, wie der eher kleine, stämmige Mann die junge Frau handgreiflich belästigt und sich an ihrer Bekleidung zu schaffen gemacht hatte. Daraufhin hatte er das brutale Schwein zunächst mit Zurufen und der Tonbandaufnahme mit einer Polizeisirene von seinem Opfer abbringen wollen, aber vergeblich.
Als letzte Möglichkeit hatte er schließlich nur noch die bisher immer so erfolgreiche Abgabe von Schreckschüssen, selbstverständlich nach vorheriger Warnung, gesehen.