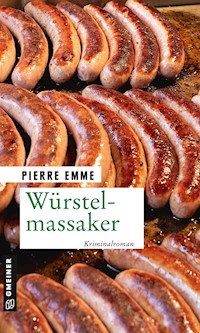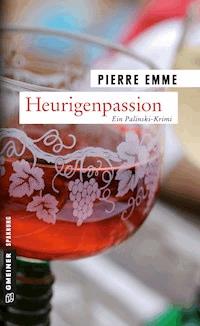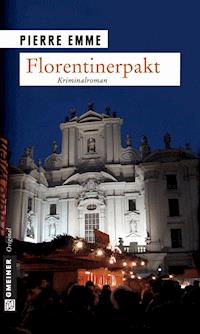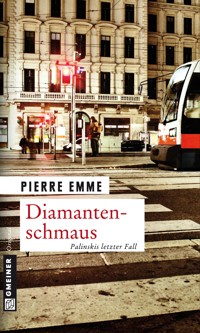Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Palinski
- Sprache: Deutsch
Singen am Hohentwiel. Zwei bizarre Morde erschüttern die Stadt. Doch auch im fernen Wien haben sie eine schockierende Wirkung: Mario Palinski muss feststellen, dass die Tötungen exakt so abgelaufen sind, wie er sie in seinem noch unveröffentlichten Kriminalroman beschrieben hat. Erschrocken über diese Entdeckung, geht er mit seinem Freund Anselm Wiegele, Hauptkommissar bei der Kripo Singen, diesem absurden Zufall auf den Grund. Dabei stolpern sie über eine für den Herbst geplante »Killer-Olympiade« in Las Vegas. Verwirrt von dieser unwirklich scheinenden Idee, geraten Palinski und Wiegele immer weiter in den Sog des Organisierten Verbrechens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Emme
Killerspiele
Palinskis fünfter Fall
Zum Buch
WENN KILLER UM MEDAILLEN KÄMPFEN Singen am Hohentwiel. Zwei bizarre Morde erschüttern die Stadt. Doch auch im fernen Wien haben sie eine schockierende Wirkung: Mario Palinski muss feststellen, dass die Tötungen exakt so abgelaufen sind, wie er sie in seinem noch unveröffentlichten Kriminalroman beschrieben hat.
Palinski, den dieses seltsame Zusammentreffen von Fiktion und Realität schockiert, geht mit seinem Freund Anselm Wiegele, Hauptkommissar bei der Kripo Singen, diesem absurden Zufall auf den Grund. Wie es scheint, wurden die schrecklichen Taten nur begangen, um sich damit zu einer im Herbst in Las Vegas stattfindenden „Killer-Olympiade“ zu qualifizieren. Verwirrt von dieser unwirklich scheinenden Idee, geraten Palinski und Wiegele bei ihren Recherchen in Wien und Singen immer weiter in den Sog des Organisierten Verbrechens …
Pierre Emme, geboren 1943, lebte bis zu seinem Tod im Juli 2008 als freier Autor bei Wien. Der promovierte Jurist konnte auf ein abwechslungsreiches Berufsleben zurückblicken und damit aus einem aus den unterschiedlichsten Quellen gespeisten Fundus an Erfahrungen und Erlebnissen schöpfen. Im Februar 2005 erschien mit »Pastetenlust« der erste Band seiner erfolgreichen Krimiserie um Mario Palinski, den Wiener Kult-Kriminologen mit der Vorliebe für kulinarische Genüsse.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Zwanzig/11 (2011)
Diamantenschmaus (2010)
Pizza Letale (2010)
Pasta Mortale (2009)
Schneenockerleklat (2009)
Florentinerpakt (2008)
Ballsaison (2008)
Tortenkomplott (2007)
Würstelmassaker (2006)
Heurigenpassion (2006)
Schnitzelfarce (2005)
Pastetenlust (2005)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
6. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von Georg Mladek
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-3302-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Vorwort
Der literarische Kriminologe Mario Palinski, ein eher bodenständiger Typ, hat seine bisherige Tätigkeit im Dienste der Wahrheit und Gerechtigkeit ausschließlich auf seine Heimatstadt Wien beschränkt.
In dem vorliegenden Roman ›Killerspiele‹ zieht es ihn allerdings hinaus in die Welt. Nicht in weit entfernte, exotische Regionen unseres Planeten, nein. Neben Wien geht es diesmal auch nach Deutschland und Italien. Damit wird er nicht gerade zum ›Jetsetter‹, aber immerhin, ›Palinski goes international‹.
Rasch lernt er, dass nichts so ist, wie es zu sein scheint und alles schwieriger ist, als man zunächst glaubt. Vor allem aber, dass es schließlich keine Sieger gibt, sondern nur kleinere und größere Verlierer.
Auf jeden Fall ist Palinskis Welt nach ›Killerspiele‹ nicht mehr dieselbe wie zuvor. Ja, selbst der Titel passt nicht ins bisherige Schema: weit und breit nichts zu essen oder zu trinken.
Ich hoffe, Sie werden den etwas anderen Palinski auch mögen. Falls nicht, kann ich Sie trösten: Der ›alte‹, rein wienerische Mario kommt auch wieder. Demnächst.
Pierre Emme, Wien, Januar 2007
P.S.: Wenn Sie jetzt zu lesen beginnen, werden Sie bitte nicht ungeduldig. Der Name Palinski fällt erst gegen Ende des zweiten Kapitels. Und in Erscheinung tritt Mario erst am Anfang des dritten Kapitels. Dafür aber, na, ich will noch nicht zu viel verraten.
Wie alles begann
Wo die Liebe eben so hinfällt. Mario Palinskis Tochter Tina hatte sich in Guido Bittner, einen Assistenten am Publizistikinstitut der Universität Wien, verliebt. Guidos Vater, Dr. Ernst Bittner, war Rechtsanwalt in der schönen Stadt Singen im Hegau. Jener traumhaft schönen Gegend am westlichsten Zipfel des Bodensees.
Da es den beiden Liebenden ernst zu sein schien, wollten auch die zukünftigen Schwiegerleute einander kennenlernen. Aus diesem Grunde folgten der Kriminologe Mario Palinski und die Seinen im September letzten Jahres der Einladung der Bittners.
*
Als Frühaufsteher nutzte der Vater der zukünftigen Braut den Morgen, um das zauberhafte Umland Singens näher zu erkunden. Bei der Gelegenheit wurde er allerdings unfreiwillig Zeuge einer schrecklichen Bluttat. Er musste beobachten, wie eine junge Frau, Rosie Apfaltinger1, wie sich später herausstellte, auf einer Wiese im Umland Singens von einem Mann im Streit erschlagen wurde.
Als Palinski der Frau zu Hilfe eilen wollte, flüchtete der Täter in einen nahe gelegenen Heuschober. Während er sich vergeblich um die leblose Frau kümmerte, war das wütende Bellen eines Hundes an Palinskis Ohr gedrungen, das kurz darauf in ein klägliches Jaulen gemündet und dann gänzlich verstummt war.
Das Verhältnis Palinskis zu der am Tatort erschienenen und unter der Leitung von Hauptkommissar Anselm Wiegele stehenden Singener Polizei stand zunächst unter schlechten Vorzeichen. Der geschwätzige Wiener und der leicht introvertierte, mit seinem Schicksal hadernde Kommissar waren einfach zu unterschiedliche Persönlichkeiten, um sich auf Anhieb zu verstehen.
Die größte Überraschung stand den beiden so verschiedenen Kriminalisten aber noch bevor. Als die Polizei endlich den Heuschober gestürmt hatte, um den Täter zu verhaften, entdeckten sie nicht einen, sondern zwei junge Männer, die Cousins Joachim und Hans Peter Windscheid, durch Adoption sogar Brüder.
Beide fast gleichaltrig, gleich groß, ähnlich aussehend und auch gekleidet machten es Palinski, der den Täter ja nur aus einiger Entfernung und gegen die Sonne gesehen hatte, unmöglich, den Täter eindeutig zu identifizieren. Da sich auch sonst keinerlei Hinweise auf die Täterschaft des einen oder anderen Bruders finden ließen, drohten die Ermittlungen ergebnislos in einer Sackgasse zu enden. Mit dem vorhersehbaren Resultat, dass Hauptkommissar Wiegele demnächst einen Schuldigen laufen lassen musste, weil er einen Unschuldigen eben nur eine bestimmte Zeit festhalten durfte. Eine zwar völlig richtige, im Sinne der Gerechtigkeit aber doch äußerst unbefriedigende Entscheidung.
*
Als Tierfreund und engagierter Hundeliebhaber hatte Palinski den Tatort aber nicht verlassen wollen, ohne sich nicht auch um den Hund zu kümmern, dessen schmerzliches Gejaule er noch im Ohr hatte. Er hatte das Tier, einen kleinen Schäferhundmischling, den er Moritz nannte, vom Tierarzt untersuchen lassen. Dieser musste feststellen, dass das arme Viech mehrmals getreten worden war.
Alles das fiel Palinski erst wieder ein, als Hauptkommissar Wiegele mit seiner Weisheit am Ende war. Wenn der Hund getreten worden war, dann konnte er eigentlich nur vom Mörder getreten worden sein. Hunde neigten nun einmal dazu, ihr Territorium gegen Eindringlinge zu verteidigen. und nichts anderes hatte Moritz auch getan. Da war sich Palinski völlig sicher.
Hauptkommissar Wiegele übernahm diese Theorie nur zu gerne. Warum auch nicht, schließlich hatte er nichts Besseres. Die folgende Gegenüberstellung zwischen den beiden Brüdern und dem Hund führte denn auch zu einem eindeutigen Ergebnis. Während Moritz Hans Peter die Hand ableckte und sich von ihm kraulen ließ, stellten sich ihm beim Anblick Joachims die Haare auf, er knurrte böse und fletschte die Zähne.
Als dann noch bekannt wurde, dass Joachim eine krankhafte Angst vor Hunden hatte, stand für die beiden Kriminalisten fest, dass es nur dieser Windscheid-Bruder gewesen sein konnte, der beim Betreten des Heuschobers den Hund getreten hatte. Und daher auch der Mörder von Rosie gewesen sein musste.
*
Beim abschließenden Zuprosten mit zahlreichen Viertele Weißherbst, mit denen der erfolgreiche Abschluss des ersten gemeinsamen Falles des Wiener Kriminologen und des Singener Hauptkommissars gefeiert worden war, war aus den höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten rasch ein Herz und eine Seele geworden.
Ein Herz und eine Seele, das war vielleicht doch ein wenig übertrieben. Auf jeden Fall war es aber, wie hieß es so schön, der Beginn einer wunderbaren Männerfreundschaft.
1 ›Der Fall Rosie‹ , Pierre Emme, Anthologie ›Grenzfälle‹, Gmeiner Verlag 2005
1
Mittwoch, 23. Oktober
Vorsichtig holten die beiden vermummten Männer eine Eisplatte im Format von 50 x 30 x 4 Zentimetern und zwei entsprechend starke, etwa 60 Zentimeter hohe Stützen aus demselben Material aus den wie große Musterkoffer wirkenden, mit Trockeneis gefüllten Spezialbehältern. Unter den wachsamen Augen eines dritten Mannes, der wie ein Marathonläufer eine Startnummer am Rücken seines maßgeschneiderten Sakkos trug, fügten sie die drei Teile zu einer Art klobigen Tischchens zusammen. Das ungewöhnliche Möbel sollte eine temporäre Stabilität durch zweimal vier dünne Zapfen, ebenfalls aus Eis, erhalten, die die Platte durch speziell eingefräste Löcher mit den Stützen verbanden.
Nachdem das Eistischchen exakt unter der von einem stabilen Haken an der Decke baumelnden, aus einer kräftigen sieben Millimeter starken Rebschnur geknüpften Schlinge stand, zeigte sich der Mann mit der Nummer 8 zufrieden. Auf seinen hoch gehaltenen Daumen hin bauten seine beiden Helfer links und rechts von dem bereits langsam zu tauen beginnenden Werk aus Wasser und tiefen Temperaturen je eine Stehleiter auf. Dann verließen sie den Ort, um kurz danach mit einem offenbar unter Drogen stehenden, völlig orientierungslos wirkenden älteren Mann zurückzukommen. Die beiden schleiften ihr taumelndes Opfer unter den Strang. Dann hoben sie den oberhalb des Beckens steif wie ein Brett wirkenden Körper hoch, legten dem Mann die Schlinge um den Hals und stellten die Füße vorsichtig auf die Platte des Eistischchens.
Da der gesamte Vorgang akkurat geplant worden war, berührten die in Hausschuhen steckenden Füße des fingierten Selbstmörders die Platte gerade so viel, dass sich die Schlinge nicht zuzog.
Das würde sie, wie Versuche gezeigt hatten, frühestens in drei Stunden tun. Sobald die Stützen des Tischchens so weit abgetaut waren, dass sie unter dem darauf lastenden Gewicht des Opfers nachgaben und der herunterfallende Körper das Seil straffen würde.
Bis dahin würden die Beteiligten an diesem bedauernswerten ›Selbstmord‹ den Ort des grauenhaften Geschehens aber schon längst verlassen und sich für den Todeszeitpunkt ein hieb- und stichfestes Alibi besorgt haben.
Die verbleibenden Eisteile würden sich nach weiteren vier Stunden völlig aufgelöst und im Abfluss der Duschwanne verloren haben. Und nur eine Stunde später würden nicht einmal mehr nasse Flecken von der Tragödie zeugen.
Jetzt fehlte nur noch eines, um den ›Selbstmord‹ wirklich glaubhaft erscheinen und den perfekten Mord damit Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Hocker oder etwas in der Art, auf den oder das der verwirrte Mann gestiegen sein musste, um sich die Schlinge um den Hals legen zu können. Ein Behelf, den er danach in selbstzerstörerischer Absicht umgestoßen hatte.
Das Anbringen dieses letzten Tüpfelchens auf dem i wollte sich Nummer 8 nicht nehmen lassen. Er hatte in der Diele einen wunderschön gearbeiteten Schirmständer aus massivem Holz gesehen. Wenn man den umdrehte, konnte man auf seiner Grundfläche durchaus stehen.
Der Mann mit der Nummer 8 auf dem Rücken verschwand und kam gleich darauf mit dem Schirmständer zurück. Ehe er ihn neben dem bereits schmelzenden, aber noch überaus stabilen Eistischchen so platzierte, dass es wie umgestoßen wirken musste, wischte er ihn noch gründlich mit dem Taschentuch ab. Sicher ist sicher, dachte er. Seine Fingerabdrücke waren wirklich das Letzte, was er auf der glatten Holzfläche zurücklassen wollte.
Aber jetzt war wirklich alles perfekt. Sichtlich zufrieden mit sich und seiner Arbeit blickte er sich um.
Dann wurde es plötzlich dunkel, und der Film war zu Ende.
Während das Licht im Saal wieder anging, begleitete höflicher Applaus die monotone Lautsprecherdurchsage »Das war der Beitrag von Startnummer 8, Jean Louis Bappier jun., genannt ›The Iceman‹ von der ADM Paris in der Kategorie ›Morde als Selbstmord getarnt‹. Bitte Ihre Wertungen. Die erste Note ist für die Idee.«
»Der Pariser Filiale der Todesagentur fällt auch nicht mehr allzu viel ein«, murrte eines der sieben Jurymitglieder, Thor Federgaard, ein weißhaariger älterer Herr, und hielt eine ›4‹ in die Höhe. »Wenn der Junior glaubt, es genüge, der Sohn eines prominenten Vaters zu sein, dann hat er sich getäuscht.«
»Na, ich finde, die Sache mit dem Eis ist doch eine immer wieder höchst amüsante Art, die Bullen zu verarschen«, hielt die neben ihm sitzende Rothaarige vom Typ Powerlady dagegen. »Nicht mehr ganz originell, aber immer noch hübsch und wirkungsvoll.« Ihrer Meinung nach war der Beitrag mindestens eine ›2‹ wert.
»Kein Wunder«, murmelte ein dritter Juror, der 29-jährige John Manitory. »Wo doch jeder Affe weiß, dass diese Schlampe Anita Brandner auch heute immer noch die Kissen mit dem Eismann zerwühlt. Eigentlich müsste sie wegen Befangenheit aus der Jury geschmissen werden.«
Auch er hatte nur eine ›4‹ für das seiner Meinung nach lediglich aufgewärmte Konzept übrig. Andererseits musste er zugeben, dass es immer schwieriger wurde, etwas wirklich Originelles auf die Beine zu stellen. Dieser Gedanke stimmte Manitory milde und er korrigierte sein Urteil auf eine ›3‹.
Die Bewertung für das nächste Kriterium, die Ausführung, fiel mit einem Mittelwert von 2,71 deutlich besser aus als der vorangegangene von 3,43 für die Idee.
Die dritte und abschließende Beurteilung galt der Effizienz. Auf ausdrückliche Befragung durch zwei Juroren bestätigte ein Sprecher des Organisationskomitees nochmals, dass der Leichnam des Erhängten vor zwei Tagen gefunden worden war. Seitens der Polizei gebe es keinen Zweifel daran, dass es sich bei der Tat um Selbstmord gehandelt habe, auch wenn bisher noch kein Abschiedsbrief gefunden worden war.
Die ausgezeichnete Note 1,85 für dieses Kriterium sorgte für eine sehr passable Gesamtwertung von 2,66 für Jean Louis Bappier jun. und brachte ihm den guten zweiten Platz in der Zwischenwertung.
»Nächster Starter ist die Nummer 11, Giuseppe de Luisini, Neapel«, kündigte die Stimme aus dem Lautsprecher an. Im Saal wurde es wieder dunkel und auf der Leinwand erschien das Heck eines bronzemetallicfarbenen Bentley-Cabrios, das auf einer kurvigen Bergstraße zu Tale fuhr.
*
Seit einigen Tagen verspürte Hauptkommissar Anselm Wiegele von der Kripo Singen ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Zunächst hatte er absolut nicht sagen können, welche Ursachen dieses zunehmend stärker werdende Unbehagen hatte. Gestern war es ihm aber endlich gelungen, dem Unbewussten ein Gesicht zu geben und es aus der Dunkelheit zu holen. Eigentlich war es aber so gewesen, dass sich sein kriminalistischer Instinkt umgesehen und gefunden hatte, wonach er suchte.
Ja, es war tatsächlich ein Gesicht gewesen, das Wiegele auf die Spur gebracht, seinen Instinkt bestätigt hatte. Kein schönes Gesicht, nein, vielmehr eine Verbrechervisage.
Zu der dem Hauptkommissar jetzt aber noch ein Name fehlte.
Er hatte den Kerl im Supermarkt registriert, als er sich gerade mit einem voll bepackten Einkaufswagen an den Regalen vorbei zu den Kassen pirschte. Der Kerl, nicht Wiegele.
Dieses Gesicht hatte er schon einmal gesehen, war sich der Hauptkommissar sicher. Zwar mit längeren Haaren und einem Oberlippenbart, aber die quer über die Wange gehende Narbe war unverkennbar. Kein Schmiss, wie sie mancher Student sein Leben lang mit sich herumtrug, sondern eindeutig das Ergebnis einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der mindestens ein Messer im Spiel gewesen war.
Und diese Narbe war ausdrücklich als besonderes Kennzeichen auf einem Steckbrief vermerkt gewesen, war sich Wiegele sicher.
Natürlich hätte es durchaus auch sein können, dass es sich bei dem Narbengesicht um einen inzwischen längst rehabilitierten ehemaligen Gesetzesbrecher handelte, der nur den Wochenbedarf an Lebensmitteln für seine Familie besorgte. Aber wo sollte diese Familie zu Hause sein? Sicher nicht in Singen. Natürlich kannte der Hauptkommissar nur einen Bruchteil der rund 45.000 Bewohner dieser Stadt, aber diesen Kerl hätte er sicher schon früher bemerkt.
Und gegen die grundsätzlich plausible Annahme, dass es sich um Touristen in einem der vielen Ferienhäuser im schönen Hegau handeln könnte, sprach die Jahreszeit. Ende Oktober war ganz einfach keine Saison mehr für Urlauber in diesem Teil des Landes.
So hatte sich Wiegele in eine stille Ecke des Supermarktes zurückgezogen und einen seiner Mitarbeiter beauftragt, das ›Narbengesicht‹ nach Verlassen des Konsumtempels unauffällig zu beobachten. Leider hatte das nicht geklappt, denn der Kollege war etwas zu spät gekommen. Oder der zu Observierende eben zu früh gegangen.
Nachdem ihm dieses eine Gesicht aber erst einmal aufgefallen war, war es nicht schwer gewesen, plötzlich auch die anderen in der Menge zu erkennen. Nicht, dass sie alle mit deutlich sichtbaren, besonderen Merkmalen verziert herumgelaufen wären. Das nicht, aber für einen Experten wie Wiegele waren die bösen Fratzen hinter den scheinbar harmlosen Fassaden dieser Männer unübersehbar. Sie hatten alle eines gemeinsam. Sie gehörten nach Stammheim, nach Pöschwies, nach Stein an der Donau, meinetwegen auch nach Sing Sing oder auf die Teufelsinsel, aber sicher nicht hierher in das friedliche Singen.
Alleine heute war ihm im Stadtbild ein gutes halbes Dutzend dieser ›Gentlemen‹ aufgefallen, deren Familien mit Sicherheit sehr groß waren und die ihren Sitz in Korsika, Neapel oder Palermo hatten. Fast sah es so aus, als ob die ehrenwerte Gesellschaft hier im Hegau einen Kongress abhalten würde, dachte Wiegele in einem seiner seltenen Anflüge von Ironie. Aber wo sollten sie ihr Nest hier in der Gegend haben, verdammt noch mal?
Er beschloss, seine wachsenden Bedenken offiziell zu machen und das LKA in Stuttgart zu kontaktieren. Vielleicht wussten die ja etwas, was man in bewährter Manier nur wieder einmal vergessen hatte, an die niedrigeren Ränge weiterzugeben. Unabhängig davon würde er aber auch seine eigenen Recherchen über die engeren Grenzen der Stadt hinaus ausweiten.
Mal sehen, was es da zu sehen gab.
*
Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg war in einem großen Gebäudekomplex in der Stuttgarter Taubenheimstraße beheimatet. Das Amt war in sieben Abteilungen und zwei Referaten organisiert.
Hauptkommissar Wiegeles Anfrage wegen des ›Narbengesichts‹ war zunächst einmal an seine zuständige Polizeidirektion in Konstanz und damit den offiziellen, aber langsamen Weg gegangen. Auf dieser Schiene würde er kaum vor einer Woche Antwort erhalten. Das hatte nicht nur mit Bürokratie zu tun und damit, dass Dinge nun einmal ihre Zeit brauchten. Nein, das lag vor allem auch in seiner Person begründet.
Als Anselm Wiegele vor knapp vier Jahren seine Ernennung erhalten hatte, war er der jüngste Hauptkommissar des Landes gewesen. Ja, sogar der ganzen Bundesrepublik, wie einige behauptet hatten. Einer kometenhaften Karriere, die ihn überall hinführen konnte, wie ihm der offenbar mit seherischen Fähigkeiten ausgestattete Polizeipräsident vorhergesagt hatte, stand angeblich nichts im Wege.
Außer vielleicht der Umstand, dass er sich einige Wochen später in eine Frau verliebte, die ausgerechnet mit dem Neffen seines obersten Chefs, des Polizeipräsidenten, verheiratet war. Jenem hatte das verständlicherweise gar nicht gefallen und er hatte bei seinem Onkel durchgesetzt, dass der lästige Nebenbuhler von heute auf morgen aus Stuttgart verschwand.
So kam es, dass die Kriminalpolizei in Singen quasi über Nacht hochkarätige Verstärkung erhielt: Hauptkommissar Anselm Wiegele.
Dem hatte das zunächst ebenso wenig gepasst wie den Kollegen auf der neuen Dienststelle, was er auch lautstark und in einer der Dienstvorschrift krass widersprechenden Form kundtat.
Die Beibehaltung seines Ranges und gewisser damit verbundener Privilegien verdankte Wiegele dem Umstand, dass keiner der Beteiligten ein Interesse daran hatte, die näheren Umstände dieses Karrieresprungs ausführlich behandelt in den Medien wiederzufinden.
Die Folge dieses Kompromisses war dann, dass im Polizeirevier Singen ein waschechter Hauptkommissar seinen Dienst versah, kleine Ladendiebstähle aufklärte, Wirtshausraufereien mit leichten Körperverletzungen protokollierte und einmal sogar einen dilettantisch geplanten Überfall auf die Kreissparkasse verhinderte. Im Übrigen aber auf ein Verbrechen wartete, das seinen kriminalistischen Fähigkeiten entsprach.
Nach fast drei Jahren, in denen seine Lebensqualität zwar enorm gestiegen, die beruflichen Herausforderungen aber nach wie vor bei Null lagen, konnte der Hauptkommissar seine Qualitäten dann endlich beim Mordfall ›Rosie Apfaltinger‹ und der gleichzeitigen Klärung einer schon länger zurückliegenden Vergewaltigung unter Beweis stellen.
Wobei er das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte, als er eine ursprünglich fatale Fehleinschätzung hinsichtlich des Täters gerade noch rechtzeitig vor Anklageerhebung hatte korrigieren können.
Dass diese ganz besonderen Umstände und die speziellen Freiheiten Wiegeles einigen Verantwortlichen in der zuständigen Polizeidirektion in Konstanz gar nicht gefielen, lag auf der Hand.
Wiegele wusste das natürlich und hatte seine Anfrage daher zunächst inoffiziell und direkt an seinen Kontakt im LKA gehen lassen. Die Antwort der Abteilung 5, die sich mit der ›organisierten Kriminalität‹ befasste, hatte er bereits in den Händen, ehe Konstanz überhaupt einen Finger in dieser Sache gerührt hatte. So erfuhr er, dass ›Narbengesicht‹ eigentlich Gianfranco Fiuminese hieß, genannt der ›Schmierer‹. Angeblich, weil seine ›Handschrift‹ als vermeintlicher Mafiakiller so unleserlich war, dass man ihm bisher keine der diesem Dunstkreis zugeschriebenen Gewaltverbrechen persönlich hatte zuordnen können. Er war lediglich einmal wegen Körperverletzung in Folge eines Raufhandels gesucht worden. Die Sache war aber längst erledigt und offiziell aus den Akten gelöscht. Fiuminese war ein unbescholtener EU-Bürger und konnte einkaufen, was, wo und soviel er wollte.
Das war wohl auch der Grund dafür, warum sich der Kerl mit dem unverkennbaren Merkmal so ungeniert in der Öffentlichkeit zeigte, dachte Wiegele. Aber dass derzeit nichts gegen den Mann vorlag, hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Denn Gianfranco war Soldat der berüchtigten Camorrafamilie De Vasino aus Neapel. Wenn so ein Mann in Singen war, dann sicher nicht nur, um sich den Hohentwiel im Spätherbst anzusehen.
Das polyphone Zirpen seines Mobiltelefons riss Wiegele aus seinen Gedanken. Bei dem Anrufer handelte es sich um seinen Mitarbeiter Just Vondermatten aus dem deutschen Zweig dieser alten Schweizer Familie. Der junge Kriminalpolizist war ganz aufgeregt.
»Ich bin sicher, ich habe eben diesen Mann mit der Narbe gesehen«, sprudelte es förmlich aus seinem Mund. »Den, den ich gestern knapp verpasst habe. Er hat gerade einen grünen BMW beim Bahnhof abgestellt und ist in ein Café gegangen. Soll ich ihn beobachten?«
Der Hauptkommissar konnte die Erregung, die seinen ehrgeizigen Kollegen ergriffen hatte, förmlich spüren. »Gut«, meinte er nach einigen Sekunden des Zögerns, »behalte ihn im Auge. Aber sei vorsichtig und mache ja keine Alleingänge. Der Mann ist wahrscheinlich sehr gefährlich.« Er räusperte sich. »Also nur aus sicherer Distanz beobachten. Und vor allem, melde dich regelmäßig.«
*
Dr. Ernst Bittner war einer der, nein, der führende Anwalt Singens. Der elegante Endfünfziger war einige Tage auf einem Juristenkongress in Kiel gewesen. Gestern hatte ihn die Nachricht vom Selbstmord seines alten Freundes und Klienten Konsul Walter Webernitz erreicht. Daraufhin hatte er seinen Aufenthalt sofort abgebrochen und war nach Hause zurückgekehrt.
Jetzt saß er vor seinem Schreibtisch in seiner geliebten Kanzlei und dachte über das Leben nach. Nicht über sein eigenes, sondern über das Leben schlechthin. Und darüber, warum ein erfolgreicher, für sein Alter ausgesprochen gesunder, rüstiger Mittsechziger sich plötzlich in seinem Badezimmer erhängte.
Lustlos ging Bittner die in seiner Abwesenheit eingegangene Post durch, überflog die Briefe flüchtig und ohne ihren Inhalt richtig zu erfassen. Er war wirklich nicht in der Verfassung, sich ernsthaft mit den vor ihm liegenden, zu Papier erstarrten Problemen und Ideen adäquat auseinander zu setzen. Er wollte die dicke Mappe schon wieder schließen und zur Seite schieben, um sich seinen Gedanken hingeben zu können, als sein Blick auf eine ihm gut bekannte, ja vertraute Unterschrift fiel.
Kein Wunder, dass Bittners Blutdruck plötzlich hochging wie der Drehzahlmesser eines Porsches bei Vollgas. Immerhin stammte das Schreiben von niemand anderem als Walter Webernitz.
Sorgfältig studierte der Anwalt die beiden dicht beschriebenen DIN-A-4-Seiten, las den Brief noch ein zweites Mal durch. Dann griff er entschlossen zum Telefon und wählte die Nummer der örtlichen Kriminalpolizei.
*
Der Kriminalbeamte Just Vondermatten verfolgte den grünen BMW mit dem Narbengesicht und zwei weiteren Männern an Bord jetzt bereits fast zwei Stunden kreuz und quer durch Baden-Württemberg. Zunächst hatte es ausgesehen, als ob die schwere Limousine aus der bayrischen Fahrzeugschmiede nach Beuren am Ried wollte. Plötzlich aber hatte der Fahrer seine Pläne geändert und eine Rundfahrt durch den halben Hegau gestartet, um sich dann unvermutet in Richtung Schwarzwald abzusetzen.
Vondermatten hatte sich zwischendurch routinemäßig mit Wiegele in Verbindung gesetzt und ihm von den bisherigen Vorkommnissen oder besser, Nichtvorkommnissen berichtet.
Dabei hatte ihn der Hauptkommissar gefragt, ob er sicher sei, von dem Verfolgten nicht bereits entdeckt worden zu sein.
Just, ein gleichermaßen ehrgeiziger wie noch unerfahrener junger Beamter, hatte auf diese ihm fast ehrenrührig erscheinende Unterstellung seines Chefs mit allem Respekt, aber heftig protestiert. Das hätte er, der sich immer gerade noch in Sichtweite des verfolgten Fahrzeugs bewegte, doch bemerken müssen, hatte er lauthals argumentiert. Und zunächst auch gar nicht erkannt, wie unsinnig dieses von Wunschdenken geprägte Argument eigentlich war.
Wiegele, der die Situation aus der Distanz wesentlich realistischer eingeschätzt hatte als sein junger Kollege, stand vor einem Problem: Sollte er den ambitionierten Kollegen, dessen Aktion dem Verfolgten offensichtlich nicht entgangen war – welchen anderen Grund sollte es sonst für das plötzlich so eigenartige Verhalten geben? Oder sollte er ihm die Gelegenheit lassen, seine eigenen Erfahrungen zu machen, eigene Schlüsse aus dieser verunglückten Observierung zu ziehen und sich unter größtmöglicher Schonung des ungestümen Egos aus der Sache wieder zurückzuziehen?
Akute Gefahr für Vondermatten schien ja keine zu bestehen, und so hatte Wiegele dem Kollegen weiter freie Hand gelassen. »Aber keine Extratouren, und du meldest dich jede Stunde bei mir. Ist das klar, Just?«
Natürlich war das Vondermatten klar gewesen. Dennoch war seine routinemäßige Meldung bereits seit 10 Minuten überfällig, als das Telefon läutete und Rechtsanwalt Dr. Bittner dringend den Hauptkommissar sprechen wollte.
Die Information, die Bittner für die Polizei hatte, war so brisant, dass sich der Kriminalist sofort auf den Weg zur Anwaltskanzlei machte und die zaghaft aufkeimende Sorge um Just Vondermatten vorerst aus seinem Bewusstsein verdrängte.
*
Obwohl Wiegele bereits fast vier Jahre in Singen war, hatte er Dr. Bittner erst letzten September im Zuge der traurigen Ereignisse um Rosie Apfaltinger persönlich kennengelernt. Dabei hatte sich zu seiner größten Überraschung herausgestellt, dass Marianne Kogler, seine große Liebe und der Grund für seine Versetzung nach Singen, eine geborene Bittner war. Kein Wunder: War sie doch die älteste Tochter des Mannes, dem er eben gegenüber saß.
Seit diesem zufälligen Treffen vor einem Jahr hatten die beiden ihre Beziehung nicht nur wieder aufgenommen, sondern zu einer neuen, alles überstrahlenden Liebe entwickelt.
Davon sollte aber im Augenblick noch niemand etwas wissen. Mariannes Scheidung würde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dann aber wollten sich beide offen zu ihren Gefühlen bekennen und den weiteren Weg gemeinsam gehen.
Wiegele saß also, wenn man so wollte, seinem zukünftigen oder zumindest potenziellen Schwiegervater gegenüber. Der ihm ein Schreiben des scheinbaren Selbstmörders Webernitz zeigte. In diesem sehr amikal gehaltenen Brief hatte der wohlhabende und äußerst rüstige Rentner seine Absicht geäußert, sich im Mai nochmals verehelichen zu wollen und den Anwalt gebeten, einen entsprechenden Ehevertrag zu entwerfen.
»Ich habe mir schon bisher beim besten Willen nicht vorstellen können, dass sich ein so vitaler, lebensfroher Mensch wie Walter selbst das Leben genommen haben soll«, versicherte Bittner und hüstelte leicht. »Aber dieses Schreiben hat meine letzten Zweifel zerstreut. Man schreibt doch nicht so einen Brief und bringt sich wenige Stunden später um«, argumentierte der Anwalt. »Das ist doch ein eindeutiger Beweis dafür, dass sich Webernitz nicht selbst getötet hat. Hchn, hchn …« Er hüstelte neuerlich leicht. »Entschuldigen Sie, eine lästige Verkühlung. Ich werde sie nicht los dieses Jahr.«
Ein eindeutiger Beweis war der Brief zwar nicht, dachte Wiegele, aber zumindest ein handfestes Indiz für die Richtigkeit von Bittners Schlussfolgerung.
»Na, dann werden wir uns die ganze Angelegenheit noch einmal genau ansehen«, versicherte der Hauptkommissar. »Haben Sie eine Idee, mit wem Ihr ehemaliger Klient den Bund fürs Leben riskieren wollte?«
»Leider nein, keine Ahnung. Hchn, hchn.« Bittners komischer Husten ging Wiegele langsam auf die Nerven. So verabschiedete er sich rasch mit dem Versprechen, Bittner über die aktuellen Erkenntnisse auf dem Laufenden zu halten und verließ die Kanzlei mit Webernitz’ Brief in der Tasche.
*
Konsul Walter Webernitz hatte wahrlich nicht schlecht gewohnt. Angesichts der großen im Landhausstil erbauten Villa am Stadtrand von Singen war aber eher der Ausdruck ›residieren‹ angebracht, dachte sich Wiegele, als er seinen Wagen vor dem Haupteingang parkte.
Der Verstorbene, der das nicht unbeträchtliche Erbe seines Vaters durch geschickte Spekulationen zu einem zweistelligen Euro-Millionenvermögen vermehrt hatte, war ein echter Eigenbrötler gewesen. Er hatte sich bereits im Alter von 45 Jahren aus dem aktiven Erwerbsleben als Vorstandsdirektor einer großen internationalen Versicherungsgesellschaft zurückgezogen und sich nur mehr seinen Hobbys und der Börse gewidmet.
Der praktizierende Frauenliebhaber hatte bereits mit 22 ein erstes Mal geheiratet und sich knapp drei Jahre später schon wieder scheiden lassen. Seither hatten jede Menge mehr oder weniger schöne Frauen sein Bett und seine manchmal etwas ausgefallenen Neigungen geteilt. Keine hatte es aber geschafft, die zweite Frau Webernitz zu werden.
Umso neugieriger waren daher Dr. Bittner und damit auch Anselm Wiegele, wem dieser große Wurf fast doch noch gelungen wäre.
Mit Ausnahme der Haushälterin, einer Francesca Doppoli, 41 Jahre alt und in Tarent geboren, und Bertram Lütterbrin, einem 34-jährigen Deutschschweizer, der als Fahrer und Gärtner für den Honorarkonsul von Sao Timero beschäftigt gewesen war, hatte Webernitz alleine in dem riesigen Anwesen gewohnt.
Zu dem vom Gerichtsmediziner ermittelten Zeitpunkt seines Todes war die Haushälterin bereits seit zwei Wochen im Italienurlaub. Lütterbrin dagegen hatte in Chur im Kantonsspital gelegen und sich von einer drei Tage zuvor durchgeführten Leistenoperation erholt.
Der Postbote hatte Webernitz am Morgen seines Todestages noch zwei Briefe und ein Päckchen geliefert. Auf Befragen hatte er ausgesagt, dass ihm am Verhalten des Herrn Konsul nichts Besonderes aufgefallen sei. Er sei so freundlich gewesen wie immer und habe ihm sogar einen Witz erzählt.
Wiegele legte das Protokoll der beiden Beamten der Schutzpolizei, die den Toten zwei Tage später gefunden hatten, wieder zur Seite und suchte das Badezimmer auf, den möglichen Tatort.
Dank der Absenz dienstbarer Geister war hier bis auf den Leichnam alles so geblieben, wie es die Polizei vorgefunden hatte. Selbst der umgestürzte Schirmständer, auf dem Webernitz gestanden haben musste, lag noch unverändert da, wie ein Blick auf das im Protokoll aufliegende Foto bewies.
Nachdenklich kratzte sich Wiegele an der Stirne. Auf den ersten Blick sah tatsächlich alles nach Selbstmord aus. Ohne Kenntnis des erst später aufgetauchten Briefs an Rechtsanwalt Bittner wäre er selbst auch zu keiner anderen Schlussfolgerung gelangt.
Obwohl … Obwohl was?, überlegte der Hauptkommissar.
Irgendetwas stimmte nicht auf dem Bild. Er hatte keine Ahnung, was das sein könnte, aber ein ganz bestimmtes Gefühl im Bauch sagte ihm, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Ein Gefühl, das ihn bisher nur selten getäuscht hatte.
Auf jeden Fall mussten hier die Kollegen von der Spurensicherung ans Werk. Vielleicht würden aus den Ergebnissen ihrer Arbeit Antworten auf Fragen resultieren, die er heute noch gar nicht kannte.
Wiegele holte sein Handy heraus und setzte die entsprechende Maschinerie in Gang.
*
Die Kaffeepause war zu Ende und die Jury hatte wieder Platz genommen. Jetzt standen noch Präsentation und Beurteilung einer erstmals in die Entscheidung aufgenommenen Kategorie, der ›Finanzierung‹, auf dem Programm.
Ehe die erste der drei für diesen Wettbewerb qualifizierten Dokumentationen über Raubzüge von nahezu genialer Einfachheit zu laufen begann, bat der Sprecher des Organisationskomitees um einen Augenblick Aufmerksamkeit.
»Wie wir eben erfahren haben, konnte die Observation einiger Mitglieder unserer Gruppe durch die Polizei vor etwa einer Stunde definitiv abgewehrt werden«, teilte er mit monotoner Stimme mit. »Dabei wurde eine verfeinerte Variante der Methode ›Provozierte Unfälle‹ mit, soweit wir bisher wissen, großem Erfolg angewendet. Da die spontane Aktion darüber hinaus vollständig filmisch dokumentiert worden ist, wird dieser Beitrag morgen um 11.30 Uhr außer Konkurrenz gezeigt und diskutiert werden. Wir bitten um rege Beteiligung. Und nun zur Startnummer 15, Edmond Grassinsky und sein Team mit der ›Salatschüssel‹. Technik bitte abfahren.«
Die tatsächliche Identität der als weitgehend gewaltfrei agierend bekannten Nummer 15 war natürlich ebenso eines der großen Geheimnisse der Branche wie ihr Aussehen. Manche Insider munkelten sogar, dass es sich bei dem zarten, schmächtigen ›Edmond‹ in Wirklichkeit um eine Frau handeln müsste. Aber das war, wie vieles in Verbindung mit dieser legendären Person, reine Spekulation.
Trotz der auf dem Bild herrschenden Dämmerung, immerhin hatte der Deal im April vor einigen Jahren, knapp vor 4 Uhr morgens stattgefunden, war die charakteristische Silhouette des weltberühmten Kochhistorischen Museums in Wien deutlich zu erkennen.
Nach der Totalen zoomte die gut geführte Kamera ganz nahe an das die Vorderfront bedeckende Baugerüst heran, und ›Sunny Boy Grassinsky‹, Spezialist für freche Coups, mit der Nummer 15 auf dem Rücken wurde sichtbar. Edmond hatte sogar die Chuzpe, sich während des Aufstiegs über das Gerüst in den zweiten Stock einige Male umzudrehen, das vermummte Gesicht der Kamera zuzuwenden und zu winken.
Oben angelangt, schlug er ganz einfach ein Fenster ein, stieg in den dahinterliegenden Raum ein und war nach nur zwei Minuten wieder zurück. Triumphierend hielt er ein einzigartiges, 60 Millionen Euro Versicherungswert repräsentierendes Kunstwerk in die Höhe, die weltberühmte ›Saladier‹ von Casimiro Belloni, die der Venezianer angeblich für den französischen König Henri IV angefertigt hatte.
Nach weiteren zwei Minuten saßen Edmond und seine Helfer schon wieder in ihren Fahrzeugen und verließen den Tatort.
Das Geniale an diesem Coup war, die Schwachstellen, die aus einer Reihe zu Recht unterstellter Paradebeispiele menschlichen Fehlverhaltens resultierten, richtig erkannt und konsequent ausgenutzt zu haben. So hatte man den Raub erst um 7.45 Uhr entdeckt, da der durch das Eindringen Grassinskys ausgelöste Alarm vom diensthabenden Personal nicht ernst genommen worden war. »Daher ist auch die an sich automatische Alarmierung der Polizei unterblieben«, lieferte die gesichtslose Stimme noch weitere Details zu dem prachtvollen Schlag gegen die neben dem Schaden nunmehr auch dem Spott ausgesetzten ›Schlawiener‹.
Was mit der ›Saladier‹ danach geschehen war, war Edmonds bestgehütetes Geheimnis. Nicht nur die Verantwortlichen in Wien, sondern auch einige Branchenkollegen Grassinskys vermuteten, dass er nach dem verunglückten Deal mit der Versicherung Gefahr gelaufen war, auf dem unverkäuflichen Kunstwerk sitzen zu bleiben. Andere wieder, darunter auch die Mehrzahl der hier anwesenden Spezialisten, waren sicher, dass die Startnummer 15 schon zum Zeitpunkt des frechen Raubes das verbindliche Angebot eines gleichermaßen steinreichen wie auch diskreten Kunstliebhabers vorliegen gehabt hatte. Und auch, dass es sich bei der vor kurzem durch die Medien gegangenen ›Auffindung‹ von Bellonis einzigartiger Salatschüssel tatsächlich nur um eine ungemein geschickte Inszenierung Grassinskys gehandelt hatte, die in der damaligen Situation durchaus auch im Interesse einzelner Verantwortlicher in Wien gelegen hatte. Daher hatten auch alle Beteiligten, zum größten Teil unbewusst, prompt und zuverlässig mitgewirkt.
Tosender Applaus sowie die traumhafte Gesamtwertung von 1,14 würdigten den Geniestreich und brachten den Beitrag ›Salatschüssel‹ an die Spitze der absoluten Wertung.
»Sehen Sie jetzt Startnummer 17, Martha Eschenbach und ihren Beitrag ›Sommerfest in Windsor‹«, kündigte die monotone Stimme aus dem Lautsprecher an.
*
Nachdem Wiegele die Kollegen von der Spurensicherung eingewiesen und sie gebeten hatte, ihn sofort nach Vorliegen erster Ergebnisse zu informieren, machte er sich auf den Weg zurück ins Büro. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass sich Just Vondermatten inzwischen immerhin seit mehr als drei Stunden nicht gemeldet hatte. Jetzt machte sich der Hauptkommissar ernsthaft Sorgen um den jungen Kollegen.