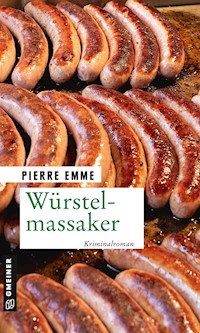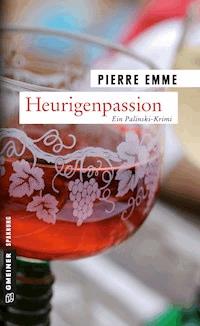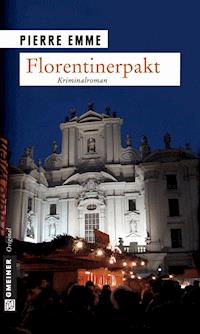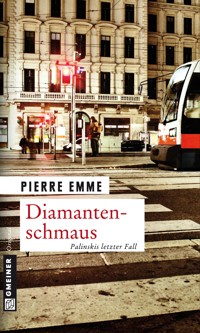Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Palinski
- Sprache: Deutsch
Noch fünf Tage, dann kann sich Mario Palinski endlich wieder etwas Ruhe gönnen. Die Organisation der in den nächsten Tagen im „Semmering Grand“ stattfindenden 50. Jahresversammlung der „Federation Européenne des Criminalistes Investigatives“ hat den Chef des Instituts für Krimiliteranalogie in den vergangenen Wochen ganz schön in Anspruch genommen. Auf der Fahrt mit dem Sonderzug von Wien zum Semmering wird ein ungarischer Journalist tot in der Zugtoilette aufgefunden. Der erste einer ganzen Reihe von Morden, wie sich schon bald herausstellen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Emme
Schneenockerleklat
Palinskis neunter Fall
Zum Buch
MORD AM SEMMERING Noch fünf Tage, dann kann sich Mario Palinski endlich wieder etwas Ruhe gönnen. Die Organisation der in den nächsten Tagen im »Semmering Grand« stattfindenden 50. Jahresversammlung der »Federation Européenne des Criminalistes Investigatives« hat den Chef des Instituts für Krimiliteranalogie in den vergangenen Wochen ganz schön in Anspruch genommen. Auf der Fahrt mit dem Sonderzug von Wien zum Semmering wird ein ungarischer Journalist tot in der Zugtoilette aufgefunden. Der erste einer ganzen Reihe von Morden, wie sich schon bald herausstellen wird.
Pierre Emme, geboren 1943, lebte bis zu seinem Tod im Juli 2008 als freier Autor bei Wien. Der promovierte Jurist konnte auf ein abwechslungsreiches Berufsleben zurückblicken und damit aus einem aus den unterschiedlichsten Quellen gespeisten Fundus an Erfahrungen und Erlebnissen schöpfen. Im Februar 2005 erschien mit „Pastetenlust« der erste Band seiner erfolgreichen Krimiserie um Mario Palinski, den Wiener Kult-Kriminologen mit der Vorliebe für kulinarische Genüsse.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Hotel »Panhans«
ISBN 978-3-8392-3006-0
Im Dezember davor
Es war an einem kalten Nachmittag im Dezember und bereits etwas dämmrig gewesen. Seit Mittag hatte es stark geschneit, übrigens das erste Mal in diesem Winter, und die Hoffnungen auf weiße Weihnachten bekamen neue Nahrung.
Die Stadt und ihre Bewohner hatten langsam die dadurch bedingten Verkehrsbehinderungen vergessen und an der alle zivilisatorischen Hässlichkeiten verbergenden Schneepracht Gefallen gefunden.
Alles war plötzlich unter einer sauberen, fast steril wirkenden weißen Decke verschwunden, die Abläufe waren gemächlicher, die akustischen Absonderungen der Stadt angenehm gedämpft.
Es war das reinste Wintermärchen gewesen, und die Kinder hatten es genossen. So wie auch alle Junggebliebenen, die sich bei solchen Gelegenheiten noch ein wenig dem Stress entziehen konnten.
Der schlanke, ausnehmend fit wirkende Frühpensionist Karl Helmbach und sein treuer Hund Hector – ja, ja, mit c, darauf legte Helmbach großen Wert – spazierten scheinbar ziellos durch den Währinger Park.
Vor einem halben Jahr hatte Helmbach von einer Tante eine kleine Eigentumswohnung in der Gymnasiumstraße, direkt an der Ecke zur Phillipovichgasse, geerbt. Kurz entschlossen hatte sich der überzeugte Junggeselle gegen einen Verkauf entschieden, seine Mietbleibe in Böheimkirchen gekündigt und war nach Wien gezogen.
Keiner, der ihn kannte oder kennenlernte, konnte verstehen, warum der über Vitalwerte eines durchtrainierten 35-Jährigen verfügende 58 Jahre alte Helmbach bereits aus dem aktiven Polizeidienst ausgeschieden war. Der Grund dafür war für Außenstehende auch nicht gerade augenscheinlich, aber logisch.
Der begeisterte Polizist hatte seit mehr als 32 Jahren seinen Dienst als Hundeführer bei der Polizeihundestaffel in St. Pölten versehen. Nun war Hector, sein letzter vierpfotiger Kollege, bei einem Einsatz im Sommer letzten Jahres so schwer an der linken vorderen Pfote verletzt worden, dass das hoch qualifizierte Tier nicht weiter im Polizeidienst eingesetzt werden konnte.
Für den Junggesellen Helmbach, der seine Hunde immer wie eigene Kinder geliebt hatte, stand fest, in diesem Fall ebenfalls aus dem Dienst auszuscheiden. Dank einer chronischen Gelenkerkrankung, die ihn bisher allerdings nicht daran gehindert hatte, 100 Meter immerhin in nur etwas mehr als 15 Sekunden zu laufen, und eines gnädigen Amtsarztes gelang es Karl, Anfang November wegen Berufsunfähigkeit in die finanziell stark beschnittene Frühpension zu gehen. Da er als ehemaliger Beamter keine Zuverdienstgrenze zu beachten hatte, hatte er sich gleichzeitig die Gewerbeberechtigungen für Sicherheitsberatung und Private Ermittlungen besorgt. Denn von den knapp 1.200 Euro monatlicher Apanage allein würde er sich in seinem neuen Lebensabschnitt keine großen Sprünge leisten können.
Begleitet wurde er bei seinem Abgang in den Ruhestand von – erraten – Hector, seinem treuen Hund.
Dank langer Spaziergänge hatte Helmbach seine neue Wohngegend bestens kennengelernt. Aber nicht nur Döbling, auch andere Wiener Bezirke, vor allem Alsergrund, Währing und Hernals sowie die City hatten keine sonderlichen Geheimnisse mehr für ihn bereit. Am liebsten streifte er mit Hector aber durch den herrlichen Wienerwald, der ihm natürlich schon vor seiner Übersiedlung ein Begriff gewesen war, den er aber bis dahin kaum wirklich gekannt hatte.
Plötzlich bemerkte Helmbach, dass Hector eine Witterung aufgenommen hatte. Das bis dahin eher verspielte Herumtänzeln des Hundes ums Herrl war schlagartig einem eindeutig zielgerichteten, hoch konzentriert wirkenden Verhalten gewichen. Für den erfahrenen Hundeführer war sofort klar, dass die von seinem Tier aufgenommene Spur nicht zu einer verlorenen Handtasche oder vielleicht zu einem verletzten Eichkatzerl führen würde, solche Funde hatte Hector auch schon zu verzeichnen gehabt. Nein, das Verhalten des Hundes war fast als lehrbuchhaft zu bezeichnen und ließ nur einen einzigen Schluss zu. Den auf das Auffinden von … Helmbach kam gar nicht dazu, den Gedanken zu Ende zu führen, denn Hector hatte sein Ziel bereits erreicht. Eine knapp einen Meter hohe und vielleicht zwei Meter lange Erhebung, eine Art Hügel. Hector hatte zunächst zu winseln und zu scharren begonnen, dann hatte er eine ganz typische Körperhaltung eingenommen und gebellt. Für Helmbach war das das untrügliche Zeichen dafür, dass sich hier etwas ganz Bestimmtes befinden musste. Oder zumindest Teile davon.
Und tatsächlich. Nachdem der ehemalige Polizist vorsichtig den Schnee beseitigt und etwas in dem darunter befindlichen Haufen stark vermoderten Laubes gewühlt hatte, war er rasch auf etwas gestoßen. Etwas, das landläufig als grauenvoller Fund bezeichnet wurde. Obwohl Helmbach im Laufe seines Berufslebens schon öfters in solchen Situationen gewesen war, bekam er eine Gänsehaut.
Bei dem Fund handelte es sich um eine rechte, aller Wahrscheinlichkeit nach weibliche Hand, wie die etwas längeren, lackierten und gepflegt wirkenden Fingernägel vermuten ließen.
Zu blöd, ging es Helmbach durch den Kopf, dass er sein Handy nicht mithatte, das hing noch im Wohnzimmer zum Aufladen am Kabel. Wer befürchtete auch schon ernsthaft, bei einer zehnminütigen Äußerltour in den benachbarten Park ein Telefon zu benötigen.
»Hören Sie«, er hatte sich wieder aufgerichtet und einen langsam näher kommenden, etwas schlampig aussehenden jungen Mann herbeigewinkt. »Wir müssen die Polizei verständigen. Können Sie mir vielleicht kurz Ihr Handy borgen? Oder selbst anrufen? Sie müssen bloß die 133 eintippen oder die Notruftaste drücken, falls Sie eine programmiert haben!«
Die neben dem Expolizisten einzige Person im Umkreis von 300 Metern hatte aber verneinend den Kopf geschüttelt.
»Tut mir leid«, meinte Jo Fossler, mit diesem Namen hatte sich der Fremde kurz danach vorgestellt, »ich habe kein Handy mit. Aber neben dem Parkeingang, da oben«, er deutete Richtung Gymnasiumstraße, »gibts ein Telefonhüttl. Wenn Sie hinaufkommen, gleich rechts. Glaub ich«, hatte er vorsichtshalber noch hinzugefügt. »Ich heiße übrigens Jo, Jo Fossler.«
»Helmbach«, hatte der automatisch erwidert und Fosslers zum Gruß hingehaltene Hand ergriffen. »Freut mich, Jo. Können Sie darauf achten, dass sich niemand an dem Fundort und der Leiche zu schaffen macht, während ich schnell die Kolleg…, die Polizei verständige? Und auf meinen Hund passen Sie doch bitte auch ein wenig auf.«
Während Fossler zustimmend genickt hatte, hatte Helmbach Hector einen ganz bestimmten Blick zugeworfen und ihm gleichzeitig einen kaum erkennbaren Befehl in Form einer scheinbar zufälligen Handbewegung erteilt, der genau das Gegenteil des vorhin Gesagten bedeutete.
Nämlich: »Pass auf den Kerl auf, Hector! Und wenn er sich davonmachen möchte oder auch nur einen Schritt weg von seinem derzeitigen Standort geht, dann …«
Auf jeden Fall hatte Hector genau gewusst, was in diesem Fall von ihm erwartet wurde. Dennoch hatte er Jo weiter freundlich interessiert angeblickt, ein leises Knurren, gepaart mit einem fast unmerklichen Fletschen seiner eindrucksvollen Zähne, aber nicht ganz unterdrücken können.
Dass Fossler während drei der sieben Minuten, die der Expolizist Helmbach benötigt hatte, um wieder an den Fundort der Leiche zurückzukehren, damit beschäftigt gewesen war, sich die Tote etwas näher anzusehen, hatte den treuen Hund dagegen überhaupt nicht gestört.
Davon war in Helmbachs Befehlen ja nichts vorgekommen.
1.
Dienstag, 18. Februar, bis 18 Uhr
Falls er die letzten beiden Wochen ohne bleibende Schäden an Körper, Geist und Seele überstanden hatte, dann konnte ihm auch in Zukunft wohl nichts mehr wirklich etwas anhaben, dachte Palinski. Unvorstellbar, wie viel Stress er in den vergangenen Monaten, insbesondere aber in den letzten 14 Tagen, hatte verkraften müssen.
Und das Verrückteste war, dass er sich sauwohl und bärenstark dabei fühlte. Ganz so, als ob er ein, ja, ein Schwungrad eingebaut hätte, das umso mehr Energie produzierte, je mehr er selbst es in Schwung hielt. Das ihn also ständig neu auflud.
Ob er diese Zeit allerdings wirklich unbeschadet überstanden hatte, würde erst die Zukunft zeigen. Doch der enorme Einsatz sollte sich schließlich auszahlen. Mehr als nur bezahlt machen, hatte man ihm im Falle der zufriedenstellenden Abwicklung der Veranstaltung in Aussicht gestellt, nämlich internationale Anerkennung und reichen Lohn.
Jetzt musste an den nächsten fünf Tagen nur noch alles klappen wie am Schnürl, dann würde es geschafft, der Tag der Ernte da sein. Endlich.
Danach wollte er sich einige Tage Urlaub gönnen. Wieder einmal richtig ausschlafen und den Erfolg in Ruhe genießen.
Vielleicht würde er auch mit Wilma auf ein verlängertes Wochenende nach Südtirol fahren, um den dort ansässigen Teil der Familie zu sehen. Ja, das war eine gute Idee. Genau die Art Belohnung, die er brauchte, um sich für die vor ihm liegende Woche so richtig zu motivieren.
Diese Woche, das bedeutete ganz konkret die diesjährige Jahresversammlung der European Federation of Investigative Criminalists (EFIC) samt umfangreichem Rahmenprogramm, die am Semmering, also in knapp 1.000 Metern Seehöhe stattfinden würde. Diese Veranstaltung hatte einen ganz besonderen Stellenwert. Immerhin handelte es sich um die 50. Jahresversammlung seit Gründung der EFIC.
Übrigens, in der Öffentlichkeit und den Medien bevorzugte die EFIC aus akustischen Gründen die französische Variante ihres Namens, nämlich Federation Européenne des Criminalistes Investigatives (FECI). Das klang irgendwie unverfänglicher, war die mehrheitliche Meinung des Exekutivkomitees.
Palinskis Handy fing an zu summen, erinnerte ihn daran, dass es bereits 10 Uhr war und damit höchste Zeit, sich auf den Weg zum Flughafen zu machen.
Sir Frederick Swanhouse, der stellvertretende Chef von Scotland Yard und als geschäftsführender Vice Chairman der FECI Letztverantwortlicher für den bevorstehenden Trubel, würde um 11.35 Uhr in Schwechat landen, nach zehn Minuten sollte dann Jean Blondell von der Sûreté ankommen und dann Gianni Monderone mit einigen Kollegen aus Rom.
Und sie alle wie auch noch einige mehr musste, nein, wollte Palinski persönlich willkommen heißen. Also, wenn so überragende, ja legendäre Kriminalisten schon einmal den Weg nach Wien fanden, dann würde er, Mario Palinski, natürlich zu ihrem Empfang bereitstehen.
*
Die alte Frau blickte neugierig auf das blassblaue Kuvert, das ihr der Briefträger mit der übrigen Post in die Hand gedrückt hatte. Normalerweise tat er das nicht, sondern stopfte die Werbung und die gelegentlichen, mehr oder weniger erwarteten Poststücke in den metallenen Briefkasten neben dem Eingang zu dem alten Bürgerhaus in der Gersthofer Herbeckstraße.
Heute hatte Frau Abbersyn, ja, so lautete der eher ungewöhnliche Nachname der Frau tatsächlich, allerdings ein Einschreiben erhalten. Ein amtliches Schriftstück, dessen Erhalt sie unbedingt persönlich hatte quittieren müssen. Und wieder hatte die Behörde es nicht geschafft, ihren Namen richtig zu schreiben, nämlich mit zwei b und einem fremden i, also einem y.
Die Witwe des bereits vor sechs Jahren dahingegangenen Medizinalrats Dr. Georg Friedrich Abbersyn ärgerte sich nach wie vor darüber, dass der – zugegebenermaßen seltene, manche vermuteten sogar gälischen Ursprungs seiende – Name meistens Abersin oder Abbersen geschrieben wurde.
In erster Ehe war Anita Abbersyn, eine geborene Danzinger, ja, ja, aus der berühmten Wiener Ärztedynastie, mit einem Zeichenlehrer namens Bauer verbunden gewesen. Zumindest nach Ansicht ihrer Eltern.
Gegen deren heftigen Widerstand hatte sich Anita nicht für die Medizin, sondern für ein Studium an der Angewandten1 entschieden. Und sich bereits im zweiten Semester von Manfred Bauer, ihrem Professor fürs Aktzeichnen, schwängern lassen.
Die Ehe hatte aber nur etwas mehr als drei Jahre gehalten, denn der Spezialist fürs Nackerte Zeichnen, wie die Danzingers den ungeliebten Schwiegersohn nannten, konnte oder wollte seinen schönen Models nicht widerstehen und seinen Pimmel in der Hose behalten. Das wurde irgendwann selbst der früher eher toleranten Anita zu viel, und sie reichte, dynamisch gecoacht von ihrer Mutter, die Scheidung ein.
Dann hatte sie sich einige Jahre nur treiben lassen. War durch die Welt gebummelt, hatte diverse Jobs gemacht und auch wieder geschmissen und sich zwischendurch noch ein Kind machen lassen. Beim Vater des heute 38-jährigen Albert hatte es sich angeblich um einen persischen Technikstudenten gehandelt, den Anita irgendwo in Barcelona kennengelernt hatte.
In den Augen ihrer extrem erfolgs- und standesbewussten Eltern hätte schon die Hälfte dessen, was Anita ihnen in diesen Jahren zugemutet hatte, gereicht, um sie dezidiert zum schwarzen Schaf zu erklären. Die Familie sah in ihr eine absolut lebensunfähige, parasitäre Existenz, noch dazu mit Anhang, die lediglich dank der Großzügigkeit der Verwandten überleben konnte.
Und dann geschah das Wunder: Anita schaffte ihren Dr. med. schließlich doch noch. Zwar nicht an der altehrwürdigen Alma Mater Viennensis, sondern nur vor dem Standesamt. Aber immerhin, wen interessierte das schon, wenn man beim Friseur vor versammelter Kundschaft als Frau Doktor apostrophiert wurde?
Damit war aber auch der Aufstieg zur Frau Medizinalrat gesichert gewesen und schließlich auch die unvermeidliche Beförderung zur Medizinalratswitwe.
Anitas Karriere war halt ein typisches Beispiel für den dritten, früher sehr beliebten, sogenannten Wiener Bildungsweg. Und aus Albert Nirgendwer wurde durch Adoption des freundlichen Stiefvaters ein inzwischen schon fast acht Jahre alter echter Abbersyn. Nicht mehr und nicht weniger.
Irgendwie kam das blassblaue Kuvert der alten Dame bekannt vor. Hatte sie nicht vor zwei, nein, drei Jahren, na egal, sie bildete sich ein, vor ein paar Jahren genau so ein Briefpapier zu Weihnachten geschenkt bekommen zu haben.
Und dass ihr Name darauf ausnahmsweise völlig korrekt geschrieben worden war, war erstaunlich. So was hatte sie schon lange nicht mehr erlebt. Irgendwie freute sie das sogar.
Langsam öffnete sie jetzt den Umschlag und zog einen gefalteten Briefbogen heraus. Umständlich breitete sie das Blatt auf dem Tisch vor sich aus, glättete es und rückte ihre Brille zurecht.
Kaum hatte sie den ersten, aus ausgeschnittenen und aufgeklebten Druckbuchstaben bestehenden Satz der Botschaft gelesen, als ihre Gesichtszüge aus der Rolle sprangen und sie zu schreien begann.
IHR KLEINER ALBERT IST IN UNSERER GEWALT, stand da. Und WENN SIE IHN IM GANZEN WIEDER ZURÜCKBEKOMMEN WOLLEN, DANN KOSTET SIE DAS 116.812, ALSO GERUNDET 120.000 EURO.
WEITERE ANWEISUNGEN FOLGEN HEUTE ABEND.
UND KEINE POLIZEI, SONST …
Anita Abbersyn konnte sich nur zu gut vorstellen, wofür die Punkte nach dem Sonst standen. Und jedes Mal, wenn sie diesen Passus las, und das tat sie gleich mehrere Male hintereinander, konnte sie ein hysterisches Schluchzen nicht unterdrücken.
Ach, Albert, ihr Liebling Albert war in den Händen von schlechten Menschen. Angst schnürte ihren Hals zu wie eine kräftige Rebschnur und drohte sie zu erwürgen. Immerhin hatte sie schon einmal ein Kind verloren. Vor vielen Jahren war die damals dreijährige Martina, Alberts ältere Schwester, die er aber nie kennengelernt hatte, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Erst lange danach war die alte Frau endlich imstande, aufzustehen und zum Telefon zu gehen, um dringend notwendige Gespräche zu führen.
*
Seit Mario Palinski auf dem im Jänner vor zwei Jahren in Wien stattgefundenen Polizei-Kongress kurzfristig als Referent eingesprungen war und einen viel beachteten Vortrag gehalten hatte, kannte er viele der führenden Kriminalisten des Kontinents. Mit einigen der Damen und Herren war er, ja, das konnte man ohne Übertreibung sagen, sogar so etwas wie befreundet.
So auch mit Sir Frederick Swanhouse, der eben mit einigen Kollegen in der improvisierten, speziell den Members of the FECI vorbehaltenen VIP-Lounge am Wiener Südbahnhof eingetroffen war.
Vor dem in der obersten Ebene befindlichen kleinen Kaffeehaus, das für einige Stunden ganz der FECI zur Verfügung stand, war ein größeres Partyzelt aufgebaut worden. Hier befand sich neben dem Check-in-Counter und dem Meeting Point eine kleine Snackbar, die die Kriminalisten aus ganz Europa mit Getränken und kleinen Speisen verwöhnte.
Judith, die 23-jährige Jurastudentin, die Palinski für die Vorbereitung und auf Dauer der Jubiläumsveranstaltung als Assistentin z. b. V., das bedeutete zur besonderen Verwendung, engagiert hatte, überreichte eben jeder der anwesenden Damen einen wunderschönen Blumenstrauß.
Die vier unter Judiths Kommando stehenden Hostessen, Schülerinnen der Maturaklasse einer Hotelfachschule, reichten inzwischen Fruchtsäfte, Longdrinks, Wasser und kleine Appetithappen.
Kurz nach Sir Frederick waren auch Magnus Bertsson aus Oslo, Kai Uwe Sterbeck vom BKA in Wiesbaden und Angelus Pelatinos, Athen, eingetroffen und gleich darauf, zur besonderen Freude Palinskis, auch Señora Cortez Ruiz aus Madrid, die Chefpsychologin der Guardia Civil. Diese Dame hatte sich bei seinem ganz speziellen Vortrag vor zwei Jahren als Einzige auf eine Diskussion eingelassen, seine Ansichten hinterfragt und so sein besonderes Interesse geweckt.
»Hola, Isabel!« Außer Buenos días und anderen Floskeln war das das einzige Spanisch, das Mario beherrschte. »Wie geht es Ihnen?«
»Hervorragend. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und bin schon neugierig, was Sie sich diesmal für uns ausgedacht haben!« Im Gegensatz zu Palinskis Spanisch sprach die Psychologin, die in Hamburg studiert hatte, ausgezeichnet Deutsch.
Die große Uhr am Bahnsteig 18, auf dem eben der Sonderzug 4311 Criminal Express zum Semmering mit der planmäßigen Abfahrt um 15.25 Uhr eingeschoben wurde, zeigte 13.28 Uhr.
Noch jede Menge Zeit, aber von den erwarteten rund 400 Ehrengästen, die sich für die Zugfahrt angemeldet hatten, waren auch erst knapp 100 in der VIP-Lounge eingetroffen.
Nun, bis zur Abfahrt war noch über eine Stunde Zeit.
*
Während Palinski seine Schäfchen für die Fahrt mit dem aus restaurierten, voll funktionsfähigen und mit modernstem Komfort ausgestatteten Waggons aus der Zeit der Monarchie bestehenden Sonderzug sammelte, saß etwas mehr als 100 Kilometer südlich von Wien ein Mann bei seinem kargen Mittagessen. Karl Schönberg, vulgo der Koglbacher, war 68 Jahre alt und schon ein wenig tattrig. Es waren die Beine, die nicht mehr so recht mitmachen wollten.
In der Erinnerung seiner ehemaligen Freunde und Geschäftspartner war er aber nach wie vor der kraftstrotzende Bulle, dem sich nichts und niemand entgegenstellte.
Ein Gigant, der Beste seines Faches überhaupt. Und das wirklich Erstaunliche war, dass seine Feinde, besser die, die seine Feinde gewesen und trotzdem noch am Leben waren, nicht viel anders dachten.
Der Koglbacher war kein Einheimischer, sondern ein sogenannter Zuagraster, also ein Zugereister. Plötzlich, eines Tages vor etwas mehr als zwölf Jahren, war er da gewesen. Hatte als einer der Ersten von den neuen Freiheiten für EU-Bürger Gebrauch gemacht und sich in der Stanz niedergelassen.
Seiner freundlichen, natürlichen Art, der unauffälligen Selbstverständlichkeit, mit der er sich seiner Umwelt angepasst hatte, ja in ihr aufgegangen war, vor allem aber seinen ausgezeichneten Deutschkenntnissen war es zu verdanken, dass der Koarl inzwischen fast als Einheimischer angesehen wurde.
Und nur sehr sensible Ohren konnten auch heute noch den leichten Hauch von Akzent erkennen, der verriet, dass der Koglbacher vor vielen Jahren als Carlo Montebello in Neapel zur Welt gekommen war.
Nach einem intensiven, höchst erfolgreichen Arbeitsleben war er, der in seinem Fach zu den Besten zählte, bereits mit 56 Jahren in den Ruhestand gegangen. Nein, eher in allen Ehren gegangen worden. Aus Gründen der Familienpolitik, wie es seinerzeit inoffiziell geheißen hatte.
Und so, wie es andere Menschen im Altenteil in den Süden zog, hatte es Signore Carlo Montebello in den Norden gezogen. Während sich der Koglbacher genussvoll mit den letzten Bissen seines Schmalzbrotes beschäftigte, klingelte das Wandtelefon im Vorraum. Wohl müßig anzumerken, dass es sich um einen Festnetzanschluss handelte. Mühsam erhob sich der alte Mann, griff nach seinem Gehstock und brachte die Strecke in den Vorraum vorsichtig zeppelnd hinter sich.
»Jo«, meldete er sich schließlich nicht gerade formvollendet, für die Gegend aber durchaus typisch.
»Ciao amico«, meldete sich eine heisere, unverkennbare Stimme aus seiner Vergangenheit, »dobbiamo parlare, Carlo, wir missen sprecken!«
*
Der Anruf ihrer Schwester Anita hatte Elisabeth Bachler völlig aus der Fassung gebracht. Entführungen und Lösegeldforderungen waren Ereignisse, an die man durch die Medien zwar immer wieder erinnert wurde, aber zwischen der allgemeinen Aufregung über solche Verbrechen sowie Mitgefühl mit den Betroffenen und dem, was sie jetzt tatsächlich bewegte, ja aufwühlte, lagen emotionale Welten.
Um Gottes willen, jetzt hatte das Verbrechen, vielleicht sogar der internationale Terrorismus auch ihre Familie erfasst, man glaubte, nein hoffte ja immer, dass einem selbst solche schrecklichen Erfahrungen erspart blieben.
Und dann, eines Tages, stellten sie sich doch ein.
Nach dem Schmerz war eine gewisse Erleichterung zu verspüren. Elisabeth Bachler schämte sich zwar, das eingestehen zu müssen. Aber sie war, und das war nur zu menschlich, froh, sehr froh sogar, dass es nicht ihre Tochter Wilma getroffen hatte. Oder eines ihrer Enkelkinder. Ein unvorstellbarer Gedanke.
Nun, die 120.000 Euro waren kein Problem. Sowohl ihre Familie als auch Anita waren relativ wohlhabend. Zwar hatten sie sicher nicht so viel Bares herumliegen, denn das Geld war langfristig gebunden, aber falls alle zusammen halfen, und davon ging sie aus, dann sollte das Aufbringen des Betrages selbst kurzfristig keine großen Probleme machen.
Das Stichwort lautete: Familientreffen, und das möglichst rasch, also noch heute Abend.
Zu trinken war genug im Hause, das Essen konnte sie sich von einem nahe gelegenen Partyservice liefern lassen.
Tja, damit war alles klar.
Wann riefen Kidnapper wohl ihre Opfer an, wenn sie von abends sprachen? Sie hatte keine Ahnung, aber sicher nicht zu früh. Wahrscheinlich auch nicht später als 22 Uhr, denn nach dieser Zeit rief man einfach nicht mehr an. Zumindest unter gut erzogenen Menschen. Außer es handelte sich um einen Notfall.
Eine Entführung konnte man ja auch als einen solchen ansehen. Wie auch immer, 19.30 Uhr war sicher eine gute Zeit, mit dem Familientreffen zu beginnen.
Elisabeth Bachler machte es sich auf dem Stuhl neben dem Telefon bequem und begann, die Familienmitglieder zusammenzutrommeln.
*
Kurz vor 15 Uhr hatten die Original Kaiserschützen am Bahnsteig Aufstellung genommen und begonnen, die Zeit bis zur Abfahrt des Criminal Express mit ihrem munteren Spiel zu verkürzen.
Die Musiker in ihren historisch anmutenden Fantasiekostümen sahen hervorragend aus und spielten auch gar nicht schlecht. Dazu kam, dass sich kaum einer der Gäste den Spaß entgehen lassen wollte, selbst einmal mit dem Dirigentenstab je nach Temperament wild herumzufuchteln oder bedächtig zu schwimmen und dabei abgelichtet zu werden.
Mit einem Wort, es war eine Riesenhetz.
Den Musikanten wars wurscht, wer was dirigierte, die kannten das Zeugs ohnehin auswendig und spielten ungerührt ihr Repertoire herunter. Vom Radetzkymarsch über ›Stars and Stripes‹ bis hin zu ›Oh, du mein Österreich‹.
Und das funktionierte prima. Selbst wenn der Kapellmeister lediglich an Blähungen gelitten oder eine lästige Fliege verjagt hätte.
Als sich der Zug exakt um 15.25 Uhr zu den Klängen von ›Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus‹ in Bewegung setzte, waren sich jedenfalls alle sicher, dass Wien zu Recht die Welthauptstadt der Musik genannt wurde.
»Grothe Klathe«, fasste Kriminaldirektor i. R. Mannsbart vom LKA mit feuchten Augen zusammen. Treffender hätte man das wirklich nicht ausdrücken können. Bloß schade, dass sich der äußerst verdiente, hochdekorierte Kriminalbeamte noch immer keinen besseren Zahnersatz leisten konnte oder wollte.
Langsam gewann der Zug, der aus drei historischen Salon-, vier Speise- und zwei Barwagen sowie fünf erst kürzlich völlig renovierten Erste-Klasse-Waggons aus der Zwischenkriegszeit bestand, an Geschwindigkeit. Nach einer bewusst prolongierten Fahrtzeit von drei Stunden und 55 Minuten sollte er exakt um 19.20 Uhr am Bahnhof Semmering einfahren.
Aus Gründen der Authentizität und Originalität hatte Palinski sogar daran gedacht, eine echte alte Dampflok vor die Garnitur spannen zu lassen. Wegen der vorhersehbaren, durchaus berechtigten Proteste der Umweltschützer gegen diese Rußorgie hatte er den Gedanken aber wieder fallen lassen.
Und das war auch gut so, denn wenn Sir Frederick etwas noch weniger liebte als eine schlechte Presse, dann eine, die zu Recht schlecht war.
Apropos Presse: An Bord des Zuges befanden sich neben einem Fernsehteam auch die Vertreter von 33 in- und ausländischen Zeitungen und Fachmagazinen. Die restlichen der insgesamt 69 akkreditierten Medienvertreter würden direkt am Zielort zu der nachrichtenhungrigen Meute stoßen.
Unter den Damen und Herren der schreibenden Zunft, die sich gleich nach der Abfahrt in dem zum provisorischen Pressezentrum umgestalteten Barwagen versammelten, befand sich auch ein junger Mann, den keiner kannte. Noch nicht.
Die inländischen Journalisten hielten ihn, falls sie überhaupt darüber nachdachten, für einen ausländischen Kollegen. Und die Ausländer umgekehrt für einen Hiesigen.
Der Name Sven Eglitz ließ mehr oder weniger alle Möglichkeiten offen. Auch die CEPA – Central Europe Press Agency, als deren Mitarbeiter ihn die am Revers seiner Jacke befestigte Registrierung auswies, ließ viele Möglichkeiten offen.
Zwar hätte keiner etwas über diese Agentur sagen können, aber bei der Dynamik, die dieser schnelllebige Markt seit Jahren entwickelte, war das nicht weiter erstaunlich.
Während sich der Zug in gemächlichem Reisetempo, wie sollte man die für knapp 100 Kilometer bis zum Ziel benötigte Fahrzeit von fast vier Stunden sonst nennen, der Station Meidling näherte, schlenderte Palinski erleichtert durch die Waggons, begrüßte die, die er noch nicht begrüßt hatte, und stellte sich jenen vor, die ihn noch nicht kannten.
Die Spannung, die ihn seit heute Morgen gefangen gehalten hatte, war jetzt völlig abgefallen. Noch – er blickte kurz auf seine Armbanduhr – knapp drei Stunden, dann würden sie alle im ›Semmering Grand‹ angelangt sein. Dort wartete bereits sein Assistent Florian Nowotny auf ihn, um ihn zu entlasten.
Wilma, seine liebe Wilma, mit der er seit mehr als 26 Jahren nicht verheiratet war und dennoch zwei Kinder hatte, würde erst morgen nachkommen. Sie hatte heute Abend noch eine berufliche Verpflichtung wahrzunehmen, ehe sie für den Rest der Woche freinehmen konnte.
Palinski passte das ganz gut ins Zeug. Nach den höllisch anstrengenden und weitgehend schlaffreien letzten Tagen wollte er heute Abend versuchen, früh ins Bett zu kommen. Da außer der informellen Get-together-Party im ›Semmering Grand‹, mit der er nicht unmittelbar zu tun hatte, nichts auf dem Programm stand, sahen die Chancen dafür recht gut aus.
Wohlig rekelte er sich im Geiste bereits auf den frischen, nach Sauberkeit duftenden Linnen, als Sven Eglitz in sein Leben trat und seinen Tagtraum zerstörte.
»Verzeihen Sie, Herr«, der junge Mann warf einen Blick auf Palinskis Namensschild, »Palinski, ah, Sie sind es persönlich. Es ist mir eine Ehre. Ich bin Sven Eglitz von der CEPA«, stellte er sich vor. »Darf ich Sie etwas fragen?«
»Natürlich«, ermunterte Palinski den bebrillten Vollbartträger, der ein eigenartiges Medaillon um den Hals trug und irgendwie weibisch damit wirkte, »dazu bin ich ja da. Was wollen Sie wissen?«
»Stimmt es, dass Sir Peter Millfish auch auf den Semmering kommen wird?« Millfish war eine legendäre Figur in der Welt der Kriminalisten und Kriminologen. Innerhalb von nur knapp zehn Jahren hatte der charismatische Herausgeber des Global Criminal Report (›GCR‹) aus einem unbedeutenden Monatsmagazin eine der, nein, die weltweit führende Fachzeitschrift in diesem Bereich gemacht. Allein die englischsprachige Auflage lag inzwischen bei mehr als 525.000 Exemplaren. Und das 26 Mal im Jahr.
Klar, dass so ein Mann normalerweise auf keiner Jahresversammlung der FECI hätte fehlen dürfen, schon gar nicht im Jubiläumsjahr. Noch dazu war der GCR Großsponsor der Veranstaltung, darüber hinaus hatte Sir Peter gerüchteweise auch privat einen namhaften Betrag zu den nicht unbeträchtlichen Kosten des Mega-Events beigesteuert.
Aber so selbstverständlich war das bei dem kauzigen, sogar im heimatlichen Blyth Valley in Northumbria kaum in der Öffentlichkeit erscheinenden und auf seinem Landsitz in der Nähe von Cramlington total abgeschirmt lebenden Sir Peter ganz und gar nicht. Nein, seine Teilnahme war erst gestern Nachmittag völlig unerwartet und überraschend bekannt gegeben worden.
Im Gegensatz dazu war der aus Lady Paulina, Andrea, Bridget und Caroline bestehende weibliche Teil der Familie als ausgesprochen kommunikativ und lebenslustig bekannt. Die Damen verbrachten den Großteil des Jahres an einer noblen Londoner Adresse.
Nur zu verständlich, dass sich nun jeder Journalist um eines dieser raren Interviews mit der Legende bemühte. Für einen jungen Mann wie Eglitz konnte das die Chance für den beruflichen Durchbruch sein.
»Sir Peter Millfish und Familie werden erst morgen im Laufe des Tages am Semmering erwartet. Er wird übermorgen nachmittags vor der ›Mörderischen Diskussionsrunde‹ zwei Stunden für Interviews zur Verfügung stehen!«, teilte Palinski Eglitz mit. Dabei war er sichtlich bemüht, seinem Gegenüber nicht direkt ins Gesicht zu blicken. »Sie sollten sich auf jeden Fall schon in die Liste eintragen lassen, das Interesse an Interviews mit ihm ist enorm!«
Der junge Journalist bedankte sich artig und ging.
Schade, dachte Palinski, das schien durchaus ein netter Kerl zu sein. Und dann so ein Mundgeruch, äh.
Im nächsten Waggon traf Mario auf István Lalas, den Doyen der ungarischen Journalisten, den er bereits von früheren Anlässen her kannte.
»Hallo Mario«, freute sich István. »Schön, wieder bei euch zu sein. Du hast da ja eine großartige Sache organisiert!«, anerkannte er. »Sag, hast du Kollegen Sven Eglitz gesehen? Laut Anwesenheitsliste soll er bei unserem Haufen dabei sein!« Er lachte gutmütig.
»Lustig, dass du gerade jetzt nach ihm fragst. Ich habe ihn eben erst kennengelernt!«, erwiderte Mario. »Vor weniger als fünf Minuten. Ist er nicht noch ziemlich jung für einen Mann in dieser Position?«
»Soviel ich weiß, ist er knapp 40, also jung …?« István schüttelte den Kopf. »Wie vieles im Leben ist jung eben auch ein relativer Begriff!«
Komisch, dachte Palinski, er hätte dem Burschen vorhin keine 30 gegeben. Aber bitte, manche sahen mit 50 noch so glatt und rosig aus wie ein Kinderpopo.
»Er muss irgendwo in einem der hinteren Wagen sein!«, er deutete in die Richtung, aus der er eben gekommen war.
»Danke«, István salutierte scherzhaft ehe er weiterging. »Wir sehen uns!«
*
Wilma Bachlers Schock über das, was sie eben von ihrer Mutter erfahren hatte, war nicht gerade gering. Zwar gab es niemanden in ihrer Verwandtschaft, den sie weniger mochte als Cousin Albert. Sie hielt ihn für ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man sich seine Freunde aussuchen konnte, die Verwandtschaft dagegen nicht.
Aber Objekt einer Entführung und Lösegeldforderung zu sein, das war gewiss eine Erfahrung, die zu machen sie nicht einmal ihren schlimmsten Feinden wünschte.
Klar, dass die Familie in so einer Situation zusammenrückte, sich gegenseitig, vor allem aber den unmittelbar betroffenen Angehörigen half. Oder dies zumindest versuchen musste.
Langsam wurde sie zornig. Sie hatte jetzt mindestens fünf Mal versucht, Mario zu erreichen, aber immer ohne Erfolg. Ständig dieser saudumme Hinweis auf die Mailbox. Was für einen Sinn hatte ein mobiles Telefon, das der potenzielle Gesprächspartner immer bei sich haben konnte, ein entscheidender Vorteil zum Festnetzangebot, wenn dieser Popsch von Palinski das Gespräch nie annahm?
Vielleicht sollte sie versuchen, Florian zu erreichen. Soviel sie wusste, war Marios Mitarbeiter bereits am Semmering.
Sie konzentrierte sich auf seine Handynummer, irgendwie schaffte sie es immer wieder, gedanklich einen Zahlensturz zu vollziehen und so regelmäßig eine Fehlverbindung zu produzieren.
Obwohl sie das wusste und sich darauf konzentrierte, den Fehler heute zu vermeiden, war sie schon wieder falsch verbunden. Sie verstand nicht, dass sie nicht imstande sein sollte, den Assistenten Marios bereits mit dem ersten Versuch zu erreichen.
Nun, es gab eben Dinge, die zu verstehen man gar nicht erst versuchen sollte. Ganz einfach, weil sie eben völlig unverständlich waren.
Wilma tippte die Nummer ein zweites Mal ein. Diesmal eine 434 statt einer 344. Und siehe da, kurz darauf hatte sie Florian Nowotny tatsächlich am Apparat.
»344 statt 434«, memorierte sie, und nochmals »344 statt 434«.
Das war doch wirklich nicht so schwer zu merken. Sie sollte sich unbedingt eine deppensichere Eselsbrücke ausdenken oder die Nummer endlich abspeichern, ging es ihr noch durch den Kopf, während sie den jungen Polizisten bat, dafür zu sorgen, dass sich Palinski so rasch wie möglich mit ihr in Verbindung setzte.
*
Adrian Eberheim war das, was man landläufig als feschen Kerl in den besten Jahren bezeichnen konnte. Der schlanke Mittfünfziger mit flottem Oberlippenbart war glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder. Und er war heilfroh, dass der Nachwuchs die Schule endlich hinter sich gebracht hatte. Natürlich mit großem Erfolg, aber auch mit erheblichen Problemen organisatorischer Natur. Oder konkret: Zorres mit den Schulferien.
Denn Tochter Anna war im niederösterreichischen Gloggnitz zur Schule gegangen, und Sohn Herbert hatte eine solche im steirischen Mürzzuschlag besucht.
Das hatte die Konsequenz, dass für Anna andere Ferientermine galten als für Herbert. Das wieder hatte erheblichen zusätzlichen Stress für die Eltern zur Folge, die beide berufstätig waren. Eltern schulpflichtiger Kinder mit etwas Fantasie konnten sich gewiss vorstellen, worauf dies immer wieder hinausgelaufen war.
Barbara Eberheim arbeitete in leitender Position im größten Haus am Platz, Adrian war Generaldirektor des ›Semmering Grand‹ und damit ihr Chef.
Der Boss hatte heute aber ganz andere Sorgen als die, die sich seinerzeit aus unterschiedlichen Ferienterminen und freien, sogenannten ›schulautonomen Tagen‹ ergeben hatten.
Als ihn Mario Palinski, den Eberheim seit vielen Jahren kannte und auch öfters schon als Gast im Hause gehabt hatte, vor fast acht Monaten mit der Ankündigung überrascht hatte, die nächste und noch dazu 50. Jahresversammlung der FECI im ›Semmering Grand‹ durchführen zu wollen, war Eberheim natürlich hellauf begeistert gewesen. Und hatte nicht lange mit seiner Zusage gefackelt. Klar, wer zögerte schon, wenn es darum ging, nach den Energie-Ferien noch eine Woche volle Auslastung realisieren zu können?
Damals war von 120 bis zu150 Teilnehmern an der Jahresversammlung die Rede gewesen. Dazu noch Angehörige und Tross, Journalisten, Mitarbeiter etc., demnach also von insgesamt höchstens 300 Gästen.
Ob nun der attraktive Ort, das schöne Hotel oder das interessante Jubiläumsprogramm für das außerordentliche Interesse an dieser Veranstaltung verantwortlich waren, darüber konnte nur spekuliert werden. Auf jeden Fall war die Zahl der Anmeldungen mit derzeit insgesamt 688 auf deutlich mehr als das Doppelte der maximalen Prognose angestiegen. Eine beeindruckende oder Angst erregende Entwicklung, je nachdem, welchen Standpunkt der Betrachter einnahm.
Unter Berücksichtigung jener Teilnehmer, die in kleineren Hotels und Pensionen untergebracht werden konnten, hatten Eberheim Mitte Dezember des Vorjahres immerhin mehr als 200 Betten im eigenen Hause gefehlt. Ein scheinbar unmöglich zu lösendes Defizit.
Dennoch war dem gewieften Manager die Quadratur des Kreises, ja, so konnte man diesen Geniestreich wohl nennen, durchaus gelungen.
Er hatte es geschafft, für diese Woche mehr als die Hälfte der im gleichen Gebäudekomplex wie das ›Semmering Grand‹ befindlichen privaten Appartements anzumieten. Darüber hinaus hatte er die benachbarte Hotelfachschule zu einer Verschiebung der Semesterferien überreden können. Dadurch konnten die zwar etwas kleineren, aber sehr ordentlichen Zweibettzimmer des der Schule angeschlossenen Internats ebenfalls berücksichtigt werden.
Schlussendlich hatte Eberheim sämtliche 442 Gäste, die unbedingt im ›Semmering Grand‹ logieren wollten, auch irgendwie adäquat untergebracht. Zumindest im selben Gebäude.
Dazu kamen noch knapp 250 weitere Gäste, die anderswo am Semmering oder in einer der umliegenden Ortschaften Platz fanden.
Wie gesagt, die Jubiläumskonvention der FECI würde die größte Veranstaltung dieser Art sein, die je am Semmering stattgefunden hatte. Und sein, Adrian Eberheims, Name würde damit untrennbar verbunden sein. Der alte Hotelfuchs war ehrlich angetan, ja richtig berührt von sich und seiner Leistung.
Allerdings barg die erzwungene temporäre Aufblähung der Kapazitäten des ›Grand‹ natürlich auch einige Gefahren in sich. Da sich die Bettenkapazität für diese Woche nahezu verdoppelt hatte und in der Gastronomie sowie bei den Veranstaltungen ebenfalls mit entsprechenden Zuwächsen gerechnet werden musste, hatte er das Personal kurzfristig beträchtlich aufstocken müssen. Mithilfe spezialisierter Agenturen sowie einiger direkt aufgenommener Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war das Problem rein formal einfach zu lösen gewesen. Aber ob und inwieweit die Mitarbeiter auf Zeit auch den hohen Qualitätsanforderungen des ›Grand‹ entsprechen würden? Trotz strikter Aufnahmekriterien konnte Eberheim nur hoffen und beten.
Am meisten irritierte ihn aber nach wie vor das spurlose Verschwinden seiner Assistentin. Die 28-jährige Ingrid Warnicek, absolvierte Hotelkauffrau mit ausgezeichnetem Abschluss und für ihr Alter sagenhaften neun Jahren Auslandserfahrung in ersten Häusern in Rom, London und Nizza, war am 13. Dezember auf Kurzurlaub nach Hause aufgebrochen. Konkret hatte das Purkersdorf bei Wien bedeutet, wo sie vor mehr als einem Jahr das kleine Häuschen ihrer Omi geerbt hatte. Ihrer Großmutter väterlicherseits, bei der sie aufgewachsen war. Denn ihre Eltern waren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ingrid hatte damals gerade zu laufen begonnen.
Am 14. Dezember hatte die junge Frau noch mit Eberheim telefoniert und ihre Rückkehr für den 16. Dezember mittags bestätigt. Das war das letzte Mal gewesen, dass er etwas von seiner Assistentin gehört hatte.
Trotz intensivster Nachforschungen waren die Bemühungen der Polizei bisher erfolglos geblieben. Eine Schwierigkeit bei der Suche war auch, dass die junge Frau dank ihrer langjährigen Auslandsaufenthalte in Österreich so gut wie keine Bekannten hatte. Und für die wenigen entfernten Verwandten, die noch existierten, war Ingrid Warnicek ein kleines Mädchen auf einer vergilbten Fotografie. Langer Rede kurzer Sinn, kein Mensch wusste, wie die junge Frau aussah, keiner hatte sie gesehen. Es gab keine Spuren, und die Chancen, doch noch auf eine zu stoßen und damit die junge Frau selbst zu finden, wurden von Tag zu Tag geringer.
Und obwohl er sich ganz schrecklich dabei gefühlt hatte, hatte sich Generaldirektor Eberheim schließlich nach Weihnachten gezwungen gesehen, die Position seiner Assistentin zumindest provisorisch neu zu besetzen. Das Arbeitsvolumen hatte ihm trotz großen Unbehagens keine andere Wahl gelassen.
Dabei hatte er noch Glück im Unglück gehabt, denn Ingrids Nachfolge hatte sich mehr oder weniger von selbst ergeben. Die junge Wirtschaftsakademikerin Elke Horwenz war am 17. Dezember im ›Grand‹ angekommen, um sich einige Tage des Ausspannens zu gönnen. Rein zufällig hatte sie mitbekommen, was sich abgespielt hatte. Am 20. Dezember hatte Frau Horwenz Eberheim um ein Gespräch gebeten. Sie habe ihre bisherige Arbeit im Ausland aufgegeben und sei nach Österreich zurückgekehrt. Und das alles wegen einer unglücklichen Affäre mit einem verheirateten Mann. Sie habe vom Verschwinden der Assistentin gehört und wolle ihre Dienste anbieten. Natürlich nur inoffiziell und ohne Bezahlung. Nun gut, gegen Kost und Quartier war nichts einzuwenden gewesen.
Der Generaldirektor hatte nicht lange überlegt und Ja zu dem Deal gesagt. Und seine spontane Entscheidung bisher nicht bereut. Ganz im Gegenteil.
Es war daher nur logisch gewesen, Elke Horwenz ein Angebot zu machen, nachdem er sich definitiv entschieden hatte, den Posten neu zu besetzen. Ein Offert, das diese erfreut, aber mit der Einschränkung angenommen hatte, das Feld räumen zu wollen, sollte ihre Vorgängerin wieder auftauchen.
Eberheim war mehr als beeindruckt von dieser Geste gewesen und durchaus zufrieden mit seiner Wahl. Obwohl Elke Ingrid natürlich nicht ersetzen konnte. Noch nicht zumindest.
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass noch knapp zwei Stunden bis zur massiven Ankunft der Gäste blieben. Gut, dass er Palinskis Idee aufgegriffen und drei Mitarbeiterinnen losgeschickt hatte, die den Crime Express in Wiener Neustadt besteigen und die Gäste noch im Zug einchecken sollten. Damit würde die Ankunft im Hause nahezu frei von den üblichen administrativen Notwendigkeiten ablaufen, relativ rasch und unproblematisch über die Bühne gehen. Aber mehr als 400 Gäste und ihr Gepäck innerhalb kürzester Zeit auf die Zimmer zu bringen, und zwar auf die richtigen, war immer noch Herausforderung genug.
Hoffentlich würden die großen Pferdeschlitten, die bis zu 24 Personen fassen konnten, rechtzeitig am Bahnhof eintreffen. Er hatte sie mühsam in einem Umkreis von 60 Kilometern auftreiben müssen, um den gewünschten stilvollen Transfer bieten zu können. Schnee dafür war ja noch genug vorhanden. Auch wenn es seit mehr als einer Woche keine Auffrischung mehr gegeben hatte.
Also, falls es jetzt auch noch schneite …
Ob die 300 Flaschen Champagner für heute Abend reichen würden? Vielleicht sollte er vorsorglich noch 100 zusätzlich auf Eis legen lassen.
Hoffentlich klappte das morgen mit dem Ersatz für Luigi Marander, den Chefpâtissier. Denn er war der einzige Pâtissier, den er in der Küchenbrigade hatte. Gehabt hatte, um korrekt zu sein. Denn dieser Unglücksrabe hatte sich gestern das Bein gebrochen. Da verbot man den wichtigen Leuten in der Saison das Skifahren, um so etwas zu verhindern, und dann rutschen sie auf einer Eisplatte aus.
Also der Gedanke, die nächsten Tage ohne seinen Spezialisten fürs Süße auskommen zu müssen, bereitete ihm echt Kopfweh.
Verdammt, der sonst so ruhige Eberheim war diesmal richtig nervös. Er musste unbedingt erneut alles durchchecken, durfte nichts dem Zufall überlassen.
In den nächsten Tagen durfte nichts, aber auch wirklich nichts schiefgehen.
*
Die Weinverkostung im Bahnhof Baden während des rund 20-minütigen Stopps in der Kurstadt war ein großer Erfolg gewesen. Palinski war richtig stolz auf seine Idee, die er gegen den rhetorischen Widerstand seines alten Freundes und Mitorganisators Ministerialrat Miki Schneckenburger durchgesetzt hatte.
Mehr als 50 Weinbauern der Thermenregion hatten kleine Stände aufgebaut und reichten den überraschten, erfreuten und teilweise sukzessive leicht beschickerten Gästen kleine Kostproben durch die geöffneten Fenster.
Zahlreiche Fahrgäste waren ausgestiegen, um sich etwas die Beine zu vertreten und bei dieser Gelegenheit rascher oder auch öfter in den Besitz der zunehmend begehrter werdenden Süffigkeiten zu gelangen. Gleichzeitig posierten sie mit den anwesenden Honoratioren der Stadt und buhlten um die Wette um einen guten Platz im Blitzlichtgewitter.
Eine Damenkapelle, die Badner Madln, spielte dazu Operettenmelodien und andere Ohrwürmer, mit einem Wort, es war eine Riesenhetz.
Die, und auch darauf war Palinski sehr stolz, keinen Cent kostete außer einem Schmattes2 für die flott aufspielenden Musikantinnen, die mit ihren trotz der niedrigen Temperaturen doch sehr ansprechenden Dekolletés bei dem vor allem männlichen Publikum großen Anklang fanden.
Kurz gesagt, war die Stimmung im Zug, der sich inzwischen langsam, aber sicher der nächsten Station näherte, ausgezeichnet und stimmte Palinski vorsichtig optimistisch. Falls es nur einigermaßen so weiterging, dann würde der Event ein Riesenerfolg werden.
Inzwischen hatte der Crime Express den Bahnhof von Wiener Neustadt erreicht. Die Rezeptionistinnen des ›Semmering Grand‹ waren bereits an Bord gegangen und begannen, die vorbereiteten Schlüsselkarten an die Gäste zu verteilen sowie die unbedingt notwendigen Formalitäten zu erledigen.
Nach der Abfahrt sollte die von einer Wiener Großbäckerei mit erheblichen Exportambitionen gesponserte Wiener Jause mit Kaffee, Schlagobers, Gugelhupf und Strudel beginnen. Dazu würde jeder Gast auch noch ein Körberl mit einem Viertel Wiener Mischung, einem kleinen Marmorgugelhupf und, als große kleine Überraschung, ein Original Kaffeehäferl mit dem Namen des jeweiligen Empfängers erhalten.
Also, wenn das nichts war!
So konnte jeder jederzeit überprüfen, ob er auch wirklich der war, für den er sich hielt.
Dem Vernehmen nach sollten sechs Mitarbeiter des Sponsors die letzte Nacht damit verbracht haben, die Häferlparade mit der Teilnehmerliste auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Was für eine Herausforderung.
Palinski fand diese Aktion ein wenig übertrieben. Schon irgendwie lieb, aber doch übertrieben. Ihm konnte es recht sein. Wenn sich der Sponsor etwas davon versprach, warum nicht? Hauptsache, das Budget der FECI war davon absolut nicht berührt worden.
Langsam setzte sich der Zug wieder in Bewegung, holperte leicht über einige Weichen und nahm schließlich Fahrt auf.
Es war genau 16.54 Uhr, und der Crime Express hatte noch knapp zweieinhalb Stunden Fahrt vor sich.
*
Karl Schönberg, in der heimatlichen Stanz auch als der Koglbacher bekannt, war jetzt plötzlich wieder Carlo Montebello. Einfach so, von einer Sekunde zur anderen. Wenn auch vorerst nur psychisch.
Der Anruf von vorhin, diese Stimme aus seiner Vergangenheit hatte eine Zeitreise und damit auch diesen Identitätswandel ausgelöst.
Carlo war sehr stolz darauf, reaktiviert worden zu sein, wenn auch nur für einen Auftrag. Vorläufig zumindest, denn falls er …, er wagte gar nicht weiterzudenken. Auf jeden Fall würde er wieder einmal mehr als sein Bestes geben.
»Diese Aufgabe ist sehr, sehr wichtig. Molto importante, die wichtigste Sache in deinem Leben überhaupt!«, hatte ihm die Stimme aus der Vergangenheit versichert. Ja, förmlich beschworen, obwohl das überhaupt nicht notwendig gewesen war. Denn Carlo hätte jeden Auftrag angenommen. Na, vielleicht nicht wirklich jeden, aber fast jeden. Jeden zumindest, der seinen ganz speziellen Talenten auch nur in etwa entsprochen hätte.
Aber das, was man jetzt von ihm erwartete, war der Traum jedes professionellen Problemlösers, wie er einer war. Und zwar einer der besten. Der Auftrag war so etwas Ähnliches wie ein Lifetime Oscar, also die Auszeichnung für ein Lebenswerk. Sein Lebenswerk mit dem Academy Award zu vergleichen, war gar nicht so abwegig. Denn Carlo verstand sich nicht als Handwerker, als Erfüllungsgehilfe, nein, überhaupt nicht. Sondern als Künstler, als einer der wenigen, die den Übergang von einer Seinsebene in eine andere nicht als bloßen Gewaltakt ansahen. Sondern als metaphysisches Ereignis.
Als einmalige Chance, den Tod eines Menschen und den Weg dorthin als originäres künstlerisches Ereignis zu inszenieren.
Nun hatte der ehemalige Koglbacher ein einem Gitarrenkasten ähnliches Behältnis aus einem Verschlag im Keller geholt und auf den Holztisch in der Küche gelegt. Vorsichtig öffnete er die beiden Metallverschlüsse und klappte den Deckel hoch.
Dann nahm er das längliche, in Öltuch eingewickelte Ding heraus, legte es ebenfalls auf den Tisch und dann mit mehreren sorgfältigen Griffen frei.
Hier war sie wieder, seine ewige Geliebte, die langjährige treue Begleiterin seines Berufslebens. Sie war noch immer schön wie am ersten Tag. Und gepflegt wie eh und je. Kein Wunder, putzte und ölte er sie doch mindestens einmal in der Woche.
Liebevoll, fast scheu nahm er die einzelnen Teile heraus und begann, die Dragunow sorgfältig wieder zusammenzusetzen.
Er hatte fast schon nicht mehr damit gerechnet, diese Waffe noch einmal professionell einzusetzen.
Und jetzt dieser Auftrag. Eine Herausforderung, die ihresgleichen suchte. Nicht nur die Gelegenheit, seine außerordentliche Meisterschaft unter Beweis zu stellen, sondern auch, sich mit einem echten Top-Kaliber in die ewige Bestenliste einzutragen.
Heilige Muttergottes von Forza d’Agro, seine Augen füllten sich vor Dankbarkeit mit Tränen. Er legte das Scharfschützengewehr zur Seite und begann mit seinen Vorbereitungen. Da man ihn bereits morgen am Einsatzort erwartete, musste er sich beeilen.
Als Erstes holte er sein Handy heraus, um seinen Adjutanten zu informieren. Denn ohne Antonio ging gar nichts.
*
Langsam, aber sicher ließ der Criminal Express die Ebene hinter sich und näherte sich den ersten Ausläufern der Berge. Nur mehr wenige Kilometer trennten ihn von jenem Bahnhof, in dem ihm eine zweite Lokomotive beigegeben werden würde, um die Fahrt über die erste normalspurige Gebirgsbahn Europas sicherzustellen.
Die von Gloggnitz nach Mürzzuschlag führende Strecke war 1854 eröffnet und 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden.
Seit Wien war Palinski ohne Pause unterwegs gewesen. Die neuen, gefütterten Schuhe, die er sich speziell für diesen Anlass gekauft hatte, waren zwar sehr schön, leider aber etwas eng geschnitten. Insbesondere der linke Treter drückte auf irgendetwas und bereitete echtes Unbehagen, sodass Mario froh war, endlich sein Abteil erreicht zu haben. Fünf oder besser noch zehn Minuten hinsetzen und die Beine ausstrecken war das Einzige, das er sich im Moment wünschte.
Fast wollüstig warf er sich auf den gut gepolsterten Erste-Klasse-Platz. Einzig beherrscht von dem Gedanken, endlich das peinigende Schuhwerk loszuwerden, übersah er völlig das Handy, das halb in der Ritze zwischen Sitz und Rückenlehne steckte. Es war sein Handy, das er unter sich begrub, ohne dass es ihm bewusst geworden wäre.
Was er allerdings gleich darauf bemerkte, war, dass er auf irgendeinem Gegenstand saß, der unter seinem Hintern nichts verloren hatte. Instinktiv griff er danach, registrierte beiläufig, dass es sich um sein Mobiltelefon handelte, und steckte es weg. In die Brusttasche seines Sakkos, wo es hingehörte.
Als die gute Judith gleich darauf atemlos in das Coupé stürmte und sich keuchend in den Sitz fallen ließ, hatte er die Sache mit dem Handy schon wieder vergessen.
Palinski merkte sofort, dass da etwas Gröberes nicht stimmte, etwas Schlimmes passiert sein musste. Er blickte seine Assistentin z. b. V. neugierig an, sagte aber nichts.
Judith atmete tief durch, ehe sie endlich zu sprechen begann.
»Ich fürchte, was ich Ihnen mitzuteilen habe, wird Ihnen nicht gefallen, Chef«, stammelte sie. Es klang echt verzweifelt, ganz so, als ob sie sich für das, was immer es auch sein mochte, selbst verantwortlich fühlte.
»Nur zu«, ermunterte er sie, »trauen Sie sich. Es wird schon nicht so schlimm sein!«
Mit leiser Stimme berichtete sie, und es war schlimmer als schlimm. Mit einem Wort, es war ganz, ganz arg.
Im WC des letzten Waggons, das war der für die Journalisten reservierte Erste-Klasse-Wagen, hatte man vor wenigen Minuten eine Leiche gefunden.
»Der Zugsführer hat mich beauftragt, einen Verantwortlichen zu holen!« Sie zuckte resignierend mit den Achseln, dann fing sie an zu weinen. »Also Sie, Chef!«
Bald betrat ein erschreckt-frustrierter Palinski den Fundort der Leiche. Der Schock, unter dem er stand, wurde noch verstärkt durch die augenscheinliche Tatsache, dass es sich bei dem Toten um István Lalas handelte. Jenen Journalisten, mit dem Mario selbst noch vor weniger als einer Stunde gesprochen hatte.
1 Akademie für angewandte Künste in Wien
2 Trinkgeld
2.
Dienstag, 18. Februar, nach 18 Uhr
Helmut Wallner blickte zum Faxgerät, das bereits vor einer Minute leise zu schnurren begonnen hatte. Wahrscheinlich befand sich unter den eingehenden Meldungen auch jene vertrauliche Information, die ihm vorhin von Major Engeler vom Verfassungsschutz telefonisch angekündigt worden war.
Der nunmehrige Chefinspektor war seit Jahresanfang stellvertretender Abteilungsleiter im Landeskriminalamt.
Vorher hatte er als Oberinspektor die Kriminalpolizei am Kommissariat Döbling auf der Hohen Warte geleitet.
Diesen interessanten, für sein Alter nicht selbstverständlichen beruflichen Werdegang verdankte der noch nicht 40-Jährige vor allem seiner selbst von seinen Gegnern anerkannten Tüchtigkeit.
Zu einem gewissen Grad hatte bei seinem Aufstieg natürlich auch das Glück seine Hand im Spiel gehabt. Er war eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, wie es so schön hieß.
Nun gut, mit diesem Makel konnte Wallner leben. Ohne etwas Glück ging im Leben überhaupt nichts.
Dass es allerdings böse Mäuler gab, die seine Freundschaft mit Mario Palinski und dessen gute Kontakte zum Innenministerium als sein eigentliches Glück bezeichneten, machte den Chefinspektor ganz schön sauer. Obwohl, na egal, was half schon langes Nachdenken.
Er war nun einmal, wer und was er war, und damit basta. Wer Probleme damit hatte, konnte ihm den Buckel runterrutschen.
Derartige leichte Anflüge von Unsicherheit waren bei Wallner selten und meistens auch rasch wieder vorüber. So auch jetzt.
Er war gut in seinem Job und hatte den Karrieresprung sehr wohl verdient, sagte er sich. Und damit nochmals basta.
Das wiedergewonnene Selbstbewusstsein war auch äußerlich erkennbar. Wallner setzte sich ganz gerade, bog den Rücken durch und straffte sich, vor allem innerlich. Dann stand er auf, ging zu dem inzwischen wieder verstummten Faxgerät und nahm die zuletzt eingegangene Meldung an sich.
Terroristische Zelle in Gemeindebau in Simmering entdeckt!, Scharfe Handgranate aus Tschetschenien auf Kinderspielplatz der russischen Botschaft gefunden! oder Anschlagserie bei Weltcup-Finale in Saalbach befürchtet! und ähnliche unerfreuliche bis beschissene Meldungen gingen tagaus, tagein von mehr oder weniger befreundeten zivilen und militärischen Geheimdiensten und anderen mehr oder weniger zuverlässigen Quellen ein.
Dabei war das, was den Dienststellen außerhalb des Amtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung regelmäßig mitgeteilt wurde, bereits das Ergebnis einer mehrfachen, nach strengen Kriterien erfolgten Filterung. Kein Wunder, dass bei diesen Unmengen an Verdachtsmomenten, Vermutungen und noch nicht realisierter Tatsachen die Gefahr des Abstumpfens bzw. des Nichternsttnehmens immer neuer Schreckensvisionen ziemlich groß war.
Dazu kam noch das zwar längst obsolete, aber nach wie vor im Lande stark verbreitete Gefühl, sich auf einer Insel der Seeligen zu befinden. Daraus wollte man ableiten, dass einem hier nichts passieren konnte.
Sicher, die weltpolitische Bedeutung des Landes war kaum geeignet, sich unmittelbar den Zorn terroristischer Gruppen zuzuziehen.
Aber es ging ja nicht nur darum, kein direktes Ziel terroristischer Aktivitäten zu sein, sondern genügte vollauf, wenn sich ein solches Ziel zeitweise im Land befand.
Soll heißen, dass es für die Opfer völlig egal war, ob ein Häuserblock in die Luft flog und sie dabei starben, weil irgendeine Gruppierung einen Zorn auf Österreich hatte oder nur auf eine Person, die sich unglücklicherweise gerade in diesem Gebäudekomplex aufhielt.
Und prominente Besucher, darunter solche, die man da und dort, aus welchen Gründen auch immer, lieber tot gesehen hätte, gab es ja das Jahr über genug in diesem Lande.
Halt, da hätte Wallner fast etwas Ungewöhnliches überlesen. Eine Warnung, die man nicht alle Tage zu sehen bekam: »Mafiaterror befürchtet – Camorra-Killer unterwegs nach Österreich?«
In Sizilien, Neapel oder auch in New York und Los Angeles hätte die Warnung vor einem Verbrechen der Mafia nicht weiter erstaunt. Für die Alpenrepublik erschien sie dem Chefinspektor instinktiv so unwahrscheinlich, ja absurd, dass er unwillkürlich lächeln musste.
Gegen wen sich der Zorn der ›Ehrenwerten Gesellschaft‹ richtete, war allerdings nicht bekannt. Noch nicht, hoffentlich.
Er nahm sich vor, Mario Palinski, dem Mafiaspezialisten im Freundeskreis, von diesem Wahnwitz zu berichten.
Und zwar übermorgen, ja, übermorgen war gut. Am Mittwochabend, nach der vom Institut für Krimiliteranalogie am Semmering veranstalteten ›Mörderischen Diskussionsrunde‹ würde sich gewiss die Gelegenheit dazu ergeben.
Immerhin war der Chefinspektor als Diskussionsteilnehmer auf dem Podium vorgesehen, und das neben bekannten Krimi-Autoren, Regisseuren und Schauspielern.
Übrigens, die gesamte Veranstaltung sollte auch im Fernsehen übertragen werden. Sogar live. Obwohl sich Wallner nicht für eitel hielt, musste er zugeben, schon ein wenig stolz darauf zu sein, dass man auch ihn dazu gebeten hatte.
*
Diesen Anblick würde Palinski wohl nie mehr in seinem Leben vergessen. Der Tod hatte István Lalas im wahrsten Sinne des Wortes mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Der Journalist aus Budapest hockte total verschwitzt und zusammengesunken auf dem Thron im letzten Häusl vor Zugschluss. Unter- und Oberhose hingen, ineinander verknäuelt, um die Knöchel der nackten, erstaunlich kräftigen Beine. Die gebrochenen Augen des Toten starrten ungläubig, aber auch ein wenig vorwurfsvoll zur Decke, und aus dem linken Mundwinkel suchte sich der Speichel eine feuchte Spur übers Kinn.
Da die beiden vom Zugsführer alarmierten Gloggnitzer Polizisten keinerlei Anzeichen für einen unnatürlichen Tod gefunden hatten, gaben sie den Leichnam zum Abtransport frei.
»Jo, jo«, meinte der ältere der beiden Rotkreuzfahrer, die den Leichnam abtransportieren sollten, »das kommt ma bekannt vor. Das hamma schon vor Jahren ghabt. Verstopfung, der Arme muss drucken wie varruckt. Bei der Anstrengung platzt ein Aderl im Kopf und bumm – aus is!«
»Genau«, bestätigte der zweite, »und der Herr war ja doch schon a bisserl in die Jahre. So schnell kanns manchmal gehn. Beim Durchfall kann des net passieren. Ich kenn da einen Fall, und zwar …«
»Alles gut und schön!«, meinte der Zugsführer, dem das Ganze langsam zu viel wurde. »Ihre Diagnose in Ehren, aber jetzt haltens doch endlich die Goschn, die Herren!«
Die beiden schienen von der groben Abfuhr nicht sonderlich betroffen zu sein. Im Gegenteil, sie unterbrachen ihr Gespräch für ein beiläufiges: Alsdann, schönen Abend noch. Dann entfernten sie sich und den Leichnam, weiter munter plaudernd, aus dem Zug.
Inzwischen hatte sich eine Verspätung von etwas mehr als einer halben Stunde zusammengeläppert. Nicht schlimm, denn der großzügig bemessene Fahrplan bot jede Menge Zeitreserven. Palinski war froh, dass nichts auf einen unnatürlichen Tod des ungarischen Journalisten hingewiesen hatte. Denn das hätte eine zumindest mehrstündige Verspätung und damit ein totales Durcheinander des Ablaufes bedeutet.
Obwohl Mario selbst gar nicht sicher war, dass bei István Lalas’ Tod alles mit rechten Dingen zugegangen war.
Falls tatsächlich etwas nicht stimmen sollte, so würde die in solchen Fällen zwingend vorgesehene Autopsie der Leiche das schon an den Tag bringen.
Je länger er darüber nachdachte, desto seltsamer kamen ihm die Umstände vor, unter denen Lalas gestorben war. Palinski wusste zwar nichts über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes. Und daher auch nichts über seine speziellen Verhaltensmuster beim Klogang. Aber irgendwie eigenartig war es schon, dass sich der Ungar das Sakko seines Anzuges nicht ausgezogen und auf den dafür vorgesehenen Haken aufgehängt hatte, ehe er Platz genommen hatte.
Nicht, dass das zwingend zu erwarten gewesen wäre oder irgendeine Statistik aussagte, dass alle Männer ihre Jacke auszogen, ehe sie ihr großes Geschäft in Angriff nahmen. Nein, das nicht. Aber bitte, so ein Verhalten, nämlich das Kacken im Sakko, widersprach doch jeder Erfahrung. Und jedem noch so geringen Empfinden für Stil. Noch dazu in dem überheizten kleinen Örtchen.
István war auch total verschwitzt gewesen. Kein Wunder, schließlich ging man ja auch nicht mit Pullover in die Badewanne.