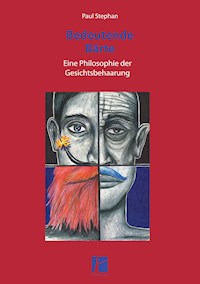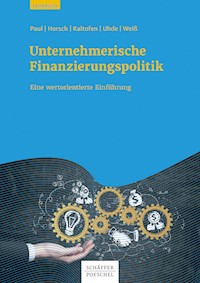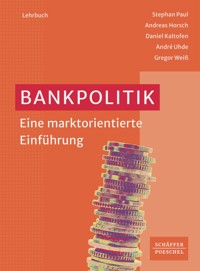
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das anwendungsorientierte Lehrbuch zum Thema Bankpolitik richtet den Fokus auf eine marktorientierte Gestaltung der Leistungen eines Kreditinstituts. Ausgehend von der Marktstruktur und den Marktprozessen werden Marktrisiken, Marktregeln und die Steuerung des Markthandelns betrachtet. Als Teil der Marktregeln wird auch die externe Regulierung durch die Aufsichtsbehörden beleuchtet. Didaktisch hervorragend entlang des Curriculums in Modulen aufgebaut, werden die zentralen Inhalte mit Einführungsbeispiel, Praxisbeispielen sowie zahlreichen Abbildungen veranschaulicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1422
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumVorwort 1 Marktorientierung als Leitperspektive der BankpolitikModul 1: Einführung in Märkte, Unternehmungen und Unternehmerfunktionen1.1 Der Grundgedanke der Marktorientierung1.2 Märkte und Unternehmungen als Institutionen1.3 Unternehmer als Gestalter von Unternehmungen und Treiber von MarktprozessenModul 2: Existenzbegründung von Banken als Intermediären in Finanzmärkten2.1 Die Grundprobleme auf Finanzmärkten und traditionelle Erklärungsversuche für Banken2.2 Neuere Existenzerklärungen für die Institution »Bank«2.2.1 Verringerung von Transaktionskosten2.2.2 Finanzintermediation zur Bewältigung der Probleme asymmetrischer Informationsverteilungen2.3 Bank- als besondere Dienstleistungen2.4 Das Entstehen alternativer Unternehmungen der Finanzintermediation2.4.1 Digitalisierung und FinTechs2.4.2 Big Data und Big TechsModul 3: Bankpolitik in einzel- und gesamtwirtschaftlicher Perspektive3.1 Bankpolitik als zielorientierte Gestaltungsaufgabe der Bankunternehmer3.1.1 Wertschaffung als Ziel der Bankpolitik3.1.2 Die Ausübung von Unternehmerfunktionen bei der marktorientierten Gestaltung des Geschäftsmodells3.2 Bankpolitik als Vorgabe spezifischer Marktregeln durch Staat und Notenbank2 Marktprozesse beim Absatz von Bankleistungen und ihre LenkungModul 4: Strategische Absatzpolitik der Bank: Grundausrichtung des Geschäftsmodells4.1 Die Suche nach Wettbewerbsvorteilen als Kern der Strategiekonzeption für marktorientiertes Handeln4.2 Marktstruktur und Marktregeln als externe Determinanten der Wertschaffungsidee von Banken (»Market-based View«)4.2.1 Abgrenzung des relevanten Marktes4.2.2 Kunden- und Wettbewerbssegmentierung4.2.3 Die Zentralnotenbank als zusätzlicher Akteur und Regelsetzer4.3 Unternehmungsstruktur und -regeln als interne Einflussgrößen auf die Wertschaffungsidee von Banken (»Resource-based View«)4.3.1 Von Ressourcen zu strategisch bedeutsamen Kompetenzen4.3.2 Besondere Bedeutung und Generierung von Wissensinnovationen4.3.3 Unternehmenskultur und interne Regeln4.4 Kombination der externen und internen Determinanten bei der marktorientierten Ausrichtung der Wertschaffungsidee von Banken4.4.1 Notwendigkeit einer integrativen Nutzen/Kosten-Sicht4.4.2 Ansatzpunkt Nettonutzen des Kunden4.4.3 Ansatzpunkt Kostenposition der Bank4.4.4 Ansatzpunkt zeitliche Dimension der Geschäftsbeziehung4.5 Management der Wettbewerbsvorteile im ZeitverlaufModul 5: Operativer Einsatz absatzpolitischer Instrumente durch die Gestaltung von Markt- und Unternehmensprozessen5.1 Eingrenzung des absatzpolitischen Instrumentariums und seiner Einsatzgebiete5.2 Marktforschung zur Vorbereitung des Einsatzes absatzpolitischer Instrumente5.3 Preispolitik5.3.1 Grundlagen und Ziele5.3.2 Preispolitische Strategien5.3.2.1 Preisdifferenzierung5.3.2.2 Preiskomposition5.4 Leistungs-/Produktpolitik5.4.1 Grundlagen und Ziele5.4.2 Teilinstrumente5.4.2.1 Programm-/Sortimentspolitik5.4.2.2 Marken(politik)5.5 Distributionspolitik5.5.1 Grundlagen und Ziele5.5.2 Teilinstrumente5.5.2.1 Wege der Distribution5.5.2.2 Orte der Distribution5.5.2.3 Zeiten der Distribution5.6 Kommunikationspolitik5.6.1 Grundlagen und Ziele5.6.2 Teilinstrumente5.6.2.1 Adressatenspezifische leistungsbezogene Kommunikationspolitik5.6.2.2 Adressatenunspezifische leistungsbezogene Kommunikationspolitik5.6.2.3 Adressaten- und leistungsunspezifische Kommunikationspolitik5.7 Personalpolitik5.7.1 Grundlagen und Ziele5.7.2 Teilinstrumente3 Marktrisiken des Bankhandelns und ihre BeherrschungModul 6: Marktpreisrisiken6.1 Definition, Entstehung und Klassifikation von Marktpreisrisiken6.2 Traditionelle risikospezifische Mess- und Steuerungsverfahren – Das Beispiel Zinsänderungsrisiken6.3 Moderne Verfahren zur einheitlichen Messung von Marktpreisrisiken6.3.1 Identifikation von Risikofaktoren und Risikomapping6.3.2 Bestimmung von Gewinn- und Verlustverteilungen6.3.3 Auswahl der geeigneten Risikomaße: Value at Risk und Expected Shortfall6.4 Strategien zur Steuerung von Marktpreisrisiken im Überblick6.5 Derivate als Absicherungsinstrumente gegen Marktpreisrisiken6.5.1 Forwards und Futures6.5.2 Swaps6.5.3 OptionenModul 7: Bonitätsrisiken7.1 Arten und Ausprägungen von Bonitätsrisiken in Banken7.2 Messung von Bonitätsrisiken7.2.1 Unterscheidung in erwartete und unerwartete Verluste7.2.2 Zentrale Parameter des erwarteten Verlusts7.2.3 Quantifizierung unerwarteter Verluste mit dem Credit-Value-at-Risk-Konzept7.2.4 Ratings als Instrument der Messung von Bonitätsrisiken einzelner Positionen7.2.5 Modelle zur Messung des Bonitätsrisikos auf Portfolioebene7.3 Steuerung und Kontrolle von Bonitätsrisiken7.3.1 Einzelgeschäftsbezogenes Management7.3.2 Gesamtgeschäftsbezogenes ManagementModul 8: Operationelle Risiken8.1 Operationelle Risiken als arteigene Wertrisiken8.2 Herausforderungen der Identifikation und Messung operationeller Risiken8.3 Ansätze zur Steuerung operationeller RisikenModul 9: Liquiditätsrisiken9.1 Bedeutung und Systematisierung von Liquiditätsrisiken9.2 Klassische Dispositionsregeln als Impulsgeber für das Liquiditätsmanagement9.2.1 Goldene Bankregel und Strategie der Risikovermeidung9.2.2 Bodensatztheorie, Bestimmung von Liquiditätssalden und Diversifikation der Refinanzierung9.2.3 Shiftability Theory und Verknüpfung von Zahlungsmittel- und Erfolgsebene9.2.4 Maximalbelastungstheorie, Stresstests und Eigenkapitalvorsorge4 Marktregeln und -aufsicht zur externen Beeinflussung des BankhandelnsModul 10: Krisen als Impulsgeber von Bankenregulierung und -aufsicht10.1 Konzeptionelle Grundfragen der Regulierung10.1.1 Ziele, Stakeholder und Prüfkriterien der Regulierung10.1.2 Ausgestaltungsoptionen der Marktregeln10.2 Krisengetriebene Entwicklung zum realen Normengerüst und institutionellen Rahmen der Bankenregulierung10.2.1 Weltwirtschaftskrise 1929, deutsche Bankenkrise 1931 und Anfänge der »modernen« Bankenregulierung10.2.2 Globalisierungskrisen der 1970er Jahre und Internationalisierung der Regulierung – Basel I10.2.3 Nationale Bankenkrisen der 1980er/90er Jahre, Krise und Ausbau der Regulierung – Basel II10.2.4 Globale Finanzkrise ab 2007 und Verschärfung der Regulierung – Basel III/IV10.2.4.1 Die drei Phasen der Finanzkrise ab 200710.2.4.2 Die regulatorische Antwort auf die Finanzkrise: Basel III10.2.4.3 Finalisierung von Basel III oder Basel IV?10.2.4.4 Institutionelle Neuerungen in der Bankenunion10.2.5 Klimakrise und neuer Regulierungsfokus – Basel IV/V?Modul 11: Zentrale Regulierungs- und Aufsichtsnormen für Bankrisiken11.1 Regulierung von Kreditausfallrisiken11.1.1 Vorbemerkungen11.1.2 Kreditrisikostandardansatz (KSA)11.1.3 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA)11.1.4 Regulatorische Behandlung von Kreditrisikominderungen11.2 Regulierung von Marktpreisrisiken11.2.1 Vorschriften bis zum Inkrafttreten der CRR III11.2.1.1 Vorbemerkungen11.2.1.2 Standardansatz11.2.1.3 Internes Marktrisikomodell11.2.2 Ausblick auf die zukünftigen Mindestanforderungen für die Eigenmittelunterlegung von Marktpreisrisiken11.2.2.1 Trennschärfere und objektivere Zuordnung von Marktrisikopositionen zum Handels- und Anlagebuch11.2.2.2 Erhöhung der Relevanz und Risikosensitivität des Standardansatzes11.2.2.3 Weiterentwicklung der Anforderungen an bankinterne Marktrisikomodelle11.3 Regulierung von operationellen Risiken11.3.1 Ansätze zur Messung und Unterlegung des operationellen Risikos mit Eigenmitteln vor Inkrafttreten der CRR III11.3.1.1 Basisindikatoransatz (BIA)11.3.1.2 Standardansatz (STA) und Alternativer Standardansatz (ASA)11.3.1.3 Fortgeschrittene Messansätze (AMA)11.3.2 Neuer Standardansatz (SMA) nach Inkrafttreten der CRR III11.4 Regulierung von Liquiditätsrisiken11.4.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR)11.4.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR)11.4.3 Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)Modul 12: Ausstrahlung der Bankenregulierung und -aufsicht12.1 Das Grundproblem des »Regulatory Footprint«12.2 Ausstrahlung der Regulierung von Bank- auf die Regulierung von Versicherungsintermediären12.2.1 Grundlagen der Versicherungsintermediation und -regulierung12.2.2 Regelsysteme der Versicherungsregulierung12.2.3 Handlungssysteme der Versicherungsregulierung12.3 Ausstrahlung der Regulierung von Bank- auf die Regulierung von Informationsintermediären12.3.1 Grundlagen der Informationsintermediation12.3.2 Rating-basierte vs. rating-gerichtete Regelsysteme12.3.3 Handlungssysteme der rating-gerichteten Regulierung12.4 Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung auf die (Regulierung der) Einlagensicherung12.5 Weitere Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung?5 Markthandeln der Bank – Abbildung, Koordination und KommunikationModul 13: Internes Rechnungswesen13.1 Adressaten des Internen Rechnungswesens13.2 Ziele des Internen Rechnungswesens13.3 Bankspezifika und Konsequenzen für das Interne Rechnungswesen13.4 Verfahren des Internen Rechnungswesens13.4.1 Zinsergebnisrechnung13.4.1.1 Traditionelle Ansätze13.4.1.2 Grundmodell der Marktzinsmethode13.4.1.3 Barwertkonzept der Marktzinsmethode13.4.2 Kalkulation weiterer Erfolgskomponenten13.4.2.1 Risikoergebnis13.4.2.2 Produktivitätsergebnis13.4.2.3 Eigenkapitalkosten13.4.3 Aggregation von ErgebnisbeiträgenModul 14: Externes Rechnungswesen14.1 Adressaten und Ziele des Externen Rechnungswesens14.2 Banktypische Handlungsschwerpunkte und Konsequenzen für das Externe Rechnungswesen14.3 Zentrale Ansatz- und Bewertungsvorschriften zur Abbildung des Bankhandelns14.3.1 Bankspezifische nationale Regeln im HGB14.3.2 Für Banken bedeutende Normen in den internationalen Regeln der IFRSModul 15: Elemente einer wertorientierten Banksteuerung15.1 Ziel, Aufgaben und Limitationen einer wertorientierten Banksteuerung15.2 Traditionelle Verfahren der Rentabilitätsanalyse15.3 Perspektiven der Risikotragfähigkeitsanalyse15.4 Messung von risikoadjustierter Performance und Wertschaffung15.5 Koordination und Kommunikation der Wertschaffung15.6 Corporate Governance als Rahmen der BanksteuerungLiteraturverzeichnisAutorenIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Version Ihres Buches zugreifen zu können
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-4633-4
Bestell-Nr. 10355-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-4634-1
Bestell-Nr. 10355-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-4635-8
Bestell-Nr. 10355-0150
Stephan Paul/Andreas Horsch/Daniel Kaltofen/André Uhde/Gregor Weiß
Bankpolitik
1. Auflage 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): © Zocha_K, iStock
Produktmanagement: Anna Pietras
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Die Kreditwirtschaft befindet sich in ihrem wohl tiefgreifendsten Umbruch seit Jahrzehnten. Nahezu zeitgleich mit dem Ausbruch der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit als säkularem Einschnitt begann 2007 mit der Einführung des Smartphones eine digitale Revolution des Absatzes (auch) von Bankleistungen. Dieser Bereich ist durch den seit einigen Jahren zunehmenden Nachhaltigkeitsfokus sowie die rasante Entwicklung der Künstliche Intelligenz (KI)Künstlichen Intelligenz einem erneuten Wandel unterworfen, der Banken ebenso wie ihre Kunden grundlegend herausfordert. Die auf Ebene des Gesamtmarkts beobachtbaren Transformationsprozesse werfen zum einen die einzelwirtschaftliche Frage auf, welche Konsequenzen eine Bank für ihr Handeln hieraus ziehen sollte. Zum anderen stellt sich in gesamtwirtschaftlicher Perspektive die Frage nach notwendigen Anpassungen der Marktregeln durch den Staat.
Dieses Buch nimmt daher die »Bankpolitik« in den Blick und betrachtet sie sowohl aus einer Mikro- als auch einer Makrosicht. In einzelwirtschaftlicher Perspektive beschreibt der Begriff die zielorientierte Gestaltung des Bankhandelns. Damit sind sämtliche Maßnahmen angesprochen, die in einem Kreditinstitut ergriffen werden, um durch Ausübung der Unternehmerfunktionen sowie unter Beachtung von externen und internen Regeln die gesetzten Ziele zu erreichen. In gesamtwirtschaftlicher Perspektive – und diese spielt angesichts der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Kreditwirtschaft eine besondere Rolle – meint Bankpolitik die Vorgabe und Durchsetzung spezifischer Marktregeln durch Staat und Notenbank. Die Institution Bank ist also im ersten Fall selbst handelndes Subjekt, im zweiten Fall Objekt darauf gerichteter Handlungen anderer Institutionen. Diese Doppelperspektive der Bankpolitik und die sich daraus ergebenden, branchenspezifischen Problemstellungen haben uns motiviert, sie zum Mittelpunkt eines neuen Lehrbuchs zu machen.
Für unsere Darstellung der Bankpolitik wählen wir einen »marktorientierten« Zugang:
Teil 1 (Module 1 bis 3) führt auf institutionenökonomischer Basis in die zentralen Konzepte der Märkte, Unternehmungen und Unternehmerfunktionen ein, stellt Ansätze zur Begründung von Banken als Intermediären in Finanzmärkten dar und gibt einen Überblick über die Bankpolitik in einzel- und gesamtwirtschaftlicher Perspektive.
Die Marktprozesse beim Absatz von Bankleistungen und deren Lenkung sind dann Inhalt des Teils 2. Die Module 4 und 5 gehen sowohl auf die strategische (Grundausrichtung des Geschäftsmodells) als auch operative (Instrumenteneinsatz) Dimension der Absatzpolitik ein und bilden dem marktorientierten Konzept gemäß einen ersten Schwerpunkt des Buches.
Auf die mit dem Handeln in Märkten verbundenen Risiken und die Möglichkeiten ihrer Messung und Steuerung stellt Teil 3 ab. Die Module 6 bis 9 sind daher vor allem Marktpreis- und Bonitäts- sowie operationellen und Liquiditätsrisiken gewidmet.
Ein zweiter Schwerpunkt des Buches liegt auf der Darstellung und Diskussion von Marktregeln und -aufsicht als externer Beeinflussung des Bankhandelns im Teil 4. Dabei werden die zentralen Normen mit Blick auf banktypische Risiken zwar nur komprimiert dargestellt (Modul 11), zuvor jedoch Bankenkrisen als Impulsgeber der Regulierung aufgearbeitet (Modul 10) sowie anschließend Konsequenzen und Wechselwirkungen der Bankenregulierung diskutiert (Modul 12).
Das Markthandeln der Bank bedarf schließlich der (zahlenmäßigen) Abbildung, Koordination und Kommunikation (Teil 5). Die Module 13 und 14 gehen auf die Informationsgrundlagen des Internen und Externen Rechnungswesens mit Fokus auf bankbetrieblichen Spezifika ein, bevor im Modul 15 die Elemente einer der Wertorientierung als Oberziel folgenden Steuerung der Bank zusammengestellt werden.
Auch wenn es angesichts von Vielfalt und Komplexität der unter die Bankpolitik fallenden Problemstellungen immer schwieriger ist, sie in zwei Buchdeckel zu fassen, haben wir uns um einen möglichst kompakten Überblick in Form dieser 15 Module bemüht, bei dem die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis ebenso wie qualitative Aussagen und ihre Formalisierung in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Zu Beginn der Module finden sich jeweils deren »Zentrale Inhalte«, nach denen geordnet die wichtigsten Inhalte am Schluss noch einmal in knapper Form »Auf den Punkt gebracht« werden.
Angesichts unseres Ansatzes, die Themenbereiche der Bankpolitik vollständig sowie in marktorientierter Perspektive zu behandeln, lohnt sich für einen abgerundeten Blick die Lektüre weiterer, zum Teil konzeptionell anders angelegter, mitunter auch auf andere Finanzsysteme ausgerichteter Schriften. Deutschsprachige Bücher mit dem Titel »Bankpolitik« liegen bereits lange zurück (Obst 1909; Somary 1915; Rittershausen 1956; Feldbausch 1969; Stützel 1983), sind allerdings insofern interessant, als sie historische Abrisse der Entwicklung des deutschen Bankensystems ermöglichen. Die marktorientierte Perspektive wurde in Ansätzen auch schon in Süchting/Paul 1998 und Büschgen/Börner 2003 verfolgt. In Deutschland ist für den Themenbereich der »Bankbetriebslehre« das Buch von Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber 2019 das Standardwerk. Ihre Behandlung insbesondere der Theorie der Intermediation, aber auch von Risikomanagement und Regulierung ist deutlich weitergehend als in dieser Einführung, im Gegenzug dazu steht die Absatzpolitik eher im Hintergrund. Ausführungen primär zu den Bereichen Bankkalkulation, Risikomanagement und Regulierung finden sich im Lehrbuch von Baule 2019, grundlegend zu Ertrags- und Risikomanagement sind unverändert die Arbeiten von Schierenbeck und Schülern (stellvertretend die Bände von Schierenbeck/Lister/Kirmße 2009 und 2014). International gibt es vergleichsweise wenige umfassende Lehrbücher zum »Banking«, für einzelne Module zu empfehlen sind aber Koch/MacDonald 2014, Greenbaum/Thakor/Boot 2019, Rose/Hudgings 2024, sowie das umfangreiche Handbuch von Berger/Molyneux/Wilson 2019.
Die Vorlagen für die Module dieses Buchs wurden federführend von Stephan Paul und Andreas Horsch erarbeitet – mit Ausnahme von Teilen des Moduls 6 (Gregor Weiß) sowie der Module 7 (Daniel Kaltofen) und 11 (André Uhde). Dabei haben wir eine sehr intensive Unterstützung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren. Besonders zu nennen sind dabei auf Bochumer Seite Jonas Ewertz und Maximilian Minz, in deren Händen die Gesamtkoordination und Verlagsabstimmung lagen und die sich zudem kenntnisreich, konstruktiv und umsichtig aller inhaltlichen und formalen Themenstellungen und Aktualisierungen bis zum Redaktionsschluss am Jahresende 2023 angenommen haben, wofür wir ihnen sehr herzlich danken. Unser Dank gilt ebenso in Freiberg Leo Mittelstaedt, Anja Rößger, Stefanie Storch und Maximilian Traun, in Leipzig Dr. Simon Fritzsch, Fleming Schmidt-Skipiol und Jana Tietze sowie in Paderborn Stephanie Heuwinkel, Laura Weigelt und Max Hoormann.
Herzlich danken möchten wir auch dem Team des Schäffer-Poeschel Verlags: Frau Marita Rollnick-Mollenhauer hat uns in der Anfangsphase ermutigt, die Idee eines neuen Lehrbuchs zur Bankpolitik zu verwirklichen, daran anknüpfend haben Frau Anna Pietras und Frau Heike Münzenmaier mit viel Verständnis dafür gesorgt, dass wir unsere Ideen tatsächlich umsetzen konnten.
Die in diesem Buch vielfach gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlechter.
Wir hoffen, dass unsere Einführung in die Bankpolitik sowohl eine Orientierungshilfe für Studierende in einem immer komplexeren Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre als auch eine nützliche Unterstützung für in der Praxis Tätige ist und sich das Buch insofern als hinreichend »marktorientiert« erweist.
Bochum, Freiberg, Paderborn und Leipzig, im April 2024
Stephan Paul, Andreas Horsch, Daniel Kaltofen, André Uhde, Gregor Weiß
1 Marktorientierung als Leitperspektive der Bankpolitik
Modul 1: Einführung in Märkte, Unternehmungen und Unternehmerfunktionen
Zentrale Inhalte
Ausrichtung von Unternehmungen auf den Markt
Neoklassische versus evolutorische Wirtschaftstheorie
Institutionenökonomische Perspektive auf Märkte und Unternehmungen
Erklärung des Entwicklungspfades von Unternehmungen über Unternehmerfunktionen
Unter der »MarktorientierungMarktorientierung« einer Unternehmung versteht man das Aufnehmen von Impulsen der beteiligten Marktparteien, deren Verarbeitung in der Unternehmung und anschließend in entgegengesetzter Richtung das Aussenden von Impulsen an die MarktspielerUnternehmerfunktionen.
1.1 Der Grundgedanke der Marktorientierung
Mit dem Aufnehmen und Aussenden von Impulsen besitzt die Marktorientierung eine Außen- und eine Innenperspektive, die sinnvoll miteinander zu verknüpfen sind (vgl. Freiling/Reckenfelderbäumer 2010, S. 7): Die marktlichen Gegebenheiten müssen erkundet, möglichst Nettonutzennutzenschaffende Angebote für Kunden entwickelt und diese wiederum an die Märkte transportiert werden, damit sich die Unternehmung (hier gleichgesetzt mit dem Unternehmen) im Wettbewerb behaupten kann. Die Integration dieser Perspektiven erfordert das gleichzeitige Verfolgen zweier Ziele. Zum einen sind wirksame Lösungen für Kundenprobleme zu erarbeiten. Verfehlt die Unternehmung dieses EffektivitätEffektivitätsziel, verliert sie ihre Existenzberechtigung. Zum anderen muss sie diese Lösungen möglichst wirtschaftlich erstellen. Ein ungünstiges Input/Output-Verhältnis der für die Leistungserstellung eingesetzten Mittel verstößt gegen das EffizienzEffizienzziel und gefährdet die Wertschaffung als Grundlage der Unternehmenssicherung (vgl. ausführlich Module 3 und 4).
Dieses Agieren der Unternehmung in den für sie relevanten Märkten muss daher systematisch geplant, gesteuert und kontrolliert werden. Am Beginn des Lebenszyklus einer Unternehmung fällt diese Aufgabe der Gründerpersönlichkeit zu, welche in der Regel die entscheidende Idee hat, warum die Unternehmung in die Wettbewerbsarena einsteigen sollte und wie sie sich darin bewähren kann. Doch dieser (hier und im Folgenden genderneutral zu verstehende) »Unternehmer« gestaltet das weitere Schicksal der Unternehmung nicht allein. Um ihre Existenz zu sichern, übernehmen im Zeitverlauf weitere Menschen unternehmerische Funktionen, wie z. B. die Entwicklung neuer Produkte oder die Erschließung innovativer Vertriebswege. Dabei erweist sich die fortwährende Aufrechterhaltung der Marktorientierung als zentral für das Fortbestehen einer jeden Unternehmung (vgl. Freiling/Reckenfelderbäumer 2010, S. 3).
Diese Marktorientierung steht daher auch im Zentrum der folgenden Überlegungen. Bei dem ausgewählten Betrachtungsobjekt – den Banken – gibt es jedoch eine Reihe von Besonderheiten, die aus den von ihnen angebotenen Leistungen resultieren und die Struktur ihrer Märkte, die sich dort vollziehenden Prozesse und die hierauf einwirkenden Regeln (regulatorische Rahmenbedingungen) bestimmen. Um diese Spezifika zu erkennen und dann im Handeln zu berücksichtigen, ist zunächst ein allgemeines Grundverständnis der Rolle und Bedeutung von Märkten, Unternehmungen und Unternehmern notwendig – dem dient dieses erste Modul. Darauf aufbauend kann dann fokussiert gefragt werden, welche Begründung es für die Existenz speziell von Banken auf Finanzmärkten gibt. Diese Frage ist nicht nur in theoretischer Hinsicht, sondern aktuell auch ganz praktisch von großer Bedeutung. Denn die Finanzbranche befindet sich derzeit in ihrem wohl tiefgreifendsten Umbruch seit Jahrzehnten, bei dem etablierte Kreditinstitute vor allem durch überwiegend digital agierende Anbieter herausgefordert, ihre Geschäftsmodelle bedroht werden (vgl. Modul 2). Diese auf Ebene des Gesamtmarkts beobachtbare TransformationsleistungTransformation wirft zum einen die einzelwirtschaftliche Frage auf, welche Konsequenzen eine Bank für ihr Handeln hieraus zieht. Zum anderen stellt sich in gesamtwirtschaftlicher Perspektive die Frage nach möglicherweise notwendigen Anpassungen der Marktregeln durch den Staat. In Modul 3 wird daher mit der Mikro- und Makrosicht die Doppelperspektive der Bankpolitik diskutiert.
1.3 Unternehmer als Gestalter von Unternehmungen und Treiber von Marktprozessen
Erst in einer prozessorientierten Perspektive wird – mit der Betrachtung von Unternehmungsprozessen – auch das Unternehmertum relevant. Galten Wirtschaftssubjekte in der neoklassischen Theorie noch als eine Art »Handlungsautomaten«, die sich an einer schwer fassbaren (Nutzen-)Optimierung ausrichten, setzt die evolutorische Blickrichtung an einem menschlichen Entscheider und Handelnden an (zurückgehend insbesondere auf von Mises 1940, S. 11 ff.; Findigkeitprägnant auch Kirzner 1997, S. 35: »Either Entrepreneurship or Equilibrium«). Daraus folgt jedoch unmittelbar die Frage, wodurch sich unternehmerisches Handeln auszeichnet bzw. wie Unternehmertum gefasst werden kann. Als wesentliches Element ist von Kirzner hier die Aufmerksamkeit für sich (neu) bietende Opportunitäten herausgearbeitet worden, für die er den Begriff der »Alertness« oder »FindigkeitFindigkeit« in Bezug auf Wissen geprägt hat (vgl. Kirzner 1978, S. 30 ff., 1988, S. 18, 1997, S. 36 ff.). Damit wird bereits erkennbar, dass Unternehmer nicht abgrenzbar sind als bestimmte Gruppe von Menschen, die sich u. U. durch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder Verhaltensmuster auszeichnen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass jeder Akteur Unternehmer in eigener Sache, also hinsichtlich seines Wissens, seiner Arbeitskraft und seines sonstigen Vermögens ist (vgl. m. w. N. Schneider 2011, S. 59). Wettbewerbsentscheidend sind daher »Marktteilnehmer […], die gegenüber wechselnden Einkaufs- und Verkaufsmöglichkeiten findig sind. […] Der wettbewerbliche Marktprozeß ist seiner Natur nach unternehmerisch. […] Unser Verständnis von dem wettbewerblichen und zugleich unternehmerischen Charakter des Marktprozesses lehrt uns, daß die beiden Begriffe Wettbewerb und Unternehmertum […] analytisch untrennbar sind. […] Man kann auch anders herum sagen, daß Unternehmertum wesentlicher Bestandteil des wettbewerblichen Marktprozesses ist.« (Kirzner 1978, S. 12 f.)
Eine geschlossene »Theorie des Unternehmertums« hat sich bislang indes nicht herausbilden können (Reckenfelderbäumer 2001, S. 423 ff.; Freiling/Reckenfelderbäumer 2010, S. 299, dort auch ein Überblick älterer Literaturansätze). Die grundlegende Erkenntnis, dass im Falle von »Unternehmern […] nicht Menschen, die sich von anderen Menschen dadurch unterscheiden, dass sie eine besondere Funktion erfüllen, sondern eine Funktion, die jeder […] auf sich nehmen muss« (von Mises 1940, S. 246) gemeint ist, legt aber immerhin einen Ansatz über die Untersuchung von Funktionen nahe, die von einem »Unternehmer« typischerweise wahrgenommen werden. Hier setzt die von Dieter Schneider entwickelte Lehre von den Unternehmerfunktionen an. Auf eine »Betriebswirtschaftslehre als Einzelwirtschaftstheorie der Institutionen« (Schneider 2011) angelegt, arbeitet dieser nachfolgend knapp dargestellte Ansatz einen hierarchisch geordneten Dreiklang von Unternehmerfunktionen – Einkommens-, Arbitrage- und Koordinationsfunktion – als Basis einer Theorie des Unternehmertums heraus.
Den Ausgangspunkt bilden die zuvor bereits genannten Grundannahmen, nach denen Individuen nach einer Verringerung ihrer Einkommensunsicherheiten streben, sich dabei allerdings mit der Unvollständigkeit und Ungleichverteilung von Wissen, Wollen und Können konfrontiert sehen. Konsequenterweise wird daher hier die erste oder institutionen-begründende Unternehmerfunktion gesehen: der Anreiz, im eigenen Interesse anderen Menschen Einkommensunsicherheiten abzunehmen. Wer sich etwa dafür entscheidet, anderen Menschen ihr Arbeitseinkommen zu zahlen, tut dies primär im eigenen Interesse, um nämlich durch diesen »Gründungsbeitrag« zu einer Unternehmung das eigene Einkommen zielführend zu gestalten, insbesondere, um Abweichungen zwischen heute geplantem und zukünftig erreichtem Einkommen zu reduzieren. Für diesen Unternehmer ist dabei sekundär, dass ein Nebeneffekt seiner Funktionsausübung darin besteht, auch die Einkommensunsicherheit anderer, hier der Angestellten, zu mindern. Es handelt sich bei dieser kurz als Einkommensfunktion benannten sowohl in historischer als auch in materiell-inhaltlicher Hinsicht um die erste und grundlegende Unternehmerfunktion. Sie geht den beiden folgenden Unternehmerfunktionen in Bezug auf eine Institution vor bzw. zeitlich voraus, denn mit ihrer Ausübung ruft der Unternehmer eine Unternehmung im institutionellen Sinne erst ins Leben, die durch die Ausübung der beiden folgenden Funktionen fortan erhalten werden muss. Die Übernahme von Einkommensunsicherheiten anderer stellt nämlich noch nicht Einkommenssicherheit her: Es handelt sich regelmäßig um keinen vollkommenen, sondern einen nur teilweisen Abbau von Unsicherheit. Das erweist sich gerade dann, wenn infolge der Unvollständigkeit des Wissens »Ex-post-Überraschungen« (Schneider 2011, S. 11) auftreten, die zu Abweichungen gegenüber der geplanten Unsicherheitsreduktion führen. Deutlich wird das etwa an Finanzierungsbeziehungen, deren Vertragsdetails zwar fest vereinbart sein mögen, bedingt durch diverse Risiken – wie die Veränderung von Kapitalmarktzinsen oder anderen Marktpreisen, steuerlicher oder bankaufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen sowie Risiken bis hin zu Naturkatastrophen – aber alles andere als »absolut sicher« sind.
Zurückgehend auf das ursprüngliche Motiv der Ausübung der ersten Unternehmerfunktion ergibt sich, dass sie zwar eine grundlegende und insoweit übergeordnete Rolle spielt, ohne die anschließende Ausübung weiterer Unternehmerfunktionen indes eine l’art pour l’art bleibt. Aufgrund seiner primären Einkommensziele muss der Unternehmer nun die Erhaltung und den Erfolg der gegründeten Institution betreiben. Dies tut er im Rahmen der für sie geltenden Regeln auf den Märkten, auf denen die Unternehmung agiert, also durch Ausübung einer nach außen gerichteten institutionen-erhaltenden Unternehmerfunktion. Kurz wird diese zweite Unternehmerfunktion auch als ArbitragefunktionArbitragefunktion bezeichnet: »Findigkeit bei Handlungsmöglichkeiten durch einzelne Unternehmer und Unsicherheit und Ungleichverteilung des Wissens unter den Menschen allgemein ermöglichen die Unternehmerfunktion des Erzielens von Arbitrage- bzw. Spekulationsgewinnen in und zwischen Märkten.« (Schneider 2011, S. 64 ff.)
Als Arbitragieren gilt allgemein das Ausfindigmachen und Ausnutzen von Preisunterschieden. Für diesen »spekulativen« Zweck ausnutzbare temporäre Preisunterschiede existieren in verschiedenen Ausprägungen:
Arbitragegewinne durch Absatz: Differenz zwischen der Preisobergrenze des Nachfragers einer Unternehmung und dem, was sie für das Absatzobjekt aufgewendet hat.
Arbitragegewinne durch Beschaffung: Differenz zwischen der Preisuntergrenze des Anbieters (Lieferanten) einer Unternehmung und dem, was sie für das beschaffte Objekt erwirtschaften kann.
Arbitragegewinne in der Zeit: Preisdifferenzen für ein Absatz- oder Beschaffungsobjekt an einem bestimmten Ort zu unterschiedlichen Zeiten.
Arbitragegewinne räumlicher Art: Preisdifferenzen für ein Absatz- oder Beschaffungsobjekt zu einem bestimmten Zeitpunkt an unterschiedlichen Orten.
Arbitragegewinne über Produktionsstufen hinweg: Preisdifferenzen zwischen Produktionsfaktoren (zuzüglich weiteren Aufwendungen der Unternehmung) und den Produkten, die eine Unternehmung daraus fertigt.
Arbitragen gegen Regulierung: Gemeinschaftliche Vorteilserzielung von Anbietern und Nachfragern durch legale Ausweichhandlungen vor staatlich gesetzten Marktregeln.
Da Arbitragemöglichkeiten vor einer Nutzung zunächst zu erkennen sind, ist die Ausübung dieser Arbitragefunktion von einem entsprechenden unternehmerischen Talent oder »Blick für die Gelegenheit« abhängig. Ein Unternehmer muss also so aufgeweckt und wachsam (= »alert«) sein, dass er nicht nur bereits erkannte Gelegenheiten nutzt, sondern die Findigkeit besitzen, die Gelegenheit sowie ihre Ausnutzbarkeit aufzudecken: »Der für Unternehmertum entscheidend relevante Wissensaspekt ist nicht so sehr das feste Wissen über Marktdaten, sondern vielmehr die Findigkeit, d. h. das ›Wissen‹, wo Marktdaten zu entdecken sind.« (Kirzner 1978, S. 54)
Von Arbitragegewinnen (statt von Gewinn oder ähnlichen Erfolgsgrößen) wird an dieser Stelle deshalb gesprochen, um die Tätigkeit des Vermittelns zwischen Angebot und Nachfrage bzw. zwischen Absatz- und Beschaffungsmärkten hervorzuheben. Der Unternehmer erkennt die Probleme der marktlichen Koordination und schafft einen »kreativen Brückenschlag« zwischen Nachfragebedürfnissen und Angebotsbedingungen (vgl. Freiling/Reckenfelderbäumer 2010, S. 64 ff.). Diese Arbitrage wird teilweise auf das Ausnutzen »sicherer« Preisunterschiede eingeschränkt und von der Spekulation als glücksspielerischem, mitunter moralisch fragwürdigem Investieren abgegrenzt. Eine solche Trennung ist jedoch realitätsfern, da alle Marktprozesse zur Gewinnerzielung risikobehaftet sind. Weil die Handlungen auch bei der (z. B. Produktionsstufen-)Arbitrage zeitlich mehr oder weniger lange auseinanderfallen (z. B. Wareneinkauf und -verkauf), drohen stets Ex-post-Überraschungen (Verderb der Ware, Beschädigungen, Wegbrechen der sicher geglaubten Nachfrage etc.). In diesem Sinne ist der Arbitrageur wie der Spekulant »ein Mann, welcher von einem erhöhten Standpunkt aus in die Ferne späht, es ist eine Art von Plänkler, welcher neue und unbekannte Wege und Gegenden für das große Heer der Handelstreibenden ausfindig macht und absucht« (so der französische Wirtschaftswissenschaftler Jean Gustave Courcelle–Seneuil, 1813–1892, zit. nach Schneider 2011, S. 65). Der Arbeit des Unternehmers zeigt sich »in der Spekulation, worin er den Begehr der menschlichen Bedürfnisse beobachtet, um ihnen gerade das Mangelnde zu bieten, die Wege des Absatzes erforscht, die besten Methoden der Produktionen erkundet, Versuche mit neuen Betriebsweisen, Maschinen oder Werkzeugen anstellt« (so der deutsche Nationalökonom Adolf Riedel, 1809–1872, zit. nach Schneider 2011, S. 65) – Arbitragegewinne werden daher hier mit Spekulationsgewinnen gleichgesetzt.
Unternehmertum zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass ein Unternehmer zur Erreichung seiner primären eigenen Einkommensziele zunächst eine Institution begründet und sodann ihren Erhalt nach außen gerichtet betreibt. Hinzu tritt, dass er auch eine dritte, ebenfalls nachgeordnete und nun nach innen gerichtete, institutionen-erhaltende Funktion ausübt: die Koordinationsfunktion. Diese beinhaltet die Durchsetzung von Änderungen in einer Unternehmung in Ausübung einer wirtschaftlichen Führungsrolle zwecks Anpassung an sich permanent verändernde Markt- und Umweltbedingungen, genauer »das Verwirklichen neuer Handlungsabläufe […], aber auch […] das Formen neuer Ordnungen (Regelsysteme) und ihres Einhaltens. Das Durchsetzen von Änderungen betrifft in Gruppen zusammen- oder gegeneinander arbeitender Menschen vor allem die Koordination als gemeinsame Planerarbeitung, Planabstimmung (Entscheidungsfindung) sowie Steuerung und Kontrolle von Handlungen« (Schneider 1997a, S. 50 f.).
Unmittelbar einsichtig ist es, hierunter die zielführende Veränderung unternehmensinterner Aufbau- oder Ablaufstrukturen zu verstehen, wie z. B. die Einrichtung einer neuen Stelle oder Abteilung in Reaktion auf entsprechende Rechtsnormen, die Verschlankung der Organisation zugunsten schnellerer Entscheidungswege angesichts zunehmender Nachfragevolatilitäten oder die Neuabgrenzung von Geschäftsfeldern aufgrund der demographischen Entwicklung in einer Gesellschaft.
Die Koordinationsfunktion beschränkt sich jedoch nicht auf das Durchsetzen von Änderungen als Reaktion auf Einflüsse im Umfeld einer Unternehmung. Vielmehr umschließt sie auch die für die nachhaltige Existenzsicherung der Institution wohl noch bedeutendere Innovation(sfunktion), also die Realisierung von Neuerungen im weitesten Sinne (vgl. Kirzner 1997, S. 46 ff.; Schneider 2011, S. 68 f.). Für seinen dynamischen Unternehmer sieht Schumpeter im »Erkennen und Durchsetzen neuer Möglichkeiten auf wirtschaftlichem Gebiet [sogar] das Wesen der Unternehmerfunktion« (Schumpeter 1928, S. 483, Hervorhebung d. d. Verf.). Diesen »dynamischen« bzw. »wagemutigen« Unternehmer identifizierte Schumpeter als wesentliche Antriebskraft für den beständigen Wandel von Unternehmungen und letztlich des (marktwirtschaftlichen) Wirtschaftssystems insgesamt. Unternehmer haben demnach die Aufgabe, immer wieder »neue Kombinationen« von Produktionsfaktoren bzw. -verfahren zu schaffen und die resultierenden Produkte auf (mitunter ebenfalls neuen) Märkten durchzusetzen (zur Systematisierung verschiedener Arten von Innovationen vgl. Modul 4). Kennzeichnend für die evolutorische Wirtschaft sei daher die ständige Erneuerung oder – spiegelbildlich – der Prozess der »schöpferischen Zerstörung« bzw. »Creative Destruction« (im Original Schumpeter 1942, S. 83 ff.).
Obwohl die Realisierung von Innovationen ihre Grundlage in der dritten Unternehmerfunktion findet, lässt sie sich kaum von den beiden zuvor dargestellten Funktionen trennen. Die Einführung einer Produktinnovation auf einem Markt etwa basiert auf entsprechenden internen Änderungen, angefangen von der zielführend lancierten Forschung und Entwicklung bis hin zu einem neu zu entwickelnden Kommunikationskonzept. Diese Produktinnovation wird aber nur dann ein ökonomischer Erfolg für die Unternehmung, wenn auch die Ausübung der Arbitragefunktion gelingt, sich also die Planung bewahrheitet, dass die Preisobergrenze zumindest einiger Nachfrager über dem Aufwand der Unternehmung für das Neuprodukt liegt (Erzielung von Pioniergewinnen). Schließlich setzen InnovationenInnovationen regelmäßig auch eine (bisher so nicht dagewesene) Übernahme von Einkommensunsicherheiten voraus, etwa durch die Neueinstellung von Entwicklungs- oder Vertriebsspezialisten für das innovative Produkt. Insoweit kann die Verwirklichung von Innovationen als »multifunktionale« Tätigkeit bezeichnet werden, da sie Element aller drei Unternehmerfunktionen ist bzw. ihre verzahnte Ausübung erfordert (vgl. ausführlich Reckenfelderbäumer 2001, S. 245 ff.).
Grundlegend bzw. den beiden anderen Funktionen übergeordnet ist insofern die Übernahme von Einkommensunsicherheiten, mit der die Entstehung und Fortexistenz von Institutionen wie insbesondere Märkten und Unternehmungen erklärt werden kann: Sie ist deswegen eine vorgelagerte Bedingung, weil ohne die (Be-)Gründung einer Institution jegliche institutionen-erhaltende Aktivität ohne Bezugsobjekt wäre. Die in Ausübung der Einkommensfunktion entstandene Institution ist durch Ausübung der zweiten Funktion in ihrem Fortbestand zu sichern, indem Arbitrage- bzw. Spekulationsgewinne durch Markthandlungen erzielt werden. Die dritte Unternehmerfunktion des koordinierten Durchsetzens von Veränderungen innerhalb einer Institution schließlich knüpft nicht nur an die Existenz der Institution selbst, sondern auch an die Planung von (Arbitrage-)Gewinnen an, weil das nach innen gerichtete Streben nach Erhalt der Institution dieser Gewinnerzielung gerade dienlich sein soll und daher kein Selbstzweck ist. Indem sich die nach innen gerichtete Erhaltung der Unternehmung zielführend an den Planungen zur Erhaltung nach außen ausrichtet, ist die Koordinations- der Arbitragefunktion nachgeordnet.
Alle drei Unternehmerfunktionen schließen den Umgang mit den aus den Marktprozessen folgenden Risiken ein. Nach der Gründung seines Unternehmens für Künstliche Intelligenz (KI)Künstliche Intelligenz mag der Unternehmer angesichts der boomenden Nachfrage unter großem Zeitdruck gezwungen sein, neue Mitarbeiter anzustellen und diesen Einkommensunsicherheit abzunehmen (erste Unternehmerfunktion). Dabei trägt er das Risiko einer falschen Personalauswahl. Durch einen globalen Vertriebsansatz können Preisdifferenzen für Produkte zu einem bestimmten Zeitpunkt an bestimmten Orten genutzt werden (Arbitragegewinne räumlicher Art, zweite Unternehmerfunktion). Dadurch erzielt die Unternehmung jedoch einen Großteil ihrer Umsätze in unterschiedlichen Währungsräumen, was entsprechende Unsicherheiten (Wechselkursrisiken) mit sich bringt. Zahlreiche der von dem Unternehmen an den Markt gebrachten Produktinnovationen mögen sich im Zeitverlauf am Markt durchgesetzt haben (dritte Unternehmerfunktion). Möglicherweise verstoßen jedoch bereits in den Markt eingeführte Neuerungen nach einer gewissen Zeit gegen die (staatlich gesetzten) Marktregeln, z. B. in Bezug auf den Datenschutz. – Das in allen Fällen notwendige, wenn auch auf unterschiedliche Gefahren bezogene und daher mit verschiedenartigen Instrumenten agierende RisikomanagementRisikomanagement einer Unternehmung wird aufgrund seines Querschnittscharakters hier nicht als eigenständige Unternehmerfunktion Unternehmerfunktioneneingestuft. Es ist eine die drei Unternehmerfunktionen umschließende, sie verbindende Tätigkeit.
Abb. 1.3:
Hierarchie der Unternehmerfunktionen (Quelle: Reckenfelderbäumer 2002a, S. 235)
Zusammenfassend meint Unternehmertum (synonym: Entrepreneurship) also die Ausübung von Unternehmerfunktionen, unter denen die Innovationen anregende, beurteilende, ermöglichende Funktion besonders bedeutend ist, um eine Unternehmung dauerhaft zu erhalten (vgl. Freiling 2006; Freiling/Reckenfelderbäumer 2010, S. 296 f.; Schneider 2011, S. 54). Entrepreneurship ist somit vor allem ein Prozess der WertschaffungWertschaffung, bei dem eine möglichst einzigartige Verbindung von RessourcenRessourcen dazu eingesetzt wird, neue unternehmerische Gelegenheiten zu identifizieren, zu bewerten und zu ergreifen (vgl. Kirchner/Loerwald 2014, S. 27). Jeder in funktionaler Hinsicht abgegrenzte »Unternehmer« ist Gestalter der Unternehmung und treibt die Marktprozesse, in die die Unternehmung eingebunden ist, voran. Somit bezieht sich Unternehmertum auch nicht nur auf die Startphase einer Unternehmung: »Insofern sind nicht nur Existenzgründer Entrepreneure, sondern auch etablierte Unternehmen, wenn sie Innovationen an den Markt bringen« (Kirchner/Loerwald 2014, S. 20). Und so heißt es etwa bei Bosch: »Wir fördern bei Bosch zunehmend das Unternehmertum im eigenen Unternehmen. Ein wesentlicher Teil einer modernen UnternehmenskulturUnternehmenskultur ist: Gründergeist – auch oder gerade in etablierten Unternehmen.« (Volkmar Denner, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Bosch, zitiert nach Heidecke 2015)
Unternehmertum erweist sich somit als von der Position eines Menschen in der Unternehmung losgelöste Triebkraft für die Betätigung einer Unternehmung im Marktprozess. Dabei gilt es, gegenüber Konkurrenten zu bestehen, also im Vergleich zur Konkurrenz die genannten Unternehmerfunktionen erfolgreicher auszuüben. Dafür muss für das verfolgte GeschäftsmodellGeschäftsmodellWettbewerbsfähigkeitWettbewerbsfähigkeit erlangt und erhalten werden (vgl. Freiling/Reckenfelderbäumer 2010, S. 299, 308). Hierauf geht das dritte Modul näher ein. Zuvor aber wird – in der institutionellen Perspektive bleibend und auf den Überlegungen zu den generellen Existenzbedingungen von Unternehmen aufbauend – nach den spezifischen Anforderungen für Finanzunternehmen gefragt.
Auf den Punkt gebracht
Unter der Marktorientierung einer Unternehmung versteht man das Aufnehmen von Impulsen der beteiligten Marktparteien, deren Verarbeitung in der Unternehmung und anschließend in entgegengesetzter Richtung das Aussenden von Impulsen an die Marktspieler.
Im Gegensatz zur neoklassischen Marktgleichgewichtstheorie vollkommener Märkte basiert die evolutorische Wirtschaftstheorie auf den Kernprämissen der Unsicherheit sowie der Unvollständigkeit und Ungleichverteilung des Wissens. In einer prozessorientierten Perspektive leistet sie Erklärungen für das Entstehen, Fortbestehen und Vergehen von Institutionen (BWL als Einzelwirtschaftstheorie der Institutionen), hier insbesondere Unternehmungen.
Institutionen sind Regelsysteme (Normensammlungen, Ordnungen, »Rules of the Game«) und Handlungssysteme (Organisationen, »Players of the Game«).
Unter dem Markt werden in institutioneller Perspektive über Marktstruktur und Marktregeln geordnete Marktprozesse verstanden. Marktprozesse sind die in Märkten beobachtbaren Handlungen.
Das Bemühen um Reduktion von Einkommensunsicherheit treibt die Entstehung von Unternehmungen als Institutionen. Für die Beteiligung an den Prozessen in denjenigen Märkten, in denen sie handeln, sind analog Unternehmungsprozesse notwendig, die durch Unternehmungsstruktur und -regeln geordnet werden.
Unternehmensführung meint die Ausübung von Unternehmerfunktionen. Die Trias aus Einkommens-, Arbitrage- sowie Koordinationsfunktion erweist sich nicht als für eine »Unternehmerkaste« reserviert, sondern als Universalinstrument, das von jedem Akteur nach Maßgabe seines Wissens, Wollens und Könnens zur Verringerung von Unsicherheit genutzt wird.
Unternehmertum bezeichnet die Triebkraft zur Erlangung und Erhaltung von WettbewerbsfähigkeitWettbewerbsfähigkeit.
Modul 2: Existenzbegründung von Banken als Intermediären in Finanzmärkten
Zentrale Inhalte
Friktionen auf Finanzmärkten
Funktionen von Finanzintermediären
Transaktionskostentheorie und Economies of Scale and Scope
Banken als Spezialisten für ScreeningScreening und Monitoring
Spezifika der BankleistungBankleistung aus Nachfragersicht und die besondere Rolle des Vertrauens
Gründe für die Entstehung und Wettbewerbsvorteile von FinTechs
Veränderung der Finanzintermediation durch FinTechs und Big Techs
2.1 Die Grundprobleme auf Finanzmärkten und traditionelle Erklärungsversuche für Banken
Back to the roots? Kehren die Volkswirtschaften in einen Zustand vor der Etablierung von Banken zurück? Tatsächlich entwickeln sich seit knapp 20 Jahren in zunehmendem Maße PlattformenPlattformen, die Anbieter und Nachfrager von Finanzmitteln mehr oder weniger »direkt« in Kontakt bringen und sich gezielt als konzeptionelles Gegenmodell zu klassischen Banken darstellen, wie das folgende Beispiel einer PlattformenKreditplattform verdeutlicht:
»An einem Wochenende im Jahr 2006 fuhren die beiden Studienfreunde Raffael und Philip durch das Frankfurter Bankenviertel. Beim Anblick der mächtigen, verspiegelten Banktürme fragten sie sich: Warum brauchen wir eigentlich Banken, um Geld von Mensch zu Mensch zu verleihen? Warum können wir Kreditnehmer und Anleger nicht direkt über einen digitalen Marktplatz zusammenbringen? Die Idee für auxmoney war geboren.«
(auxmoney GmbH 2019, 2022)
Immer mehr Unternehmungen treten also auf den Markt, die offenbar den Banken vergleichbare Leistungen anbieten und damit deren Bedeutung gefährden. Um diesen Trend zu verstehen, muss man in einem ersten Schritt nach den Funktionen der Banken, letztlich also ihrer Existenzberechtigung, fragen. In einem zweiten Schritt wird dann analysiert, inwiefern diese Funktionen auch durch alternative Institutionen erfüllt werden können.
Das Grundproblem auf Finanzmärkten lässt sich einfach beschreiben (Abb. 2.1): Die Marktstruktur ist durch Mittelanbieter (»Finanzielle Überschusseinheiten«) und Mittelnachfrager (»Finanzielle Defiziteinheiten«) gekennzeichnet. Ein direkter Liquiditätsaustausch zwischen ihnen kann vor vier Schwierigkeiten stehen, die als Friktionen bezeichnet werden. Der Kapitalnachfrager – typischerweise eine Unternehmung – benötigt für eine Investition z. B. an ihrem Standort Bochum 1 Mio. €, die er nach zehn Jahren zurückzahlen will. Er weist eine Bonität im mittleren Bereich (B+) auf. Die Kapitalanbieter – typischerweise private Haushalte – befinden sich etwa in Frankfurt (örtliche bzw. räumliche FriktionFriktionen im Geldstrom), möchten jeweils höchstens 5.000 € anlegen (betragsmäßige/quantitative oder Losgrößenfriktion) und streben nach einer möglichst sicheren Anlage (risikomäßige bzw. qualitative Friktion), die aufgrund ihrer Konsumpläne nur sechs Monate laufen soll (zeitliche Friktion). Offensichtlich passen die Präferenzen der beiden Marktseiten nicht ideal zueinander, ein Zustand, den Oliver E. Williamson mit Zahnrädern vergleicht, die aufgrund von Reibungen (= Friktionen) nicht perfekt ineinandergreifen.
Abb. 2.1:
Friktionen
Kreditgeschäft
auf Finanzmärkten (Quelle: eigene Darstellung)
Marktprozesse in Form des Direktkontakts zwischen Gleichgeordneten (Peer to Peer LendingPeer to Peer) stehen daher vor hohen, mitunter unüberwindlichen Hürden. So kann es für die Unternehmung (die Privatpersonen) zeitintensiv und mit hohen Kosten verbunden sein, diejenigen Mittelanbieter (-nachfrager) zu identifizieren, die in quantitativer, qualitativer, zeitlicher und örtlicher Hinsicht zum eigenen Bedarf passen. Zur Verringerung dieser Hürden, die letztlich zu Einkommensunsicherheiten auf beiden Marktseiten führen (vgl. Modul 1), ist daher ein anderes Design der Marktprozesse sinnvoll. Konkret können sich Mittlerinstitutionen auf Finanzmärkten – Finanzintermediäre – zwischenschalten, also den Privaten eine Anlagemöglichkeit und gleichzeitig der Unternehmung einen Kredit anbieten (vgl. weiterführend Allen/Santomero 1997). Sie unterhalten damit Vertragsbeziehungen zu beiden Marktseiten, sind also Finanzintermediäre im engeren Sinne. Zur Bewältigung der Friktionen liegt ihre Funktion dann in bestimmten TransformationsleistungenTransformationsleistung – in betraglicher (Losgröße), risikomäßiger, zeitlicher und örtlicher Hinsicht (vgl. Greenbaum/Thakor/Boot 2019, S. 24). Erleichtern Institutionen lediglich das Zustandekommen von Finanzverträgen (Tauschvereinbarungen über liquide Mittel), ohne diese jedoch mit Mittelanlegern oder -nachfragern geschlossen zu haben und ohne in die Liquiditätsströme eingebunden zu werden (wie Rating-UnternehmungRating-Unternehmungen oder Börsen), spricht man von Finanzintermediären im weiteren Sinne (vgl. Breuer 1993; Oehler/Horn/Wendt 2018).
In naturalen Tauschwirtschaften, in denen lediglich nichttypisierte Sachgüter und Dienstleistungen »gehandelt« wurden, konnte demnach für Banken kein Platz sein. Banken als Mittler zwischen Wirtschaftssubjekten, die finanzielle Überschüsse bilden und daher Geldanlagebedarf haben, und anderen Wirtschaftseinheiten, deren finanzielle Defizite einen Bedarf zur Geldaufnahme auslösen, existieren naturgemäß erst seit Beginn der Geld- und Kreditwirtschaften.
Nach frühen Vorläufern (etwa schon im zweiten Jahrhundert v. Chr. in Mesopotamien, Graeber 2012), entwickelte sich das moderne Bankwesen spätestens im 13. Jahrhundert in Oberitalien. Durch ihre günstige geographische Lage an den wichtigsten Verkehrswegen der damaligen Zeit blühten Städte wie Siena, Lucca und Pisa, später auch Florenz zu florierenden Handelszentren auf (vgl. Goldthwaite 2009; Plumpe 2019). Um aus der Zersplitterung des Münzwesens resultierende qualitative Friktionen auszugleichen, wechselten erste findige Unternehmer am banco (einem Wechseltisch) die Münzen verschiedener Münzsysteme. Um räumliche Friktionen im überregionalen ZahlungsverkehrZahlungsverkehr auszugleichen, übergaben sie reisenden Händlern Briefe an befreundete Korrespondenten, in denen diese zur Zahlung von Metallgeld an den Vorleger aufgefordert wurden (Wechselbriefe), während sie selbst die Rückzahlung aus den von den Reisenden hinterlegten Geldern vornahmen. Um zeitliche Friktionen auszugleichen, machten diese Unternehmer – vor allem mit der Obrigkeit – Leihgeschäfte in Geldern, welche die Bürger aus Sicherheitsgründen und gegen Ausgabe von Depotscheinen oder Noten bei ihnen deponiert hatten. Aus diesen von findigen Akteuren initiierten Anfängen entwickelten sich im Zeitablauf Institutionen, die (nach dem Plural von banco) banca genannt wurden, darunter z. B. die 1472 gegründete Banca Monte dei Paschi di Siena, die älteste bis heute ununterbrochen existierende Bank der Welt (die allerdings in Folge der letzten Finanzkrise vom italienischen Staat gerettet werden musste). Aus Kaufleuten wie der Familie Medici wurden »banchiere«, also Bankiers, die wiederum ihre Dienste den Staaten anboten. So gab es einen hohen Grad an Überlappung zwischen Handel, Bankgeschäft und Staatsfinanzierung – in Deutschland besonders markant durch die Familie der Fugger ab dem frühen 16. Jahrhundert ausgeprägt.
In dieser Tradition wurden Banken bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland von Theorie wie Praxis als Institutionen gesehen, die den Warenhandelssektor der Volkswirtschaft durch den Geldhandel ergänzten. Mit Hübner (1854) und Wagner (1857) griff dann zur Mitte des Jahrhunderts die Auffassung Raum, dass in der Kreditvermittlung das eigentliche Wesen der Banken liege, eine Anschauung, die sich bis nach dem ersten Weltkrieg hielt. Die Standardlehrbücher der Bankbetriebslehre waren in der Folge um die Wende zum 20. Jahrhundert eher banktechnisch orientiert, indem sie sich einer detaillierten Beschreibung der Bankgeschäfte, nicht aber der Funktionsbestimmung der Institution widmeten. Beginnend mit Bernicken (1926) wurde die Bank dann jedoch als Produktions- (und nicht mehr nur als Handels-)Betrieb aufgefasst, der EinlagenEinlagen in Kredite umwandle. Hieraus entwickelte Schmalenbach den angesprochenen Begriff der »Transformation« (1961, S. 131–142): Aufgrund der unterschiedlichen Fristigkeitsbedürfnisse von Kapitalgebern und -nehmern sah er die Notwendigkeit einer Überbrückung der Fristeninkongruenz. Eine Harmonisierung der zeitlichen Überlassungs- bzw. Nutzungsdauer von Liquidität könnten die Banken durch Prolongation de jure kurzfristiger Gelder auf ihrer Passivseite und die Gewährung langfristiger Kredite bewirken. Parallel dazu stellten Schneider (1952) und Mülhaupt (1957) die Fähigkeit der Bank zur Geldschöpfung in das Zentrum ihrer Überlegungen. Während eine Notenbank Zentralbankgeld emittiert, können Banken durch die Einräumung von Krediten die Giralgeldmenge erhöhen. Doch statt diese Erklärungen zur Funktion der Bank weiter auszubauen und zusammenzuführen, kehrten die bankbetrieblichen Lehrbücher der 1950er und 1960er Jahre indes zu einer nahezu ausschließlichen Geschäftslehre zurück (vgl. etwa Hagenmüller 1959, 1964). Auch die für Banken grundlegende Marktregelsammlung – das 1934 eingeführte KreditwesengesetzKreditwesengesetz (KWG) (KWG) – entstand aus dieser Tradition heraus und enthielt keine Funktionsbeschreibung von Banken, sondern lediglich eine Aufzählung von Einzelgeschäften, bei deren Betreiben man als Kreditinstitut eingeordnet und damit Regelungsobjekt wurde. Dieses Enumerationsprinzip ist bis heute beibehalten worden und hat zuletzt zur Fassung von § 1 Kreditwesengesetz geführt, worin Banken unverändert indirekt, nämlich über »Bankgeschäfte« – z. B. das Hereinnehmen von Spareinlagen sowie die Vergabe von Krediten – definiert werden.
Umfassender erklärte erst wieder Süchting (vgl. Süchting 1967, 1982a) den Zusammenhang der einzelnen Bankgeschäfte. Unter Bezug auf die Untersuchungen von De Viti de Marco (1898) über die historische Entwicklung italienischer Banken stellte er dabei die Liquiditätsausgleichsfunktion der Kreditinstitute in den Mittelpunkt. Nach De Viti de Marco beginnen die Bankgeschäfte historisch beim Depotgeschäft, dem das Bankgewerbe – als Ausdruck des Sicherheitsbedürfnisses der Kaufleute – seine Entstehung verdanke (S. 2). Die Kundendepots würden entweder ausgeliehen (investiertes Depot), oder die Bankiers übten die Geldverwahrung in reiner Form gegen Gebührenzahlung aus (brachliegendes Depot, S. 10). Auf der Basis des Depotgeschäfts habe sich die Durchführung von Zahlungen angeboten, die anfangs durch Umlagerung konkreter Geldbestände erfolgt sei. Als später im Zusammenhang mit der Rationalisierung des Zahlungsverkehrs die Geldsurrogate Wechsel und Scheck sowie das Giro (die Überweisung) eingeführt und damit Zahlungen auch bargeldlos abgewickelt worden seien, habe sich dem Kreditgeschäft die Möglichkeit der Loslösung von den Bargeldbeständen eröffnet. Aus der früheren »Geldbank« entwickelte sich ein Kreditzahlungssystem, das Edelmetall nur noch für den Ausgleich des (Abrechnungs-)Saldos und die Rückforderungen der Einleger (über einen Bodensatz, der juristisch von den Kunden abgezogen werden könnte, de facto aber als langfristiges Guthaben bei der Bank verbleibt, hinaus) benötigte (S. 22 ff.). Dadurch nahm das Volumen möglicher Finanzierungen deutlich zu. – Die Zusammengehörigkeit der Geschäfte umreißt De Viti de Marco dann mit diesen Worten: »[…] es ist klar, daß jede dieser Bankoperationen – wie die Geldaufbewahrung oder die Darlehensgewährung oder der Geldwechsel – für sich allein nicht die eigentliche Banktätigkeit darstellen […]. Die Bank besteht in der Zusammenfügung dieser und anderer Operationen […], die alle […] der über ihnen stehenden Funktion der Zahlung verbunden und untergeordnet sind« (S. 53 f.). Nach De Viti de Marco sind also die konstituierenden Elemente der Bank das Depositum, die Zahlung und die (Umsatz-)Finanzierung. Die Abhängigkeiten sind deutlich: Um Zahlungen durchführen zu können, bedarf es des Depots. Um das Kreditpotenzial auszunutzen, ist der Zahlungsverkehr in einer entwickelten Form erforderlich. Es ist somit ein Komplex von Geschäften, aus denen die moderne Bank besteht. Daher schlussfolgerte Süchting (1982, S. 7): »Banken sind Distributionsunternehmen, die zum Zwecke des Ausgleichs von Friktionen im Geldstrom ein zusammengehöriges Bündel übernehmen, dessen wesentliche Elemente der Umtausch, die Deponierung, der Transport und die Zurverfügungstellung von liquiden Mitteln für die Öffentlichkeit darstellen.«
Abgesehen von diesem Erklärungsansatz wurde die Frage nach den Existenzbedingungen von Finanzintermediären in den 1960er und 1970er Jahren vergleichsweise selten diskutiert (eine Ausnahme waren die Arbeiten von Gurley und Shaw, vgl. exemplarisch Gurley/Shaw 1960, S. 192 ff.). Die Ursache dafür dürfte im Vordringen der von den USA ausgehenden Theory of Finance gelegen haben, die das Kapitalmarktgeschehen in Neoklassikneoklassischer Tradition (vgl. Modul 1) mit Hilfe von Gleichgewichtsmodellen auf (meist) vollkommenen Märkten zu erklären versuchte (vgl. einführend Paul et al. 2017, S. 193–260, 469–496). In dieser idealisierten Welt ohne Friktionen im Geldstrom, in der die zentralen Modelle der Finanzierungstheorie angesiedelt sind (Capital Asset Pricing ModelCapital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory, Option Pricing Model), besteht für Intermediäre keine Existenzberechtigung. Alle optimalen Verträge werden von allwissenden rationalen Marktteilnehmern effizient geschlossen, so dass durch Hinzunahme von Finanzintermediären keine Wohlfahrtssteigerungen mehr bewirkt werden können.
Insofern drängte die Kapitalmarkttheorie die Finanzintermediäre auf die Rolle allenfalls von Dienstleistern im Zahlungsverkehr zurück, da die zuvor als konstitutiv genannten Transformationsleistungen auch in einer anderen Marktstruktur denkbar sind: »Die Wirtschaftstheorie konnte bis in die jüngste Zeit hinein mit den Finanzintermediären, also beispielsweise den Banken, wenig anfangen. Man fand zwar in allen Lehrbüchern eine Aufzählung der Bankleistungen, nämlich Fristen-, Risiken- und Losgrößentransformation, war sich aber gleichzeitig der Tatsache bewußt, daß all diese Transformationsleistungen auch von Märkten unmittelbar, also ohne Einschaltung eines Intermediärs erbracht werden können« (Engels 1992, S. 16). Aufgrund des Mankos, dass demnach »in der Finanztheorie finanzielle Institutionen wie Banken und die reale Vielfalt komplexer Finanzierungsinstrumente keinen Platz« hatten, forderte etwa Schmidt schon 1981 ein Forschungsprogramm, mit dem »Institutionen innerhalb eines finanzierungstheoretischen Rahmens nicht nur zu berücksichtigen, sondern auch theoretisch zu erklären« sein sollten: den Neo-Institutionalismus (Schmidt 1981, S. 137; Schmidt/Terberger 2013). Wesentliche Impulse erhielt dieses Forschungsprogramm durch die auch in der allgemeinen Theorie der Unternehmung zu verzeichnende Tendenz, die Unternehmung als dauerhafte Institution losgelöst vom neoklassischen Marktgleichgewichtsdenken und stattdessen mit Hilfe institutionenökonomischer Denkansätze zu begründen (vgl. erneut Modul 1 sowie Paul/Horsch 2005; und für die folgenden Ausführungen Paul 2007).
2.2 Neuere Existenzerklärungen für die Institution »Bank«
Im ersten Modul wurde die nach außen gerichtete, institutionen-erhaltende Unternehmerfunktion der Erzielung von Arbitragegewinnen dargestellt. Eine Begründung von Finanzinstitutionen aus derartigen Arbitrageüberlegungen heraus entwickelte in systematischer Form erstmals Pyle (1971). Hatte man zuvor versucht, in Partialmodellen entweder die Struktur der Aktiva einer Bank (bei gegebenen Passiva) oder die der Passiva (bei gegebener Aktivseite) aus einer Portefeuille-Entscheidung heraus zu begründen, so arbeitete Pyle mit einer Verknüpfung beider Bilanzseiten. Er definierte einen Finanzintermediär als Institution, die Depositen aufnimmt und diese in zinstragende Aktiva investiert. In einem Modell mit drei Vermögensformen leiteten sich sowohl von den Einlagen als auch den (risikobehafteten) Krediten und (hier: risikolosen) Anleihen Zahlungsströme ab, die von Pyle unter Rückgriff auf die Erkenntnisse der Kapitalmarkttheorie mit Hilfe des Erwartungswertes und der Standardabweichung innerhalb eines komplexen Gleichungssystems beschrieben wurden. Als Intermediationsbedingung leitete er hieraus ab, dass nach Portefeuille-Optimierung, wenn also Veränderungen der Zusammensetzung und der Größe von Aktiva und Passiva keine Nutzensteigerungen mehr bewirken, der durchschnittliche Zins der Aktivpositionen über dem der Passivseite liegen müsse. Die Existenz eines Intermediärs erkläre sich demnach aus der positiven Zinsspanne, die durch Ausnutzung der Arbitragechance entsteht.
Der Hauptvorwurf gegen Pyle bestand darin, dass dieser nur einen temporären Ungleichgewichtszustand hergeleitet habe, in dem der Intermediär als Arbitrageur auftreten könne. Die Arbitragechance locke jedoch neue Wettbewerber auf den Markt, der – durch deren vereintes Arbitrieren – langfristig in einen Gleichgewichtszustand gelange, in dem keine Preisdifferenzen für Geldanlage und Geldaufnahme – und damit auch keine Arbitragechancen – mehr bestünden. Ein derartiges »Einschwingen« in das Gleichgewicht erfolgt aber nur dann automatisch, wenn alle Wirtschaftssubjekte ohne Marktzugangsschranken unter Sicherheit – und unter auch ansonsten idealen Bedingungen – ihrem Einkommensstreben nachgehen. Unter Unsicherheit fehlt jedoch bislang ein überzeugendes Modell für die »Tendenz zum Wegschwemmen von Arbitragegewinnen« (Schneider 1995, S. 294). Eine Prämisse hierfür wäre insbesondere, dass die Präferenzen aller Marktteilnehmer und ihr Informationsstand konstant sind. Damit schließt man aber Innovationen aus, die gerade aus dem nicht vorhersehbaren Erfindungsreichtum einzelner Marktteilnehmer resultieren (nach innen gerichtete, institutionen-erhaltende Unternehmerfunktion).
Die theoretisch nur unzureichend untermauerte Vermutung einer Tendenz zum Marktgleichgewicht als empirische Gesetzmäßigkeit (vgl. Schneider 1992, S. 72 f.) kann daher den Ansatz von Pyle nicht abwerten. Nicht die Arbitrage als solche