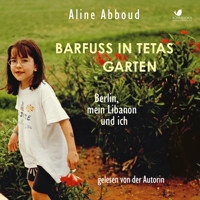15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die beliebte Tagesthemen-Moderatorin über ihre zweite Heimat Der Libanon ist ein kleines Land voller Widersprüche: Pulsierend, lebenslustig und gute Gerüche überall ... Auf der anderen Seite ein zerstörerischer Bürgerkrieg, dessen Narben auch noch immer deutlich sichtbar sind, Konflikte mit den Nachbarstaaten und Armut. Für Aline Abboud ist der Libanon ihre zweite Heimat: geboren 1988 als Tochter eines Libanesen und einer Ostberlinerin verbrachte sie von klein auf ihre Sommerferien bei ihren Großeltern und ihren 15 Cousins und Cousinen im Libanon. Den Geschmack dieser unbeschwerten Monate, diese ganz eigene Mischung aus Hummus, Meersalz und labbrigen Pommes, hat sie noch immer im Gedächtnis. Aline Abboud begibt sich auf eine sehr persönliche Suche nach ihren Wurzeln, und ermöglicht zugleich einen anderen Blick auf den Libanon und seine Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Barfuß in Tetas Garten
Aline Abboud, geboren 1988 in Berlin, ist eine deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin und Redakteurin. Ab 2021 war sie für zwei Jahre Teil des Moderator*innenteams der ARD „tagesthemen“ und von „tagesschau24“. In „Zenith – Der Nahost Podcast” beleuchtet sie die Lage im Nahen Osten, bei funk präsentiert sie „DIE DA OBEN!”.
Nana Heymann wurde 1977 in Ost-Berlin geboren und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Moskau. Als freiberufliche Journalistin arbeitet sie unter anderem für das ZEITmagazin und den Tagesspiegel, zudem hat sie mehrere Sachbücher veröffentlicht. Ihre Leidenschaft fürs Schreiben und Geschichtenerzählen lebt sie mittlerweile auch als Drehbuchautorin aus (»Roccos Reise«, »Last Christmas«).
Aline Abbouds Geschichte ist eine ostdeutsch-libanesische. Wenn ihre Eltern ein Essen für die Familie ausrichten, stehen Berliner Beamtenstippe und libanesisches Baklava auf dem Tisch. Zum Einkaufen geht sie in die »Kaufhalle«, und sie ruft auch oft und gerne »Yalla!«, wenn sich das Auto vor ihr nicht schnell genug bewegt. Doch wie fühlt es sich an, ein Land als zweite Heimat zu haben, das vor allem für Katastrophen und Krieg bekannt ist? Aline erzählt von der unaufhaltsamen Hoffnung der Menschenim Libanon, von ihrem Durchhaltevermögen – und erinnert sich daran, wie dieses kleine Land voller Widersprüche sie seit ihrer Kindheit geprägt und ihren Lebensweg beeinflusst hat. Sie erzählt von unbeschwerten Sommern mit labbrigen Pommes am Strand, von ihrer Flucht vor dem Krieg 2006 und von der Hoffnung und ihrem Traum eines friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in der gesamten Region.»Inmitten der Kontraste zwischen ost-deutschem Matriarchat und libanesischer Herzlichkeit entfaltet sich die Geschichte einer Frau, die in der Verbindung beider Welten ihre Identität findet – stolz, mehrfach verwurzelt und bereit, Brücken zwischen Kulturen zu schlagen.« Natalie Amiri
Aline Abboud und Nana Heymann
Barfuß in Tetas Garten
Berlin, mein Libanon und ich
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG ausdrücklich vor.Alle Rechte vorbehaltenFoto der Autorin: © Jennifer FeyE-Book-Konvertierung powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3290-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
Vor Gericht
Der Junge mit dem Schaf
Die Hochzeit und der Krieg
Jesus und das Knoblauchhuhn
Im Überlebensmodus
Tetas Garten
Fliegende Fische, labbrige Pommes
Meine persönliche Bombe
Zedern auf Lunge
Ein Sonnenbrand für den Papst
Auge in Auge mit der Schlange
Berlin am Meer
Papas Heilmittel
Kitchen Impossible
Im Pyjama durch den Libanon
Migras unter sich
Lost in Translation
Einmal Ossi, immer Ossi
Im Kopf woanders
Quarkkeulchen und Baklava
Nachwort: Libanons Kinder
Danksagung
Bildteil
Quellen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Widmung
Dieses Buch widme ich als Halblibanesin meinem Vater, einem ganzen Libanesen, und meiner Tochter, einer Viertellibanesin.
Motto
»Den Libanon kannst du nicht verstehen. Und wenn du glaubst, ihn verstanden zu haben, hat man ihn dir falsch erklärt.«
Libanesisches Sprichwort
»Reisen ist das Entdecken, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken.«
Aldous Huxley
Vorwort
Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich sehr froh, gerade nicht in einem Nachrichtenstudio vor der Kamera zu stehen, weil ich mich in Elternzeit befinde. Die Meldungen aus dem Libanon in den letzten Wochen und Monaten haben mich tief bewegt. Als Tochter eines Libanesen, die Familie und Freunde in dieser Konfliktregion hat, würde es mir schwerfallen, nicht emotional zu werden. Doch Gefühle sind so ziemlich das Letzte, was man im Studio brauchen kann, wenn man auf Sendung geht. Unser Job ist es, den Menschen sachlich und neutral einen Überblick über die politische Lage zu geben.
Seit Jahren schon möchte ich ein Buch über den Libanon schreiben. Am liebsten einen klassischen Reiseführer, der die vielen schönen Orte und Sehenswürdigkeiten dieses Landes vorstellt. Doch der richtige Zeitpunkt schien nie zu kommen. Immer wieder sorgt der Libanon für negative Schlagzeilen. Das Bild, das viele Menschen hierzulande vom Libanon haben, ist düster: Bürgerkrieg, Wirtschaftskollaps, Straßenproteste, die Hisbollah. Mit mehr verbindet man den Libanon nicht. Dabei ist dieses Land viel facettenreicher, als es vielen bewusst ist. Die Nahostkorrespondentin Andrea Backhaus formulierte es 2024 in einem Podcast anlässlich des Krieges zwischen Israel und der Hisbollah so: »Die Berichterstattung fokussiert sich oft auf geopolitische Analysen. Es fehlt die differenzierte Sichtweise auf das Leben im Libanon, die unterschiedlichen Stimmen.« Dieser Einschätzung stimme ich voll und ganz zu.
Das heißt nicht, das Leid der Menschen im Libanon und im ganzen Nahen Osten auszublenden – wer könnte das angesichts der furchtbaren Bilder und Nachrichten, die uns täglich erreichen. Dennoch scheint es mir richtig und notwendig, einen anderen Blick auf den Libanon zu werfen. Seit über dreißig Jahren verbringe ich meine Sommerferien fast ausschließlich bei meiner Familie am Mittelmeer, in einer Stadt etwa vierzig Kilometer nördlich von Beirut. Ich erzähle, wie ich als Tochter einer Ost-Berlinerin und eines Libanesen zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin – als »Halblibanesin mit ostdeutschem Migrationshintergrund«. Diese Mischung hat mir schon früh gezeigt, wie unterschiedlich Identität und Herkunft wahrgenommen werden.
Ein Schlüsselerlebnis war die Begegnung mit einer Journalistin zu Beginn meines Masterstudiums der Arabistik 2010, die mir empfahl, mich um ein Stipendium für »junge Menschen mit Migrationshintergrund« zu bewerben. Ich war irritiert. Sie konnte doch nicht mich meinen, denn schließlich bin ich eine echte Berliner Pflanze, geboren und aufgewachsen in Berlin-Pankow. So einfach war es dann aber doch nicht. Es lag offenbar an meinem Teint, meinen dunklen Haaren und an meinem Namen, der eben nicht Müller, Meyer oder Schulze lautet, sondern Abboud.
Wo fängt Migrationshintergrund an und wo hört er auf? Für die einen bin ich nicht deutsch genug, für die anderen zu deutsch. Seit ich 2021 zum ersten Mal für die »Tagesthemen« vor der Kamera stand, wurde mir sogar der Stempel »ostdeutsch« verpasst – obwohl ich die DDR nur als Kleinkind erlebte.
Ich stelle immer wieder fest, dass mein Aufwachsen zwischen zwei Kulturen die Menschen interessiert. Es gibt viele Deutsche, die sich in verschiedenen Welten bewegen, deren Lebenswege anders verlaufen sind als die der Mehrheitsgesellschaft. Ihre Geschichten sind genauso deutsch wie meine.
Meine Identität führt mich immer wieder zum Libanon zurück. Dieses Land ist ein Teil von mir, auf den ich stolz bin, auch wenn es meinem Vater oft schwerfällt zu verstehen, warum ich so gerne dorthin fliege. Das Verhältnis, das mein Vater zum Libanon hat, ist ein völlig anderes als meines: Er ist dort aufgewachsen und hat sich doch aktiv dazu entschlossen, von dort wegzugehen. Es geht nicht mit, aber auch nicht ohne. Mein Bild vom Libanon ist womöglich romantisiert, aber die Erinnerungen sind ein Teil von mir, den ich nicht missen möchte. Deshalb rede ich auch oft darüber. Meine Cousine Maria sagte mal: »Du machst mehr Werbung für den Libanon als das libanesische Tourismusministerium.«
Der Libanon ist eben mehr als nur ein Land der Konflikte und Krisen. Er ist ein Land, das in vielen Bereichen überraschend jung und lebendig ist. Wenn ich zum Beispiel erwähne, dass man im Libanon Skifahren kann, reagieren die meisten überrascht. Oder wenn im Beisein von Freunden vom besten Club der Welt die Rede ist, ich aber nicht das »Berghain« in Berlin meine, sondern die »Grand Factory« in Beirut. Nach der gewaltigen Explosion im Hafen im August 2020 war der Club fast komplett zerstört. Doch die Betreiber haben alles daran gesetzt, ihn wiederzueröffnen. Heute tauchen in der ehemaligen Matratzenfabrik wieder Tausende Raver jedes Wochenende ab, um den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen. Gerade weil es im Land so viele Probleme und Krisen gibt, feiern die Menschen umso intensiver. Sie tanzen sich in Ekstase, weil ihnen oft nichts anderes übrig bleibt. Diese Resilienz, diese Fähigkeit, sich auch den widrigsten Umständen anzupassen, ist eine typisch libanesische Eigenschaft, die ich bewundere.
Dieses Buch ist meinem Vater gewidmet. Es erzählt davon, wie er 1982 seine vom Bürgerkrieg geplagte Heimat verlassen hat und zum Studieren in die DDR ging. In einen Staat, der ihm eine Zukunft schenkte und in dem er in einem Studentenwohnheim in Leipzig meine Mutter kennenlernte. Doch es geht nicht nur um unsere Familiengeschichte. Sondern auch, mit diesem Buch dem Libanon eine Stimme zu geben und gewisse Vorurteile abzubauen.
Was aktuell in und um den Libanon herum passiert, lässt sich für mich natürlich nicht ausblenden. Der Libanon steht gerade vor der größten politischen, wirtschaftlichen, aber vor allem humanitären Krise seit Beginn des Bürgerkriegs.
Dieses Buch liefert aber keine politische Analyse. Dieses Buch handelt von meiner Familie, meinem Libanon, meiner Biografie. Meinem Leben und Aufwachsen in zwei Welten.
Ob ich mich jemals um das Stipendium beworben habe? Nein. Nicht, weil ich dachte, ich würde es nicht bekommen, sondern weil ich mittlerweile verstanden habe, dass der Begriff »Migrationshintergrund« mehr über die Gesellschaft, in der wir leben, aussagt als über einen selbst.
Berlin, November 2024
Vor Gericht
Als der Film »Das Lehrerzimmer« des deutsch-türkischen Autors und Regisseurs Ilker Çatak im Jahr 2023 beim Deutschen Filmpreis zum besten Spielfilm gekürt wurde, hielt der Produzent eine Dankesrede. Mit der goldenen Trophäe in der Hand stand er auf der Bühne und hielt eine Lobrede. Darin betonte er die Rolle von Lehrkräften für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Wie gerne man sich an sie erinnere, wenn sie einen erkannt und gefördert haben, einem »die Freiheit zur eigenen Entwicklung gegeben haben.«
Als mir das Video der Rede auf YouTube eingespielt wurde, dachte ich: Mag sein, dass das auf viele Menschen zutrifft – aber auf mich tut es das definitiv nicht. An Herrn K. erinnere ich mich nicht gerne. Wenn überhaupt, dann nur mit sehr gemischten Gefühlen. In der 9. und 10. Klasse war er mein Lehrer. Ich habe ihn nie sonderlich gemocht, und das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit gab er mir zu verstehen, dass ich das Abitur nicht schaffen würde. In seinen Augen war es ein Fehler, dass ich überhaupt das Gymnasium besuchte.
An meiner Schule, dem Carl-von-Ossietzky-Gymnasium im Ost-Berliner Stadtteil Pankow, unterrichtete Herr K. Politikwissenschaft. Auf seinen Unterricht hatte ich nie wirklich Bock. Das lag nicht ausschließlich an ihm, überhaupt konnte ich mich nur schwer für die Schule motivieren. »Weil du faul warst«, sagt mein Vater immer, wenn wir in Erinnerungen schwelgen und diese Zeit Revue passieren lassen. Er stößt dann gerne einen leisen Seufzer aus und schüttelt den Kopf. Vor allem Mathe war für mich der blanke Horror, denn ich habe Dyskalkulie. Wie viel Geld für Mathe-Nachhilfe meine Eltern gezahlt haben, damit ich mit dem Stoff einigermaßen hinterherkomme: unglaublich.
Dass ich mich mit der Schule schwer schwertat, hatte nicht nur mit dem Stoff zu tun, sondern auch mit meinem Status als Außenseiterin. Ich war immer die Kleinste in der Klasse, die meisten meiner Mitschüler überragten mich um Längen. Dann trug ich auch noch eine Brille. Hinzu kam ein unvorteilhafter Kurzhaarschnitt. Im Zusammenspiel bot das wohl die maximale Angriffsfläche. Aber woran es am Ende wirklich lag, dass ich als Mobbing-Ziel für einige auserwählt wurde, weiß ich bis heute nicht. Eine Zeit lang war für mich der Gang in die Schule der blanke Horror. Ich meldete mich kaum in den Stunden aus Angst und Unsicherheit, meine Noten wurden schlechter. Als dann sogar ein blauer Brief bei meinen Eltern eintrudelte, mussten meine Eltern reagieren. Regelmäßig führte mein Vater Gespräche mit Herrn K. und versuchte ihm klarzumachen, dass ich von meinen Mitschülern gemobbt wurde. Herr K. hörte ihm dann zu und tat … nichts.
Die Stunden bei Herrn K. sind mir bis heute nachhaltig in Erinnerung geblieben. Im negativen Sinne. Grundsätzlich machte er recht engagierten Unterricht, nur eben nicht mit mir. Trotzdem hat er mich auf eine Weise erkannt und gefördert, die ihm selbst vermutlich nie bewusst war. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar.
Auf dem Lehrplan stand der Besuch einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. Wir Schüler sollten einen Einblick bekommen, wie der Rechtsstaat so arbeitet. Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Wedding saß an diesem Tag ein etwa fünfzigjähriger Mann. Er sprach kein Deutsch und hatte deshalb einen Übersetzer zur Seite gestellt bekommen. Was dem Mann vorgeworfen wurde, worum es ging, weiß ich heute nicht mehr. Aber ich habe noch genau vor Augen, wie der Angeklagte immer wieder seinen Kopf zur Seite neigte, weil der Übersetzer ihm ins Ohr flüsterte. Zwischendurch fielen sich die verschiedenen Parteien immer wieder gegenseitig ins Wort: der Staatsanwalt, der Verteidiger, der Richter. Dann noch das sonore Murmeln des Dolmetschers, der für den Angeklagten simultan übersetzte. Ein chaotischer Sprachbrei waberte so durch den Raum.
Weil ich in der ersten Reihe saß, schnappte ich immer mal ein paar Brocken auf. Einzelne Worte und Halbsätze zwischen dem Angeklagten und seinem Übersetzer. Irgendwann wandte ich mich zu Herrn K. neben mir und flüsterte: »Ich verstehe, wovon die reden. Das ist Arabisch.« Ich hatte mir nichts dabei gedacht. Es schoss mir einfach so durch den Kopf und musste raus. Ich sagte es wahrscheinlich mehr zu mir selbst als zu meinem Lehrer. Der nahm es scheinbar unbeeindruckt zur Kenntnis, nickte nur stumm und verfolgte weiterhin die Verhandlung.
Ich hatte diesen Moment bereits vergessen, als wir das Gerichtsgebäude verließen und uns auf den Heimweg machten. Plötzlich tippte mir Herr K. von hinten auf die Schulter. Irritiert drehte ich mich um. Was wollte er? Ich war auf alles gefasst. Eindringlich sah er mich an und sagte: »Das ist ein Pfund, dass du Arabisch sprichst. Bau das ruhig aus. Daraus solltest du etwas machen.« Entgeistert starrte ich Herrn K. an und war baff. Hatte ich richtig gehört? Zum ersten Mal hatte dieser Mann etwas Positives zu mir gesagt. Ich konnte es kaum glauben.
Dass es für Außenstehende ungewöhnlich sein könnte, dass ich Arabisch sprach, war mir bis dahin nicht in den Sinn gekommen. Warum auch? Für mich war es das Normalste der Welt. Erst durch Herrn K. wurde mir bewusst, dass es offenbar ein Alleinstellungsmerkmal war. Zum ersten Mal bekam ich das gespiegelt. Zum ersten Mal hatte jemand darauf reagiert.
Dass Leute in Berlin Arabisch sprechen, ist ja heutzutage nichts Ungewöhnliches. Vor allem in Kreuzberg, Neukölln oder Wedding. Dort wohnen viele Araberinnen und Araber. Aus dem Libanon, Palästina, Syrien, Ägypten. Im Ostteil der Stadt sind es bis heute weitaus weniger. In Pankow, wo vor dem Fall der Mauer die politische und intellektuelle Elite des Landes lebte und danach gut situierte Besserverdiener aus Westdeutschland, waren arabische Nachbarn eher eine Seltenheit. Außer meinem Vater und einigen seiner alten libanesischen Studienfreunde kannte ich keine weiteren Libanesen in der Gegend, geschweige denn sonst jemanden, der wie ich Arabisch sprach.
Mein Vater erzählte mir mal, dass es in der gesamten DDR nur um die sechzig libanesische Studenten überhaupt gab. Für die meisten, die Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger vorm Bürgerkrieg geflohen sind, war Ost-Deutschland nur eine Art Zwischenstopp. Die DDR-Fluggesellschaft »Interflug« bot damals einen Direktflug vom Libanon nach Deutschland an. Tausende Geflüchtete stiegen in Beirut in den Flieger und landeten in Berlin-Schönefeld. Dort kauften sie sich dann für fünf Ost-Mark ein Transitvisum und »machten rüber« in den Westen. Besonders viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die vorher schon aus ihrer Heimat in den Libanon und von da aus Richtung Deutschland flüchten mussten.
Mein Vater aber wollte in der DDR Fotografie studieren und bekam ein Stipendium. Er war damals zweiundzwanzig und hatte eine Zusage von der renommierten Kunsthochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Für ihn ein Sechser im Lotto. Schon immer hatte er sich für Fotografie interessiert, mit einer kleinen Kamera geknipst, was ihm vor die Linse kam. Auch im Libanon hatte er einige Zeit in Studios, bei libanesischen Hochzeiten oder auch Miss Libanon fotografiert, und diesen Traum wollte er sich dann in der DDR verwirklichen. Nicht weil er mit dem System sympathisierte, sondern aus ganz pragmatischen Gründen. Anders als zum Beispiel in Kanada, wohin es viele seiner Landsleute wegen der französischen Sprache verschlug, hatte er damals für das Studium der Fotografie die Auswahl DDR, Tschechoslowakei oder die Sowjetunion. »Was soll ich mit Russisch oder Tschechisch, Aline?«, hatte mein Vater mir vor Jahren mal geantwortet, warum er die DDR wählte. Er sprach wie viele junge Libanesinnen und Libanesen neben Arabisch fließend Französisch, etwas Schulenglisch und jetzt noch Deutsch? – Ja, damit konnte er mehr mit anfangen. Das Studium in Leipzig war für ihn eine Chance. Dass er dafür auch einiges aufgeben musste, nahm er in Kauf und hat es bis heute nicht bereut.
Seine Familie gehört der christlichen-katholischen Glaubensgemeinschaft der Maroniten im Libanon an. Noch heute reagieren Menschen verwundert, wenn sie von meinen Wurzeln erfahren. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, lautet: »Warum trägst du kein Kopftuch?« Dass es im Libanon, oder generell in der Region, nicht nur Muslime gibt, scheinen die wenigsten auf dem Schirm zu haben.
Aber egal ob christlich oder muslimisch: In Pankow, wo ich geboren und aufgewachsen bin, habe ich die ersten Jahre meines Lebens ohnehin kaum Libanesen getroffen. Wenn, dann waren es alte Studienfreunde meines Vaters, die auch damals nach Deutschland gekommen sind. Verstreut in ganz Berlin, zu deren Familienfeiern wir oft eingeladen waren. Da wurde dann libanesisch gesungen, getanzt und lecker gegessen. Für mich als Kind waren das tolle Abende, mit vielen anderen Kindern, die so aussahen wie ich. Das war für mich Normalität. Ohne Zwang, ohne Probleme. Ich erinnere mich an eine libanesisch-nicaraguanische Familie, bei der wir früher oft waren. Ihre Tochter war etwas jünger als ich, aber eine gute Spielpartnerin. Und sie sprach damals schon drei Sprachen: Deutsch, Spanisch und Arabisch. Diese Diversität. Verschiedene Kulturen, die zusammenkamen. Dass sie so viele Sprachen in so einem jungen Alter sprechen konnte, fand ich ziemlich cool und war sehr neidisch. Denn mein Arabisch dümpelte bis dahin noch eher vor sich rum.
Dass ich auch in Pankow gelegentlich Libanesen traf, änderte sich erst Mitte der Nullerjahre. Damals zog die libanesische Botschaft in eine denkmalgeschützte Villa, die sich nur wenige hundert Meter Luftlinie von unserem Wohnhaus entfernt befand. Das zweistöckige Gebäude mit dem ausgebauten Mansardendach war mir schon oft im Vorbeigehen aufgefallen. Es war ein umzäuntes, aus der Zeit gefallenes Schmuckstück, das Ende des neunzehnten Jahrhunderts erbaut wurde. Anfangs diente es dem jüdischen Zigarettenfabrikanten Josef Garbáty und seiner Familie als Privatwohnsitz – daher auch der Name: Villa Garbáty. Hier wohnte der Unternehmer bis zu seinem Tod 1939. Nachdem er gestorben war, emigrierte seine Familie in die USA. Sein Zigarettenimperium, das mehrere Standorte in Prenzlauer Berg und Pankow umfasste, war zu diesem Zeitpunkt auf Grundlage der sogenannten »Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben« längst zwangsverkauft worden, unter anderem an die Hamburger Reemtsma Zigarettenfabrik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich in dem Gebäude dann die bulgarische Botschaft. Bis zum Mauerfall und der damit einhergehenden politischen Wende. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung verfiel das Areal erst mal ungenutzt. Bis es von einem Unternehmer gekauft und an die Partei »Die Republikaner« vermietet wurde. Ausgerechnet! Dass die rechtskonservative Partei hier ihre Landeszentrale einrichtete, empfanden viele Anwohner vor dem geschichtlichen Hintergrund des Hauses als ziemlichen Hohn. Immer wieder gab es Proteste gegen die Nachbarn. Demonstranten zogen mit Bannern durch die Straße. »Kein Platz für Ausländerfeindlichkeit in Pankow«, stand da drauf oder »REPs unerwünscht«. Linke Jugendliche gingen sogar noch weiter und verübten Anschläge auf das Gebäude. Auch wenn ich noch einen Tick zu jung war, um das alles richtig einzusortieren, bekam ich es aus der Ferne mit. Jedes Mal, wenn ich an der Villa vorbeikam, wechselte ich vorsichtshalber die Straßenseite. Die komischen Gestalten, die dort ein- und ausgingen, waren mir unheimlich.
Vorbei war der Spuk erst, als »Die Republikaner« 2003 aus dem Gebäude auszogen. Was für eine Erleichterung! Die Villa wurde umfassend saniert, dann zog die Botschaft des Libanon ein, und vor dem Eingang wehte die mir vertraute libanesische Fahne mit der Zeder in der Mitte. Ab da begegnete ich auf der Straße immer mal wieder Leuten, die wie ich Arabisch sprachen. Ich ließ mir dann nichts anmerken, horchte innerlich aber jedes Mal interessiert auf.
Jemanden wie mich bezeichnet man heutzutage als einen Menschen mit Migrationshintergrund. Das Statistische Bundesamt definiert diesen Begriff so: »Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.« Nun ja. Anfang der Nullerjahre existierte dieser Begriff noch nicht. Damals war man entweder Ausländer oder Deutscher, und ich war ganz klar Letzteres. Für mich selbst habe ich das nie in Frage gestellt. Dabei hätte ich ja eigentlich ins Grübeln kommen können. Zum Beispiel weil ich eben nicht wie die meisten meiner Klassenkameraden in den Sommerferien nach Spanien oder Italien fuhr, sondern in den Libanon. Oder weil ich zu den Klassenfesten keinen mayonnaisegetränkten Kartoffelsalat mitbrachte, sondern Taboulé: einen leichten, unheimlich leckeren Salat aus Petersilie und etwas Bulgur, der Zahnseide nach dem Essen zu deinem besten Freund macht. Meine Klassenkameraden und ihre Eltern näherten sich der Schüssel meist erst mal zögerlich. Mir war das recht. So blieb immer noch eine Portion für das Abendessen zu Hause übrig. Heute wäre das sicherlich anders. Gerichte aus dem Libanon erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit und gelten als Trend-Food. Seit Jahren sprießen libanesische Imbisse wie Pilze aus dem Boden. Wenn Leute überhaupt etwas über den Libanon wissen, dann wie gut die libanesische Küche ist. Mein ehemaliger ZDF-Kollege Christian Sievers schwärmte jedes Mal, wenn er mich sah, und zählte alle Gerichte auf, die er liebt und vermisst. Oft schickte er mir Fotos von Essen oder Ecken im Libanon, mit dem Satz: »Na, wo bin ich gerade?« In gewisser Weise haben mein Vater und ich also Pionierarbeit geleistet.
Dass mein Anderssein von den Menschen in meinem Umfeld lange Zeit nicht hinterfragt wurde, ist mir erst im Rückblick aufgefallen. Weder meine Lehrerinnen und Lehrer noch meine Klassenkameraden machten es zum Thema. Für sie war ich einfach nur Aline. Und weil mein Vater eben Libanese ist, war es nur naheliegend, dass ich in den Ferien dorthin fahre und zu Klassenfesten libanesische Speisen mitbringe. Erst der Gerichtstermin und das Erlebnis mit Herrn K. haben diese Selbstverständlichkeit für mich in Frage gestellt. Für mich war es eine Zäsur. Denn ab da fing ich so langsam an, mich mit meiner Identität zu beschäftigen. Wo komme ich her? Wer bin ich? Was bedeutet es, dass ich Arabisch spreche, dass ich diese andere Seite habe? Diese Fragen haben sich mir vorher nie gestellt. Wahrscheinlich braucht es dafür ein gewisses Alter, eine gewisse geistige Reife. Ich musste erst fünfzehn werden, um von außen darauf gestoßen zu werden. Um vermittelt zu bekommen, dass ich anders bin als die anderen Jungs und Mädchen an meiner Schule.
Warum habe ich das vorher nicht wahrgenommen?
Heute erkläre ich mir das damit, dass es im Leben meiner Familie weder Zeit noch Raum dafür gab, sich mit diesen Themen zu befassen – vielleicht auch, weil einfach weniger Aufhebens drum gemacht wurde. Ich werfe das meinen Eltern nicht vor. Sie hatten viel mit sich zu tun. Nicht aus Egoismus, sondern weil einiges zusammenkam: 1989, als die Mauer fiel, war mein Vater gerade erst ein Jahr vorher fertig mit der Hochschule geworden. Die zurückliegenden anderthalb Jahre bis dahin waren bestimmt die anstrengendste Zeit seines Lebens gewesen. Ich kam auf die Welt, er steckte in den letzten Zügen seines Studiums. Meine Mutter lebte mit mir zu diesem Zeitpunkt schon wieder in Berlin. Daher war mein Vater unter der Woche an der Hochschule in Leipzig, um seinen Abschluss zu machen, und an den Wochenenden bei uns in Berlin, um sich um mich zu kümmern.
Dass sein Studium länger dauerte als ursprünglich geplant, hatte jedoch nicht allein mit mir und dem vielen Pendeln zu tun. Sein Stipendium und damit sein Visum galten nur für die Dauer des Studiums. Sobald er mit der Diplomarbeit fertig sein würde, hätte er direkt zurück in den Libanon gemusst. Aber nichts lag ihm ferner als das. Unter allen Umständen wollte er bei mir und meiner Mutter bleiben. Die Behörden hatten zwar Verständnis, aber mussten sich an die Vorschriften halten. Regelmäßig luden sie meinen Vater vor. Jedes Mal musste er dann Auskunft darüber geben. Dass er frischgebackener Familienvater war, interessierte die Beamten aber nicht. Immerhin unterstützte ihn die Hochschule dabei, von den Behörden eine Verlängerung zu bekommen. Das klappte aber nur, weil er dort einen guten Ruf hatte. Bei seinen Kommilitonen und Dozenten war er sehr beliebt. Er war zu jedem freundlich, hilfsbereit und respektvoll. Ein bunter Hund, würde man heute sagen, der zu vielen Wegbegleitern von damals immer noch Kontakt hat. Daher stieß er auch auf offene Ohren, als er der Direktorin aufgelöst von seiner Situation erzählte. Kurzerhand rief sie bei den Behörden an, klärte die Angelegenheit und bekam für meinen Vater eine offizielle Aufenthaltsverlängerung. Kurze Dienstwege würde man heute sagen. Für ihn und auch für meine Mutter war das eine große Erleichterung.
Heute kann mein Vater vergleichsweise beiläufig von dieser Zeit erzählen. Als seien all diese Dinge nicht ihm, sondern einem Fremden passiert. Wie nervenaufreibend die Situation damals für ihn gewesen sein muss, kann ich nur erahnen. Die ständige Ungewissheit: Irgendwann ertrugen meine Eltern sie nicht mehr. Um sicherzugehen, als Familie nicht auseinandergerissen zu werden, beantragten sie Ende 1988 ihre Hochzeit mit dem Ausreiseantrag. Das ging damals nur zusammen. Unter normalen Umständen hätten sie nie die Absicht gehabt, in den Westen zu gehen. So aber erschien ihnen der Libanon als einzige Möglichkeit für eine gemeinsame Zukunft als Familie.
Die Abschrift des Ausreiseantrags hat mir meine Mutter Jahre später mal gezeigt. Was mich erstaunte: Es war nicht einfach ein formeller Antrag mit ein paar biografischen Angaben. Meine Eltern mussten sich vor den DDR-Behörden regelrecht nackig machen. Detailliert mussten sie darlegen, wie sie sich kennengelernt hatten und wie sie einander nähergekommen sind. Schritt für Schritt. Jeder Urlaub war aufgeführt, das erste Kennenlernen mit den Eltern meiner Mutter, der Heiratsantrag. Halb amüsiert, halb fassungslos las ich das Schriftstück. Die komplette Beziehungsbiografie meiner Eltern wurde darin auf mehreren Seiten chronologisch zusammengefasst. Für mich völlig absurd!
Die ersehnte Genehmigung von den Behörden kam im Frühjahr 1989. Aber selbst als meine Eltern im Mai heirateten, änderte sich nichts an der nervenaufreibenden Prozedur. Mein Vater musste weiterhin Rechenschaft ablegen, der Trauschein stellte die Beamten nicht zufrieden. Im Juni wurde er erneut zur Polizei gerufen – und nahm mich mit. »Wollen Sie gehen oder bleiben?«, fragte die Beamtin meinen Vater und sah ihn eindringlich an. Papas Herz schlug schneller. Dass ihm so unvorhergesehen die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, damit hatte er nicht gerechnet. Libanon oder DDR. Wie sollte er sich entscheiden? In seiner Heimat herrschte immer noch Krieg, sogar der Flughafen von Beirut war geschlossen. Konnte man sich unter diesen Umständen mit einer Familie eine sichere Zukunft aufbauen? Wohl kaum. »Wie sieht es mit den Rechten für meine Frau und meine Tochter aus?«, wollte mein Vater wissen, bevor er diese wichtige Entscheidung für uns alle traf. Ich saß auf seinem Schoß und gluckste. »Sie bekommen uneingeschränktes Reiserecht, sowohl ins kapitalistische als auch ins sozialistische Ausland«, erwiderte die Beamtin. Mein Vater überlegte. Seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der DDR waren gut. Als Fotograf auf der Leipziger Messe verdiente er viel Geld, seine Fotos waren gefragt. Wenn er dann auch noch mit der Familie frei reisen durfte, was sprach dann überhaupt noch für eine Rückkehr in den Libanon? »Wir bleiben«, entschied mein Vater kurzerhand und schluckte. Zumal sich auch meine Mutter auf eine so große Lebensentscheidung, von jetzt auf gleich auszureisen, erst hätte einstellen müssen.
Doch dann fiel, zack, die Mauer.
»Da war ich vielleicht sauer«, sagt meine Mutter noch heute und lacht. Wie gerne hätte sie »exklusive Westluft« geschnuppert und damit ihre Freunde und Verwandten beeindruckt. Auf einmal durften plötzlich alle diese nicht mehr ganz so exklusive Luft schnuppern.