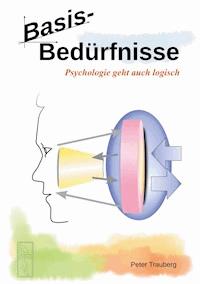
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Welche Anteile menschlichen Verhaltens sind genetisch ererbt, welche kulturell bedingt und welche machen eine Person einzigartig? Geiz zum Beispiel wäre evolutionär nützlich, ist aber nicht erblich. Dieses Buch berichtet von einer geisteswissenschaftlichen Entdeckung, mit der sich genetische von kulturellen Bestandteilen menschlichen Verhaltens trennen lassen. Bei der Vererbung von Informationen ist die biologische Evolution systematischen Einschränkungen unterworfen. Das Verständnis dieser Einschränkungen liefert einen Schlüssel, mit dem sich ererbte Verhaltensstrukturen erschließen lassen. Auf anschauliche und logisch nachvollziehbare Weise erklärt das Buch die Grundlagen der neuen Erkenntnisse und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Unter anderem ergibt sich ein Qualitätskriterium, mit dem die wissenschaftliche Qualität psychologischer Aussagen geprüft werden kann. Das Buch lädt zum Mitdenken und Argumentieren ein und bleibt bei aller Logik allgemein verständlich. Mit der neuen Methodik entfaltet sich ein faszinierend klarer Blick auf die menschliche Psyche. Bedürfnisse werden mit ihren Funktionsprinzipien erkennbar. Scheinbare Widersprüche im Verhalten klären sich auf. Und bei aller sachlichen Analyse bleibt die Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten stets im Blick. Die neue Methode liefert eine Grundlage der theoretischen Psychologie. Theoretische Psychologie kann die empirische Forschung nicht ersetzen, aber sie liefert das Gerüst, das die Einordnung von Forschungsergebnissen ermöglicht und das Aussagen eine bestimmte Form gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Worum es geht
Erkennbarkeit des Gegenstandes
Antworten der Fachgebiete
1 Fragen an die Fachgebiete
2 Philosophie
Argumentationskette
Erkenntnistheorie
Kant
Materialismus
Phänomenologie
Kognitionswissenschaft
Postmoderne
Rawls
Habermas
Postmoderne philosophische Ethik
Umgang mit dem Tabu
3 Psychologie
Psychoanalyse
Popper
Behaviorismus
Motivationsforschung
Experimentelle Psychologie
Kognitive Psychologie
Verhaltensbiologie
Neuropsychologie
Emotionsforschung
4 Der Begriff Wille
5 Gene und Umwelt
Verhaltensforschung an Tieren
Evolutionäre Psychologie
Grundlagen einer Ethik
Ist die Trennung möglich?
Abschließend
Methodische Grundlagen
6 Entstehungsgeschichte
7 Kognitives Modell
Das Modell
Wahrnehmungen und Handlungen
Inversion des Modells
Der Begriff Kognition
Ideale Elemente
Zur handelnden Psyche
8 Kybernetisches Modell
Elemente des Regelkreises
9 Weitere Methoden
Reichweite
Grenzwertbetrachtung
Zwei Arten von Bedürfnissen
Wellenbewegungen
Lineare Unabhängigkeit
Basisbedürfnisse
Geeignete Gegenstände
Anzahl der Bedürfnisse
Fähigkeiten
10 Psychologischer Skeptizismus
Trennung zwischen Natur und Kultur
Das Synchronisationsproblem
Kulturelle Begriffe
Pfade
Drei Arten von Zweifeln
Satz von der Zuverlässigkeit
Qualitätskriterium
Übersetzung kultureller Begriffe
Bedeutungsverschiebung
Sprachkritik
Beispiele
Einschränkung der Natur
11 Was sind Gefühle?
Bedürfnisse
12 Einleitung
Beispiele
Benennung
Allgemeinheit der Gegenstände
13 Resonanz
Konzeption Resonanz
Wahrnehmungsstrecke Umwelt
Persönliche Wahrnehmungsfähigkeiten und sinnliche Strukturen
Pfad Messgröße Resonanz
Benötigen wir Resonanz?
Persönliche sinnliche Strukturen
Resonanz in geringer Reichweite
Ästhetik und Relativismus
Terminologie
Nützlichkeit
Monolithisches Bedürfnis?
14 Selbstabbildung
Handlungen und Stimmungen
Langfristige Motive
Bowling
Elementarhandlung
Erwartung
Handlungsstruktur
Routinehandlungen
Zwei Wege
Gedanken
Y-Struktur
Genetischer Algorithmus
Bewertung
Endogene Handlungselemente
Abgrenzungen
Terminologie
Kulturelle Begriffe zu Selbstabbildung
Eine Formel
Beispiel Euphorie
Der Pfad
Selbst oder Fähigkeiten
Lange Reichweite
Aufmerksamkeit
Intelligenz
Abbildung der Umwelt
Virtuelle Gegenstände
Auflösung eines Widerspruchs
Tierische Vermutung
15 Zärtlichkeit
Alltagserfahrung
Berührt werden
Soziales Bedürfnis
Weitere Reize
16 Sexualität
17 Angst
Ausgangssituation
Routinehandlungen
Erinnerungen
Terminologie
18 Aggression
Auslöser
Befriedigung
19 Empathie
Spiegelneurone als Pfadelemente
Empathie über Resonanz
Soziale Empathie
Empathie über Selbstabbildung
Empathie über Sexualität
Empathie der Zärtlichkeit
Empathie der Angst
Zusammenfassung Empathie
20 Konstruktion
Weitere Bedürfnisse
Gerüst
Abbildungen auf die Kultur
21 Zusammenwirken
22 Wettbewerb, Kreativität und Kommunikation
23 Macht
Leben in der Autokratie
Durcheilen der Macht
24 Dienstleistungsgesellschaft
25 Ungewöhnliche Handlungen
Kontroll-Strategie
Strategie der Verantwortlichkeit
Reaktionen
Nutzung der Gegenstände
Elastizität der Gegenstände
26 Traumatisierung
27 Kränkung
28 Religion
Aufgaben der Religion
Resonanz gegen Angst
Rituale
Monotheismus
Seelsorge
29 Erotik
Devotes Verhalten
Würde
30 Liebe
Unerfahrenheit
Kommunikation
Verwerfungen
31 Der Nutzen der Bedürfnisse
Nachbetrachtungen
32 Methodik
Verhaltensbiologie
Psychologischer Skeptizismus
Behaviorismus
33 Kritik der Verhaltensbiologie
34 Über die aktuelle Kultur hinaus
35 Zusammenfassung
Anhang
Anmerkungen
Personenregister
Sachregister
Literaturverzeichnis
Einleitung
Hinterher erscheint alles wie vorher, also was soll das Ganze?
Eine Lehrerin müht sich engagiert den Schülern ihrer Klasse bestimmte Inhalte zu vermitteln. Nach einem Jahr verlassen die Schüler die Schule – die Lehrerin sieht sie nie wieder. Vor ihr sitzt eine neue Klasse mit anderen Schülern. Es hätten die Schüler vom nächsten Jahrgang sein können, oder die vom vorletzten. Die Wahrnehmungen der Lehrerin ändern sich kaum – Warum hat sie sich gemüht?
Eine Ingenieurin konstruiert im Kundenauftrag ein Maschinenteil. Sie setzt sich dafür ein, das Teil nach einem bestimmten, von ihr favorisierten Prinzip zu entwerfen – nicht nach einem anderen, das der Kollege für geeigneter hält. Mit dem fertig entworfenen Teil endet der Auftrag. Der Kunde erhält die Konstruktion. Die Ingenieurin schaut ihre Pläne nie wieder an. Ihre Wahrnehmungen sind hinterher wie vorher.
Ein Hobbygärtner bestellt seinen Garten. Im Frühjahr kauft er frische Pflanzen und begrünt seine Beete. Der Garten erblüht. Im Herbst verwelken die Pflanzen. Im Winter erscheint der Garten trostlos – wie im Jahr zuvor.
Das menschliche Verhalten ist ein Mysterium. Unsere Wahrnehmungen, die Erscheinungen der Welt, die wir aufnehmen, ändern sich durch unsere Handlungen meistens nur minimal. Dennoch setzen wir uns mit Eifer dafür ein, die Welt von einem Zustand in einen anderen zu versetzen. Unsere Natur muss uns mit der Funktion ausgestattet haben, das zu bewerkstelligen. Nicht, dass ich mich über die Mühen beschwere, aber ich möchte doch wissen, wie es funktioniert.
Worum es geht
Das Vorhaben, das diese Untersuchung unternimmt, ist kein kleines. Es geht um die Frage: Was will der Mensch? Genauer geht es darum: Was sind die Bedürfnisse des Menschen? Was will er regelmäßig heute und morgen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder aufs Neue? Was ist die Natur seines Begehrens, auf das er notwendig sein Wollen und sein Leben einrichtet? Wichtiger noch, als eine detaillierte Antwort, die dieses Wollen in allen Einzelheiten beschreibt, ist die Frage nach der Methode: Wie lassen sich überhaupt Prinzipien von Bedürfnissen erkennen?
Welche Prinzipien hat die Evolution für das Wollen des Menschen aufgefunden? Welche Prinzipien haben sich in der genetischen Entwicklung vom tierischen Ahnen über den Vormenschen und Frühmenschen herauskristallisiert, die die Handlungen des heutigen Menschen steuern, ihn in der gegebenen Umwelt überleben lassen und ihn dazu bringen, eine ungeheure Vielfalt unterschiedlicher Dinge zu tun?
Nun könnte man meinen, dass die Frage generell unbeantwortbar sei, da sich jeder Mensch mit seinen individuellen Interessen beschäftigt und diese Interessen in einer Weise vielfältig sind, dass sich darin kein gemeinsames Muster finden lässt. Dennoch sind wir in der Lage, miteinander zu kommunizieren, uns über unsere Interessen und Konflikte auszutauschen und gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Offenbar gibt es eine gemeinsame Basis des menschlichen Wesens, die uns über die verschiedenen Interessen hinweg verbindet und ein gegenseitiges Verständnis ermöglicht.
So unbeantwortbar die Frage angesichts der zahlreichen menschlichen Neigungen auf den ersten Blick erscheint, so wird sie einfacher, wenn wir die biologische Evolution mit hinein nehmen. Die Evolution bringt einerseits eine große Fülle an Möglichkeiten, biologische Eigenschaften über die Gene von Generation zu Generation zu übertragen. Andererseits ist sie auf diesem Wege bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Einschränkungen unterworfen. Gerade solche Einschränkungen können helfen, sinnvolle von weniger sinnvollen Annahmen über ererbtes Verhalten zu trennen.
Beispielsweise könnten wir uns mit einer Grenzwertbetrachtung vorstellen, dass für mehr oder weniger jede Situation, die uns im Laufe des Lebens begegnet, ein eigenes Verhaltensprogramm genetisch überliefert sei. In jeder neuen Situation, in die wir geraten, überraschte uns unsere Natur mit einem neuen Verhalten. Daran können wir die Frage prüfen, ob dieser Umstand für die Evolution effizient wäre. Offensichtlich bräuchte das menschliche Genom eine ungeheure Größe, um alle diese Informationen zu übertragen. Und die überlieferten Verhaltensmuster kämen sich beständig gegenseitig in die Quere. Das Überleben in einer sich stets verändernden Umwelt würde damit zum Glücksspiel. Offensichtlich ist diese extreme Annahme wenig sinnvoll.
Während die meisten unserer physischen Eigenschaften offensichtlich genetisch bestimmt sind, lässt sich das bei den Verhaltensmustern unserer Psyche nicht so leicht erkennen. Praktisch alle Menschen haben Arme und Beine. Und diese haben sie bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Mutterleib, zu einem Zeitpunkt, an dem die Umwelt bzw. die Kultur nur einen geringen Einfluss auf ihre Entwicklung nehmen konnte. Überall auf der Welt haben Menschen Arme und Beine und von den vergangenen Generationen wissen wir ebenso, wie von den gegenwärtigen, dass sie so ausgestattet waren und sind. Es ist daher offensichtlich, dass die Ausbildung der Gliedmaßen genetischen Ursprungs ist.
Verhaltensmuster von Menschen sind dagegen keineswegs so einfach gegeneinander abzugrenzen und bei einem Großteil der Menschheit wiederzuerkennen. Die Verhaltensmuster einer Person entwickeln sich erst im Heranwachsen. Diese Entwicklung geschieht im steten Wechselspiel mit der Umwelt und speziell mit der Kultur. Welche Aspekte des Verhaltens sind so relativ stabil, wie man es für eine genetische Determination erwarten kann? Verhalten bringt die unterschiedlichsten Formen hervor. In den verschiedenen Teilen der Welt sind unterschiedliche Kulturen entstanden. Menschen vergangener Generationen dachten anders als wir es heute tun. Sie hatten andere Wertmaßstäbe und taten andere Dinge als wir. Selbst im Vergleich mit unseren eigenen kulturellen Vorfahren handeln wir heute in vielen Situationen anders als sie. Entsprechend schwieriger ist es zu bestimmen, welche Elemente unseres Verhaltens durch die Gene bestimmt sind, und welche die Folge unserer kulturellen oder persönlichen Entwicklung sind.
Bei den Bedürfnissen, die unser Verhalten lenken, sind wiederum die physischen besser zu erkennen als die psychischen.
Der Zusammenhang ist leicht zu erkennen, dass wir essen, um unseren Körper zu ernähren und dass unser Körper uns eindringliche Signale gibt, wenn er zu wenig Nahrung erhält. Offensichtlich sendet unser Körper ein Signal an die Psyche, wenn ein Mangel an Nahrung unserem Körper und damit unserer Handlungsfähigkeit zu schaden droht. Ein entsprechendes Signal verursacht uns Leid und nötigt uns zu handeln. Eine Kultur, die darin bestünde, sich dieser Nötigung zu widersetzen, wäre wenig erfolgreich. Die meisten Menschen würden der Forderung einer solchen Kultur, die Nahrungsaufnahme zu verweigern, vermutlich nicht nachkommen. Auf jeden Fall bliebe ihnen ein intensives Bedürfnis nach ausreichend Nahrung. Offensichtlich handelt es sich also bei dem Bedürfnis Hunger um ein genetisch veranlagtes, an dessen Prinzip die Kultur nicht zu rütteln vermag. Wir können unseren Umgang mit dem Hunger ändern, nicht aber das Bedürfnis an sich.
Schwieriger sind dagegen psychische Bedürfnisse zu erklären. Warum spielen wir gerne Fußball oder warum lesen wir gerne ein Buch? Es kann zum Beispiel sein, dass wir in unserer Jugend gerne Fußball spielten. Nichts konnte uns davon abhalten, zu den Freunden auf den Bolzplatz zu laufen und zu kicken. Irgendwann haben wir uns davon abgewandt und beschäftigen uns in unserer Freizeit lieber mit dem Lesen von Büchern. Wir denken vielleicht gerne an die Fußballerlebnisse in unserer Jugend zurück. Dennoch verspüren wir keinerlei Bedürfnis, wieder hinaus zu laufen und zu kicken. Es könnte auch anders herum sein, dass wir uns stets mit geistigen Tätigkeiten beschäftigt haben und plötzlich den Sport für uns entdecken. Welches dieser Bedürfnisse ist nun angeboren und welches hat sich durch die Kultur und persönliche Entwicklung herausgebildet?
Verhaltensweisen sind schwierig gegeneinander abzugrenzen. Wir nutzen ständig unsere Psyche, um Handlungen zu steuern. Ebenso erleben wir ständig die Handlungen unserer Mitmenschen. Wir können daher relativ einfach sagen: Der hat dieses gemacht und ich habe jenes getan. Wollen wir die beobachteten Handlungen jedoch in allgemeine Begriffe abstrahieren, so dass nicht jede Handlung als unverständliche Einzelaktion für sich stehenbleibt, sondern verständlich in einer Ordnung erscheint, so bieten sich dafür bald zahllose Alternativen an. Jede Handlungsbeschreibung ist von einer Perspektive abhängig, aus der heraus sie das Verhalten interpretiert. Wenn es dann weiter darum geht, zu unterscheiden, welche Aspekte dieser Handlung sind uns mit unseren Genen überliefert, welche sind aus unserer kulturellen Entwicklung hinzugekommen und welche werden durch die momentane Situation bestimmt, wird die Lage unübersichtlich. Die unzähligen Aspekte menschlichen Handelns haben keine Kennzeichen, an denen wir ihren Ursprung erkennen können.
Verhaltensforscher, insbesondere Motivationsforscher sprechen von Disposition, wenn sie meinen, ein Individuum habe eine bestimmte Veranlagung zu einem Verhalten mitgebracht. Mit Disposition kann einerseits eine genetische und andererseits eine kulturell bzw. individuell erworbene Voraussetzung gemeint sein. In dieser Untersuchung haben wir ein besonderes Interesse an genetisch veranlagten Verhaltensdispositionen, die zudem mehr oder weniger allen Menschen gemeinsam sind.
Der Begriff Disposition wird von Forschern, die eine These über Verhalten vertreten, häufig so eingesetzt, dass er die These relativiert. Es wird gesagt, Menschen haben eine Disposition so oder so zu handeln. Da Verhalten aber stets im Zusammenhang mit individuellen Unterschieden der Person, mit Kultur und einer besonderen konkreten Situation einhergeht, könne man nicht genau sagen, worin die Disposition im Einzelnen bestehe. Einerseits sagt man also, man wolle eine These aufstellen, andererseits sagt man, es könne nicht genau beschrieben werden, worin die These besteht. Diese Ungenauigkeit der Theorie gilt es zu überwinden. So soll zumindest eine klare Behauptung erreicht werden, eine Behauptung darüber, was in der menschlichen Psyche der Fall ist, wenn schon die Überprüfung einer solchen Behauptung durch Messungen des Verhaltens ihre großen Unsicherheiten mitbringt.
Um den Prinzipien der Verhaltensweisen nachgehen zu können, sollten die Beschreibungen beobachteter Verhaltensweisen eindeutiger und damit nachvollziehbarer gestaltet sein. Darauf aufbauend werden Theorien über Verhaltensdispositionen tendenziell besser überprüfbar. Der Skeptizismus, den diese Untersuchung vorstellen wird, liefert Kriterien und zeigt eine Methode auf, mit der Beschreibungen von Verhaltensdispositionen bestimmter werden.
Eine andere Frage, die man hinter dem Thema »Was will der Mensch?« vermuten könnte, ist die: Was will der Mensch auf lange Sicht? Welche Ziele steckt er sich, oder gar, welchen Sinn hat das Leben? Diese Frage ist jedoch nicht Gegenstand der Untersuchung. Vielmehr liegt ihr die Vorstellung zugrunde, dass der Mensch angeborene Verhaltensdispositionen hat. Mit Intelligenz sucht er nach Strategien, den Verhaltensdispositionen besonders gut gerecht zu werden, viel Lust und wenig Unlust zu erleben. Bei der Optimierung der Strategien, die durch Versuch und Intelligenz erzeugt und durch Kultur überliefert werden, wäre es dem Menschen hilfreich, er könnte sich an einem letzten Ziel orientieren. Ein solches Ziel zu bestimmen ist aber nicht Gegenstand unserer Betrachtung.
In dieser Untersuchung geht es um die Bestimmung der Verhaltensdispositionen, genauer gesagt, um Bedürfnisse. Es geht also um die Frage, was der Fall ist. Dies gilt es so klar wie möglich von der Frage zu trennen, welche Strategien sich zur Optimierung von Verhalten anbieten, also der Frage, was soll ich tun. Erst eine Grundlagentheorie verbunden mit einer Grundlagenforschung, die nicht nach dem Wozu fragt, kann eine solide Basis liefern für eine nachfolgende Suche nach optimierten Strategien.
Erkennbarkeit des Gegenstandes
Als moderne, aufgeklärte Menschen in einer Wissensgesellschaft verstehen wir selbst als Laien hochkomplexe Gegenstände unser Umwelt zu erklären. Wir wissen aus welchen Basiskomponenten ein Automobil besteht. Wir können verschiedene Antriebstechniken wie Otto-, Diesel- oder Elektromotor benennen und wir wissen zwischen den Komponenten zu unterscheiden, die Energie bereitstellen, wie Motor und Batterie, und denen, die sie nutzen, wie Getriebe, Antrieb, Lenkung und Bordelektronik. Auch bei anderen komplexen Gegenständen unseres Alltags wie Computern, der Quantenmechanik oder den Institutionen unserer Gesellschaft zum Beispiel, weiß der durchschnittlich Gebildete einige Kernelemente aufzuzählen und ihre Bedeutung zu erklären. Doch wenn es darum geht, die Grundelemente menschlichen Wollens zu benennen, dann stehen wir dem hilflos gegenüber.
Aber die Frage nach menschlichem Wollen ist keine nach einem Gegenstand jenseits aller Erfahrung, wie die nach dem Innenleben Schwarzer Löcher, Fragen wie »was war vor dem Urknall?« oder »warum ist nicht Nichts?« Wir gehen täglich mit dem menschlichen Willen um. Wir probieren unseren Willen in zahlreichen Situationen aus und nutzen dazu wachsende und wechselnde Fähigkeiten. Wir lernen auf vielfältige Weise nicht nur unsere Bedürfnisse sondern auch die unserer Mitmenschen kennen. Wir schaffen es, gezielt miteinander umzugehen, fremde Wünsche und Empfindungen zu erahnen oder nachzuempfinden und über Gespräche Konflikte zu lösen.
Offensichtlich sind wir intuitiv in der Lage, diese Prinzipien zu verstehen und sie in unterschiedlichen Situationen erfolgreich anzuwenden, auch wenn es dabei gelegentlich zu Streit kommt, und zu Gewalt. Ein Mangel an Anschauung kann es nicht sein, der uns das Verständnis der menschlichen Psyche erschwert. Und offenbar haben wir im Laufe der Geschichte und der persönlichen Entwicklung des Einzelnen gelernt, immer besser damit umzugehen. Möglicherweise liegt es in der Komplexität des Gegenstandes, der schon eine einfache Ordnung zum Einstieg in diese Materie so schwierig macht. Gerade die psychischen Grundbedürfnisse spontan zu benennen, fällt uns schwer. Das liegt nicht zuletzt daran, dass auch die Wissenschaft keine Position gefunden hat, über die einigermaßen Konsens besteht.
Teil I
Antworten der Fachgebiete
1 Fragen an die Fachgebiete
Der erste Teil dieser Untersuchung stellt einige Fachrichtungen und Forschungsrichtungen der Geisteswissenschaften, speziell der Philosophie und der Psychologie vor, die auf die Fragestellung nach dem Wollen des Menschen hinarbeiten. Die Vorstellung ist recht weit gefasst, denn der Ansatz, den ich im Anschluss vorstellen möchte, sitzt gewissermaßen zwischen den Stühlen. Er ist konsequenter als der Zugang der Psychologie, die eher in zahlreichen Beispielen denkt, als den generellen theoretischen Zugang sucht. Andererseits ist die Psychologie konkreter mit ihren Aussagen über die Eigenarten der menschlichen Psyche, als die Philosophie. Diese sieht in der Psyche eher einen Abgrund mit seinen Unwägbarkeiten und fragt sich, wie damit umzugehen sei, statt zu fragen was es ist.
Im Zuge der Vorstellung der einzelnen Fachgebiete werden wir ihre Perspektive auf die Frage nach dem menschlichen Wollen beleuchten. Dabei werden wir die folgenden Fragen untersuchen:
(1) Mit welchen Methoden wird die Fragestellung angegangen?
(2) Wie werden genetische Ursachen menschlichen Verhaltens unterschieden von kulturellen bzw. anderen nicht genetischen Ursachen?
(3) Welche konkreten Antworten werden gegeben, zum Beispiel in der Form von identifizierten Bedürfnissen?
Ich werde skizzieren, in wieweit diese Ansätze und ihre Lösungsvorschläge Gemeinsamkeiten, Unterschiede oder gar Gegensätze zu den Thesen unserer nachfolgenden Untersuchung haben.
Die Einschätzung der Fachgebiete muss vage bleiben. Ich kann nicht von mir sagen, dass ich in den zahlreichen Gebieten detailliertes Wissen habe. So sind denn die Einschätzungen in ihrer Kürze notwendigerweise pauschalisierend und mit der entsprechenden Vorsicht zu lesen.
Dem Leser, der sich mit diesen Gebieten nicht näher auskennt, sollen die Beschreibungen einen kurzen Einblick ermöglichen. An verschieden Stellen der Untersuchung wird auf einzelne der genannten Gebiete Bezug genommen. Trotzdem soll die Untersuchung für sich ohne tiefere Kenntnisse der einzelnen Fachgebiete verständlich sein.
2 Philosophie
In diesem Kapitel werden wir einen Rundgang durch verschiedene historische wie aktuelle Gebiete der Philosophie machen.
Argumentationskette
Vereinfachend kann man verschiedene Hauptthemen der Philosophie als eine Argumentationskette betrachten, deren Fachgebiete und Methoden aneinander anschließen bzw. aufeinander aufbauen. Den Ausgangspunkt bildet die Erkenntnistheorie (Epistemologie), also die Frage: Wie kommt der Mensch mit seinen Fähigkeiten und durch Berücksichtigung logischer Zusammenhänge zu verlässlichen Erkenntnissen über die Welt und über sich als Mensch? Im zweiten Schritt, der Motivationstheorie könnte man mit den Werkzeugen der Erkenntnistheorie die Frage klären: Was will der Mensch seiner Natur und seiner Kultur nach? In einem dritten Schritt, der Ethik, gilt es unter Verwendung von Methoden und Erkenntnissen der voraufgegangenen Gebiete die Frage zu untersuchen: Wie können wir unser gesellschaftliches Zusammenleben so einrichten, dass jeder möglichst gut nach seinen Wünschen lebt?
Es fällt auf, dass die Philosophien, die im Zentrum allgemeiner Aufmerksamkeit standen und stehen, sich in der Regel nur minimal mit der Frage auseinandersetzen, was der Mensch von seiner Natur aus will, sondern eher gleich mit der Antwort aufwarten, was er soll, dass sie also die Psychologie umgangen haben. Trotz dessen, dass diese Theorien scheinbar an unserem Thema vorbeigehen, bilden sie dennoch eine wichtige Grundlage unserer Kultur. Umso dringender scheint die Frage, welche Vorstellung von der menschlichen Natur sie enthalten, wenn sie diese auch nur am Rande erwähnen und nicht näher ausführen. Darüber hinaus ist es interessant zu sehen, wie es ihnen dennoch gelungen ist, unter weitgehendem Ausschluss der Psychologie, ihre jeweiligen Theorien zu begründen.
Erkenntnistheorie
O.K., so einfach ist die Sache mit der Argumentationskette nicht. Schließlich geht bereits im ersten Schritt so einiges schief. David Hume hat festgestellt, dass sich Kausalität nicht beobachten lässt, Kant hat festgestellt, dass wir das Ding an sich nicht erkennen können und die Solipsisten glauben, allein auf der Welt zu sein; niemand könne schließlich beweisen, dass das, was sie wahrnehmen, außerhalb ihrer selbst liege. Soweit die schlechten Nachrichten. Andererseits gibt es auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie doch einige hilfreiche Ansätze. Die Empiristen sagen, man sollte beobachten und nachmessen, um festzustellen, was der Fall ist. Wenn die Messergebnisse wiederholbar sind, dann verfüge man immerhin über einige verlässliche Aussagen, wenn sich auch keine sichere Gewissheit erreichen lässt. Die Rationalisten oder besser Theoretiker sagen, man braucht zum Messen mindestens vorher eine Theorie, weil Messen ohne eine modellhafte Vorstellung von dem, was man da misst, nur einen zusammenhanglosen Datenberg generiert. Außerdem kann man mit Theorien Voraussagen machen über Umstände, die man zuvor noch nie beobachtet hat. Macht man dann eine Messung, die die Voraussage bestätigt, so ist das besonders beeindruckend und spricht für die Theorie. Karl Popper kam zu dem Schluss, die Gültigkeit einer Theorie könne man mit Beobachtungen und Messungen allerdings nicht beweisen, sondern nur widerlegen. Darüber hinaus gibt es noch eine Fülle weiterer Methoden für die Untersuchung von Allesmöglichem. Erkenntnistheorie gibt es also, mehr konkret oder mehr abstrakt, je nachdem.
Die Erkenntnistheorie interessiert sich für die Fähigkeiten des Menschen in der Regel nur so weit, wie es erforderlich scheint, eine geeignete Methodik zu entwickeln, zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen. So interessiert zum Beispiel die Frage, wie gut Menschen sehen können, mit oder ohne Hilfsmittel. Daraus kann man schließen, über welche Maßstäbe der Welt der Mensch nichts wissen kann, weil sie zum Beispiel zu klein sind. Die Motivation des Menschen spielt dabei eher indirekt eine Rolle. Dahinter steht meist die Vorstellung, dass sich aus verlässlicher Erkenntnis dessen, was der Fall ist, schließen ließe, was der Einzelne tun sollte. Gelänge sichere Erkenntnis, so wäre alles falsche Wollen entlarvt und das richtige Wollen könnte sich durchsetzen. Wollen und Sollen fallen so in einem weit entfernten imaginären Punkt zusammen. Das Erkannte, was der Fall ist, wird zu einem Leitfaden dessen, was wir wollen.
Von der Erkenntnistheorie zur Ethik macht die Philosophie dann doch gerne einen großen Bogen um die Motivation. In der Tat erscheint, bei einem Blick in die Geschichte, die menschliche Seele eher als ein finsterer Ort, denn als ein interessanter Gegenstand für Erkenntnisse. Dort, wo keine staatliche Gewalt den Bürger oder Untertanen in seine Schranken weist, herrschen alsbald Raub, Vergewaltigung und Mord. Und selbst dort, wo eine kulturell gesittete Ordnung herrscht, folgen die Menschen doch hauptsächlich ihrer Habgier, Machtgier, frönen dem Sex und dem Konsum. Wer mag es also den Philosophen verdenken, dass sie wenige Anstrengungen unternahmen, diesen Pfuhl aufzuklären. Allzu leicht macht man sich einer Verharmlosung des Ungemachs verdächtig.
Kant
Kant hat denn auch davon abgeraten – oder wie spricht: »Seien Sie froh, dass Sie damit nichts zu tun haben.« Affekte, wie derartige Bedürfnisse in der Philosophie genannt werden, können keine Grundlage eines sittlichen Lebens sein. Kant trennt zwischen dem Mensch als Erscheinung und dem Vernunftmenschen, ausgestattet mit Autonomie und freiem Willen.
»[D]a er daselbst nur als Intelligenz das eigentliche Selbst (als Mensch hingegen nur Erscheinung seiner selbst) ist, so daß, wozu Neigungen und Antriebe (mithin die ganze Natur der Sinnenwelt) anreizen, den Gesetzen seines Wollens, als Intelligenz, keinen Abbruch tun können, sogar, daß er die erstere [Natur der Sinnenwelt] nicht verantwortet und seinem eigentlichen Selbst, d.i. seinem Willen nicht zuschreibt«1
Man solle sich vielmehr seines Verstandes bedienen. Der Mensch sei frei, könne das allgemeine moralische Gesetz erkennen und es zur Grundlage seines Handelns machen. Das Gesetz besagt im Wesentlichen, man solle die Maxime seines Wollens so wählen, dass sie als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könnten. Wichtig ist ihm die universelle Geltung, dass alle so handeln könnten, nicht das Alle tatsächlich gleich handeln, aber eben doch nach den gleichen Maximen. Der Zweck ist ihm die Erhaltung vernunftbegabter Wesen.
Bei dieser Argumentation bleibt unklar, woher die Motivation kommt, sich an das Gesetz zu halten. Kant schreibt dazu: »so ist die Erklärung, wie und warum uns die Allgemeinheit der Maxime als Gesetzes, mithin die Sittlichkeit, interessiere, uns Menschen gänzlich unmöglich.«2
Kant hat das von ihm selbst aufgefundene Gesetz befolgt – oder er hat es zumindest versucht. Als Mensch der Postmoderne würde ich annehmen, er hat es auch deswegen befolgt, weil die Entdeckung und Begründung desselben sein Lebensinhalt war, und weil er von dessen Klarheit und Einfachheit fasziniert war. Kant selbst hätte diese Deutung strikt abgelehnt. Aus seiner Sicht folgt ein Mensch diesem Gesetz, weil er frei ist und dieses als richtig erkannt hat.
Mit dem Kategorischen Imperativ hat Kant ein ehernes Gesetz aufgestellt, auch wenn es viele Fragen zur Alltagstauglichkeit offen lässt. Er hat der Philosophie zugleich einen Weg aufgezeigt, die Frage nach dem Sollen zu diskutieren, ohne die Frage nach dem Wollen berühren zu müssen. Das Beispiel hat insofern Schule gemacht, als auch noch die Existenzialisten in den siebziger Jahren meinten, sie könnten und sollten als autonome Wesen sich ein Ziel wählen und dieses umsetzen, ohne Rücksicht auf die weiteren Umstände. Nach Sartre ist der Mensch das, wozu er sich durch eigene Wahl macht. Sartre hat diesen Ansatz rückblickend als einen Fehler seiner Arbeit gesehen. Allerdings sah er nun stärker die Gesellschaft als prägend an, nicht jedoch die Eigenheiten der menschlichen Natur.34
In der Philosophie unserer Tage nennt man einen Ansatz wie den Kategorischen Imperativ den Primat (den Vorrang) des Gerechten vor dem Guten. Was gerecht ist, wird durch Gesetzte geregelt. Daher ist wichtig aufzuklären, wie Gesetze zustande kommen sollten. Wenn sich der Einzelne an die Gesetze hält, kann er sich im Übrigen frei um sein gutes Leben kümmern. Das ist die Privatsache jedes Einzelnen und erfordert keine nähere Aufklärung durch die Philosophie, zumal ohnehin jeder etwas anderes wünscht.
Materialismus
Der Materialismus von Karl Marx kommt mit wenigen Annahmen über die menschlichen Bedürfnisse aus. Mit seiner Kritik am Kapitalismus sieht Marx den Menschen als ausgebeutet und von seiner Arbeit entfremdet. In der Beschreibung dieser Klage scheint ein wenig das Bild durch, das Marx von der psychischen Natur des Menschen hat:
»[D]ie freie bewußte Tätigkeit ist der Gattungscharakter des Menschen. [...] Die entfremdete Arbeit kehrt das Verhältnis dahin um, daß der Mensch eben, weil er ein bewußtes Wesen ist, seine Lebenstätigkeit, sein Wesen nur zu einem Mittel für seine Existenz macht.«5
Statt frei und bewusst zu arbeiten, wie es seine Natur sei, arbeite der Mensch also nur für seine Existenz.
Im Übrigen ist der Marxismus wie die Marktwirtschaft eine materialistische Weltanschauung. Das heißt, Wohl und Wehe des Menschen werden als wesentlich bestimmt gesehen durch die Verfügbarkeit materieller Güter. Welche Güter auf welche Weise der menschlichen Natur entsprechen, ist nicht näher bestimmt. Durch die Verwendung von Geld als Tauschmittel lassen sich Güter flexibel gegen einander eintauschen, so dass sich vermeintlich jeder, bei genügend verfügbaren Waren und Geld, die zu seinen Bedürfnissen passenden Güter verschaffen kann. Eine genauere Beschreibung der menschlichen Natur scheint nicht erforderlich.
Die verschiedenen, auf den Marxschen Ideen fußenden Strömungen im zwanzigsten Jahrhundert sahen den Menschen meist als ein weithin formbares Wesen, dass zu einem sozialistischen Menschen umgeformt, umerzogen werden kann. Bei der Umerziehung ging es dann häufig darum, die Menschen dahin zu bringen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und die Parteilinie zu vertreten; in der Praxis ging es jedoch meist schlicht darum, mit Gewalt das Volk einzuschüchtern und potentielle Rivalen aus dem Feld zu schlagen.
Darüber hinaus gab es verschiedene Versuche, die Marxsche Sozialkritik psychologisch zu fundieren, in dem man sie mit Erklärungen der Freundschen Psychoanalyse versah. Unter anderen nahmen sich Sartre und Jean-François Lyotard dieser Aufgabe an. Mit der Psychoanalyse beschäftigen wir uns noch.
Phänomenologie
Mit der Phänomenologie hat Edmund Husserl in den zwanziger und dreißiger Jahren den Versuch unternommen, eine Erkenntnistheorie auf den Wahrnehmungen aufzubauen. Dabei sollten die Wahrnehmungsinformationen in einer frühen Phase der Bearbeitung durch die Psyche betrachtet werden, noch ehe sie zu Begrifflichkeiten geworden sind. Ziel der Methode war vorrangig erkenntnistheoretischer Natur: Wie entsteht das, was wir wahrnehmen, und wie stehen unsere Wahrnehmungen im Bezug zu den Dingen? In Husserls Phänomenologie wie in vielen anderen philosophischen Untersuchungen zur Wahrnehmung geht es um die Untersuchung verschiedener Stationen im Wahrnehmungsprozess, bei dem Informationen aus der Umwelt in unsere Psyche gelangen und dort zu Eindrücken, Begriffen, Meinungen und Überzeugungen werden. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob die Eigenschaft Gelb einem beobachteten Gegenstand zukommt, oder ob Gelb ein Gefühl ist, das erst im Beobachter des Gegenstandes entsteht.
In unserer Untersuchung werden wir einen Ansatz verfolgen, der den Schwerpunkt auf das Ende der Verarbeitungsketten der Wahrnehmungsinformation legt. Dort gilt es die psychische Wirkung zu messen. Was die Verarbeitungskette angeht, ist es nicht erforderlich, die Verarbeitung in jedem Glied detailliert zu kennen. Vielmehr genügt es, dass der Behauptung über eine Verarbeitung in einem Abschnitt der Kette eine Bestimmtheit zukommt, dass also bestimmte Eingangswahrnehmungen zu einem bestimmten Ergebnis führen.
Kognitionswissenschaft
Als in den siebziger Jahren die Computer in Form von Großrechnern zunehmend Verbreitung fanden, versuchte man das menschliche Denken in Analogie zu Computerprogrammen zu erklären. Ein Ansatz bestand darin, die Funktion der Psyche durch sogenannte Production Systems nachzubilden. Unter einem Production System versteht man die Kombination aus einer Entscheidungs- und einer Handlungskomponente, vergleichbar der If-Then-Kontrollstruktur in einer Programmiersprache. Wenn also eine bestimmte Wahrnehmung der Fall ist, dann tut die Person das Folgende. Die Handlungskomponente kann aus weiteren Production Systems bestehen. So kann die Entscheidung über eine Handlung beliebig tief verschachtelt sein, komplex wie ein Computerprogramm eben. Allerdings fand sich kein Computerprogramm, dessen Verhalten dem der menschlichen Psyche hinreichend ähnlich erschien.
Mit seinem Gedankenexperiment vom Chinesischen Zimmer6 argumentierte John Searle, dass die Computer-Analogie die Fragestellung nach dem Wesen menschlicher Erkenntnisfähigkeit nur auf eine andere Ebene verschiebe, nicht aber beantworten könne. Ein Computer könne Wahrnehmungen nur verarbeiten, nicht aber verstehen. Wie eine Person, die der chinesischen Sprache nicht mächtig ist, wohl nach vorgegebenen Regeln chinesische Dokumente sortieren kann, diese aber dennoch nicht versteht. So versteht auch der Computer bei der Ausführung eines Programms nichts von dem, was er da tut. Die Computer-Analogie könne also das geistige Verstehen eines Menschen nicht erklären. Diese Kritik versetze den Versuchen zu einer Computer-Analogie einen Dämpfer. Ohnehin fühlten sich viele Menschen durch den Vergleich mit Computern zu willenlosen Robotern reduziert, die nach fremdbestimmten Programmen funktionieren.
In unserer Untersuchung werden wir keine Computer-Analogie verwenden. Allerdings nehmen wir den Ausgangspunkt ebenfalls bei den Wahrnehmungsinformationen und fragen uns, wie der Psyche daraus eine Entscheidbarkeit über Handlungen möglich ist. Wir verfolgen also ebenfalls eine informatische Betrachtungsweise, eine Sichtweise, die die Verarbeitung von Informationen untersucht.
Postmoderne
Etwa seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Menge der Gegenstände, mit denen sich Menschen beschäftigen, und die Vielfalt der Ziele, die sie verfolgen, derart angewachsen, dass es unmöglich erscheint, darin ein allgemeines Muster zu identifizieren. Jean-François Lyotard hat für die Epoche, in der wir leben, 1979 mit seiner Studie Das postmoderne Wissen7 den Begriff der Postmoderne geprägt. Lyotard sah in den verschiedenen theologischen und philosophischen Erklärungsansätzen zu dem, was ist, lediglich verschiedene Erzählungen, die mehr oder weniger gleichberechtigt neben einander existieren. Keine von ihnen könne für sich beanspruchen, die singuläre Erklärung zu bieten. Man solle darum diese metaphysischen Erklärungsversuche lassen, und sich den praktischen Problemen zuwenden.
Die postmoderne Forderung stimmt weitgehend mit dem vorwiegend angloamerikanisch geprägten Pragmatismus überein. Auch der Pragmatismus lehnt übergreifende (»metaphysische«) Erklärungsversuche ab, allgemeine behauptete Zusammenhänge, die sich nicht direkt aus Beobachtungen ableiten lassen. Stattdessen bevorzugt er einzelne Lösungen für konkrete Probleme.
Viele Menschen vertreten im Alltagsverständnis unserer Kultur eben diese Position, meistens ohne sich der programmatischen Forderung der Postmoderne bewusst zu sein. Sobald man die Frage stellt, was der Mensch seiner Natur nach will, wird bereits die Frage abgelehnt. Es erscheint vielen als weder möglich noch wünschenswert eine modellhafte Vorstellung von der Funktion und insbesondere vomWollen des menschlichen Geistes zu entwickeln. Eine zentrale Quelle der Angst vor derartigen Modellbildungen sind die großen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts: die nationalistischen Weltkriege, der Holocaust, die faschistischen und stalinistischen Diktaturen. Die Ursache der Katastrophen, so die postmoderne Vorstellung, waren verschiedene zu konkrete Menschenbilder. Aus der jeweiligen Annahme, zutreffende Beschreibungen dessen zu besitzen, was der Mensch sei, was er benötigt oder sein sollte, wurden gesellschaftliche Utopien entwickelt und fanatisch verfolgt. Die Utopien mündeten letztlich in Formen der Gewaltherrschaft, des Krieges und des Massenmordes.
Eine andere Quelle der Ablehnung von zu konkreten Menschenbildern ist die Furcht vor Manipulation. Übelwollende Mitmenschen könnten sich der Kenntnisse um die menschliche Psyche bedienen, um uns zu steuern und uns trotz eines scheinbar liberalen und freien Umfeldes zu Handlungen und in Situationen zwingen, die wir nicht wollen.
Man könnte also sagen, die Untersuchung der Frage nach der menschlichen Motivation ist ein Tabu unserer Kultur. Antworten auf die Frage nach dem menschlichen Wollen werden von der Gesellschaft nur insoweit toleriert, als sie hinreichend unbestimmt sind.
Die Philosophen der Postmoderne sehen sich der Herausforderung gegenüber, einerseits allgemeine Aussagen finden zu wollen, wie es der Gegenstand der Philosophie ist, andererseits aber keine allgemeinen Aussagen machen zu dürfen, zumindest soweit es die Natur des Menschen betrifft und die Aussagen zu klar erkennbar werden.
Auch wenn der Umstand, keine modellhafte Vorstellung vomWollen des menschlichen Geistes zu haben, von vielen Zeitgenossen als Vorteil gesehen wird, so bringt er auch Nachteile mit sich. Wenn wir eine Vorstellung von einem Bedürfnis haben, dann sehen wir uns immer auch in der Pflicht, denen zu helfen, die unter einem extremen Mangel an der Befriedigung des Bedürfnisses leiden. Keine Vorstellung von einem Bedürfnis zu haben, bewahrt uns damit vor einer solchen Verpflichtung, ignoriert aber Leid. Das mag man gut finden, solange man keinen Mangel leidet. Erfährt man aber selbst diesen Mangel, dann kann man nicht auf Hilfe hoffen; es fehlt die Grundlage den Mangel verständlich zu machen. Nicht verstehen zu wollen ist damit auch ein Mittel der Rücksichtslosigkeit; und Rücksichtslosigkeit zum Prinzip zu erheben, erscheint mehr als fraglich.
Rawls
Werfen wir einen Blick auf die Philosophen John Rawls und Jürgen Habermas, wie sie mit der Herausforderung umgegangen sind. Beide beschäftigen sich mit Ethik. Sie suchen allgemeine Vorgehensweisen, wie gerechte Gesetze und Handlungsnormen in einer freien Gesellschaft zustande kommen sollten.
Rawls sucht in seiner Philosophie einen Weg, um Unparteilichkeit herzustellen bei der Gestaltung einer Grundstruktur der Gesellschaft. Er empfiehlt dazu einen imaginären Schleier des Unwissens. Dieser soll den Personen, die an der Diskussion beteiligt sind, die eigene Rolle verbergen, die sie zu einem späteren Zeitpunkt, bei der Anwendung der Normen, selbst einnehmen werden. Eine imaginäre Unwissenheit soll so Unparteilichkeit produzieren. Sollte ich zum Beispiel eine Norm zum Schutz einer Minderheit gestalten, so wäre es mir eine Pflicht zu ignorieren, ob ich der Minderheit angehöre oder später angehören könnte. So soll eine Gesellschaftsordnung entstehen, die für die Beteiligten in jeder Rolle fair ist. Im Blick hat Rawls dabei vor allem gleiche Aufstiegs- und Entwicklungschancen bei verschiedener sozialer oder ethnischer Herkunft. Das Menschenbild, das dahinter steht, ist die Annahme, dass Jemand glücklich ist, wenn er Chancen hat, worin die Chancen im Einzelnen auch bestehen mögen. Die psychologische Behauptung, die man dahinter erkennen kann, lautet also: Der Mensch mag Chancen.
Habermas
In der Postmoderne wird die Aufgabe der Philosophie, speziell der Erkenntnistheorie, nicht mehr darin gesehen, als Unterbau für die Wissenschaft eine Ordnung von Begriffen zu liefern, oder ein methodisches oder logisches Fundament. Habermas sieht die Wissenschaft als eine Reihe von »Expertenkulturen, zwischen denen die Philosophie in der Rolle eines Interpreten vermittelt, ohne sie ‚begründen‘ zu müssen. [...] Zwischen den autonom gewordenen Disziplinen und Wissensgebieten wird der [...] Zusammenhang [...] nur noch durch Kohärenz gesichert, nicht durch ‚Fundierung‘.«8 Demnach fällt der Philosophie die Aufgabe zu, zwischen Expertenkulturen zu vermitteln und auf Widersprüche zwischen den Aussagen der Einzelwissenschaften hinzuweisen.
Um das Problem der Fundierung zu umgehen, verzichtet die zeitgenössische Ethik in der Regel ganz auf eine erkenntnistheoretische Grundlage. Sie meidet außerdem die Frage nach den Affekten. Pragmatisch sucht sie nach Umständen, unter denen ethische Aussagen zustande kommen können, die in der Gesellschaft eine breite Akzeptanz finden. Sie beschreibt Prozeduren, durch deren Abarbeitung zum Beispiel im Rahmen demokratischer Prozesse Entscheidungen zustande kommen.
Habermas empfiehlt in seiner Diskursethik einen Diskurs über ethische Fragen, an dem im Idealfall alle Betroffenen gleichberechtigt teilnehmen und sich ohne Zwang äußern können. In dem Diskurs übernimmt jeder Teilnehmer in der Vorstellung reihum die Rollen aller anderen Teilnehmer, ummoralische Forderungen zu überprüfen. Die gegenseitige Perspektivübernahme soll zu allgemein akzeptierten moralischen Normen führen. Es soll nur das zur Norm werden, was von allen gleichermaßen akzeptiert werden kann. Für Habermas kann nicht ein Einzelner durch Nachdenken allgemein akzeptierbare Normen finden, diese können stets nur im Diskurs mit allen Beteiligten entwickelt werden.
Durch das Mittel der gegenseitigen Perspektivübernahme entfällt für Habermas die Notwendigkeit ein Modell beizubringen, das weitere Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen näher beschreibt. Habermas sieht den Menschen in erster Linie als ein kommunikatives Wesen. Die Person entsteht durch Kommunikation in der Gesellschaft und umgekehrt entsteht die Gesellschaft aus der Kommunikation ihrer Personen: »In kommunikativen Bildungsprozessen formen und erhalten sich die Identität des Einzelnen und die des Kollektives gleichursprünglich.«9
In dieser Vorstellung entsteht die Person aus etwas Abstraktem, der Kommunikation. Kommunikation bedeutet zunächst nicht mehr als Informationsaustausch, sagt aber nichts über die Inhalte der Kommunikation. In seiner Theorie des kommunikativen Handelns unterscheidet Habermas verschiedene Formen sprachlicher Aussagen. Dies sind Möglichkeiten, die einem Individuum für sprachliche Äußerungen zur Verfügung stehen, verrät aber auch nicht mehr über die Inhalte. Die Entstehung aus etwas Abstraktem, vermittelt den Eindruck, das Individuum könne gänzlich formbar sein durch die Gesellschaft.
Doch eine weitere Eigenschaft der Personen erfahren wir noch: Sie sind verletzlich. »In diesem Sinne versehrbar und moralisch schonungsbedürftig sind Lebewesen, die allein auf dem Wege der Vergesellschaftung individuiert werden.«10 Die Aufgabe der Gesellschaft ist demnach, ihre Mitglieder zu schützen.
Eine Forderung für die Bildung von Normen ist die Universalisierung, die Möglichkeit, dass Normen für alle Menschen gültig sein könnten. Diese Forderung übernimmt er von Kant. Habermas bezeichnet sie als Kantische Intuition11, weil der universelle Charakter einer Norm intuitiv einleuchtet, sich aber selbst im Werk Kants keine Begründung dafür findet.
Mit der gegenseitigen Perspektivübernahme lädt Habermas der Argumentation einige Probleme auf. Einerseits ist es praktisch kaum möglich, dass alle Teilnehmer des Diskurses sich gedanklich in die Perspektive jedes anderen begeben. Bereits bei einer Gruppe von wenigen Teilnehmern stößt das an die Grenze des Durchführbaren. Wenn andererseits die Bedürfnisse der Personen erst aus dem Diskurs sichtbar werden und in ihrer Aussagekraft nur auf die Teilnehmer des Diskurses beschränkt sind, dann müssen für universell gültige Normen komplett alle Menschen an dem Diskurs teilnehmen – eine absurde Vorstellung. So ist letztlich auch der Diskurs angewiesen auf ein gemeinsames Verständnis von den Mechanismen der menschlichen Psyche. Im Diskurs tragen die Teilnehmer lediglich die Besonderheiten ihrer eigenen Person bei, wie weitreichend diese auch immer sein mögen.
In den demokratischen Gesellschaften der Postmoderne sind wir gewohnt, Probleme auf dem Wege des Gesprächs, der sprachlichen Argumentation zu lösen. Wir haben zahlreiche Institutionen geschaffen, um gerade diese Kultur zu schützen, und sie gegen Systeme autoritärer Entscheidungen zu verteidigen. Das gilt zumindest insoweit, wie öffentliche Belange betroffen sind, sowohl gesetzliche Normen als auch Entscheidungen über öffentliches Eigentum. Gesprochen wird dabei über fast beliebige Inhalte. Der Ansatz von Habermas’ Diskursethik passt offenbar recht gut zu den moralischen Vorstellungen der Postmoderne.
Für Kant ist der Ansatzpunkt in der menschlichen Natur das vernunftbegabte Wesen. Habermas sieht als Ansatzpunkt seiner Theorie das kommunikative soziale Wesen Mensch. Für unsere nachfolgende Untersuchung ist der Gegenstand der Psychologie und ein möglicher Ansatzpunkt für eine anschließende Ethik das bedürftige menschliche Wesen. Dabei gilt es, den postmodernen Vorbehalten zum Trotz, sich eine Vorstellung von den Bedürfnissen des Menschen zu machen. Wir gehen von der Annahme aus, dass sich mit der Befriedigung bzw. nicht-Befriedigung von Bedürfnissen, positive bzw. negative Emotionen verbinden, die letztlich die Begründung und Berechtigung für eine mögliche Ethik liefern.
Postmoderne philosophische Ethik
Wie wir gesehen haben, vermeidet die postmoderne philosophische Ethik die Begründung von ethischen Normen durch psychische Eigenheiten. Stattdessen sucht sie nach Prozeduren, mit denen die Gesellschaft in die Lage versetzt werden soll, allgemein akzeptable Verhaltensnormen zu finden und zu beschließen. Zum Beispiel wählen in der Demokratie die Bürger ihre Repräsentanten, die wiederum über Gesetze abstimmen. Habermas empfiehlt die gegenseitige Perspektivübernahme, um vorgeschlagene Werte und Normen zu prüfen. Rawls empfiehlt, bei der Entscheidungsfindung die eigene Rolle in der Gesellschaft auszublenden, und sich stattdessen gedanklich in jede mögliche andere Rolle zu versetzen - ein Vorgehen, dass von Habermas’ Vorschlag nicht weit entfernt ist.
Nicht dass es mir darum geht, diese Prozeduren in Frage zu stellen. Die Demokratie leistet uns einen unschätzbaren Dienst. Mich interessiert jedoch die Begründung der Ergebnisse, der Werte und Normen, basierend auf den menschlichen Bedürfnissen. Allerdings werden wir in dieser Untersuchung nicht so weit gehen, den Zusammenhang mit Normen zu diskutieren.
Umgang mit dem Tabu
Kommen wir noch einmal auf das Tabu der Postmoderne zurück, das darin besteht, sich kein Bild von der psychischen Natur des Menschen machen zu sollen. Mit der Untersuchung menschlicher Bedürfnisse werden wir dieses Tabu berühren.
Auf die Ängste, die dem Tabu zugrunde liegen, habe ich zwei Antworten, eine allgemeine und eine konkrete. Als Mitglied der postmodernen Gesellschaft kann man nicht anders, als die Vielfalt der Beschäftigungen, der Lebensentwürfe und den Drang nach Freiheit der Menschen als ein Faktum zur Kenntnis zu nehmen. Allgemein lässt sich darum fordern, dass ein Modell der menschlichen Psyche diesen Umstand erklären muss. Enthält es keinen Ansatz zu einer entsprechenden Erklärung, dann ist das Modell offensichtlich unzutreffend. Die konkrete Antwort, die ich anbiete, ist das Modell, das ich im Rahmen dieser Untersuchung vorstellen will. Ich werde am Schuss auf die Frage der Toleranz zurückkommen.
Die Philosophie überlässt es weitgehend der Psychologie, die Untiefen der menschlichen Seele zu ergründen. Doch auch dann, wenn sich die Philosophie nicht kompetent genug sieht, die Strukturen der Psyche auszuleuchten, so könnte sie die Ergebnisse der Psychologie mindestens zur Kenntnis nehmen. Und sollte die Philosophie diese Ergebnisse als zu wenig tragfähig erachten, ist es ihre Pflicht, diese zu kritisieren, versteht sich die Philosophie doch (nach Habermas) als Mittler zwischen den Expertenkulturen. Also werfen wir als nächstes einen Blick auf die Psychologie.
3 Psychologie
In diesem Kapitel untersuchen wir einige psychologische Strömungen und Theorien, die den Willen, also die Motivation von Menschen untersucht haben. Da ist die Psychoanalyse, die den Menschen durch Triebe motiviert sieht. Der Behaviorismus sah den Menschen als ein Individuum das lernt, und durch Belohnung auf bestimmtes Verhalten konditioniert werden kann. Die Motivationsforschung versucht die Wahl verschiedener Handlungsalternativen zu messen und durch Formeln zu beschreiben. Die Verhaltensbiologie sieht menschliches Verhalten am besten dadurch erklärt, dass sie die vorgeschichtlichen Situationen rekonstruiert, in denen ein Verhalten hilfreich gewesen ist. Betrachten wir die Gebiete im Einzelnen.
Psychoanalyse
Sigmund Freud nimmt in seiner Theorie der Psychoanalyse an, dass verschiedene Kräfte in einer Person miteinander ringen, um Verhalten hervorzubringen. Drei dieser Kräfte sind das Es, das Ich und das Überich. Im Es sieht Freud die animalischen Triebe, allen voran den Sexualtrieb. Das Überich repräsentiert die Erziehung und die Forderungen der Gesellschaft als eigenständige Instanz. Das Ich stellt den Kontakt zur Realität her, gleichzeitig vermittelt es zwischen Es und Überich und entscheidet, ob es die Triebansprüche des Es zulässt.12
Eros, der Sexualtrieb, ringt mit dem Selbsterhaltungstrieb. Dieser wandelt sich im Laufe der Freudschen Theorieentwicklung zu Thanatos, dem Todestrieb. Das Wesen des Todestriebes ist das Zerstörerische; dieses tritt nach Freud in vielfältiger Form im Verhalten auf. In den Sexualtrieb schließt Freud alles Körperliche mit ein, also auch körperliche Berührungen, Bewegungen, Nahrungsaufnahme und Ausscheidungen.13
Freud erklärt die individuellen Unterschiede der Menschen über verschiedene Phasen der Entwicklung des Kindes und des Heranwachsenden. Das sind zum Beispiel die orale, die sadistisch-anale und die phallische Phase mit dem Penis-Neid des Mädchens. Hemmungen und allerlei Verwicklungen in dieser Entwicklung führen zu Störungen und zu Fixierungen auf bestimmtes Verhalten.14
Für Freud ist die Psyche eine mystische Welt. Triebe sind mystische Wesen, die miteinander ringen.
»Die Trieblehre ist sozusagen unsere Mythologie. Die Triebe sind mythische Wesen, großartig in ihrer Unbestimmtheit. Wir können in unserer Arbeit keinen Augenblick von ihnen absehen und sind dabei nie sicher, sie scharf zu sehen.«15
Zu den mystischen Charakteren kommen verschiedene Zutaten, die eine nachvollziehbare und eindeutige Erklärung erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Freud nennt sie Triebschicksale. Durch verschiedene Triebschicksale kann sich ein Trieb in etwas anderes verwandeln, und verkehren:
»Die Beobachtung lehrt uns als solche Triebschicksale folgende kennen:
Die Verkehrung ins Gegenteil.
Die Wendung gegen die eigene Person.
Die Verdrängung.
Die Sublimierung.«16
Unter Sublimierung versteht Freud, die Umwandlung von Triebwünschen in kulturell anerkannte Verhaltensweisen. Durch Verdrängung werden tabuierte und bedrohliche Wünsche und Vorstellungen ins Unterbewusstsein verdrängt. Dort verbergen sie ihr Wirken vor der Erkenntnis durch den Beobachter, was die Psychoanalyse für ihre Aufdeckung erfordert.
Besonders problematisch ist der Begriff des Gegenteils. Wenn ein Trieb gleichzeitig als sein Gegenteil auftreten kann, wie kann er dann als solcher erkannt werden? Der Begriff Gegenteil ist im Zusammenhang mit Bedürfnissen kaum brauchbar. Was ist das Gegenteil von Hunger? Bedürfnisse sind komplexe Strukturen, die ganz bestimmte Zustände der Umwelt als gewünscht ermitteln. Die Invertierung dessen ist in hohem Maße unbestimmt.
Freud benennt die von ihm identifizierten Elemente der menschlichen Psyche nach antiken Helden und Göttergestalten. Er nennt sie nicht nur so, er versteht sie auch so, dass Charaktere um etwas ringen. Die Tragödie des Ödipus will er als detailliertes Abbild der menschlichen Seele verstanden wissen. Was nicht passt, ist ein Zeichen für Verdrängung. Das Es ringt mit dem Überich. Das Bewusste ringt mit dem Unbewussten. Bei der Verdrängung entwickelt das Unbewusste sogar eine besondere Raffinesse. Es besitzt eine Intelligenz und Verschlagenheit, die es dem bewussten Beobachter unmöglich macht, die eigenen Motive zu erkennen. Nur der Therapeut und Analytiker vermag in den Aussagen des Patienten, in dessen Widerständen, die wahren Motive zu erkennen; sie liegen häufig gerade im Gegenteil dessen, was der Patient sagt.17
Das generelle Problem mit der Freudschen metaphorischen Betrachtungsweise psychischer Eigenheiten liegt darin, dass ein komplexer Zusammenhang erklärt wird durch etwas noch komplexeres; statt einer Person, die es zu erklären gilt, ringen plötzlich drei oder mehr Charaktere miteinander. Die Raffinesse und die Methoden, derer sie sich bedienen, machen es undurchschaubar, welcher Charakter oder welches Prinzip gerade der bestimmende Faktor ist. Die Beschreibung und Deutung enthält ein hohes Maß an Unbestimmtheit in dem, was sie behauptet.
Zum Teil erklärt Freud das Verhalten von längerfristigen Zielen her. So ist nach seiner Erklärung Homosexualität eine Perversion, weil sie nicht der Fortpflanzung dient.18
Freud hat zur Erklärung insbesondere von psychischen Störungen ein Modell entworfen, die von ihm sogenannte Metapsychologie. Das Modell trifft eine Vielzahl von Annahmen über die frühkindliche Entwicklung. Dazu gehört das sexuelle Begehren eines Jungen gegenüber seiner Mutter und die darauf aufbauende Kastrationsangst gegenüber dem Vater. Beim Anblick eines unbekleideten Mädchens, dem das männliche Glied fehlt, sieht der Junge sich in seinen Ängsten bestätigt. Zugleich verdrängt er diese entsetzliche Realität in das Unbewusste. Zwischen den verschiedenen Instanzen der Psyche, dem Es, dem Ich und dem Überich, der Realität, sowie dem Bewussten, dem Vorbewussten und dem Unbewussten entwickeln sich nach Freud nun eine Fülle von Kräften, Energieflüssen und Verdrängungsmechanismen.
Freud hat die Metapsychologie im Zuge seiner langjährigen klinischen Tätigkeit aus den Erfahrungen mit seinen Patienten heraus immer wieder erweitert und umgeschrieben. Das Ergebnis ist eine Fülle von Schriften und Thesen, aus denen sich nur schwer rekonstruieren lässt, welche Aussagen am Ende nach Freud noch Gültigkeit besitzen.
In seiner Einleitung zu einer Sammlung von Freuds Metapsychologischen Schriften gibt Alex Holder die folgende Einschätzung:
»Allerdings gibt es heute auch viele Psychoanalytiker, denen die Metapsychologie fremd ist und entbehrlich erscheint. Diese Analytiker stellen grundsätzlich in Frage, daß eine Erklärung klinischer Phänomene auf Grund metapsychologischer Überlegungen zu einem tieferen Verständnis intrapsychischer Prozesse führen könne. Deshalb neigen sie dazu, die Metapsychologie als eine Pseudowissenschaft abzulehnen – weil sie lediglich die Illusion von Wissenschaftlichkeit erwecke –, und beschränken sich auf eine rein klinische Theorie, der ein hermeneutischer Ansatz zugrunde liegt, der es also um das Ergründen verborgener, unbewußter Wünsche und Absichten im Verhalten oder in den Assoziationen eines Patienten geht.«19
Andererseits gibt es laut Holder für eine metapsychologische Erklärung Bedarf:
»Selbst die oben erwähnte klinische Theorie kommt ohne metapsychologische Annahmen nicht aus, weil auch sie sich mit unbewußten Wünschen und Zielvorstellungen befassen muß.«20
DiePsychoanalyse ist in den Vereinigten Staaten als Therapieform nach wie vor recht beliebt. Aber wie hat sie sich als Wissenschaft weiterentwickelt? Siegfried Zepf hat den Versuch unternommen, verschiedene theoretische Weiterentwicklungen der Psychoanalyse zu vergleichen und zu systematisieren.21 Doch bereits in der Einleitung seines Buches muss er mit Bedauern eine ganze Reihe von Einschätzungen seiner Kollegen aus den letzten Jahrzehnten auflisten, die bestätigen, dass die theoretischen Überlegungen der Fachwelt im Gebiet Psychoanalyse in alle Richtungen auseinander laufen. Es scheint kein Interesse zu bestehen, diese zu einem schlüssigen System zusammenzufügen. Zepf selbst machte die Erfahrung, dass seine kritischen Artikel speziell zum Konstruktivismus in der Psychoanalyse von verschiedenen amerikanischen Fachzeitschriften abgelehnt wurden; Sie begrüßen einerseits sehr die intelligente Auseinandersetzung mit der Schwäche in der theoretischen Begründung durch den Konstruktivismus; andererseits sei ihr Fachpublikum nur an klinischen Fragen interessiert.
Entsprechend der pragmatischen Grundhaltung sind übergreifende Erklärungen nicht erwünscht. Und so bleibt der Eindruck, dass die Psychoanalyse eher als ein Fundus dient, zur anregenden Ausgestaltung von Therapiesitzungen, denn als ein systematisches, wissenschaftliches Erklärungsmodell menschlichen Verhaltens.
Popper
Karl Popper beschäftigte sich zu Beginn seiner Karriere als Wissenschaftler bereits in den zwanziger Jahren intensiv mit der Psychoanalyse Freuds und der Individualpsychologie von Alfred Adler.22 Bald jedoch war er enttäuscht von der offensichtlichen Beliebigkeit und gleichzeitigen Selbstsicherheit, mit der die Psychoanalyse Phänomene menschlichen Verhaltens erklärte. Das war für ihn einer der Gründe, sich von der Psychologie ab- und der Wissenschaftstheorie zuzuwenden.
In seiner Theorie fordert Popper für jede wissenschaftliche Aussage, dass sie ein Falsifikations-Kriterium mitliefert, eine überprüfbare Voraussage. Lässt sich durch eine Messung nachweisen, dass die Voraussage nicht zutrifft, so ist damit die Aussage widerlegt - falsifiziert. Nur eine prinzipiell falsifizierbare Aussage ist nach Popper eine wissenschaftliche Aussage. Die Bestätigung einer Theorie durch eine Beobachtung hält Popper dagegen für unmöglich:
»Jede ’gute’ wissenschaftliche Theorie ist ein Verbot; sie verbietet das Eintreten gewisser Ereignisse. Je mehr eine Theorie ’verbietet’, desto besser ist sie.«23
Poppers Forderung ist in der Praxis recht anspruchsvoll, so anspruchsvoll, dass sie selbst in der Physik nicht als die Prüfung auf





























