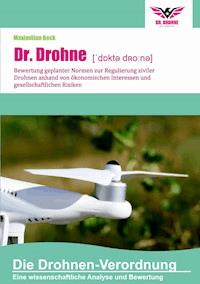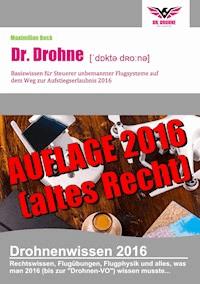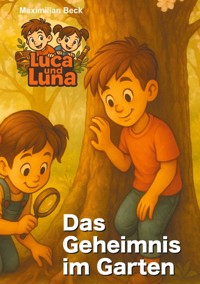Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Einsatz unbemannter Luftfahrzeugsysteme (UAS) durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) nimmt stetig zu: sei es zur Lageerkundung, Personensuche oder Dokumentation. Doch mit dem praktischen Nutzen steigen auch die rechtlichen Herausforderungen: Welche Sonderregelungen gelten für BOS? Welche Gesetze müssen beachtet werden - und was droht bei Verstößen? Dieses Fachbuch liefert eine umfassende, praxisnahe Orientierung zum rechtssicheren Umgang mit Drohnen im BOS-Kontext. Es richtet sich an Einsatzkräfte, Führungspersonal, Ausbilder:innen, Behördenvertretungen sowie alle, die UAS im Auftrag der öffentlichen Sicherheit einsetzen. Die Inhalte reichen von der Einordnung in das nationale und europäische Luftrecht über Datenschutz und Haftung bis hin zu Einsatzszenarien und Genehmigungsfragen. Alle rechtlichen Aspekte sind auf dem Stand Sommer 2025 und werden verständlich und anwendungsbezogen dargestellt. Besonders hilfreich: zahlreiche Schaubilder, übersichtliche Kapitelstruktur, klare Sprache: auch für juristisch nicht vorgebildete Leser:innen. Das Werk basiert auf langjähriger Erfahrung des Autors im Bereich der zivilen Drohnennutzung und seiner wissenschaftlichen Arbeit an der Schnittstelle von Luftrecht und BOS-Praxis. Es bietet Orientierung im Dickicht der Vorschriften und zeigt auf, wie UAS im Rahmen der geltenden Gesetze sicher und effektiv genutzt werden können. Ein Muss für alle, die Verantwortung beim Drohneneinsatz im BOS-Bereich tragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Ehrenamt ist nicht Arbeit die nicht bezahlt wird, sondern Arbeit die nicht bezahlt werden kann.“
- unbekannt
INHALTSVERZEICHNIS
Glossar, Definitionen, Erläuterungen und Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Einleitung
2 Grundlagen des Luftverkehrsrechts und Aufbau der Luftfahrtverwaltung
2.1 Internationale und europäische Luftfahrtverwaltung, Zuständigkeiten und Organisationen
2.1.1 International Civil Aviation Organisation (ICAO)
2.1.2 Joint Authorities for Rulemaking on unmanned Systems (JARUS)
2.1.3 Europäische Kommission
2.1.4 Europäische Agentur für Flugsicherheit
2.2 Nationale Luftverkehrsverwaltung, Zuständigkeiten und Organisationen
2.2.1 Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)
Zudem obliegt dem BMDV die Ausarbeitung nationaler Gesetze, Verordnungen und Grundsätze im Bereich der Luftfahrt, einschließlich der Regelungen für unbemannte Fluggeräte.
2.2.2 Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
2.2.3 Das Bundesausichtsamt für Flugsicherung (BAF)
2.2.4 Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU)
2.2.5 Die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
2.2.6 Die Landesluftfahrtbehörden (LLB)
2.2.7 Die Bund-Länder Arbeitsgruppe UAS-Flugmodelle (BLAG-UAS/FM)
2.2.8 Die Luftsportverbände
2.2.9 Die Verbände der unbemannten Luftfahrt
3 Hierarchie der luftverkehrsrechtlichen Normen und Richtlinien
3.1 Europäische Normen und Richtlinien
3.2 Nationale Normen und Richtlinien
4 Basisinformationen zu unbemannten Luftfahrzeugsystemen
4.1 Begrifflichkeiten
4.1.1 International
4.1.2 National (rechtlich)
4.2 Technische Rahmendaten und Arten von UAS
4.2.1 Antriebsarten
4.2.2 Luftfahrzeugarten
4.2.3 UAS-Kategorien nach Gewicht
4.2.4 UAS-Klassen gemäß Delegierter Verordnung (EU) 2019/945
4.2.5 Spezielle UAS für BOS
5 Wirtschaft, Einsatzgebiete und Akzeptanz
5.1 Einsatz von (Flug-)Robotern Übersicht
5.2 Nichtstaatliche Einsätze
5.3 Einsätze durch Behörden, sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Rahmen
5.3.1 Erkundung, Lagebild und Einsatzdurchführung
5.3.2 Dokumentation des Einsatzes bzw. Einsatzortes
5.3.3 Suche von Personen und Tieren
5.3.4 Detektion von Gefahrenstoffen
5.3.5 Überwachung und Beobachtung
5.3.6 Kommunikationsmittel
5.3.7 Logistik und Abwurf von Rettungsmitteln
5.3.8 weitere Einsatzmöglichkeiten von BOS-UAS heute und morgen
5.3.9 Behördliche Einsatzgebiete außerhalb des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes
5.3 Umfragen zur Nutzung und Akzeptanz von UAS bei Nutzung durch BOS
5.3.1 Akzeptanz innerhalb von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
5.3.2 Akzeptanz von UAS in der Bevölkerung
6 Europäische Regeln für den Betrieb von UAS durch BOS
6.1. Basisverordnung (EU) 2018/1139
6.2 Delegierte Verordnung (EU) 2019/945
6.3 Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
6.3.1 Generelles
6.3.2 Die offene Kategorie
6.3.3 Die spezielle Kategorie
6.3.4 Die zulassungspflichtige Kategorie
7 Nationale Regelungen zum Betrieb von Drohnen
7.1 Geozonen gemäß § 21h Luftverkehrs-Ordnung
7.1.1 Flugplätze
7.1.2 Flughäfen
7.1.3 Industrieanlagen, Energieerzeugung, Militär, JVA
7.1.4 Wichtige Behörden und Polizei
7.1.5 Wichtige Verkehrswege
7.1.6 Naturschutz
7.1.7 Wohngrundstücke
7.1.8 Badeeinrichtungen
7.1.9 Kontrollzonen
7.1.10 Krankenhäuser
7.1.11 Einsatzorte von BOS
8 Sonderrechte für Behörden und Organisationen mit Sicherheitssaufgaben und interne Regelungen
8.1 Hintergrund; Militär und Polizei
8.1.1 Umfang der Befreiungen
8.1.1.1 Bundeswehr
8.1.1.2 Polizei
8.1.2 Grenzen der Befreiungen
8.1.3 Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
8.1.4 Erfüllung der besonderen Aufgaben
8.1.4.1 Besondere Aufgaben der Bundeswehr
8.1.4.2 Besondere Aufgaben der Polizei
8.1.5 Erforderlichkeit und Verwaltungsgrundsatz
8.1.5.1 Geeignetheit
8.1.5.2 Erforderlichkeit
8.1.5.3 Angemessenheit
8.1.6 Zwingende Notwendigkeit
8.2 Behörden (mit und ohne Sicherheitsaufgaben), sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Einsatz Dritten
8.2.1 Behörden
8.2.2 Behörden mit Sicherheitsaufgaben
8.2.3 Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
8.3 Sonderrechte auf europäischer Ebene
8.4 Empfehlungen für Gemeinsame Regelungen zum Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz und interne Regelungen
8.4.1 Ausbildungskonzept
8.4.2 Einsatzorganisation, - Risikobewertung und -Durchführung
8.4.2.1 Risikobewertung
8.4.2.2 Einsatzorganisation
8.4.2.3 Koordination bei Großlagen oder mehreren Systemen oder Einheiten.
8.4.2.4 Einsatzdurchführung
8.4.2.5 Flugvorbereitung und Flugbetrieb
9 Normen, die auch für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben relevant sind oder sein können
9.1 Nationales Luftverkehrsrecht
9.1.1 Luftverkehrsgesetz
9.1.1.1 Alkohol, Drogen und Medikamente, sowie Gesundheitszustand
9.1.1.2 Vermeidung von Störungen und Fluglärm
9.1.1.3 Allgemeine Gefahrenabwehr durch die Luftfahrtbehörde
9.1.1.4 Versicherungspflichten
9.1.2 Luftverkehrs-Ordnung
9.1.2.1 Abwerfen von Gegenständen
9.1.2.2 Schlepp- und Reklameflüge
9.1.2.3 Luftraumordnung und Flugverkehrskontrollfreigabe
Luftraum G – Der Standardluftraum für UAS
Luftraum D (CTR) – Kontrollzone
Luftraum C & E – Kontrollierter Luftraum
Weitere relevante Luftraumzonen
9.1.2.4 Außenstarts und Außenlandungen
9.1.3 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)
9.2 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und weitere Rechte Dritter
9.2.1 Schutzrechte aus dem Grundgesetz (Eigentumsrechte und Persönlichkeitsrechte)
9.2.2 Datenschutz
9.3 Weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
10 Konsequenzen für rechtswidrigen Einsatz von Drohnen durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und Haftungsansprüche
10.1 Fragen der Haftung und Verantwortlichkeiten
10.1.1 Mögliche Verantwortliche
10.1.2 Haftungsprivileg
10.1.3 Haftung in Ehrenamt und Vereinen
10.2 Dienstrechtliche Schritte und Sanktionen von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
10.3 Haftung bei dem Einsatz von BOS-Fremden Dritten
11 Fazit
12 Literatur und Quellen
Glossar, Definitionen, Erläuterungen und Abkürzungsverzeichnis
ADS-B
Automatic Dependent Surveillance – Broadcast; automatische Übertragung abhängiger Beobachtungsdaten.
AGL
Above Ground Level; über Grund.
AltMoc
Alternative Means of Compliance; alternative Nachweisverfahren.
AMC
Acceptable Means of Compliance; akzeptierte Nachweisverfahren.
A-NPA
Advance Notice of Proposed Amendment; Vorentwurf europäischer Regulierungen.
App
Application; Programm für Smartphones/Tablets.
ARC
Air Risk Class; Risikoklasse Luft.
ATTI
Attitude Modus; Betriebsmodus bei DJI ohne GPS.
ATZ
Aerodrome Traffic Zone; Flugplatzverkehrszone.
BDL
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.
BFU
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.
BLAG-UAS/FM
Bund-Länder-Arbeitsgruppe UAS und Flugmodelle.
BMVI
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Oberste Luftfahrtbehörde für zivile Luftfahrtangelegenheiten.
BOS
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.
BVLOS
Beyond Visual Line of Sight; Betrieb außerhalb der Sichtweite: eine UAS-Betriebsart, die nicht in VLOS durchgeführt wird.
ConOps
Concept of Operations; Einsatzbeschreibung bzw. Betriebskonzept.
CTR
Control Zone; Kontrollzone an Flughäfen.
D&A
Detect & Avoid; Erkennen & Vermeiden. Ein D&A-System erkennt Hindernisse und weicht selbstständig aus.
DAeC
Deutscher Aero Club e.V.; Größter Luftsportverband in Deutschland.
DAS
DFS Aviation Service GmbH; Flugsicherungsorganisation.
DFS
Deutsche Flugsicherung GmbH; Flugsicherungsorganisation.
DLRG
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.; Verein zur Wasserrettung.
DMFV
Deutscher Modellflugverband e.V.
DRK
Deutsches Rotes Kreuz; Sanitätsdienst und Organisation mit Sicherheitsaufgaben.
EASA
European Aviation Safety Agency; Europäische Agentur für Flugsicherheit.
ED-R
Gebiet(e) mit Flugbeschränkungen.
EU
Europäische Union.
EVLOS
Extended Visual Line of Sight; Betrieb in erweiterter Sichtweite: Entweder sorgen Luftraumbeobachter:innen für eine Luftraumbeobachtung oder übernehmen die Steuerung und sind fortan neue:r Fernpilot:in.
Fernpilot:in
Eine natürliche Person, die für die sichere Durchführung des Fluges eines unbemannten Luftfahrzeugs verantwortlich ist, wobei der/die Fernpilot:in entweder die Flug-steuerung manuell vornimmt oder, wenn das unbemannte Luftfahrzeug automatisch fliegt, dessen Kurs überwacht und in der Lage bleibt, jederzeit einzugreifen und den Kurs zu ändern.
Synonyme: Steuer:in, Luftfahrzeugführer:in.
FL
Flightlevel; Flugfläche.
FLARM
Kollisionswarngerät für Luftfahrzeuge.
Flugmodell
National: Unbemanntes Fluggerät einschließlich Kontrollstation, welches ausschließlich zu Sport- und Freizeitzwecken betrieben wird.
EU: UAS im Betrieb in Vereinen und Vereinigungen, einfacher gestaltet als andere Klassen von UAS. Dient der Durchführung von Freizeitflügen, Flugveranstaltungen, sportliche Aktivitäten oder Wettbewerben.
Flyaway
Unkontrolliertes Abdriften oder Hinfort-Fliegen einer Drohne.
Follow-Me-Modus
ein Betriebsmodus eines UAS, bei dem das unbemannte Luftfahrzeug Personen innerhalb eines vorher festgelegten Radius ständig folgt.
FPV
First Person View; Egoperspektive.
ft
feet; Fuß (Maßeinheit); 1 ft entspricht 0,3048 m.
Geofencing
virtuell eingerichtete Begrenzung (Einzäunung) mittels GNSS.
Gimbal
Kardanische Aufhängung; Mehrachsige Stabilisierungsvorrichtung für die Kamera.
GNSS
Global Navigation Satellite System; Sammelbegriff für globale Satellitensysteme.
GPS
Global Position System; globales Satellitensysteme der USA.
GRC
Ground Risk Class; Risikoklasse Boden.
HALE
High Altitude Long Endurance; große Höhe, lange Reichweite.
ICAO
International Civil Aviation Organisation; Internationale Zivilluftfahrtorganisation.
IFR
Instrument Flight Rules; Instrumentenflugregeln.
J
Joule; Maßeinheit für kinetische Energie.
JARUS
Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems; Internationale Arbeitsgruppe zur Regulierung von Drohnen.
kmz (kml)
Keyhole Markup Language; Eine Datei, die als Layer in bspw. Google-Earth geladen werden kann. Die kmz ist eine komprimierte Version der kml.
KunstUrhG
Kunst-Urheber-Gesetz.
LBA
Luftfahrt-Bundesamt.
LiPo
Lithium-Polymer-Akkus; Akkuart.
LLB
Landesluftfahrbehörde.
LuftVG
Luftverkehrsgesetz.
LuftVO
Luftverkehrs-Ordnung.
LuftVZO
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung.
LVL
Lärmvorschrift für Luftfahrzeuge.
MALE
Medium Altitude Long Endurance; mittlere Höhe, lange Reichweite.
MTOM
Maximum Takeoff-Mass: die von Hersteller:in oder Erbauer:in festgelegte höchstzulässige Masse des unbemannten Luftfahrzeugs, einschließlich Nutzlast und Kraftstoff, mit der bzw. dem das unbemannte Luftfahrzeug betrieben werden kann.
Synonyme: MTOW, Maximale Abflugmasse, Maximales Abfluggewicht.
Menschenansammlung
eine Vielzahl von Menschen, die so dicht gedrängt stehen, dass es einer einzelnen Person nahezu unmöglich ist, sich aus dieser Menge zu entfernen.
Mhz
Megahertz; Maßeinheit für Funkfrequenz.
MSL
Mean Sea Level; Meeresspiegel.
N/A
Not Applicable; nicht verfügbar.
NDB
Non-Directional Beacon; ungerichtetes Funkfeuer. Positionsbestimmung in der bemannten Flugnavigation.
NfL
Nachrichten für Luftfahrer; Verbindliche Bekanntmachungen von Anordnungen sowie wichtige Informationen für die Luftfahrt.
NOTAM
Notice To Airmen; Informationen über temporäre und permanente Änderungen des Luftfahrthandbuches AIP.
Payload
alle Instrumente, Mechanismen, Ausrüstungen, Teile, Geräte, Zubehörteile oder Zusatzteile, einschließlich Kommunikationsausrüstung, die in das Luftfahrzeug eingebaut bzw. an diesem angebracht sind und nicht dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, das Luftfahrzeug im Flug zu betreiben oder zu steuern, ohne jedoch Teil des Flugwerks, eines Motors oder eines Propellers zu sein.
Synonyme: Nutzlast.
PIS
Public Interest Site; Landestelle (des öffentlichen Interesses) z.B. für Hubschrauber bei Krankenhäusern.
RC
Remote Control; Fernsteuerung; ferngesteuert
Redundanz
Ein Ausfall eines Systems bspw. eines Motors kann durch zusätzliche Systeme der Ausfall kompensiert werden.
RTH
Return To Home; Rückkehr zum Startpunkt (Homepoint); das Gerät kehrt autonom zum Startpunkt zurück.
RMZ
Radio Mandatory Zone; Gebiet mit Funkkommunikationspflicht.
SAIL
Specific Assurance Integrity Level; Risikostufe gem. SORA zur Ermittlung der Gegenmaßnahmen.
SAR
Search And Rescue; Suchen und Retten.
SERA
Standardised European Rules of the Air; Standardisierte Europäische Luftverkehrsregeln.
SMH
Sicherheitsmindesthöhe; Mindestflughöhe für bemannten Luftverkehr.
SOP
Standard Operating Procedures; Standardbetriebsverfahren.
SORA
Specific Operational Risk Assessment; Risikobewertung.
SORA-GER
Specific Operational Risk Assessment Germany; Risikobewertung (deutsche Version).
Tethered
gefesselt(e Drohne; kabelgebunden; angebunden).
THW
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk; Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums.
Tilt Wing/ Tilt Rotor
Kippflügler; Die Antriebe/Tragflächen lassen sich kippen.
TMZ
Transponder Mandatory Zone; Zone mit Transponderpflicht.
TRA
Temporary Reserved Airspace; zeitweilig reservierter Luftraum.
UA
Unbemanntes Luftfahrzeug; Ein unbemanntes Luftfahrzeug ist ein Luftfahrzeug, das ohne einen an Bord befindliche Pilot_innen autonom oder ferngesteuert betrieben wird oder dafür konstruiert ist.
UAS
Unbemanntes Luftfahrzeugsystem; Ein unbemanntes Luftfahrzeug sowie die Ausrüstung für dessen Fernsteuerung.
Synonyme: UAV, unbemanntes Luftfahrtsystem, Unbemanntes Fluggerät, Flugmodell.
VFR
Visual Flight Rules; Sichtflugregeln.
VLOS
Betrieb in Sichtweite (visual line of sight operation, VLOS): eine UAS-Betriebsart, bei der der Fernpilot:innen in der Lage sind, einen ununterbrochenen und nicht unterstützten Sichtkontakt mit dem unbemannten Luftfahr-zeug aufrechtzuerhalten, sodass dessen Flugweg so gesteuert werden kann, dass Kollisionen mit anderen Luftfahr-zeugen, Menschen und Hindernissen vermieden werden.
VR
Virtual Reality; virtuelle Realität.
VTOL
Vertical Take-Off and Landing; Senkrechtstart und -landung.
Waypoint
Wegpunkt.
WLAN
Wireless Local Area Network; Drahtlosnetzwerk, meist auf 2,4 Ghz-Basis.
Vorwort
Liebe Leser:innen,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben und sich mit dem Thema der unbemannten Luftfahrt auseinandersetzen möchten.
Die ursprüngliche Fassung entstand als wissenschaftliche Abschlussarbeit im Rahmen meines Masterstudiums. Dabei war es mein Ziel, wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig eine möglichst gute Lesbarkeit zu bieten. Diese überarbeitete Version wurde inhaltlich und sprachlich weiterentwickelt, um rechtliche Aktualisierungen einzubeziehen und den Zugang zur Materie zu erleichtern. Zudem wurden Quellen entfernt (diese können in der ersten Auflage nachgeschlagen werden).
Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Bereiche der unbemannten Luftfahrt und stellt Bezüge zu den rechtlichen Rahmenbedingungen her.
Bitte beachten Sie, dass sich das Luftrecht in einem fortlaufenden Wandel befindet. Es empfiehlt sich daher, stets auf dem aktuellen Stand der Rechtslage zu bleiben. Der Stand dieser Ausgabe ist Sommer 2025.
Herzlichst,
Maximilian Beck
Kapitel 1: Einleitung
Automatisierte Systeme und Roboter finden seit einigen Jahren zunehmend Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Besonders unbemannte Luftfahrzeugsysteme (Unmanned Aerial Systems, kurz: UAS) eröffnen ihren Betreiber:innen neue Perspektiven – etwa bei Vermessungen, Inspektionen oder in der Überwachung.
Dank ihres erhöhten Blickwinkels, der einfachen Handhabung und der schnellen Einsatzbereitschaft sind UAS auch für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) von großem Interesse. Prognosen und Marktanalysen deuten bereits heute auf ein stark wachsendes Potenzial im BOS-Bereich hin, mit nahezu exponentiellen Wachstumsraten.
Mit der wachsenden Zahl von UAS-Anwendungen entstehen für Luftfahrtbehörden und Betreiber:innen fortlaufend neue Szenarien. Diese machen es notwendig, bestehende rechtliche Rahmenbedingungen zu überprüfen und an die tatsächliche Nutzung anzupassen.
Neben den zahlreichen Chancen und technischen Möglichkeiten von UAS werden jedoch auch Risiken diskutiert – etwa für die bemannte Luftfahrt oder unbeteiligte Personen am Boden. Ein prägendes Beispiel war der Absturz eines rund 15 Kilogramm schweren Multikopters bei einem Wintersportevent im Jahr 2015, bei dem der Skirennläufer Marcel Hirscher nur knapp verletzt wurde. In den letzten Jahren kam es auch zu Störungen des Flugverkehrs durch UAS in der Nähe von Flughäfen. Dabei führten Sperrungen von Start- und Landebahnen zu erheblichen Verspätungen im Linienverkehr.
Während sich der Missbrauch unbemannter Fluggeräte in Deutschland bislang häufig auf Verstöße gegen die sogenannte „Drohnenverordnung“ sowie auf den Schmuggel von Pyrotechnik in Stadien oder von Drogen und Mobiltelefonen in Justizvollzugsanstalten beschränkte, setzen internationale Terrororganisationen UAS gezielt für Anschläge ein – häufig mit Sprengsätzen, die unter den Geräten angebracht und im Schwarm abgeworfen werden.
Um solchen Gefahren zu begegnen, wurde im April 2017 die sogenannte „Drohnenverordnung“ verabschiedet. Ziel war es, klare gesetzliche Rahmenbedingungen für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge zu schaffen und gleichzeitig den Einsatz von UAS für BOS zu erleichtern. Während Polizei und Militär bereits über Sonderrechte verfügten, wurden vergleichbare – wenn auch eingeschränkte – Ausnahmeregelungen auch für BOS eingeführt. Diese ermöglichten eine Nutzung ohne umfangreiche Einzelgenehmigungen, was insbesondere im Einsatzfall eine erhebliche Erleichterung darstellte.
Bis zur Verabschiedung dieser Verordnung mussten etwa Feuerwehren für jeden UAS-Einsatz eine separate Aufstiegserlaubnis einholen – häufig zu aufwändig für den zeitkritischen BOS-Alltag. Auch heute gelten diese Sonderregelungen weiter. Zwischenzeitlich wurden viele Vorschriften in sogenannte Geozonen überführt oder durch europäische Regelungen ersetzt.
Durch die eingeführten Sonderregeln konnten seit 2017 Behörden bei Ihrer Aufgabenerfüllung und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Zusammenhang mit Not- und Unglücks- sowie Katastrophenfällen auch ohne Erlaubnis unbemannte Fluggeräte in vielen Verbotszonen betreiben. Jedoch räumen diese Sonderrechte keine allumfänglichen Freiheiten ein; das Luftverkehrsrecht und weitere Rechtsgebiete gelten unbeschadet der Befreiungen weiterhin und haben somit Einfluss auf den Betrieb. Hierdurch kann es zu rechtswidrigen Einsätzen von UAS durch BOS kommen, die mit Strafen bis hin zum Freiheitsentzug geahndet werden können und folgende Frage aufwerfen:
„Können Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unbemannte Luftfahrzeugsysteme rechtssicher bei der Aufgabenwahrnehmung einsetzen?“
Um die Frage fundiert zu beantworten und Behörden sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) einen umfassenden Überblick über aktuelle und zukünftige rechtliche Rahmenbedingungen zu geben, behandelt diese Arbeit die relevantesten Rechtsgebiete und Normen im Zusammenhang mit dem Einsatz unbemannter Luftfahrzeugsysteme (UAS).
Die luftverkehrsrechtliche Gesetzgebung und -verwaltung ist komplex: Zahlreiche Akteur:innen sind auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene beteiligt. Entstanden ist ein schwer überschaubares Geflecht aus EU-Verordnungen, nationalen Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und föderalen Sonderregelungen.
Trotz vorhandener Sonderrechte kann der Einsatz von UAS durch BOS dennoch zu Rechtsverstößen führen – mit möglichen disziplinarrechtlichen, haftungsrechtlichen oder gar strafrechtlichen Konsequenzen. Umso wichtiger ist ein klarer Überblick über die geltenden Vorgaben und ihre Wechselwirkungen.
Da es sich um ein vergleichsweise junges und dynamisches Rechtsgebiet handelt, ist die Fachliteratur bislang begrenzt. Neben geltenden Gesetzen, Verordnungen, Studien, Fachzeitschriften und Onlinequellen basiert dieses Buch auch auf aktuellen Entwicklungen und praktischen Erfahrungswerten. Ein Großteil der bisher verfügbaren Literatur stammt aus einer Zeit, in der Drohnen primär von Privatpersonen genutzt oder militärisch eingesetzt wurden. Nur wenige Werke – darunter Veröffentlichungen von Prof. Dr. Elmar Giemulla, Christian Dieckert sowie des Autors dieser Arbeit – setzen sich mit dem aktuellen nationalen Rechtsrahmen und seiner praktischen Umsetzung auseinander.
Dieser Leitfaden ist durchgängig gendergerecht formuliert, um alle Leser:innen und Prüfer:innen gleichermaßen anzusprechen. Auf das generische Maskulinum wurde bewusst verzichtet. Ausnahmen bilden wörtliche Zitate aus Gesetzes- oder Verordnungstexten, die im Original nicht genderneutral formuliert sind.
2 Grundlagen des Luftverkehrsrechts und Aufbau der Luftfahrtverwaltung
Die Regulierung und Standardisierung des Luftverkehrs erfolgt durch eine Vielzahl internationaler, supranationaler und nationaler Organisationen, Institutionen und Behörden. Diese werden im Folgenden zusammenfassend als Luftfahrtverwaltung bezeichnet.
Die Abbildung zeigt die Struktur der Luftfahrtverwaltung. Sie zeigt die wichtigsten nationalen und internationalen Akteur:innen im Bereich der Luftfahrt.
Quelle:Eigene Darstellung
Auf nationaler Ebene umfasst die Luftfahrtverwaltung in Deutschland verschiedene zuständige Behörden, Stellen und Vereinigungen. Während einige Bereiche zentral durch den Bund geregelt werden, erfolgt die Verwaltung in anderen Bereichen föderal im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung.
2.1 Internationale und europäische Luftfahrtverwaltung, Zuständigkeiten und Organisationen
Nachfolgend werden zunächst die internationalen und europäischen Behörden, Stellen und Vereinigungen vorgestellt.