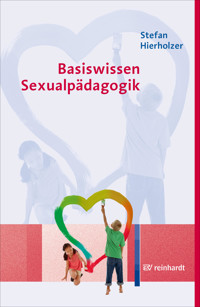
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Sexualität begleitet den Menschen über den Lebenslauf hinweg. Wie können pädagogische Fachkräfte sexuelle Bildung vermitteln und gleichzeitig genügend Entwicklungsspielraum lassen? Das Buch bietet Informationen zu den grundlegenden Themen: sexuelle Entwicklung, sexuelle Vielfalt, Sexualität und Medien, Pornografiekonsum sowie rechtliche, gesundheitliche und ethische Aspekte. Ausgrenzungsmechanismen und Tabuisierung, z. B. von Alterssexualität oder Trans- und Inter-Personen, werden thematisiert und pädagogische Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Mit methodischen Bausteinen für die praktische Umsetzung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stefan Hierholzer arbeitet als Lehrer und Schulleiter des Campus29 und Sexualpädagoge in Hamburg.
Hinweis
Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. -- Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02973-0 (Print)
ISBN 978-3-497-61424-0 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61425-7 (EPUB)
© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Cover: Agenturfoto. Mit Model gestellt © iStock.com/skodonnell
Satz: Der Buchmacher, Arthur Lenner, Windach
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort – Wie ist dieses Buch zu lesen?
1 Sexualitätsbegriff – Annährung an ein diffuses Konstrukt
1.1 (Sozial-)pädagogische Perspektive
1.2 Medizinische Perspektive
1.3 Psychoanalytische Perspektive
1.4 Soziologische Perspektive
2 Sexuelle Entwicklung
2.1 Sexualentwicklung im ersten Lebensjahr
2.2 Sexuelle Entwicklung im zweiten Lebensjahr
2.3 Sexuelle Entwicklung im dritten Lebensjahr
2.4 Sexuelle Entwicklungen im vierten Lebensjahr
2.5 Sexuelle Entwicklung im fünften Lebensjahr
2.6 Sexuelle Entwicklung im sechsten Lebensjahr
2.7 Sexuelle Entwicklung vom siebten Lebensjahr bis zur Pubertät
2.8 Pubertät
2.9 Reproduktives Alter
2.9.1 Reproduktion und Erwerbsbiografie
2.9.2 Paardynamiken
2.9.3 Der Stellenwert von Ehe und Elternschaft
2.9.4 Die Skripttheorie
2.10 Zwischen Reproduktion und höherem Alter – die Wechseljahre
2.11 Sexuelle Entwicklungen im höheren Lebensalter
2.11.1 Das Defizitmodell
2.11.2 Das Kompetenzmodell
2.11.3 Bedeutung von Sexualität für ältere Menschen
3 Sexualität und Medien
3.1 Pornografiebegriff
3.2 Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen
3.3 Medienverhalten im Sinus-Milieu Vergleich
3.4 Pornografiekonsum unter Jugendlichen
3.4.1 Pornografiekonsum von Mädchen
3.4.2 Pornokonsum von Jungen
3.4.3 Pornografiekompetenz
4 Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
4.1 Sexuelle Identitäten als Forschungsgegenstand
4.2 Vom Gender- zum Queer-Diskurs – historische Rückgriffe auf die Bewertung der sexuellen Identität
4.2.1 Antike in Europa
4.2.2 Israel und die Antike
4.2.3 Kirchliche Sexualmoral
4.2.4 Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit
4.2.5 Die Aufklärung: Wissenschaftliche Erklärungen gewinnen an Bedeutung
4.2.6 Die Frauenbewegung verändert alles…
4.2.7 Gender und Queer Studies
4.3 Coming-out-Modelle
4.4 Bisexualität
4.5 Queere Erscheinungsformen
4.6 Interkulturelle Pädagogik
5 Sexualität, Recht und Gesundheit
5.1 Allgemeine Menschenrechte
5.2 Sexuelle Menschenrechte
5.3 Sexualstrafrecht
5.4 Sexuell übertragbare Krankheiten und Verhütung
6 Sexualpädagogik – von der Sexualerziehung bis zum Sexualbildungsbegriff
6.1 Sexualerziehung als „Abwehrpädagogik“
6.2 Sexualpädagogik als Aufklärung und Gegenaufklärung
6.3 Sexuelle Bildung als Bildungsideal
7 Sexualpädagogische Didaktik und Methodik
7.1 Sexualdidaktik
7.2 Zielgruppen und Arbeitsfelder der Sexualpädagogik
7.3 Didaktische Entscheidungsfelder
7.4 Ausgewählte pädagogische Bausteine für die Praxis
7.4.1 Kita
7.4.2 Schule und Jugendarbeit
7.4.3 Behindertenhilfe
7.4.4 Erwachsenenarbeit und sonstige Arbeitsfelder
8 Sexualethik
8.1 Prostitution
8.2 Umgang mit Sexualstraftäter_innen
8.3 Veränderte Liebes- und Lebensbeziehungen
9 Sexualisierte Gewalt
9.1 Annäherung an den Missbrauchsbegriff
9.2 Statistik: Hell- und Dunkelfeld
9.3 Tatumstände
9.4 Typologie von Täterinnen und Tätern
9.5 Täter_innenstrategien
9.6 Folgen sexualisierter Gewalt für die Opfer
9.7 Präventionsstrategien bei sexuellem Missbrauch
Literatur
Sachregister
Vorwort – Wie ist dieses Buch zu lesen?
Hinter jedem Werk steckt ein Schreibender. So simpel diese Erkenntnis auch erscheinen mag, so bedeutend ist sie für die Lesenden.
Die Auseinandersetzung mit dem sensiblen Themenfeld Sexualität setzt die Einsicht voraus, dass eine „objektive“ Beschreibung dieses sozialen Phänomens dem jeweiligen Schreibenden aufgrund seiner eigenen emotionalen Beteiligung nur schwer möglich ist. Selbst bei intensiver Reflexion durch den Autor schwingen dennoch immer normative Implikationen mit. Kaum ein anderes Forschungsfeld berührt so viele kontrovers diskutierte Fragen wie das der Sexualität. Als Autor dieses Buchs habe ich wie jeder andere Schreibende eine ganz eigene, individuelle Sexualität und damit eine individuelle Sicht auf das Thema.
Als Lesende dieses Buchs sollen Sie wissen, dass der Mann hinter diesem Buch eine durchschnittlich-konservative Sexualerziehung genossen hat. Durch Fort-, Aus- und Weiterbildung im pädagogisch-psychotherapeutischen Bereich konnte ich mir meiner eigenen sexuellen Entwicklung und der dahinter liegenden sozialisatorischen Aspekte bewusst werden und mich nach und nach einer emanzipatorisch-gesellschaftskritischen sexualpädagogischen Haltung zuwenden.
In dieser Wissenschaftsperspektive ist dieses Werk zu lesen und zu verstehen. Deshalb habe ich auch auf einen sprachsensiblen Umgang mit der Thematik geachtet und vorrangig den Gender-Gap (_) verwandt, um der Vielfalt der sexuellen und geschlechtlichen Erscheinungsformen Rechnung zu tragen. Damit möchte ich auch verdeutlichen, dass eine Verengung der Frage nach Sexualität und geschlechtlicher Vielfalt auf binäre Geschlechterverhältnisse (Mann vs. Frau) nicht mehr den wissenschaftstheoretischen Ansprüchen genügen kann. Auch im Sinne einer emanzipatorischen Sexualwissenschaft und Sexualpädagogik gilt es, zukünftig die „dritte Option“ (divers) mitzudenken und gleichwertig mit zu argumentieren.
!
Über (Schrift-)Sprache wird die (sexuelle) Welt konstruiert. Aus heteronormativen bzw. heterosexistischen Weltvorstellungen generiert sich die Annahme, dass Heterosexualität normal und alle anderen sexuellen und geschlechtlichen Erscheinungsformen nicht normal seien. Diese Sichtweise erschwert es, im Alltag genau hinzuschauen und zu sehen, dass es auch Menschen zwischen den Geschlechtern (Inter-Personen) gibt.
Die Entstehung von Texten geschieht selten im Alleingang und Schreibende werden von anderen Menschen auf ihrem Weg begleitet. In diesem Sinne danke ich meinen Eltern und Freunden für ihre ausdauernde (ideelle) Unterstützung.
1 Sexualitätsbegriff – Annährung an ein diffuses Konstrukt
Begriffsklärungen gehören zu den zentralen Aufgaben von Sozialwissenschaftler_innen. Der Sexualitätsbegriff stellt alle Sexualwissenschaftler_innen vor enorme Herausforderungen, da dieser Begriff zeitlichen, kulturellen, religiös-weltanschaulichen und traditionellen Vorstellungskonstruktionen unterworfen ist. Lautmann konstatiert daher, dass der Sexualbegriff trotz aller Bemühungen nicht definierbar ist (Lautmann 2002). Aus diesem Grund soll das Phänomen der Sexualität bzw. Soziosexualität (Kentler 1973) hier multiperspektivisch betrachtet werden.
1.1 (Sozial-)pädagogische Perspektive
Der Sexualitätsbegriff wird erstmals im Zusammenhang mit der Botanik im Jahr 1820 in August Henschels Buch „Von der Sexualität der Pflanzen“ verwendet. Darin differenziert Henschel männliche und weibliche Pflanzen und beschreibt, wie diese beiden gegensätzlichen Geschlechter für die Fortpflanzung Sorge tragen (Bange 2000). Mit dieser ersten schriftlichen Normierung bahnte sich letztlich auch die heute immer noch spürbare Biologisierung der Sexualität an. Gerade seit den 1990er Jahren wird mit dem Diskurs über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt die Biologisierung des Sexuellen nachhaltig infrage gestellt (Tuider et al. 2012).
„Sexualität ist, was wir daraus machen. Eine teure oder eine billige Ware, Mittel zur Fortpflanzung, Abwehr gegen Einsamkeit, eine Form der Kommunikation, ein Werkzeug der Aggression (der Herrschaft, der Macht, der Strafe und der Unterdrückung), ein kurzweiliger Zeitvertreib, Liebe, Luxus, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse oder das Gute, Luxus oder Entspannung, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, eine Form von Zärtlichkeit, eine Art der Regression, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, Vergnügen, Vereinigung mit dem Universum, mystische Ekstase, Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Form, Neugier und Forschungsdrang zu befriedigen, eine Technik, eine biologische Funktion, Ausdruck psychischer Gesundheit oder Krankheit oder einfach eine sinnliche Erfahrung“ (Offit 1979, 16).
Offits ausdifferenzierte Darstellung des Sexualbegriffs macht deutlich, dass Sexualität zeithistorischen und kulturellen Wandlungen unterworfen ist und verschiedene menschliche Bedürfnislagen umfasst. So sind besonders Anerkennung und personelle Wahrnehmung durch Dritte zentrale Bedürfnisse, die durch sexuelle Begegnungen zwischen Menschen gestillt werden können.
Die Perspektive der Sichtbarkeit ist dabei gerade für den (sozial-)pädagogischen Zugang unerlässlich, wenn die verschiedenen Zielgruppen der (Sozial-)Pädagogik bedacht werden. So ist die Tendenz zur Marginalisierung und Dethematisierung von Fragen der Sexualität bei Menschen mit Behinderungen oder im Kontext totaler Institutionen (wie z. B. Gefängnisse oder geschlossene Psychiatrien) (Goffmann 1973; Geifrig 2003) auch unter Pädagog_innen weit verbreitet. Unter dem Gesichtspunkt, dass eine menschenrechtsbasierte Profession wie die der (Sozial-)Pädagogik den Auftrag hat, die Würde und Anerkennung der Adressat_innen in ganzheitlicher Form (wieder-)herzustellen, kann aber der Bereich der Sexualität nicht ausgeklammert werden (Staub-Bernasconi 2017).
!
Sexualität ist in jedem (sozial-)pädagogischen Setting mit zu berücksichtigen und mitzudenken.
Sielert definiert Sexualität als „[…] allgemeine Lebensenergie, die sich des Körpers bedient, aus vielfältigen Quellen gespeist wird, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen kennt und in verschiedener Hinsicht sinnvoll ist“ (Sielert 2015, 43). Diese Perspektive ist insofern relevant, als sie verdeutlicht, dass Sexualität (sozial-)pädagogisch angemessen im Alltag zu berücksichtigen ist. Sielert schlägt vor, den Sexualbegriff unter vier Aspekten zu betrachten:
Identitätsaspekt: Hierunter ist das eigene Erleben als männlich, weiblich oder nonbinär, genderqueer oder auch genderfluid u.Ä. zu verstehen.
Beziehungsaspekt: Dieser Aspekt betrifft die intime Begegnung mit einem oder mehreren Anderen, die das Individuum als wärmend und Sicherheit gebend empfinden kann.
Lustaspekt: Dieser beschreibt die kraftspendende Erfahrung sexueller Begegnungen mit der Option, zur sexuellen Ekstase zu gelangen.
Fruchtbarkeitsaspekt: Hierunter fällt sowohl die lebensspendende Energie, die durch Geschlechtsverkehr freigesetzt wird, als auch die Option, durch Zeugung Leben weitergeben zu können. (Sielert 1993)
Neben diesen von Sielert ausgearbeiteten Aspekten bestehen aber noch weitere Perspektiven, die es zu bedenken gilt:
Biografischer Aspekt: Dieser Aspekt betont die lebenslange Präsenz von Sexualität – von der Zeugung bis zum Tod ist der Mensch ein sexuelles Wesen. Es konnte nachgewiesen werden, das Babys schon im Mutterleib an ihre Genitalien greifen und mit ihnen spielen (Borneman 1981; Nilsson 2003). Auch Freud (2012) verweist bereits um 1900 darauf, dass Kleinkinder eine eigene „kindliche Sexualität“ besitzen.
Genderspezifischer Aspekt: Das Erleben von Sexualität ist auch zwischen den Geschlechtern höchst unterschiedlich. So konnten Masters und Johnson nachweisen, dass das Erleben des Orgasmus entscheidend vom Geschlecht abhängig ist (Masters/ Johnson 1966). Für den Bereich der Sonderpädagogik konnte gezeigt werden, dass Frauen mit Behinderung im Gegensatz zu Männern häufiger unterstellt wird, keinen Sexualtrieb zu haben (Geifrig 2003; Schmetz / Stöppler 2007). Auch kulturell und historisch geprägte Ge- und Verbote im Zusammenhang mit Sexualität weisen geschlechtsspezifische Unterschiede auf.
Ambivalenzen der Sexualität: Da Sexualität als soziales Phänomen betrachtet werden muss, bleiben Ambivalenzen nicht aus, denn menschliches Handeln ist immer auch von Ambivalenzen durchzogen. Sexualität hat neben allen hier geschilderten positiven Aspekten auch „Schattenseiten“, wie bspw. sexuellen Missbrauch (Martin / Niemann 2000) (s. Kap. 9). Besonders deutlich wird dies bei jenen Adressat_innen, die nicht oder noch nicht wehrhaft sind, so bspw. Menschen mit (geistiger) Behinderung, Menschen mit Demenz oder Kinder.
Ausdrucksformen der Sexualität: Noch in der Antike wurden homosexuelle Beziehungen geachtet und teilweise aus pädagogischer Perspektive positiv bewertet (Knabenliebe im antiken Athen). Der Einzug des Christentums in den westlichen Kulturraum stellt eine Zäsur dar, mit der Sexualität stark auf ihren Fortpflanzungsaspekt fokussiert wird (Fiedler 2004). Dies mag seinen Ursprung in der jüdischen Geschichte haben, in der die äußeren Bedrohungsszenarien das Volk möglicherweise dazu veranlassten, die Zeugung von Nachkommenschaft stark zu betonen und auch mit religiösen Riten zu versehen, damit das Weiterbestehen des eigenen Glaubens und der eigenen Kultur sichergestellt werden konnte (Hierholzer 2014, s. Kap. 4.2).
Die restriktive christliche Sichtweise führte letztlich zur Kriminalisierung, Stigmatisierung und Verfolgung von nicht auf Fortpflanzung gerichteter Sexualität bzw. sexuellen Orientierungen, die nicht primär den Zeugungsauftrag erfüllen können. Erst seit der Jahrtausendwende erfahren gleichgeschlechtlich liebende Personen allmählich die notwendige Anerkennung ihrer Lebensform. In Deutschland schlägt sich dies unter anderem auch in staatlicher Anerkennung / Rehabilitation von Menschen nieder, die nach § 175 Strafgesetzbuch verurteilt worden waren, und in der Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe (Hierholzer 2016).
1.2 Medizinische Perspektive
Medizin als Erfahrungswissenschaft hat mit dem Aufkommen der Queer Studies in den 1990er Jahren eine erweiterte Differenzierung von Geschlechtsvorstellung erfahren. Dies zeigt sich u. a. an der Veränderung der Perspektive auf Trans-Identität in der Neufassung der ICD, welche darin nicht mehr als „Störung“ verstanden wird (Rauchfleisch 2018). Innerhalb der Sexualforschung lässt sich nach wie vor eine Diskrepanz konstatieren. Zum einen gibt es die biologistische Perspektive auf Sexualität, welche sich seit August Henschel (s. Kap. 1.1), gerade bei konservativ-religiösen Wissenschaftler_innen im angloamerikanischen Raum, weiterhin stark durchzieht (Sigusch 2008). Eine der ersten und bedeutendsten Studien, die die Bedeutung biomedizinischer Aspekte relativierten, war der sogenannte „Kinsey-Report“ (Kinsey 1941). Kinsey und Kollegen waren es, die mittels Befragungen zur Erkenntnis gelangten, dass innerhalb der amerikanischen Bevölkerung eine beachtliche Spannbreite von sexuellen Orientierungen vorlag.
Aus den Befragungen entwickelte Kinsey schließlich die sogenannte Kinsey-Skala, mit deren Hilfe er den Grad der Homosexualität maß. Die Ergebnisse dieser Skaleneinteilung sind bis in die Gegenwart hinein umstritten, da Kinsey vor allem Gefangene zu ihrem Sexualverhalten befragte. Dennoch wurde mit dieser Untersuchung zum ersten Mal deutlich, dass Hetero- und Homosexualität keine gegensätzlichen Pole der sexuellen Identität darstellen, sondern dass deren Grenzen fluide sind. Dieser sozialwissenschaftliche Ansatz war gerade im angloamerikanischen Bereich der Startschuss für eine differenzierte Betrachtung der menschlichen Sexualität, die durch die queer-theoretischen Überlegungen von u. a. Butler in den 1990er Jahren weitergeführt wurde.
Die von Kinsey entwickelten Messverfahren übernahmen Masters und Johnson in den Folgejahren und untersuchten die verschiedensten Aspekte von Sexualität. Eine ihrer bekanntesten Untersuchungen betraf bspw. das Orgasmuserleben von Männern und Frauen. Ihre Forschungsergebnisse gingen unter dem Stichpunkt „Vermessung der Sexualität“ in die Sexualwissenschaften ein (Masters / Johnson 1966).
Der medizinische Blick auf Sexualität ist auch insofern für die Sexualpädagogik von Belang, als er deutlich macht, dass Geschlecht nicht automatisch mit den äußeren Geschlechtsmerkmalen gleichgesetzt werden kann. Mittlerweile wird innerhalb des medizinischen Fachdiskurses eine Dreiteilung des Geschlechts vorgenommen. So unterscheiden Mediziner_innen zwischen dem chromosomalen, dem gonadalen und dem hormonalen Geschlecht.
Chromosomales Geschlecht: Dieses wird durch die Chromosomenpaare bestimmt, die für die Herausbildung der Geschlechtsmerkmale maßgeblich sind, wobei eine XX-Variation aus einem Embryo eine Frau „macht“ und eine XY-Variante einen Mann.
Gonadales Geschlecht: Die Gonaden sorgen sechs Wochen nach der Befruchtung für die Ausschüttung des Hormons Androgen, das die Geschlechtsdifferenzierung hervorbringt.
Hormonales Geschlecht: Die Herausbildung von Hodensack und Penis wird in einem komplizierten Prozess durch das Hormon Testosteron angeregt. Wird kein Testosteron ausgeschüttet, entwickeln sich Vulva und Klitoris. Letztlich kann konstatiert werden, dass das, was gesellschaftlich als männliches Geschlecht wahrgenommen wird, zumindest auf hormoneller Ebene mit einem erhöhten Aufwand generiert werden muss. Anders ausgedrückt kann gesagt werden, dass die „Grundform“ des Menschen weiblich ist.
Auch wenn diese Aufzählung den Schluss nahelegt, dass eine Geschlechtsentwicklung klaren biochemischen Abläufen folgt, ist dies nicht so. Der Prozess hinter der biologischen Geschlechtsentstehung ist hoch komplex und störungsanfällig, was sich gerade bei Inter-Personen zeigt (s. Kap. 4.5). Darüber hinaus sind Hormone auch im Lebensverlauf nachhaltig für sexuelle Lust und sexuelle Erregung mit verantwortlich.
1.3 Psychoanalytische Perspektive
Nachdem die biologischen Grundlagen für Geschlechtsentstehung dargelegt wurden, wird im Folgenden die Frage betrachtet, wie Geschlechtsidentität entsteht. Diese Hinterfragung weist auf eine relativ alte philosophische Herausforderung hin, die unter dem Stichwort „Leib-Seele-Problem“ von verschiedenen Philosoph_innen bearbeitet wurde. Für den Sexualbegriff ist dieser Diskurs insofern relevant, als Sexualität sowohl körperliche Betätigung (Leibaspekt – zärtliche Berührungen, Küsse, Onanieren, ggf. auch Geschlechtsverkehr) als auch affektive Komponenten (Seelenaspekt) umfasst (Kluge 1998). Das bedeutet in der Konsequenz, dass der Mensch immer als gesamtes Wesen in Sexualität eingebunden ist.
Auf diesen Umstand verwies bereits der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Freud 2010). Bei seinen Analysen konstatierte Freud, dass die meisten seiner Patient_innen wenig positiven Zugang zu ihrer eigenen Sexualität besaßen und daher häufig krank wurden. Daher stellte er die Sexualität ins Zentrum seines Theoriegebäudes der Psychoanalyse.
!
Theoretische Überlegungen sind immer in ihrer jeweiligen historischen Verortung zu betrachten und in ihrem kulturellen Kontext zu verstehen.
Freuds Theorien sind heute stark umstritten, dennoch konnten Wissenschaftler viel von ihm lernen. Die psychoanalytische Forschung hat sich in der Vergangenheit viel damit befasst, wie wir zu unserem Geschlechtsbewusstsein kommen. Wie kommt es, dass wir uns als Junge / Mann bzw. Mädchen / Frau wahrnehmen? Erst neuere Forschung nimmt zaghaft nicht-binäre Geschlechtervorstellungen zu Kenntnis. Daran sind auch Fragen nach „Genderfluidität“ gekoppelt, die eine Diskussion um die völlige Auflösung von Geschlechterkategorien mit sich bringen. Gerade im klinischen Kontext stellt sich die Frage, wie damit umgegangen werden kann / muss, wenn Menschen für sich eine geschlechtliche Festlegung komplett verweigern bzw. zwischen dem männlichen und weiblichen Pol „oszillieren“ (s. Kap. 4.5). Grundsätzlich lassen sich drei zentrale Aspekte unter dem Begriff der Geschlechtsidentität zusammenfassen:
■Kern-Geschlechtsidentität
■Geschlechtspartnerorientierung
■Geschlechtsrolle
Kern-Geschlechtsidentität: Hierunter wird die Fähigkeit einer Person verstanden, sich einem Geschlecht sicher zuzuordnen. Dabei ist hier gerade im Zusammenhang mit queer-theoretischen Überlegungen deutlich einzuwenden, dass solche Zuordnungen zu kurz greifen, da es auch Menschen gibt, die sich weder als männlich noch als weiblich empfinden bzw. begreifen wollen. Darüber hinaus ist anzumerken, dass Empfindungen stark soziokulturell geprägt sind. So wird das geschlechtliche Empfinden zwar zum Teil durch die Menschen selbst erzeugt, z. B. wenn kleine Kinder ihre sekundären Geschlechtsmerkmale ausgiebig erkunden. Zum anderen aber werden Kinder in ihrem Geschlecht durch ihr soziales Umfeld (Angehörige, Lehrer_innen u. v. a. m.) bestärkt. Dies erfolgt in den ersten Lebensjahren indirekt, bspw. durch das Verschenken unterschiedlicher Spielzeuge (Autos für Jungen, Puppen für Mädchen) oder durch geschlechtsspezifische Gestaltung des Zimmers und Auswahl der Kleidung.
Gerade zum Ende der Kindergartenzeit werden die Peers für die Kinder bedeutender. Ein aus deren Sicht nicht normkonformes Geschlechtsverhalten wird bspw. durch Ausschluss oder abwertende Sprache („Du bist gar kein richtiges Mädchen / kein richtiger Junge“) sanktioniert und ein konformes geschlechtsspezifisch Verhalten bestärkt (Schmidt / Sielert 2012).
Geschlechtspartnerorientierung: Dies bezieht sich in der psychoanalytischen Forschung auf die Frage, welches Geschlecht einem Menschen begehrenswert erscheint. Freuds Auffassung nach sind alle Menschen grundsätzlich zur Bisexualität fähig („polymorph pervers“). Eine klarere Vorstellung davon, welches Geschlecht präferiert wird, erfolgt erst in der Pubertät. Ungeachtet dessen bleibt der Mensch im Besitz der Fähigkeit, bisexuell zu sein.
Geschlechtsrolle: Hierunter wird die soziale Rolle (Gender) verstanden, die an Geschlecht gekoppelt ist. Was in den verschiedenen Kulturen und Milieus als weiblich / männlich bzw. divers gilt, ist dabei höchst unterschiedlich (Wrede 2000).
!
Die psychoanalytische Forschung hat dazu beigetragen, dass Sexualität im Rahmen eines „Leib-Seele-Dualismus“ verstanden wurde. Mit Blick auf die affektive Komponente wird deutlich, dass Sexualität kein rein biologisches Phänomen sein kann.
1.4 Soziologische Perspektive
Das Kernanliegen der soziologischen Forschung besteht darin, gesellschaftliche Verhältnisse zu erklären. Dabei sind vor allem veränderte Norm- und Moralvorstellungen stark in den Vordergrund gerückt. Deutlich wird dies besonders an der Bewertung vorehelicher bzw. außerehelicher Sexualkontakte.
War es um 1900 noch gesellschaftlich geboten, sich vor der Ehe sexuell enthaltsam zu geben, so ist dies heute nicht mehr der Standard (Neubauer 2002). Staatliche Vorgaben dazu, was in heterosexuellen Ehen erlaubt bzw. verboten ist, waren jedoch lange Zeit gesellschaftlich akzeptiert. Der eheliche Sexualverkehr konnte – zumindest theoretisch – durch den Ehemann eingeklagt werden (Fend 2003). Nicht-heterosexuelle Paarbeziehungen bzw. Sexualkontakte standen nach § 175 StGB bis 1994 in Deutschland unter Strafe. Dabei war ausschließlich männliche Homosexualität ein Straftatbestand. Die Verfolgungsbehörden gingen so weit, dass sie bekannte Treffpunkte schwuler Männer aufsuchten, auf sexuelle Avancen warteten und dann die Männer festnahmen und anklagten.
!
Sexualität ist eine lebenslang wirkende Triebenergie, die kulturell, biologisch, biografisch, geschlechts-, milieu- und schichtspezifisch determiniert ist. Dabei existieren diverse sexuelle Ausdrucksformen (Heterosexualität, Homosexualität und Bisexualität). Darüber hinaus sind nicht ausschließlich binäre Geschlechtskomponenten im Fähigkeitsspektrum des Menschen angelegt, sondern auch Formen, die darüber hinausreichen (Inter- und Trans-Identitäten). Auch eine fehlende bzw. schwache Ausprägung von Sexualität, z. B. in Form von Asexualität, ist existent.
Bücher zum Thema
Lemmen, K. et al. (2005): Sexualität wo hin? Hinblicke, Einblicke, Ausblicke. AIDS-Forum DAH Band 49. Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin (kostenlos über www.aidshilfe.de beziehbar)
Lautmann, R. (2002): Soziologie der Sexualität: Erotischer Körper, intimes Handeln und Sexualkultur. Juventa, Weinheim
Schelsky, H. (2017): Soziologie der Sexualität: Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft. Rowohlt, Hamburg
Birke, P. (Hrsg.) (2019): Perspektiven der Sexualforschung. Psychosozial-Verlag, Gießen
Internetadressen
Bundessstiftung Magnus Hirschfeld: http://mh-stiftung.de/
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.sexualaufklaerung.de/
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung: http://dgfs.info
Deutsche Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung: www.sexologie.org/
Deutsche Gesellschaft für Geschlechtserziehung: www.dgg-ev-bonn.de/
GenderKompetenzZentrum der Humboldt Universität zu Berlin: www.genderkompetenz.info/
HeinrichBöll Stiftung – Gunda Werner Institut Feminismus und Geschlechterdemokratie: www.gwi-boell.de/
Institut für Interdisziplinäre Genderforschung und Diversity (IGD): www.fh-kiel.de/index.php?id=2911
Institut für Queer Theory: www.queer-institut.de/
Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin: https://sexualmedizin.charite.de/
2 Sexuelle Entwicklung
Wie der Begriff Soziosexualität bereits suggeriert, handelt es sich bei menschlicher Sexualität nicht ausschließlich um instinktgesteuerte Sexualität, wie dies bei den meisten Tieren der Fall ist, sondern um eine in soziale Bedingungen eingebettete Sozialhandlung. Für alle Sozialhandlungen gilt, dass diese über Sozialisationsleistungen erlernt werden müssen. In der Literatur wird daher von „sexuellen Skripten“ gesprochen, (Gagnon 1977). Zentral ist, dass diese sexuellen Skripte ein Leben lang erweitert, umgeschrieben und an die jeweiligen sozialen, körperlich-physischen und psychischen Bedingungen angepasst werden.
Auch die sexuelle Entwicklung verläuft wie alle Humanentwicklungen nicht statisch, sondern höchst intraindividuell. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass die nun folgenden Altersangaben ausschließlich als Orientierungshilfen zu lesen sind.
!
Humane Sexualentwicklung ist intraindividuell höchst divergent, daher können entwicklungsbedingte Altersangaben allenfalls als Richtwert verstanden werden.
2.1 Sexualentwicklung im ersten Lebensjahr
Der Mensch zählt zur Gattung der Säugetiere und ist, aus biologischer Perspektive betrachtet, ein zum Geburtszeitpunkt als schlecht angepasstes, gar hilfloses Wesen zu bezeichnen, da er alleine nicht in der ihm potenziell feindlichen Umgebung aufwachsen könnte. Der Umstand, dass sich der Mensch im Laufe der Evolution an seine Umwelt angepasst hast, verändert zwar die Überlebenschancen von Säuglingen ungemein, dennoch bleibt die Schutzlosigkeit des Menschenkindes erhalten.
Das Säugen prägt das erste Lebensjahr nachhaltig, da i. d. R. über die Mutterbrust Nahrung durch den Säugling aufgenommen wird, daher wird der Mund zum zentralen Erkundungsorgan. Sigmund Freud bezeichnet diese Phase als orale Phase (Freud 2010), in der sinnliche Erfahrungen essenziell für das Kind sind. Löbner bezeichnet den Mund daher als Lust- und Erkundungsorgan (Löbner 1998). Mit dem Säugevorgang wird in der Regel ein enges Band zwischen Säugendem und Gesäugtem geknüpft. Dabei ist nicht zwingend notwendig, dass das Kind gestillt wird. Auch das Fläschchengeben, begleitet von innigem Körperkontakt, hat diesen Effekt. Die lange Zeit vorherrschende Annahme, dass sich dieses Bindungsverhalten ausschließlich zwischen der Mutter und dem Kind entwickeln kann, ist daher schlicht falsch.
Freud und Erikson formulierten, dass sich in dieser Phase auch ein „Urvertrauen“ beim Kind entwickelt, sofern die Sorgepersonen angemessen auf dessen Bedürfnisse eingehen können. Urvertrauen kann besonders dann entstehen, wenn der körperlich-emotionalen Zuwendung, wie bspw. durch Streicheln beim Wickeln oder durch Liebkosungen im täglichen Miteinander, viel Raum und Zeit gegeben wird. Mertens merkt dazu an: „Im Falle eines glücklichen Dialogs führt dies zu der Erfahrung von Urvertrauen und bei Erwachsenen zu einem Harmonieren der Körper, einer großen sinnlichen Freude in allen Arten des gegenseitigen Streichelns, Schaukelns und Wiegens und im psychischen Sinn zu einem Sich-aufgehoben-Fühlen in der Erziehung“ (Mertens 1997, 57).
Dieser intensive Bindungsaufbau zwischen den Bezugspersonen und dem Kleinkind ist auch deshalb essenziell, weil Kinder sich ab dem Ende des ersten Lebensjahres bereits eigenständig fortbewegen können. Je sicherer sie gebunden sind, desto freudiger und offener können sie sich auf Exploration begeben. Mit diesem erweiterten Bewegungsradius haben die Kinder dann auch die Chance, sich weitere Interaktionspartner freier selbst auszusuchen. Diese neu gewonnene Freiheit geht auch mit wiederkehrenden Kontakt- und Trennungssituationen einher. Die Kinder entwickeln eine innerpsychische Balance zwischen Festhalten und Loslassen und lernen, zwischen sich selbst und anderen zu unterscheiden (Löbner 1998).
Da es sich auch bei der oralen Phase um ein sexuelles Skript handelt, kann davon ausgegangen werden, dass die Lust am Oralen ein Leben lang fortbesteht. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass gutes Essen als lustvoll empfunden werden kann, dass Küssen in der westlichen Welt als Symbol der Zuwendung gedeutet wird oder dass Oralsex als lustvolle Form der Sexualität erlebt werden kann (Lache 2016).
!
Der Umstand, dass der Mensch zur Gattung der Säugetiere zählt und dass er trotz relativ langer Austragezeit nach der Geburt schlecht an eine „feindliche“ Umwelt angepasst ist, führt dazu, dass er von Geburt an auf die Zuwendung und Versorgung Dritter angewiesen ist. Da das Säugen über den Mund erfolgt, wird diese Zone von Beginn an als lustvoll erlebt. Dieser Umstand wird als sexuelles Skript ein Leben lang erweitert.
2.2 Sexuelle Entwicklung im zweiten Lebensjahr
Nachdem mit Ende des ersten Lebensjahres sowohl die Entwicklung des Urvertrauens als auch erste Explorationsversuche erfolgreich verlaufen konnten, wird im zweiten Lebensjahr der Fokus verstärkt egozentristisch, und der junge Mensch wendet sich verstärkt der Erkundung eigener Genitalien zu. Freud bezeichnet diese Phase als phallische Phase, die er aber zeitlich im vierten Lebensjahr verortet (Freud 2010).
Innerhalb der Literatur besteht keine Einheitlichkeit bezüglich der jeweiligen Alterszuordnung. Freud (2010) ordnet die phallische Phase nach der analen Phase ein, andere Autoren (z. B. Mertens 1997) beobachten jedoch das Auftreten der phallischen Phase noch vor der analen Phase (s. Kap. 2.3).
Kinder sind nun häufig dabei zu beobachten, dass sie ihre Hände an den Genitalien haben. Schuhrke bezeichnet diesen Umstand als „Körperentdeckung“ und betont die Wichtigkeit dieser Phase „[…] schon deshalb, weil hier notwendige Informationen über den Körper erstmals aufgenommen und organisiert werden“ (Schuhrke 1997). Dabei ist das Interesse nicht ausschließlich auf das eigene Geschlecht gerichtet, auch das Geschlecht naher Bezugspersonen fasziniert Kinder in dieser Altersgruppe sehr. Dies lässt sich auch daran ableiten, dass Kinder – sofern ihnen diese Möglichkeit eröffnet wird – nun nahe Bezugspersonen intensiv beobachten, wenn sie nackt sind (Schuhrke 1994). Auch das Verständnis, einem der beiden Geschlechter zuzugehören, wächst in dieser Phase. Die Kinder zeigen nun auch verbal häufiger an, zu welchem (zumeist binären) Geschlecht sie sich zuordnen. Hierbei existiert ein Forschungsdesiderat hinsichtlich des Verhaltens derjenigen Kinder, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen.
!
Im zweiten Lebensjahr werden die basalen Grundlagen der Geschlechtsidentität gelegt. Dies geht vorrangig mit der Neugierde auf das eigene bzw. fremde Geschlecht einher.
2.3 Sexuelle Entwicklung im dritten Lebensjahr
Mit dem dritten Lebensjahr verändern sich grundlegende Sozialbeziehungen aus Perspektive des Kindes. Die meisten Kinder besuchen nun elementarpäd-agogische Einrichtungen und kommen so mit vielen anderen Kindern in Kontakt. Damit nimmt automatisch die Selbstständigkeit des Kindes zu. Diese entwickelt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem sicheren Bezugspunkt der Sorgeberechtigten und dem Aufbau neuer Sozialbeziehungen mit bis dato fremden Menschen (Erzieher_innen und anderen Kindern). Loslassen und Einbehalten ist auch das zentrale sexuelle Thema dieses Lebensabschnitts, den Freud als anale Phase bezeichnet (Freud 2010). Löbner verweist darauf, dass in dieser Lebensphase Kinder und Sorgeberechtigte vor allem mit der Sauberkeitserziehung befasst sind (Löbner 1998).
Anatomisch wird es dem Kind um das dritte Lebensjahr herum erstmals möglich, seinen Schließmuskel bewusst zu kontrollieren. Ausscheidungsvorgänge werden als lustvoll erlebt und regelrecht zelebriert. Das Ausscheiden fördert ein Bewusstsein der Selbstwirksamkeit. Kinder können nun auch dabei beobachtet werden, wie sie mit dem ausgeschiedenen Kot spielen. Aus hygienischen Gründen ist dies zu unterbinden, stattdessen kann Knete und Ton bzw. Sand und Matsch angeboten werden. Diese alternativen Angebote sind essenziell notwendig, damit Kinder einen „Ersatz“ für ihren Trieb bekommen.
Im sprachlichen Bereich ist das Kind nun in der Lage, seine Bedürfnisse zu sehr deutlich zu äußern. Die „Ich-Phase“ (Phase der Willensbildung) ist nun klar erkennbar, Kinder diesen Alters neigen nun auch dazu, ihren Willen nachhaltig durchsetzen zu wollen.
Dabei ist es ein erzieherischer Spagat, einerseits die Interessen des Kindes zu wahren und andererseits auch Grenzen zu setzen. Die Phase der Willensbildung ist auch deshalb dringend zu unterstützen, weil sie eine der wenigen Möglichkeiten darstellt, Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Wenn Kinder die Erfahrung machen, dass sie mit ihrem „Nein“ Dinge, die ihnen missfallen, abwenden können, versetzt sie dies in die Lage, eigene Grenzen zu ziehen. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Kinder sprachlich dazu befähigt werden, ihre Körperregionen und eventuelle sexuelle Handlungen angemessen zu benennen. Nur dann können sie auch über Erfahrungen von sexueller Übergriffigkeit sprechen und sich Hilfe suchen. Elementarpädagogische Fachkräfte müssen daher auch sexuelle Begriffe angemessen verwenden, damit die Kinder in die Lage versetzt werden, sich dieser Begriffe zu bedienen (s. Kap. 9.7).
!
Etwa ab dem dritten Lebensjahr wird es dem Kind möglich, den Schließmuskel aktiv zu beherrschen. Ausscheidungsvorgänge werden zumeist als lustvoll erlebt und zelebriert. Die Ausscheidungskontrolle wird als Selbstwirksamkeitsmoment erlebt. Die sprachliche Entwicklung ist so weit vorangeschritten, dass Grenzen klar verbalisiert werden können.
2.4 Sexuelle Entwicklungen im vierten Lebensjahr
Mit der Aufnahme des Kindes in elementarpädagogische Einrichtungen werden Regeln zunehmend bedeutender, und es setzt nach und nach eine natürliche „Körperscham“ ein. Dies ist nicht gleichzusetzen mit einem nachlassenden Interesse am Geschlechtlichen, sondern bedeutet lediglich, dass nun nicht mehr unbefangen die eigenen Geschlechtsteile thematisiert werden. In diesem Stadium können erstmalig Liebesbekundungen von den Kindern formuliert werden, zumeist gegenüber dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Deutlich wird dies immer dann, wenn bspw. der gleichgeschlechtliche Elternteil durch die Kinder abgewertet wird: „Das ist meine Mama, die heirate ich auch mal, geh weg Papa, du bist doof“. Solcherlei Sätze prägen nun durchaus den Erziehungsalltag.
Da Kinder im Regelfall ausschließlich heterosexuelle Paare zum Vorbild haben, ist es wenig verwunderlich, dass auch die Paarungsmuster der Jüngsten schon relativ heteronormativ geprägt sind (Milhoffer 1998). Dieser Umstand wird auch stark durch eine heteronormative Gesellschaft befördert, in der besonders Mütter geschlechtstypisches Verhalten von Mädchen belohnen, Väter jenes von Jungen, und gleichzeitig geschlechtsuntypisches Verhalten sanktioniert wird (Langlois / Downs 1980). Mittlerweile gibt es auch Bestrebungen zur geschlechtsneutralen bzw. geschlechtssensiblen Erziehung. Gerade in jüngerer Zeit ist allerdings ein Rollback bezüglich Geschlechtsstereotypisierung zu beobachten. Dies wird besonders durch die Spielzeugindustrie (Gendermarketing) befeuert, indem hier ein klares Mädchen-versus-Junge-Schema aufgebaut wird (https://pinkstinks.de / ). Es zeigt sich auch in klaren Farbzuweisungen in der Modeindustrie (Kuhl 2010).
Das kindliche Spielverhalten erweitert sich um Rollenspiele, in denen Kinder ihre erlebten Alltagssituationen verarbeiten und gleichzeitig auch mit Geschlechterrollen spielen. Das Interesse am Gegenüber ist zwar nun etwas schambehafteter, aber auf den Kindertoiletten oder in Kuschelecken werden Geschlechtsteile nun dennoch intensiv erforscht und verglichen. In diesem Alter sind Kinder meist noch mehr am Erkunden oder aber am Verbergen ihrer Geschlechts- und Ausscheidungsvorgänge interessiert (Schuhrke 1997).
!
Im vierten Lebensjahr wird das Spannungsverhältnis zwischen Körpererkundung und Körperschamentwicklung erprobt. Sozial erlebte Situationen werden nun in Rollenspielen verarbeitet, wobei hier auch Geschlechtsrollen spielerisch erlernt werden. Dabei wird Geschlechtsrollenkonformes durch die Peers, oft aber auch durch erwachsene Bezugspersonen belohnt und Geschlechtsuntypisches sanktioniert.
2.5 Sexuelle Entwicklung im fünften Lebensjahr
Mit zunehmendem Wortschatz werden auch die kindlichen Rollenspiele ausdifferenzierter. So finden neben dem klassischen „Vater-Mutter-Kind-Spiel“ erste „Hochzeitspiele“ statt. Erste „Liebesbeziehungen“ werden geknüpft. Sie sind in aller Regel von kurzer Dauer, aber etwaige Trennungen oder Zerwürfnisse werden durch die Kinder als sehr schmerzhaft erlebt. Darüber hinaus finden nun auch „Doktorspiele“ statt. Mit diesen spezifischen Rollenspielen verarbeiten Kinder auch erste Erfahrungen der U-Untersuchungen beim Arzt. Darüber hinaus erlaubt ihnen dieses Spiel, andere Kinder am ganzen Körper zu erkunden (Löbner 1998).
!
Im fünften Lebensjahr werden die Rollenspiele als Verarbeitungsmoment noch differenzierter genutzt, wobei bspw. Alltagshandlungen wie Arztbesuche aktiv nachgestellt und reflektiert werden. Dabei stellen die Doktorspiele vor allem eine legitime Möglichkeit dar, sich und das Gegenüber zu untersuchen und körperlich zu erkunden. Auch die hinter Arztbesuchen stehenden Machtgefälle zwischen Arzt / Ärztin und Patient_in werden dadurch verarbeitet.
2.6 Sexuelle Entwicklung im sechsten Lebensjahr
Im sechsten Lebensjahr verändert sich die Beziehungsgestaltung zwischen Jungen und Mädchen nachhaltig. Kurz vor dem Übertritt in die Grundschule werden aus bisherigen Spielkamerad_innen Kontrahent_innen. Zusammenfassend kann dies auf die Formel gebracht werden: „Jungs sind doof und Mädchen zickig“. Zentral für diese Lebensphase ist der Rückbezug auf die jeweiligen Geschlechtsgenoss_innen. In dieser Phase sind die Kinder sehr stark darauf bedacht, scheinbar klare Rollenbilder zu erfüllen. Ein scheinbares Nichterfüllen der Geschlechtsrolle wird durch die Gruppe der Gleichaltrigen stark sanktioniert. Aussagen wie „Du verhältst dich wie ein Mädchen“ werden von Jungen als sehr verletzend erlebt – und umgekehrt.
Mädchen neigen nun besonders dazu, scheinbar mädchenhaft zu sein, besonders die Farbe Rosa und sehr weiblich wirkende Comicfiguren stehen hoch im Kurs. Das Bedürfnis der Jungen wie Mädchen ist stark darauf fokussiert, zu ihrer jeweiligen Geschlechtergruppe dazuzugehören und als gleichgeschlechtliches Subjekt gelesen und anerkannt zu werden: „[…] die Kinder [suchen] jeweils die Selbstvergewisserung als Mädchen bzw. Junge […] das ausschließliche Zusammensein mit ihresgleichen dient der Identitätssicherung“ (Philipps 2000, 32). Auch hier besteht weiterer Forschungsbedarf, da gegenwärtig noch nicht geklärt ist, welche Entwicklung Trans-Kinder in dieser Hinsicht durchlaufen.
2.7 Sexuelle Entwicklung vom siebten Lebensjahr bis zur Pubertät
Die Latenzphase, wie die Phase zwischen dem siebten Lebensjahr und dem Beginn der Pubertät in der Psychoanalyse bezeichnet wird (Freud 2010), kann auch als „Ruhe vor dem Sturm“ begriffen werden. Die Kinder haben zentrale sexuelle Skripte angelegt und verschiedene gleich- und gegengeschlechtliche Erfahrungen sammeln können. Sie wissen um gesellschaftliche Erwartungen an Jungen und Mädchen und haben ggf. erlebt, was es bedeutet, wenn den Erwartungen nicht entsprochen wird. Auch die sichere geschlechtliche Rollenzuordnung in ein binäres Geschlechtersystem gelingt ihnen. Hier machen Trans-Kinder (s. Kap. 4.5) immer wieder Ausschlusserfahrungen, über deren Folgen bislang nur wenig Forschung vorliegt. Besonders hervorstechend ist ein Umstand, den Mertens wie folgt beschreibt: „Die Sexualisierung der Beziehung, wie sie bei vier- bis fünfjährigen Kindern anzutreffen ist, verringert sich deutlich, und zärtliche Impulse gewinnen die Oberhand“ (Mertens 1997, 117).
Die Latenzphase wird durch die Kinder vorrangig dazu genutzt, weitere Erfahrungen in Bezug auf ihre Geschlechtsrolle zu sammeln. Dabei unterscheiden sich die Geschlechter insofern, als das Mädchen verstärkt nach Anerkennung bei den Erwachsenen suchen, Jungen hingegen stärker die Anerkennung der Peers benötigen (Milhoffer 1998). Allerdings gilt es hier kritisch anzumerken, dass die gegenwärtige Literaturlage fast ausschließlich heteronormative Erklärungsmuster bietet und bisherige Untersuchungen ausschließlich auf Jungen / Mädchen abzielen. Die Kategorie „divers“ findet bislang in Bezug auf die kindliche Sexualentwicklung noch keine Berücksichtigung innerhalb der sexualwissenschaftlichen Forschungsliteratur.
Das zuvor negative Verhältnis zum anderen Geschlecht verbessert sich in dieser Phase zusehends. „Die Kinder spüren, dass körperlich-sexuelle Nähe sehr lustvoll sein kann […]. Andererseits ist ihnen diese Form von Nähe und Beziehung auch noch fremd und unheimlich“ (Gnielka 2012, 19). Demnach sind auch Annährungsversuche zwischen Jungen und Mädchen stark durch spielerische Elemente gekennzeichnet. Der Klassiker des Briefchenschreibens mit der Auswahl „Willst du mit mir gehen – kreuze an“ existiert bis in die Gegenwart hinein.
Das noch unheimliche Fremde bleibt in der Regel bis zur Mitte der Pubertät erhalten. Dessen ungeachtet beginnen die Kinder nun verstärkt, sich selbst zu befriedigen. Dabei wird die Selbstbefriedigung zumeist aus Schamgefühl verheimlicht, wobei engere Beziehungen zu gleichgeschlechtlichen Peers durchaus genutzt werden, um gemeinsam Selbstbefriedigung zu betreiben. „Auffällig ist, dass Selbstbefriedigung für Jungen und Männer eine viel selbstverständlichere Angelegenheit ist als für Mädchen und Frauen“ (Gnielka 2012, 29).
Die Latenzphase ist für Jungen häufig problematischer als für Mädchen. Da der gesamte Elementar- und Grundschulbereich von Frauen dominiert wird, ist ein Junge in einer „permanenten Beweispflicht seiner Männlichkeit, vor allem in der männlichen Peer Group“ (Milhoffer 1998, 97). Dies lässt sich gut auf Schulhöfen beobachten, wenn besonders Jungen sich körperlich bspw. im Ringen und Raufen erproben und so auch innerhalb ihrer Peergroup ihre Gruppenstellung symbolisch demonstrieren.
Mädchen hingegen benötigen zumeist etwas mehr Zeit, bis sie beginnen, ihren eigenen Körper zu erkunden. Dies liegt zum einen an gesellschaftlichen Zuschreibungsprozessen, die weibliche Sexualität immer noch stärker negieren als männliche Sexualität. Zum anderen scheint das Nicht-sehen-können der eigenen Genitalien die Entwicklung eines Bewusstseins für die eigene Vagina zu erschweren.
Die zunehmende kognitive Reife führt letztlich dazu, dass Kinder nach und nach komplexere Sozialbeziehungen (wie erste Paarbeziehungen) eingehen können.
„Erst im Laufe der Grundschulzeit können sie verstehen, dass ein Kind nicht deshalb entsteht, weil Mama und Papa sich lieb haben oder verheiratet sind, sondern weil nach dem Geschlechtsverkehr im Körper der Mutter eine Befruchtung von Samen und Eizelle stattfindet“ (Gnielka 2012, 25).
Dass Sexualität einen Lustaspekt beinhaltet (s. Kap. 2.1), können Kinder diesen Alters nun auch kognitiv nachvollziehen. Viele Erwachsene haben dennoch Probleme, diesen Aspekt der Sexualität mit Kindern zu besprechen – häufig aus Sorge, die Kinder damit zu überfordern. Aus kindlicher Perspektive ist diese Sorge eher unbegründet, da Kinder entwicklungsbedingt ohnehin vor allem jene Fragen stellen, deren Antworten sie in ihren nächsten Entwicklungsschritten benötigen. Voraussetzung dafür ist die Sicherheit, dass Fragen erlaubt sind und gewürdigt werden.
!
Die Latenzphase kann als ‚Ruhe vor dem Sturm‘ verstanden werden und ist eine Art Vorpubertät, in der die sichtbare Sexualität merklich rückläufig ist. Sexuelle Erfahrungen zwischen den Kindern finden dennoch statt, nun aber heimlich aufgrund des entwickelten Schamgefühls. Die Beziehungen zum anderen Geschlecht entspannen sich, und erste Annährungsversuche sind sichtbar, aber noch mit starken Unsicherheiten und Ängsten besetzt. Selbstbefriedigung ist gerade bei den Jungen weit verbreitet.
2.8 Pubertät
Das Heranreifen des Menschen ist auch mit der immer weiter fortschreitenden Sozialisation in der jeweiligen Gesellschaft verknüpft. Die Erwartungen an ein Individuum steigen auch mit den Lebensjahren. Gerade hier ist in modernen Industriestaaten zu sehen, dass zentrale Entwicklungsaufgaben mitten in die Pubertät gelegt sind. Diese Erkenntnis wurde bereits 1972 durch den Psychologen Havinghurst zusammengestellt und von Dreher und Dreher (1985) zusammengefasst:
■Aufbau und Erhalt reiferer Beziehungen zu allen Geschlechtern
■An- und Übernahme der Geschlechtsrolle
■Veränderungen des eigenen Körpers akzeptieren
■Loslösung aus emotionalen Abhängigkeiten zu engen Bezugspersonen zugunsten gleichwertiger Beziehungen
■Vorbereitung auf sozial erwünschte Lebensentwürfe, wie Ehe und Familienleben
■(Weiter-)Entwicklung der beruflichen Zukunft und Karriere
■Sozialverhalten und sozial verantwortliches Handeln ausbauen
Zum Ausbau des Sozialverhaltens gehört auch die moralische Entwicklung, die stark an kognitive Entwicklungen gekoppelt ist. Je älter und erfahrener ein Mensch ist, umso mehr wird er in die Lage versetzt, soziale Situationen differenzierter erleben und bewerten zu können, wenngleich die Bewertung sozialer Aspekte individuell bleibt (Dreher / Dreher 1985.)
Fend fasste die obigen Erkenntnisse zusammen und erweiterte ihren handlungsorientierten Ansatz. Fend geht davon aus, dass Jugendliche in eine Gesellschaft eingebettet sind, diese aber auch beeinflussen können. Somit ist die sexuelle Entwicklung des Jugendalters durch ein reziprokes Moment zwischen dem / der Jugendlichen und der Gesellschaft gekennzeichnet. Daraus leitet Fend zwei Aspekte bzw. Entwicklungsaufgaben ab (Fend 2003):
■den Körper bewohnen lernen
■den Umgang mit Sexualität lernen
Den Körper bewohnen lernen
Hierunter beschreibt Fend vor allem Sozialaspekte wie Werbung, gesellschaftlich anerkannte und vorgegebene Körperideale und Kleidernormierungen. Andere als die binären geschlechtlichen Erscheinungsformen werden tendenziell eher dethematisiert. Zwar bringt die Modeindustrie mit Serien wie „Germany´s next Topmodel“ durchaus auch Trans-Vorstellungen in den Mainstream, aber auch hier stehen stereotype Schönheitsideale wie Schlankheit, Nicht-behindert-Sein usw. im Vordergrund.
Die wenigsten Jugendlichen und auch Erwachsenen können diesen (häufig durch Bildbearbeitung optimierten) Idealen standhalten. Die pubertären Veränderungen erschweren es den Jugendlichen zusätzlich, sich komplett anzunehmen (Pommer / Linke 2017).





























