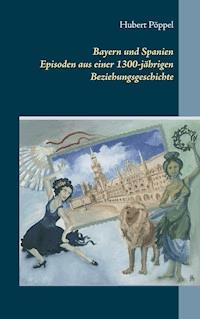
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von den Agilolfingern bis heute spannt sich die Geschichte der Begegnungen zwischen Bayern und Spaniern. Kaiser und Könige wie Karl der Große, Karl V. und Ludwig I. haben daran mitgewirkt, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Doch sie und die große Politik bilden nur den Hintergrund. Im Mittelpunkt des Bandes Bayern und Spanien stehen die Geschichten der Menschen, die die Geschichte der bayerisch-spanischen Beziehungen geschrieben haben. Dabei kommen viele kuriose, ja skurrile Begebenheiten, einige traurige, aber auch einige wahrhaft unterhaltsame und spannende Episoden aus 1300 Jahren ans Licht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Die
Lex Baiuvariorum
:
Bayern und Westgoten im Frühmittelalter
Der spanische Adoptianismus auf der Regensburger Reichssynode Karls des Großen
St. Afra und Sant Narcís:
eine mittelalterliche Heiligenpartnerschaft zwischen Augsburg und Girona
Santiago – St. Jakob in Bamberg:
Geschichten um den niederträchtigen Bischof Hermann, drei irische Mönche und eine Fegefeuervision
Bayerische Herzöge auf dem sizilianischen Königsthron:
eine gescheiterte Bewerbung in Barcelona
Reiseberichte des Spätmittelalters:
ein Spanier in Nürnberg, Nürnberger in Spanien
Bayerische Konquistadoren in Hispanoamerika:
Ulrich Schmidl und Philipp von Hutten
Danubio, río divino
:
der spanische Dichterfürst Garcilaso de la Vega auf der Donauinsel
Barbara Blomberg:
Geliebte des Kaisers, Heldenmutter und eigensinnige Frau unter spanischer Aufsicht
Bayern und Spanien im Dreißigjährigen Krieg:
das Tagebuch des Abtes von Andechs und die seltsame Kampfschrift eines spanischen Gesandten
Eine kurze und tragische Episode:
Prinz Joseph Ferdinand von Bayern, designierter König Spaniens
Johann Kaspar von Thürriegel:
die deutschen Kolonien in Südspanien
König Ludwig I. und die spanische Sprache:
der Briefwechsel mit Lola Montez und das Theaterstück
Recept gegen Schwiegermütter
Das Wirken der Infantin María de la Paz in Bayern und die ersten Autofahrten nach Spanien
Adalbert von Bayern:
erster Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Spanien
Spanien auf dem Weg nach Europa:
das Techtelmechtel der spanischen Opposition in München
Die spanische Arbeitsmigration in Bayern:
die Rolle des Bayerischen Rundfunks und eine Auswandererkomödie
Zum Abschluss:
ein katalanischer Dichterwettbewerb in Bayern
Bayern und Spanien:
Nachwort
Vorwort
Wie gelangte vor 1300 Jahren ein westgotisches Gesetzbuch aus dem fernen Spanien nach Regensburg? Was hat der angeblich niederträchtige Bamberger Bischof Hermann mit den Anfängen des Jakobswegs in Bayern zu tun? Warum scheiterte der bayerische Herzog Stephan III. so jämmerlich in Katalonien, als er versuchte, seinem Sohn den sizilianischen Königsthron zu verschaffen?
Was brachte König Ludwig I. dazu, mit Lola Montez eine mehrhundertseitige Korrespondenz auf Spanisch zu führen, wo doch beide dieser Sprache kaum mächtig waren? Warum trugen 1946 spanische Anarchisten den Sarg der Infantin María de la Paz in die Grablege der Wittelsbacher? Wie kam es, dass ausgerechnet München in den 1960er Jahren zum Tummelplatz für die spanische Opposition wurde?
Der vorliegende Band geht solchen und ähnlichen Fragen auf den Grund. Er bringt dabei viele spannende und ein paar skurrile, einige traurige, aber auch etliche wahrlich unterhaltsame Episoden aus der 1300-jährigen Geschichte der Begegnungen zwischen Bayern und Spaniern ans Licht.
Aus beinahe jeder Epoche gibt es dabei etwas zu erzählen, auch wenn es natürlich Zeiten gab, in denen sich die Kontakte häuften, und solche, in denen die Verbindungen schwächer ausgeprägt waren.
Die große Politik spielt fast immer eine Rolle, aber sie bildet meist nur den Hintergrund. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Menschen, die über ihre Initiativen und ihr Engagemement, aber auch mit ihrem Scheitern die lange bayerisch-spanische Beziehungsgeschichte geschrieben haben.
Die Lex Baiuvariorum:
Bayern und Westgoten im Frühmittelalter
Wie ein spannendes historisches Rätsel präsentiert sich die erste kulturgeschichtlich bedeutsame Verbindung zwischen dem frühmittelalterlichen Bayern und der Iberischen Halbinsel: die ausgiebige Nutzung des westgotischen Codex Euricianus als Vorlage bei der Abfassung des ältesten schriftlich fixierten bayerischen Gesetzbuches.
Seit weit über einem Jahrhundert streiten Rechtsgelehrte und Historiker nun schon darüber, wo und wann die Lex Baiuvariorum entstanden sein könnte, wer sie in Auftrag gegeben, wer sie verfasst hat und wie die Quellen, die auf Südfrankreich und Spanien verweisen, nach Bayern gekommen sind. Eine einvernehmliche Lösung für die vielfältigen Probleme, soviel sei vorausgeschickt, haben die Forscher bislang nicht gefunden. Allerdings zeichnen die entsprechenden Hypothesen und durchaus kreativen Vorschläge ein buntes Bild von den internationalen Kulturkontakten zwischen dem 6. und dem 8. Jahrhundert.
Die Entstehung der Lex Baiuvariorum
Die Lex Baiuvariorum, das Gesetzbuch der Bayern aus der Zeit der Agilolfinger, gilt allgemein als gelungenes und qualitativ hochstehendes Stammesrecht aus dem frühen Mittelalter. In mehr als 20 Kapitel unterteilt, umfasst die Sammlung über 250 Bestimmungen zu kirchlichen Angelegenheiten, zum Herzog und den führenden Adelsgeschlechtern in Bayern, zu Freien, Freigelassenen, Sklaven und Frauen, zum Straf-, Ehe-, Zivil- und Vertragsrecht.
Generell sprechen die Kommentatoren von einer klaren Tendenz zur Praxisnähe. Gefördert wird sie durch entsprechende Begründungen und durch die immer wieder eingefügten volkssprachlich-bairischen Begrifflichkeiten für einzelne Tatbestände innerhalb des lateinischen Textes. Ein Grund dafür, dass ein stimmiges Werk geschaffen werden konnte, liegt darin, dass sich die Redaktoren auf bereits schriftlich fixierte Texte stützten. Sie wählten daraus klug aus und gelangten auf diese Weise zu einer in sich geschlossenen Rechtsordnung.
Ein für die Lex Baiuvariorum zentraler Vorläufertext war nun ohne Zweifel ein westgotisches Gesetzbuch: der Codex Euricianus. König Eurich (ca. 440-484) hatte ihn Ende des 5. Jahrhunderts in Auftrag gegeben, als die Westgoten von ihrem Machtzentrum in Südfrankreich zur Eroberung der Iberischen Halbinsel und damit zur Verdrängung von Sueben, Vandalen und Alanen angesetzt hatten. Aber noch eine zweite Spur führt vom Gesetzbuch der agilolfischen Bayern nach Spanien. Der Prolog zitiert nämlich im rechtshistorischen und rechtsphilosophischen Teil ausführlich aus den Etymologiae, dem Hauptwerk des westgotischen Bischofs Isidor von Sevilla (ca. 560-636), in dem dieser versucht hatte, das gesamte Wissen seiner Zeit zusammenzufassen.
Es liegt also zunächst nahe, für die Frage nach der Abfassung der Lex Baiuvariorum an die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts zu denken. Unterstützt wird dieser Ansatz durch die weiteren Ausführungen des Vorworts. Dort heißt es nämlich, dass der merowingisch-fränkische König Theuderich I. (448-533) befohlen habe, für die Franken, Alemannen und Bayern ihr jeweiliges Recht aufzuzeichnen und von heidnischen Einflüssen zu reinigen. Seine Nachfolger Childebert I. und Chlothar II. hätten diese Arbeit fortgeführt. König Dagobert I. (ca. 608-639) schließlich habe vier erlauchte Männer damit beauftragt, diese Stammesgesetze noch einmal zu überarbeiten und in die Fassung zu bringen, die bis auf den heutigen Tag in Geltung sei.
Allerdings schweigt sich der Prolog darüber aus, wann der „heutige Tag“ anzusetzen sei, wann das Gesetzeswerk also endgültig schriftlich fixiert wurde. Im Einführungssatz zu den Bestimmungen heißt es dann noch, dass jenes Stammesrecht vor dem König, den Vornehmen und dem Volk im Reich der Merowinger beschlossen worden sei. Zumindest auf den ersten Blick ergibt sich aus all diesen Hinweisen eine deutliche Tendenz, das bayerische Gesetz auf eine Initiative des fränkischen Königs zurückzuführen.
Doch hier nun beginnen die Auseinandersetzungen unter den Forschern: Eine Fraktion bewertet den Prolog als reine Erfindung. Er sei als Versuch des 8. Jahrhunderts zu lesen, das Gesetzbuch zurückzudatieren, um ihm dadurch ein höheres historisches Gewicht zu verleihen oder um ihm eine bestimmte politische Ausrichtung zu geben. Als Entstehungszeit der Lex Baiuvariorum werden daher die 740er Jahre unter Herzog Odilo vorgeschlagen.
Eine zweite Fraktion plädiert hingegen für einen stufenweisen Prozess in der Abfassung des uns überlieferten Textes. Die Ausarbeitung hätte mit einem nicht überlieferten fränkischen Königsgesetz Dagoberts begonnen und dann über mehrere Redaktionen das endgültige bayerische Gesetzeswerk des 8. Jahrhunderts hervorgebracht.
Und natürlich gibt es noch eine dritte Fraktion, die für eine im Wesentlichen einheitliche Niederschrift bereits in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts plädiert, mit nur noch kleineren Abänderungen, Hinzufügungen und Aktualisierungen in späterer Zeit.
Für unsere Betrachtung der bayerisch-westgotischen bzw. bayerisch-spanischen Beziehungen ist diese weithin offene Debatte allerdings von eher untergeordneter Bedeutung. Wichtiger erscheinen die beiden Fragen, warum die Redaktoren ausgerechnet auf westgotische Quellen zurückgegriffen haben und, vor allem, wie diese Texte aus der fernen Iberischen Halbinsel in ihren Besitz gelangt sind.
Das Warum lässt sich dabei am ehesten mit der Tendenz der Lex Baiuvariorum zum Pragmatismus erklären. Die Verfasser brauchten für ihre Arbeit eine möglichst systematisch geordnete und umfangreiche Vorlage, um daraus in kreativer Anpassung einen anwenderfreundlichen Text zu erstellen. Beide Anforderungen erfüllte der Codex Euricianus voll und ganz.
Die geographische Distanz zum Urtext war dabei eventuell sogar von Vorteil, ließen sich doch gerade dadurch situationsbedingte Bestimmungen wie jene zum Verhältnis von Goten und Romanen problemlos streichen. Andere Artikel hingegen konnten ohne Rücksicht auf Regelungen benachbarter Stämme abgewandelt werden. Das Ziel des bajuwarischen Gesetzbuches, das Gewohnheitsrecht zum Nutzen der öffentlichen Ordnung, des Friedens und der Rechtssicherheit mit der Vernunft zu versöhnen, konnte auf diese Weise vielleicht besser erreicht werden als durch eine zu starke Anlehnung an näherstehende Rechtsauffassungen. Obwohl es natürlich auch zur Lex Alemannorum aus dem ersten Drittel des 8. Jahrhunderts Verbindungen gibt, vermutlich über gemeinsame Quellen.
Schließlich, als ebenfalls mögliche Erklärung für den Rückgriff auf den westgotischen Text, hatten die Redaktoren vielleicht gar keine große Auswahl an Vorlagen, so dass sie das nehmen mussten, was sie in den noch dünn bestückten Bibliotheken in Bayern fanden oder selbst dorthin mitbrachten.
Dies führt uns dann weiter zu der zweiten zentralen Frage, auf welchen Wegen denn im 7. oder im 8. Jahrhundert ein westgotisches Gesetzbuch aus der Zeit vor 500 nach Bayern gelangt sein mag.
Erschwerend kommt bei dieser Frage hinzu, dass der Codex Euricianus schon lange vor der Abfassung seines bayerischen Pendants außer Gebrauch war. Auf der Iberischen Halbinsel wurde er nämlich bereits in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts zunächst revidiert und dann in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts unter König Reccesvinth durch die Lex Visigothorum ersetzt. Von diesem späteren westgotischen Gesetzeswerk scheint jedoch nichts in die Lex Baiuvariorum eingeflossen zu sein. Dort, wo beide Codices parallele Bestimmungen aufweisen, lässt sich dies weithin durch die Übernahme der gleichen Vorlage erklären.
Diese Beobachtung scheint zunächst wieder für eine Frühdatierung des bayerischen Gesetzbuches in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts zu sprechen. Dass dies jedoch ein voreiliger Schluss sein könnte, das zeigen die Forschungshypothesen, die über die verwickelten Wege der westgotischen Quellen Richtung Bayern aufgestellt wurden. Wir wollen uns auf einige wenige solcher Vorschläge beschränken.
Die Niederaltaich-Hypothese der von den Arabern vertriebenen Mönche
In seiner Ausgabe der Ingolstädter Handschrift der Lex Baiuvariorum von 1926 setzt Konrad Beyerle für seinen Argumentationsgang mit einer Charakterisierung der frühmittelalterlichen Bewohner Bayerns ein, die es wert ist, hier wörtlich angeführt zu werden:
Kaum erst christianisiert und von Äußerungen literarischen Lebens noch fast völlig frei, der Sprache Roms unkundig, in der ungeschriebenen Rechtsordnung des eigenen Volkstums sein Genügen findend, so etwa sah die geistige Physiognomie des Bayernstamms aus, als das fein ziselierte Gesetzeswerk in Bayern entstand.
Ob das so stimmt, und vor allem, ob das auf alle Stände zutrifft, sei dahingestellt. Als logische Schlussfolgerung aus dieser Bestandsaufnahme postuliert Bayerle jedenfalls, dass nur Kleriker für die schwierige Aufgabe der Kompilation und Redaktion infrage gekommen seien. Kirchenleute also, die zudem Erfahrung in Rechtsangelegenheiten hatten und ein bestimmtes Interesse verfolgten: nämlich zugleich mit der kirchlichen Autorität auch den fränkischen Einfluss auf Bayern zu befördern. Es könne sich daher nicht um Einheimische gehandelt haben, die Redaktoren müssen von außen gekommen sein.
Die entsprechende Kombination von Einflussfaktoren und Fachkenntnis sei erst mit der Gründung von Kloster Niederaltaich (731 oder 741) sowie mit der Entsendung von Mönchen aus dem Benediktinerkloster Reichenau dorthin gegeben gewesen. Die bayerischen Domklöster in Salzburg und Regensburg seien nicht in der Lage gewesen, eine solch komplexe Aufgabe in Angriff zu nehmen.
Mit dieser Behauptung ist aber die Frage noch nicht beantwortet, wie das westgotische Gesetzbuch nach Niederaltaich gelangte. Dazu muss Beyerle weiter ausholen und zunächst einmal die These aufstellen, dass der Gründer der Abtei Reichenau (724), der heilige Pirmin, nicht, wie bislang angenommen, aus Westfranken oder Irland stammte, sondern aus Spanien. Von dort sei er nach dem Einfall der Mauren im Jahr 711 zusammen mit anderen Ordensbrüdern ins Fränkische Reich geflohen und habe sich schließlich auf der Insel im Bodensee niedergelassen.
In seinem Gefolge hätte sich auch der spätere erste Abt von Niederaltaich, Eberswind, befunden. Für ihn nun schmiedet der Herausgeber der Ingolstädter Handschrift der Lex Baiuvariorum eine auf die Namensforschung aufbauende Beweiskette, die seine westgotische Abstammung belegen soll. Somit kann Beyerle ihm eine intime Kenntnis westgotischer Rechtslehre und die Vertrautheit mit dem Werk Isidors von Sevilla zuschreiben.
Die kurz hintereinander erfolgte Redaktion der Gesetze der Alemannen und Bayern könne kein Zufall sein, fährt er fort. Sie müsse auf die programmatische Initiative der Pirminsmönche zurückgehen, die beiden süddeutschen Herzogtümer durch entsprechende neue Rechtsordnungen enger an das Frankenreich anzuschließen. Die Reichenauer Mönche, insbesondere der Gründungsabt von Niederaltaich als eigentlicher Autor, hätten also die Idee für das Gesetzbuch, vielleicht sogar schon den Aufriss in seinen wesentlichen Zügen nach Bayern mitgebracht. In enger Abstimmung mit dem Herzog und den bayerischen Iudices, den mit der Rechtsprechung Beauftragten, hätten sie den Text vor Ort fertiggestellt.
Die Vorlage für die Lex Baiuvariorum, der Codex Euricianus, soll also gemäß der These Beyerles im Gepäck der spanischen Mönche zunächst nach Westfranken, dann auf die Reichenau und von dort aus in die niederbayerische Abtei gelangt sei. Dass es sich dabei um genau dieses alte Gesetzeswerk gehandelt habe und nicht um die jüngere Lex Visigothorum, sei Zufall. Auf ihrer überstürzten Flucht vor den Arabern hätten die Ordensleute nicht darauf achten können, welchen Codex sie einpackten und ob er noch Gültigkeit besaß. Für die Niederaltaicher Verfasser hingegen sei diese Frage nie relevant gewesen, da sie keine Implementierung geltenden westgotischen Rechts anstrebten. Sie hätten sich nur eines brauchbaren Modells für die Redaktion einer Rechtsordnung bedienen wollen, die ihren politischen und kirchlichen Interessen entsprach.
Soweit Konrad Beyerles Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte der Lex Baiuvariorum aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So schlüssig dieser Argumentationsgang auch klingt, so hat er neben der doch recht spekulativen Behauptung, Pirmin und seine Begleiter seien vor den Mauren aus Spanien geflohen, noch ein weiteres Problem. Er vermag nämlich nicht wirklich zu erklären, warum sich die Lex Alemannorum, die ja angeblich ebenfalls aus der Feder der Pirminsmönche stammt, nicht auch durch so umfangreiche Übernahmen aus westgotischen Vorlagen auszeichnet.
St. Emmeram als Abfassungsort?
Bevor wir zur zweiten großen Theorie über die möglichen Reisewege des Codex Euricianus nach Bayern kommen, sei eine Studie von Peter Landau dazwischengeschoben, die leider nur am Rande auf die Vermittler und die Vermittlungswege eingeht. Dafür interessiert sie sich umso mehr für den Ort, an dem das bayerische Gesetzbuch aufgeschrieben wurde. Für uns ist sie vor allem wichtig, weil sie behauptet, dass der Bezug nach Spanien noch stärker sei, als bislang angenommen.
Peter Landau stimmt in seinen Ausführungen grundsätzlich Beyerle zu, was die Abfassung des Textes Mitte des 8. Jahrhunderts unter Herzog Odilo angeht. Somit glaubt auch er, dass der Prolog die Entstehungszeit bewusst zurückdatiert. Allerdings weicht er in Hinblick auf die politische Grundtendenz der Lex Baiuvariorum von Beyerle ab. Er sieht in dem Text keinesfalls den Versuch, das Herzogtum mittels des Gesetzbuches stärker an die fränkischen Herrscher heranzuführen, sondern vermutet vielmehr eine herzoglich-bayerische Gesetzgebungsinitiative.
Mit der neueren Forschung geht Landau davon aus, dass für ein solch ambitioniertes Projekt ein ganzer Stab an rechtskundigen Redaktoren und erfahrenen Schreibern vonnöten war, die auf eine mehr oder weniger gut ausgestattete Bibliothek zurückgreifen konnten. Deshalb schließt er als Entstehungsort sowohl den merowingischen Königshof als auch den Herzogshof in Regensburg aus. Er plädiert stattdessen ebenfalls für einen kirchlichen Rahmen mit gelehrten Mönchen, die nach Bayern zugewandert seien. Dadurch ließen sich bestimmte Wendungen im Gesetzbuch erklären, wie etwa „jene Provinz“ statt „unsere“ oder „diese Provinz“.
Dass allerdings Kloster Niederaltaich als Neugründung ohne die Tradition einer Bibliothek und aktiver Schreibtätigkeit in der Lage gewesen sein soll, ein solches Vorhaben anzugehen, bezweifelt Landau. Deshalb kommentiert er Beyerles Theorie von der komplizierten Wanderungsgeschichte des Codex Euricianus aus dem arabisch besetzten Spanien über die Reichenau nach Bayern erst gar nicht. Nur drei Orte kommen seiner Meinung nach für die Abfassung der Lex Baiuvariorum in die engere Auswahl: Salzburg, Passau und Regensburg.
In Salzburg aber seien die nötigen Voraussetzungen erst ab den 740er Jahren, vermutlich sogar erst später gegeben gewesen. Gegen Freising, das vielleicht schon etwas früher mit einem Skriptorium und einer brauchbaren Bibliothek ausgestattet gewesen sein könnte, spreche vor allem die herzogsfreundliche Tendenz der Rechtsordnung. Deshalb verbleibe als wahrscheinlichster Entstehungsort nur Regensburg, und dort wiederum nur das Kloster St. Emmeram, dessen Anfänge bis um das Jahr 700 zurückreichen und das Ende des 10. Jahrhunderts eine der größten Büchersammlungen Europas vorzuweisen hatte.
Leider verzichtet Landau in seiner Begründung darauf, noch einmal speziell auf den Codex Euricianus einzugehen. Im Gegenzug erwähnt er jedoch zwei weitere Spuren, die nach Spanien führen und die wiederum von der übrigen Forschung kaum angesprochen werden. Um die Mitte des 8. Jahrhunderts sei eine Zusammenstellung kanonischen Rechts, die sogenannten Spanischen Epitome, nach Bayern gelangt. Möglicherweise könne auch eine westgotische Sammlung römischen Rechts aus Südfrankreich zu dieser Zeit schon St. Emmeram erreicht haben.
Zumindest im Falle der Spanischen Epitome nun deutet Landau den Weg an, auf dem sie in die Herzogsstadt gelangt sein könnten: nämlich über Italien. Und genau dieser Hinweis führt uns nun zum zweiten umfassenderen Erklärungsansatz für die Beziehungen zwischen Bayern und Spanien in der Lex Baiuvariorum.
Die Hypothese der langobardischen Rechtsschule
Einen völlig anderen Aspekt der internationalen Verflechtung Bayerns im Frühmittelalter als Beyerle nimmt nämlich Hermann Nehlsen zum Ausgangspunkt für seine Theorie, die auch die umstrittene Frühdatierung wieder stark macht.
Zwischen dem 6. und dem 8. Jahrhundert habe eine nahezu ununterbrochene Reihe dynastischer Verbindungen zwischen den Agilolfingern und den langobardischen Königen bestanden, die entsprechend enge politische und kulturelle Verknüpfungen mit sich brachten. Speziell in der Zeit von Herzog Garibalds Tochter, der Langobardenkönigin Theudelinde (ca. 570-627) und ihren Nachkommen, sei es in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts zu einer Verdichtung dieser Beziehungen gekommen.
Möglicherweise entscheidend für die Lex Baiuvariorum sei der vehemente Einsatz Theudelindes für die Abkehr der Langobarden vom Arianismus und für die Annahme des römischen Glaubensbekenntnisses gewesen. In diesem Kontext sei 614 von Columban das Kloster Bobbio gegründet worden, das mit seinem Skriptorium und seiner reich ausgestatteten Bibliothek bald Berühmtheit erlangt habe.
Dank der Kodifizierung ihres Rechts unter König Rothari im Jahr 643 und dank ihrer Rechtschule hätten sich die Langobarden den Ruf erworben, die besten Juristen unter den Germanenstämmen zu sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätten sich in der Hofbibliothek zu Pavia daher auch die westgotischen Codices befunden. Was läge also näher, als die Vermittler des Codex Euricianus nach Bayern bei den Langobarden zu suchen.
Die Tatsache, dass sich im bayerischen Gesetzbuch keine Verweise auf das langobardische Edictum Rothari finden, beweise laut Nehlsen nur, dass es früher als dieses und damit auch früher als das neue westgotische Recht König Reccesvinths aus dem Jahr 654 entstanden sein müsse. Dies stünde vollkommen im Einklang mit dem Prolog, der eindeutig auf die Initiative des 639 verstorbenen Merowingerkönigs Dagobert verweist. Zudem ließen sich in dieser Zeit in verschiedenen Quellen auch die Namen der vier gelehrten Männer nachweisen, die laut der Einführungspassagen die Redaktion der verschiedenen Stammesrechte übernommen hätten.
Dieser Versuch Nehlsens, die einheitliche Entstehung des bayerischen Gesetzbuches mit der Frühdatierung seiner Abfassung im ersten Drittel des 7. Jahrhunderts zu verbinden, löst zwar weithin die Probleme, die der Codex Euricianus als zentrale Quelle des bayerischen Gesetzbuches aufwirft. Zumindest ist die Erklärung schlüssig, wenn man von einer wirklich umfassenden juristischen Bibliothek in Pavia oder Bobbio zu dieser frühen Zeit ausgeht. Doch Nehlsen erkauft sich mit diesen Hypothesen ein neues Problem, das er indirekt am Ende selbst thematisieren muss, das er aber dann nicht wirklich löst.
Er fährt nämlich fort mit den vier erlauchten Männern, die im Auftrag Dagoberts angeblich die früheren bayerischen Gesetzessammlungen noch einmal überarbeitet haben sollen. Von ihnen stammen zwei aus dem direkten Umfeld des merowingischen Hofes, der dritte könnte Bischof von Avignon oder Straßburg gewesen sein – wenn denn die Zuschreibungen richtig sind. Dass diese drei sich längere Zeit in Bayern aufgehalten haben, um ihr Werk zu verrichten, und dass sie dazu möglicherweise sogar einen Umweg über die langobardische Hofbibliothek in Pavia eingelegt haben, das mag nicht recht einleuchten.
Dementsprechend lässt Nehlsen sie auch beiseite, um sich auf den vierten zu konzentrieren, der im Prolog Agilulf genannt wird. Von ihm nimmt die Forschung gemeinhin an, dass sich dahinter ein Bischof von Valence verbergen könnte. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass die tatsächlichen Redaktoren der Lex Baiuvariorum für ihre fiktive Entstehungsgeschichte des Gesetzeswerks einfach den Leitnamen der Herzogsdynastie der Agilolfinger wählten, um damit das bayerische Element herauszuheben.
Nehlsen jedoch schreibt dem Prolog eine gewisse Authentizität zu. Deshalb behauptet er, Agilulf sei identisch mit dem Mönch Agilus, der aus dem Umfeld Columbans stammt und später Abt eines Klosters bei Paris wurde. Dieser hätte sich, was allerdings in den Quellen nur schwach belegt ist, auf Veranlassung der langobardisch-agilolfischen Königin Theudelinde zusammen mit seinem Begleiter Eustasius zur Missionsreise nach Bayern aufgemacht und Kloster Weltenburg gegründet. Dort sei dann im frühen 7. Jahrhundert die Lex Baiuvariorum verfasst worden.
Allerdings muss Nehlsen irgendwann selbst einräumen, dass diese Theorie nicht haltbar ist, zumindest was die Gründung von Weltenburg angeht. Also modifiziert er seinen Vorschlag noch einmal, hält aber trotzdem in Bezug auf die Entstehungszeit gegen viele Kollegen an der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts fest. Er plädiert letztlich für den agilolfischen Herzogshof in Regensburg als Entstehungsort des Gesetzbuches. Dank der regen dynastischen und kulturellen Kontakte ins Langobardenreich seien dort möglicherweise schon in so frühen Zeiten die Voraussetzungen für die komplexe Redaktion der Lex Baiuvariorum gegeben gewesen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ohne Zweifel frühe westgotische Rechtsbücher – der Codex Euricianus, die Schriften Isidors von Sevilla sowie möglicherweise weitere Rechtssammlungen – entscheidenden Einfluss auf die Lex Baiuvariorum hatten. Wie diese so außergewöhnliche und mit Blick auf andere Stammesgesetze beispiellose spanisch-bayerische Begegnung jedoch zustande kam, bleibt allerdings ein Rätsel.
Die Forschung konnte bislang noch nicht einmal eindeutig klären, wann das erste bayerische Gesetzbuch entstand. Die neueren Studien tendieren überwiegend zu einer Datierung zumindest der Schlussredaktion auf die Zeit Herzog Odilos um 740. Dies wäre also der zeitliche Kontext, in dem auch die kirchlichen Angelegenheiten in Bayern durch die Gründung der Bistümer Regensburg, Freising, Passau und Salzburg rechtlich geregelt wurden.
Fraglich bleibt aber weiterhin, wo ein entsprechender Stab an Rechtsgelehrten und Schreibern – also mit hoher Wahrscheinlichkeit Mönchen – die notwendige Infrastruktur vorfand. Daher lässt sich auch unsere zentrale Frage, auf welchen Wegen die Texte von der Iberischen Halbinsel nach Bayern gelangt sind, noch nicht beantworten. Roman Deutinger drückt es so aus: „man muss sich mit dem Faktum abfinden, ohne es recht erklären zu können.“
Direkte Kontakte des agilolfischen Herzogshofes oder bayerischer Klöster mit dem spanischen Westgotenreich sind wohl auszuschließen, so dass von indirekten Wanderwegen der entsprechenden Buchabschriften auszugehen ist, sei es über die Langobarden in Italien, sei es über das Frankenreich.
Auswahlbibliographie
Bayerle, Konrad. Lex Baiuvariorum. Lichtdruckwiedergabe der Ingolstädter Handschrift des bayerischen Volksrechts mit Transkription, Textnoten, Übersetzung, Einführung, Literaturübersicht und Glossar. München: Hueber, 1926.
Deutinger, Roman (Hrsg.). Lex Baioariorum. Das Recht der Bayern. Regensburg: Pustet, 2017.
Fastrich-Sutty, Isabella. Die Rezeption des westgotischen Rechts in der Lex Baiuvariorum. Köln: Heymanns, 2001.
Holzner, Thomas. Die Decreta Tassilonis. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.
Landau, Peter. Die Lex Baiuvariorum. Entstehungszeit, Entstehungsort und Charakter von Bayerns ältester Rechts- und Geschichtsquelle. München: Akademie der Wissenschaften, 2004.
Nehlsen, Hermann. Bayerische Rechtsgeschichte vom frühen Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Lang, 2011.
Schumann, Eva. „Entstehung und Fortwirkung der Lex Baiuvariorum“, in: Gerhard Dilcher und Eva-Maria Distler (Hrsg.). Leges – Gentes – Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur. Berlin: Erich Schmidt, 2006, 291-319.
Siems, Harald. „Lex Baiuvariorum“, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin: de Gruyter, 2001, Band 18, 305-315.
Der spanische Adoptianismus auf der Regensburger Reichssynode Karls des Großen
Die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts leitete sowohl für die Iberische Halbinsel als auch für Bayern Entwicklungen ein, die für die Zukunft der beiden Territorien entscheidende Bedeutung haben sollten. Wenig deutete damals allerdings darauf hin, dass sich dabei ein wie auch immer gearteter Berührungspunkt für einen direkten Austausch ergeben könnte. Denn auf der einen Seite haben wir das agilolfische Herzogtum im Osten, das unter Tassilo III. vergeblich nach einer gewissen Autonomie innerhalb des Fränkischen Reiches strebte. Auf der anderen Seite lag im Westen das maurisch-muslimische Al-Andalus, das sich mutmaßlich den islamischen Reichen Nordafrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens zuwandte.
Erstaunlicherweise war es dann eine hochkomplexe christlich-theologische Frage, die den Kontakt herstellte. Und selbstverständlich verdankt sich diese ganz spezifische bayerischspanische Begegnung jener Zeit in erster Linie der zentralen Figur der europäischen Geschichte jener Epoche, nämlich Karl dem Großen.
Der fränkische König nahm höchstpersönlich das Heft in die Hand, als es darum ging, den Streit um den sogenannten spanischen Adoptianismus beizulegen. Er berief dazu im Jahr 792 in Regensburg eine Reichssynode ein und war wohl selbst die treibende Kraft im Prozess gegen die in Spanien vertretene christologische Auffassung. Die auf dieser Kirchenversammlung beschlossene, offizielle Verurteilung der adoptianistischen Lehre vermochte die Debatte jedoch noch nicht endgültig zu beenden. Auch die Folgekonzilien in Frankfurt (794) und Aachen (799) mussten sich noch einmal damit beschäftigen, bestätigten aber weithin die in Bayern gefassten Beschlüsse.
Im Zentrum der Auseinandersetzung stand Erzbischof Elipandus von Toledo (ca. 717-802), der auch unter der islamischen Herrschaft sein Amt als Oberhaupt der westgotischen Christen ausüben durfte. Als Adoptianismus wird die von ihm entwickelte christologische Auffassung deshalb bezeichnet, weil er vorgeschlagen hatte, das alte Dogma von den zwei Naturen in der einen Person Jesu Christi genauer zu bestimmen.
Der Sohn, so die Interpretation des Elipandus, sei durch seine göttliche Natur Schöpfungsmittler und insofern im Wesen Gott gleich, wie es ja das traditionelle Glaubensbekenntnis aussagt. Folglich sei er in seiner göttlichen Natur nicht adoptiert. In seiner menschlichen Natur hingegen, die in dieser Lehrmeinung eng mit der Erlösungstheologie verknüpft wird, sei der aus der Jungfrau geborene Sohn von Gott lediglich adoptiert.
Möglicherweise steht hinter dieser Formel ein besonderes spanisch-westgotisches Verständnis der lateinischen Begriffe „adoptio“ und „assumptio“, die in der fränkischen Kirche ganz anders interpretiert wurden. Aber dies braucht hier nicht eingehend besprochen zu werden, da an dieser Stelle nicht die theologischen Details (vgl. dazu ausführlich Nagel), sondern die Rahmenbedingungen des Streits im Mittelpunkt stehen sollen.
Bayern und Spanien im 8. Jahrhundert
Nach ihrer Landung bei Gibraltar im Jahr 711 hatten es die arabisch-berberischen Verbände vermocht, innerhalb kürzester Zeit das bereits brüchig gewordene westgotische Reich vollständig zu zerschlagen und nahezu die gesamte Iberische Halbinsel, ja sogar Gebiete nördlich der Pyrenäen zu erobern. Nur in einem kleinen Streifen an der für die Araber wenig attraktiven, kühlen und regnerischen Atlantikküste um Oviedo im Nordwesten konnten sich westgotische Adelige mit der einheimischen Bevölkerung zusammenschließen und ein christliches Kleinreich aufbauen.
Innerhalb der neuen, islamischen Führungsschicht des Landes kam es bald zu Rivalitäten und Aufständen. Erst als Emir Abd ar-Rahmân I. aus der Dynastie der Omayaden in der Mitte des 8. Jahrhunderts die Macht übernahm, vermochte er, den inneren Zerfall aufzuhalten. Doch auch gegen seine Zentralisierungspolitik erhob sich Widerstand. Dies führte dazu, dass mehrere lokale muslimische Herrscher aus dem Norden der Halbinsel den unbestrittenen Führer des christlichen Europas, den jungen König Karl, um Hilfe gegen das Emirat von Córdoba anriefen.
Karls Spanienfeldzug 778 endete allerdings in einem Fiasko, denn zum einen war er gegen die Araber vor Zaragoza erfolglos, zum anderen brachte er durch seine Kriegsführung die Basken gegen sich auf. Bei dem nicht eben ehrenvollen Rückzug der Franken rächten sich diese und rieben an dem Pyrenäenpass bei Roncesvalles Karls Nachhut auf. Das gut 300 Jahre später entstandene Rolandslied hält bis in unsere Zeit die Erinnerung an dieses Ereignis wach.
Nur kurz nach dem französischen Epos entstand dann im 12. Jahrhundert noch ein weiterer, auf lateinisch verfasster und stark ausgeschmückter Text, der sogenannte Pseudo-Turpin. Er deutete den schmachvollen Zug nach Spanien in eine glorreiche Eroberung um, bei der Karl ganz nebenbei das Grab des Apostels Santiago besucht, wenn nicht gar entdeckt hätte. Außerdem hätten in seinen Reihen Ritter aus Bayern gegen die ungläubigen Mauren gekämpft und sich damit die ewige Herrlichkeit erworben. Doch diese späte Version kann getrost in das Reich der Mythen und Legenden verwiesen werden. Es gibt keinerlei belastbare Hinweise darauf, dass Tassilo III. wirklich Seit an Seit mit Karl die Stadt Zaragoza belagert hätte.
Dagegen sprechen zeitgenössischen Quellen davon, dass sich der letzte Agilolfingerherzog bereits früher einem Aufgebot der Franken widersetzt habe, an einem Feldzug gegen Aquitanien im heutigen Südfrankreich teilzunehmen. Jedenfalls nutzte Karl dieses Argument im Schauprozess gegen Tassilo, um ihn abzusetzen und in ein Kloster zu schicken. Damit und mit dem ersten Aufenthalt des Frankenherrschers in Regensburg, wo er im Herbst 788 den Treueschwur des lokalen Adels entgegennahm, endete die zuvor immer wieder angestrebte und zumindest partiell erreichte Autonomie Bayerns.
Noch stärker in das Blickfeld des Königs rückte das alte Herzogtum im Osten seines Reiches jedoch im Kontext der Awarenkriege. Über zwei Jahre lang, vom Sommer 791 bis Herbst 793, hielt sich Karl dort auf und richtete seine Residenz in Regensburg ein. Dorthin berief er auch, wohl im Sommer 792, eine Synode, um den in Spanien ausgebrochenen dogmatischen Streit zu behandeln, der drohte, von der Iberischen Halbinsel aus auf das gesamte Fränkische Reich überzugreifen.
Trotz des erfolglosen Feldzugs von 778 hatten es die Franken nämlich in den darauffolgenden Jahren vermocht, sukzessive ihre Einflusssphäre über den Pyrenäenhauptkamm hinweg in die nördliche Zone des heutigen Kataloniens auszudehnen. Damit war die Iberische Halbinsel in drei völlig unterschiedliche Gebiete aufgeteilt:
Im Nordwesten gab es einen noch immer vergleichsweise kleinen Küstenstreifen, wo sich das auf westgotische Traditionen fußende, christlich-asturianische Königtum konsolidierte und langsam aber sicher auf angrenzende Regionen wie etwa Galicien und Gebiete südlich des Küstengebirges ausgriff. Daraus sollten später, im Verlauf der sogenannten Reconquista, Portugal und Kastilien hervorgehen.
Einige hundert Kilometer weiter im Osten war in den Pyrenäen eine zunächst schmale, gebirgige Zone unter christlichfränkische Oberherrschaft gefallen, die sich als Spanische Mark ebenfalls allmählich Richtung Süden ausweitete, quasi als Keimzelle für die späteren Regionen Katalonien, Aragón und Valencia.
Den gesamten großen Rest des heutigen Spaniens und Portugals beherrschten die Omayaden von Córdoba aus. Sie leiteten dort in den nächsten beiden Jahrhunderten eine beispiellose kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit ein.
Die Herausbildung des spanischen Adoptianismus
Dank der von den Mauren gepflegten Toleranz gegenüber dem Christentum und dem Judentum konnten die Christen in Al-Andalus zunächst weithin ohne Einschränkungen ihre Religion bewahren. Ja sie konnten sogar Konzile einberufen und Kontakte zu den Glaubensgenossen außerhalb des Emirats pflegen. Die alte Vorrangstellung des Erzbistums Toledo über die westgotische Kirche blieb somit unangetastet.
Gleichzeitig bildeten sich aber natürlich im Laufe der Zeit Assimilierungstendenzen unter den Gläubigen heraus. Christentum und Islam mussten, ob sie wollten oder nicht, zu einem Modus Vivendi finden. So kam es, dass sich die auch zuvor schon sehr eigenständige westgotische Kirche nun in einem schwierigen Umfeld als mozarabische – wahrscheinlich in der Bedeutung „arabisierte“ – Kirche unter dem Islam gegen ganz unterschiedliche Fronten verteidigen und abgrenzen musste.
Aus dem Frankenreich war als Vertreter der Rom nahestehenden Kirche ein Wanderbischof aufgetaucht, der die liturgischen Eigenheiten der westgotischen Traditionen sowie den notwendigerweise engen Kontakt zu Andersgläubigen kritisch betrachtete. Er versuchte, diejenigen Gruppen auf der Iberischen Halbinsel zu unterstützen, die den Primat des Papstes über alle westlichen Kirchen postulierten.
Gegen eine dieser Gruppen hatte nun Erzbischof Elipandus von Toledo zu Beginn der 780er Jahre nicht nur kirchenpolitische, sondern auch dogmatisch-theologische Vorbehalte formuliert. Im Zuge dieser Auseinandersetzung entwickelte er dann den Adoptianismus als eigenständig westgotisch-spanische Interpretation der christologischen Lehre von den zwei Naturen in einer Person.
Die zweite Front, gegen die der Erzbischof von Toledo seinen Hoheitsanspruch verteidigen musste, erwuchs ihm in Asturien. Trotz der politischen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen Al-Andalus und dem christlichen Königreich war ja die Trennung auf kirchlichem Gebiet noch nicht vollzogen worden. Elipandus legte daher den dortigen Bischöfen und Klöstern das von ihm entwickelte adoptianistische Glaubensbekenntnis vor und fand selbstverständlich Anhänger, denn an die dogmatische Frage war letztlich die Einheit der westgotischen Kirche gekoppelt. Doch ebenso verständlich erscheint, dass sich aus der Abwehrhaltung gegen das maurische Spanien heraus jetzt Widerstand gegen Toledo regte.
Ein dreiviertel Jahrhundert nach dem Zusammenbruch des westgotischen Reiches waren alle Hoffnungen auf eine schnelle Änderung der Verhältnisse geschwunden. Im kleinen, christlichen Königreich im Nordwesten wurde die Eroberung des Landes durch den Islam als Katastrophe, ja als Apokalypse wahrgenommen. Daher konnte für die Vordenker dieser Richtung die Lösung nicht in der Anpassung und im „Weiter so“ bestehen.
In der Figur eines Mönches, der unter dem Namen Beatus von Liébana bekannt wurde, kristallisierte sich daher eine unbeugsame Haltung heraus, die für einen radikalen Neuanfang stand. Er und seine Mitstreiter wiesen auf überaus brüske und hochemotionale Art und Weise den Adoptianismus zurück, weil sie die theologische Frage zum Anlass nahmen, damit einhergehend auch den Primatsanspruch von Toledo über ganz Spanien abzulehnen.
Gleichzeitig wollte Beatus, der Mönch aus dem Kloster inmitten der Berge der Picos de Europa, keineswegs die alte Eigenständigkeit der westgotischen Kirche zugunsten einer Unterwerfung unter das Fränkische Reich oder einer Anpassung an Rom aufgeben. Sein Ziel war es vielmehr, eine neue, ebenso eigenständige spanische Kirche zu etablieren, in deutlicher Distanz zu Toledo, aber eben auch in Distanz zu Aachen und Rom. Allerdings scheute er nicht davor zurück, sich aus taktischen Überlegungen heraus der Hilfe des fränkischen Königs und des Papstes zu bedienen, wenn es darum ging, das Joch des Primats abzuschütteln.
Die dritte Front gegen Erzbischof Elipandus formierte sich in den von den Franken eroberten Gebieten im Nordosten der Halbinsel. Die dort in den Pyrenäen ansässigen Bischöfe entglitten seiner Kontrolle und wurden in die fränkische Reichskirche eingegliedert. Dennoch – oder gerade deswegen – gelang es ihm ausgerechnet dort, einen theologisch ausgewiesenen Anhänger für seine Thesen zu finden, nämlich Bischof Felix von La Seu d’Urgell, dem bis heute existierenden Pyrenäenbistum südlich von Andorra.
Felix entwickelte sich sogar zum profiliertesten Verfechter des Adoptianismus. Die neue Lehre vertrat er mit aller Konsequenz nicht nur gegen Beatus von Liébana aus Asturien, sondern auch gegenüber den theologischen Beratern des Frankenkönigs. Spätestens damit war aus dem spanieninternen Streit ein reichspolitisches Problem geworden, um das sich Karl persönlich kümmern musste.
Fassen wir kurz zusammen: Als Vertreter der alten, westgotischen Kirche, die sich jetzt mit der maurischen Herrschaft arrangieren musste, entwickelte Erzbischof Elipandus von Toledo die Lehre des Adoptianismus. Sein schärfster Gegner in dieser Angelegenheit wurde der Mönch Beatus von Liébana aus dem christlich-asturianischen Reich im Nordwesten, das in kirchlichen Angelegenheiten eigentlich noch ihm, dem Erzbischof-Primas von Spanien unterstellt war. Dagegen fand er für seine Dogmeninterpretation in Bischof Felix aus dem Nordosten der Iberischen Halbinsel einen begeisterten Anhänger, der inzwischen der fränkischen Reichskirche unterstand.
Regensburg und die Verdammung des Adoptianismus
Über die genauen Abläufe der Regensburger Synode des Jahres 792 liegen keine bzw. nur indirekte Quellen vor. Sicher ist jedoch, dass Elipandus selbst nicht nach Bayern reiste. In seiner Bischofsstadt Toledo unter maurisch-arabischer Herrschaft war er geschützt vor dem Zugriff Karls. Bischof Felix war als Oberhaupt einer Diözese des fränkischen Reiches jedoch direkt vom König abhängig, so dass er an die Donau zitiert wurde.
Wenige Jahre später entstandene Berichte sagen nun aus, dass der Bischof von Urgell gezwungen wurde, öffentlich seinen Lehren abzuschwören. Anschließend führte ihn ein Vertrauter Karls nach Rom, wo er vor dem Papst schriftlich und durch feierliche Eide seine Zustimmung zu der nun als orthodox deklarierten anti-adoptianistischen Christologie geben musste. Sein Bistum wurde ihm entzogen, so dass er wohl zu Elipandus nach Toledo flüchtete.
Offensichtlich waren aber beide keineswegs gewillt, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Eine Vielzahl von Briefen, Traktaten und Gegentraktaten hielt in den folgenden Jahren die Angelegenheit offen, bis schließlich Bischof Felix nach seinem vergeblichen Versuch, auf der Synode in Aachen im Jahr 799 doch noch die Gunst des Königs zu gewinnen, von Karl in ein Kloster bei Lyon verbannt wurde.
Für die bayerisch-spanischen Beziehungen war der Adoptianismusstreit ein punktuelles Ereignis, das sich ausschließlich dem Zufall verdankt, dass Karl zu dieser Zeit im Osten seines Reiches weilte. Auswirkungen auf Bayern hatte die Debatte auf der Regensburger Synode daher nicht, so dass sie dort höchstens als Fußnote in den Geschichtsbüchern vermerkt wird.
Ganz anders jedoch stellt sich die Lage für Spanien dar. Durch das entschiedene Eingreifen des Beatus von Liébana und seiner Mitstreiter gegen die Lehrautorität Toledos hatten sich die entstehenden christlichen Reiche im Nordwesten der Iberischen Halbinsel Freiräume geschaffen. In diesen konnte sich bald darauf ein kirchenpolitisch und kulturgeschichtlich kaum zu überschätzendes Phänomen herausbilden, das bis heute wirksam und bedeutsam geblieben ist: der Jakobsweg nach Santiago de Compostela.
Neben seinen polemischen Stellungnahmen zum Adoptianismus und einem Apokalypsenkommentar, der durch die reich illustrierten Ausgaben des Hochmittelalters berühmt werden sollte, stammt aus der Feder des Beatus nämlich vermutlich auch der liturgische Hymnus O Dei Verbum (um 785). In ihm greift der Mönch aus Liébana eine bis dahin kaum beachtete Tradition unbekannten Ursprungs aus dem 7. Jahrhundert auf, wonach der Apostel Jakobus der Ältere vor seiner Enthauptung in Jerusalem auf der Iberischen Halbinsel missioniert haben soll. Beatus legte nun durch die dezidierte Einbindung dieser Legende in einen Kirchengesang zentrale Fundamente für die Jakobsverehrung im Nordwesten Spaniens, denn in O Dei Verbum wird der Jünger Jesu erstmals emphatisch zum Apostel, Haupt und Patron Spaniens eingesetzt.
Es war also keineswegs Zufall, dass in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, nur wenige Jahrzehnte nach dem Adoptianismusstreit, auf wundersame Art und Weise das Grab in Santiago de Compostela gefunden wurde. Damit begann die Geschichte des Camino de Santiago, die, wie wir sehen werden, ab dem 11. Jahrhundert auch in Bayern ihren Niederschlag fand.
Auswahlbibliographie
Abad y de Vinyals, Ramón de. La batalla del adopcionismo. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1949.
Hartmann, Wilfried. Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien. Paderborn: Schöningh, 1989.
Marboe, René Alexander. Von Burgos nach Cuzco. Das Werden Spaniens 530-1530. Essen: Magnus, 2006.
Márquez Villanueva, Francisco. Santiago: trayectoria de un mito. Barcelona: Bellaterra, 2004.
Nagel, Helmut. Karl der Große und die theologischen Herausforderungen seiner Zeit. Frankfurt/M.: Lang, 1998.
Orlandis, José. „La circunstancia histórica del adopcionismo español“, in: Scripta Theologica, 26, 1994, 1079-1091.
Perarnau Espelt, Josep. „Feliu d’Urgell: fonts per al seu estudi i bibliografia dels darrers seixanta anys“, in: Arxiu de Textos Catalans Antics, 16, 1997, 435-482.
Rivera Recio, Juan Francisco. El adopcionismo en España, siglo VIII. Historia y doctrina. Toledo: Seminario Conciliar, 1980.
Schmid, Peter. Regensburg. Stadt der Könige und Herzöge im Mittelalter. Kallmünz: Lassleben, 1977.
St. Afra und Sant Narcís:
eine mittelalterliche Heiligenpartnerschaft zwischen Augsburg und Girona
Ein unbefangener Tourist, der heutzutage im katalanischen Girona eine mit Fliegen bestückte Figur des Stadtheiligen Narcissus erwirbt, wird kaum auf die Idee kommen, dass die Legenden um diesen Bischof ihren Ursprung in Augsburg haben und eng mit der dortigen Schutzpatronin St. Afra verbunden sind.
Doch über viele Jahrhunderte hinweg gab es einen intensiven Austausch zwischen den beiden Städten, in dessen Verlauf die sich wechselseitig beeinflussenden Geschichten über die beiden Märtyrer aus der späten Römerzeit immer weiter ausgebaut wurden. Mönche, Schriftstücke und Reliquien nahmen ihren Weg vom Lech nach Nordostspanien und zurück, in den Kirchen wurden entsprechende Altäre eingerichtet, Bruderschaften gründeten sich hier und dort.
Heute kann zwar von einer gemeinsamen Verehrung beider Heiliger keine Rede mehr sein. Zumindest als Relikt vergangener Zeiten ist jedoch die 1603 ins Leben gerufene St. Narcissus Bruderschaft der katholischen Schneider in Augsburg bis in die jüngste Zeit aktiv gewesen. Und in Girona wird in der Kirche St. Felix auf dem Altar der heiligen Afra der erste Steinsarkophag des Bischofs aufbewahrt, der sie der Überlieferung gemäß im Jahr 304 getauft hat.
Eine zentrale Rolle für den mittelalterlichen Austausch über eine Distanz von 1.200 km hinweg spielte dabei ein Bote, der 1087 vom Abt des Klosters St. Ulrich und Afra ausgeschickt und von Berengar, dem Bischof von Girona, mit allen Ehren empfangen wurde. Dieser erste überlieferte persönliche Kontakt diente dazu, die jeweiligen Informationen über die Heiligen abzugleichen und ihre Verehrung voranzutreiben.
Bevor wir aber zur Rekonstruktion dieses für Bayern und Spanien wohl einzigartigen Kulturaustauschs ansetzen, muss vorausgeschickt werden, dass von der kritischen Geschichtswissenschaft heutzutage nahezu alles an dieser Tradition in Zweifel gezogen wird: Auf Lesefehlern von alten Märtyrerlisten soll die frühe Zuordnung St. Afras nach Augsburg ebenso beruhen wie die Behauptung, dass sie eine bekehrte Prostituierte gewesen sei, und auch die Existenz des Bischofs Narcissus von Girona gehe auf eine falsch interpretierte Abkürzung zurück. Da es uns aber nicht um die Authentizität und Historizität der Heiligen an sich geht, sondern um die auf ihnen aufbauenden Beziehungen zwischen Augsburg und Girona, können wir diese Nachfragen ruhigen Gewissens beiseite lassen.
Legenden und Schriften über St. Afra in Augsburg
Die einschlägigen Handbücher und Nachschlagewerke zur Bayerischen Geschichte und Kirchengeschichte (Spindler, Brandmüller, Schwaiger, Hausberger / Hubensteiner etc.) sind sich einig in der großen Bedeutung, die der heiligen Afra für die frühe Volksfrömmigkeit, wenn nicht sogar für die Kontinuität des Christentums von der Römerzeit bis ins Mittelalter im Gebiet des heutigen Bayerns zukommt.
Die erste verbriefte, wenn auch extrem kurze Nennung der Verehrung der Gebeine der Märtyrerin Afra in Augsburg stammt aus der Vita Sancti Martini des Venantius Fortunatus aus der Zeit vor 600. Gut 100 Jahre später, um 700, gibt es mit der Passio Afrae bereits einen etwas ausführlicheren Bericht über ihr Martyrium während der Christenverfolgung unter Diokletian zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Über ihre Bekehrung wird dort jedoch nichts ausgesagt.
Da sich solche Texte über Heilige und ihre konkrete Verehrung vor Ort wechselseitig bedingen, und da die dramatische Schilderung vom Prozess und der Hinrichtung Afras notwendigerweise weitergehende Fragen aufwarf, verwundert es nicht, dass um die Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert eine erheblich umfangreichere Fassung auftauchte. Es handelt sich um die Conversio et passio Afrae, die schnell in vielen Abschriften im gesamten Frankenreich Verbreitung fand.
Wo sie verfasst wurde, muss offen bleiben. Der These Mundós zufolge sollte sie in den Zeiten Karls des Großen dazu dienen, die beiden weit entfernten Gebiete des Reiches einander anzunähern, so dass sie aus dem Umfeld des Frankenkönigs stammen könnte. Andere Forscher hingegen plädieren für ihre Augsburger Herkunft.
Ebenso ungewiss ist, wo der unbekannte Verfasser der Conversio den Namen von Bischof Narcissus und den seines Diakons Felix hernahm. Es könnte sein, dass er sie in einem alten Martyriologium fand und fälschlicherweise Girona zuordnete, wo die Verehrung eines anderen Felix bereits gesichert war. Auf diese Weise hätten sich unterschiedliche Traditionen und Inventionen überlagert, die dann später mühsam wieder voneinander getrennt werden mussten.
Der Text der Bekehrungsgeschichte der Augsburger Heiligen setzt jedenfalls mit der Information ein, dass während der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian ein Bischof Narcissus und sein Diakon Felix auf der Flucht waren. Sie kommen in das Haus der Afra, ohne zu wissen, dass diese der Prostitution nachgeht.
Das seltsame Gebaren des Mannes, der zum Essen betet, ruft die Neugier der Hausherrin hervor. Narcissus beginnt, ihr die christlichen Lehren zu erklären. Sie ruft daraufhin ihre Dienerinnen sowie ihre Mutter und berichtet den Frauen von den wundersamen Dingen, die geschehen sind. Bevor sie sich bekehren, fassen die Anwesenden für den Bischof die Geschichte der aus Zypern stammenden Familie zusammen. Um Afras Beruf zu rechtfertigen, fügen sie noch hinzu, dass sie der Liebesgöttin Venus geweiht sei.
Als retardierendes Moment der Legende taucht dann auf einmal ein Dämon auf, mit dem der heilige Bischof einen langen Kampf ausficht. Wundersamerweise bezwingt er ihn am Ende und schlägt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn der Teufel fährt in einen Drachen und tötet ihn dadurch.
Erst nach diesen Zeichen werden Afra und ihr Anhang getauft. Narcissus aber und sein Gefährte bleiben neun Monate in Augsburg, ordnen alles zum Besten, weihen Afras Onkel Zosimus (Dionysius) zum Vorsteher der Gemeinde und damit zum ersten Bischof Augsburgs, um schließlich Richtung Spanien zu ziehen. In Girona wirken sie drei Jahre, vergrößern die Zahl der Gläubigen und sterben als Märtyrer.
Interessanterweise kündigt der Text dann an, später über ihren Tod zu berichten, zunächst wolle er sich aber wieder den Geschehnissen in Augsburg zuwenden. Dies tut er auch, indem er leicht abgewandelt die ältere und schon bekannte Passio Afrae einfügt. An deren Ende findet sich ein weiterer Zusatz, nämlich die Erzählung vom wundersamen Auffinden des unversehrten Leichnams der Heiligen, nicht jedoch die zuvor versprochene Information über den Bischof und seinen Diakon.
Der Weg der Narcissusverehrung von Augsburg nach Girona
Dieser Bericht von der Conversio et passio beantwortete nun die drängenden Fragen nach der Herkunft der Heiligen, ihrer Bekehrung und ihres Bekehrers, wie auch die nach den Ursprüngen der Diözese und des damals außerhalb der Stadt gelegenen Kirchleins St. Afra. Gleichzeitig öffnete er jedoch ein Fenster für neue Fragen, die insbesondere Girona betrafen.
Der katalanischen Stadt und Diözese war mit der erweiterten Afralegende überraschenderweise ein neuer Heiliger zugefallen, zudem ein bedeutender Bischof und Märtyrer aus früher Zeit. Die Nachricht davon muss wohl noch im Verlauf des 9., spätestens aber im 10. Jahrhundert dort angekommen sein. Möglicherweise über eine Abschrift der ausführlichen Legende, vielleicht aber auch durch Anmerkungen in Texten des Florus von Lyon oder Ados von Vienne, die Narcissus bereits um 850 kennen.
Gesichert ist jedenfalls, dass Papst Silvester II. im Jahr 1002 Gironas Bischof Odo die Besitztümer der Diözese bestätigt, wobei er eine Kirche zu Ehren des heiligen Märtyrers Felix und des heiligen Narcissus erwähnt.
Dieser Felix aber war der alte Patron der Stadt Girona, der, aus Nordafrika stammend, ebenfalls unter Diokletian den Tod gefunden haben soll. Er konnte in Katalonien keinesfalls mit dem Diakon Felix aus der Afrageschichte gleichgesetzt werden, weil er dort schon lange verehrt worden war. Außerdem waren im 10. Jahrhundert Gebeine in einem römischen Steinsarg aufgefunden und ihm zugeschrieben worden.
Dass nun ausgerechnet das Gotteshaus, das diesem Felix geweiht war, kurz nach der Jahrtausendwende ein zweites Patrozinium trägt, könnte als Indiz gewertet werden, dass um diese Zeit bereits die Verehrung des aus Augsburg kommenden Bischofs eingesetzt hatte. Möglicherweise hatte man schon damals mumifizierte Überreste aus einem anderen Sarkophag zum wundersam erhaltenen Körper des Narcissus erklärt.
Klarer werden die Hinweise im Verlauf des 11. Jahrhunderts. Aus der Feder des bedeutenden katalanischen Bischofs Oliba von Vic ist ein Text zu Ehren des heiligen Narcissus erhalten, der in der Fassung der Patrologia Latina Spuren einer vielfachen Überarbeitung aufweist. Wahrscheinlich aber hat der Bischof tatsächlich 1043 in Girona gepredigt, um das Andenken an Sant Narcís nicht nur in der Stadt selbst, sondern in ganz Katalonien zu befördern.
Die allegorisch ausgemalte Ansprache (vgl. die kritische Ausgabe bei Junyent) setzt eindeutig die Kenntnis der Conversio et passio der heiligen Afra voraus, denn Oliba geht insbesondere auf das Dämonen- und Drachenwunder ein. Er fügt ihr aber noch keine neuen, aus Katalonien selbst stammenden Informationen hinzu, etwa Details über die Auffindung des Grabs oder Einzelheiten zu Narcissus’ Martyrium.
Den nächsten Schritt der Traditionsbildung stellt dann der anfangs erwähnte, erste nachweisbare direkte Kontakt zwischen Augsburg und Girona dar. In der Stadt am Lech war St. Afra gegen den neuen Heiligen und Ungarnbezwinger Ulrich wohl etwas ins Hintertreffen geraten. Doch der Abriss ihrer alten Kirche brachte einen Sarkophag zutage, in dem man ihre Gebeine gefunden zu haben glaubte. Der Neubau des Gotteshauses und möglicherweise der Investiturstreit verzögerten die Angelegenheit noch etwas, doch im Jahr 1087 entsandte Abt Sigehard einen Boten nach Spanien mit der Bitte um Informationen über Narcissus.
Natürlich ging er damit ein gewisses Risiko ein, denn es hätte ja sein können, dass dieser Heilige dort gar nicht bekannt gewesen wäre, was einen erheblichen Rückschlag für die Legendenbildung um Afra bedeutet hätte. Entweder konnte es für ihn also keinen vernünftigen Zweifel an den Aussagen der Conversio und der sich daraus notwendigerweise ergebenden Verehrung des Bischofs in Katalonien geben, oder aber er verfügte über entsprechende Informationen aus Girona. Als Quelle dafür kämen beispielsweise frühe Santiagopilger in Frage, die auf ihrer Wallfahrt in den äußersten Westen Europas den Weg über Katalonien genommen hatten.
Wie dem auch sei, die Antwort, die der Laienbruder aus Spanien mitbrachte, klingt zwar zunächst etwas enttäuschend, denn die erhofften Nachrichten über Afra und Narcissus waren spärlicher Natur. Aber zumindest konnte Bischof Berengar von Girona bestätigen, dass der Heilige existiert und verehrt wird. Bei näherem Hinsehen gibt der Begleitbrief aus Spanien jedoch einige weitergehende Informationen preis.
Zunächst einmal schickt das Oberhaupt der Gironeser Kirche seinen Mitbrüdern in Augsburg einige Reliquien des heiligen Felix und seiner Begleiter. Er beeilt sich aber klarzustellen, dass es sich dabei um den alten, aus Afrika stammenden Glaubensboten und Märtyrer handle.
Vom Leichnam des Narcissus könne er hingegen nichts hergeben, denn dessen Körper sei unversehrt aufgefunden worden und man wolle ihn nicht zerstückeln. Deshalb müssten sich Abt und Mönche von St. Ulrich und Afra mit einem Teil der Stola begnügen, die im Grab gefunden worden sei. An der in Girona aufbewahrten Stola, die vermutlich aus dem 10. oder 11. Jahrhundert stammt, fehlt in der Tat ein kleines Stück, das bis ins 17. Jahrhundert in Augsburg nachweisbar ist.
Über den Begleiter von Narcissus, den Diakon Felix, weiß Berengar zu berichten, dass dessen Gebeine bereits vom Frankenkönig Karl nach Paris geschafft worden seien. Natürlich ist damit Karl der Große gemeint, der im Jahr 785 angeblich höchstpersönlich Girona erobert haben soll. Dass diese Geschichte auf historisch wackeligen Füßen steht, soll uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen.
Was die schriftlichen Traditionen angeht, so zeigt sich der Bischof in Bezug auf die Passio Felicis des alten Stadtheiligen Gironas großzügig. Die Abschrift, die er davon anfertigen ließ, wird in Augsburg aber kaum auf großes Interesse gestoßen sein. Und zu St. Afra scheinen der Bischof und der Gesandte des Abtes die jeweiligen Manuskripte verglichen zu haben. Der Informationsstand über sie war dabei offensichtlich gleich, so dass davon auszugehen ist, dass in beiden Städten die Conversio et passio Afrae schriftlich vorlag.





























