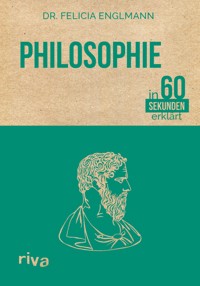Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mvg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Briefe bewegen Menschen, Briefe bewegen die Welt. Sie verändern den Lauf der Geschichte oder auch nur das Leben eines einzelnen Menschen. Mal erzählen sie Bedeutendes, mal Belangloses, mal Amüsantes oder Skurriles. In ihnen spiegelt sich das Schicksal der Welt. Dieses Buch versammelt 90 der faszinierendsten Briefe, die in deutscher Sprache je geschrieben wurden: von Politikern und Königen, Schriftstellern, Künstlern, Philosophen, Gelehrten, Wissenschaftlern, Weltenbummlern, Entdeckern, Erfindern und vielen anderen. Ausgestattet mit Faksimiles der Originale und erklärenden Texten, bietet diese Sammlung einen Einblick in die Gedankenwelt der großen Geister unserer Nation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2016
© 2015 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Es wurde versucht, die Urheberrechte an allen Texten und Reproduktionen zu ermitteln. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung oder eine nachweisbare Rechtsinhaberschaft aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis an den Verlag.
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, München
Coverabbildungen: iStock/Shutterstock
Satz: Carsten Klein, München
ISBN Print 978-3-86882-627-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-807-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-808-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Inhalt
Vorwort 7
Elsbeth von Baierbrunn an Dietmut 10
Maximilian I. an Sigmund Prüschenk 12
Albrecht Dürer an Willibald Pirckheimer 15
Johann Tetzel, Papst Leo X. und Albrecht von Brandenburg an die Gläubigen 20
Martin Luther an Albrecht von Brandenburg 23
Helena von Schallenberg an Christoph Schallenberg 27
Johannes Junius an Veronika Junius 32
Johann T‘Serclaes Graf von Tilly an Philipp Adolf von Ehrenberg 39
Gott an die Menschheit 42
Maria von Raden an Catharina Bruns 45
Werther an Lotte 48
Wolfgang Amadeus Mozart an Maria Anna Thekla Mozart 53
Friedrich Schiller an Christian Gottfried Körner 57
Immanuel Kant an Dietrich Ludwig Gustav Karsten 61
Matthias Claudius an Johannes Claudius 65
Friedrich Schiller an Johann Wolfgang von Goethe 69
Königin Luise von Preußen an Herzog Karl zu Mecklenburg-Strelitz 72
Andreas Hofer an Simon Kapferer 75
Ludwig van Beethoven an die „Unsterbliche Geliebte“ 78
E. T. A. Hoffmann an Theodor Gottlieb von Hippel d.J. 82
Ludwig van Beethoven an Franz Anton Stockhausen 84
Das Mägdelein an den Rittmeister des 4. Eskadron des 6. Chevauxlers-Regiment in Nürnberg 88
Alexander von Humboldt an Christian Gottfried Ehrenberg 91
Zur Feier der Vermählung 94
Richard Wagner an Mathilde Wesendonck 98
Karl Marx an Josef Valentin Weber 102
Georg von Neumayer an den unbekannten Finder 104
König Ludwig II. an Richard Wagner 108
Otto von Bismarck an die Presse 110
Johanna an Carl 113
Johannes Brahms an Clara Schumann 117
Sigmund Freud an Martha Bernays 120
Mary Vetsera an ihre Mutter, ihren Bruder Feri und ihre Schwester Hanna 123
Otto von Bismarck an unbekannt 126
Kaiser Wilhelm II. an Houston Stuart Chamberlain 128
Emil „Bär“ Orlik an seine Liebste in Wien 132
Josef Filser an den Oekonom Jakob Absreiter 135
Richard Degener an Gretel Degener 137
Franz Marc an Maria Marc 140
Franz Kafka an Julie und Hermann Kafka 143
Elisabeth Wanner an den Bayerischen Rundfunk 146
Herbert Frahm an einen Jungarbeiter 149
Walter Benjamin an Aage Friis 153
Herbert von Karajan an Richard Strauss 156
Adolf Eichmann an die Leitstellen der Geheimen Staatspolizei 159
Sophie Scholl an Fritz Hartnagel 164
Helmuth James an Freya von Moltke 167
Jakob Geimer an seine Frau 171
Bruno Reinke an seinen Vater Anton Reinke 174
Friedrich Dürrenmatt an das Radiostudio Bern 177
Albert Einstein an Erich Gutkind 179
Else Herzog an den Leiter des Heimkehrerlagers Friedland 181
Deutsche Atomforscher an Franz Josef Strauß 184
Marie Louise P. in Zittau an Anneliese H. in Meckenheim 188
Romy Schneider an Hermine Steckel 192
Die „Rote Armee Fraktion“ an die deutsche Bundesregierung 195
Josef Kardinal Ratzinger an die Gläubigen in der Diözese München und Freising 198
Erich Mielke an seine Genossen 205
Genosse Müller an Genosse Meißner 212
Udo Lindenberg an Erich Honecker 214
Ernst Messerschmid an Felicia Englmann 217
Die Botschaft der USA in West-Berlin an ausgewählte Bürger 220
Stefanie R. an die Welt 223
Julias Omi an den Nikolaus 225
Alice Schwarzer an Bushido 228
Unbekannte Love-Parade-Überlebende an das Schicksal 231
Der „Krümelmonster“-Erpresser an die Firma Bahlsen 234
Sachen zum Lachen 237
Personenregister 239
Bildnachweis 240
Vorwort
Seit die Menschen schreiben können, gibt es Briefe: schriftliche Nachrichten, die erst mit zeitlicher Verzögerung und meistens auch über räumliche Distanz hin beim Empfänger ankommen. Bevor es sie gab, konnten Menschen nur von Angesicht zu Angesicht kommunizieren – Rauchzeichen, Trommelsignale und andere nicht-wörtliche Kommunikation außer Acht gelassen.
Die ersten schriftlichen Botschaften entstanden vermutlich vor mehr als 5000 Jahren. Die Sumerer, Arkadier und Babylonier drückten Nachrichten in ihrer Keilschrift in Täfelchen aus weichem Ton. Die Ägypter wiederum schrieben mit Rußfarbe auf Papyrus, ein aus Gräsern hergestelltes Papier; ihre Schrift bestand aus detaillierten Bildern, den Hieroglyphen. Die südamerikanischen Indios übermittelten ihre Nachrichten mit einer komplizierten Knotenschrift. Tontäfelchen, Papyri und Knoten konnten von einem Boten vom Sender zum Empfänger gebracht werden. Das hatte den Vorteil, dass der Bote die Botschaft nicht auswendig lernen musste, dass er mehrere Botschaften zugleich transportieren und der Empfänger die Botschaft eindeutig nachvollziehen konnte. Er hatte es „schwarz auf weiß“, wie es heute heißt.
Der Brief ist als Erfindung mindestens so praktisch wie das Rad – er bedeutete nicht weniger als eine Revolution der Kommunikation. Die Sprachen und Schriften, in denen er geschrieben wurde, kamen und gingen, und auch die Zahl derer, die lesen und schreiben konnten, änderte sich laufend. Meistens war es nur die gebildete Oberschicht, und auch das Schreibmaterial an sich war hochpreisig und damit nicht für jedermann verfügbar. Ein Brief war etwas Kostbares und enthielt wichtige Informationen. Ein Teil des Neuen Testaments der Bibel besteht aus Briefen – diese trugen damals, als sie in die ersten Gemeinden geschickt wurden, wesentlich zur Verbreitung des Christentums bei und sind heute ein Teil der christlichen Heilsbotschaft.
Die Bedeutung, die man Briefen beimaß, spiegelt sich in der deutschen Sprache. Etwas ist „verbrieft“, wenn es urkundlich sichergestellt ist. „Brief“ war lange Zeit ein Synonym für Urkunde; ein Adelsbrief etwa ist ein Dokument, das dem Inhaber bestätigt, dass er in den Adelsstand erhoben ist. Der Wappenbrief bestätigt dem Besitzer sein heraldisches Abzeichen. Ein Bürgerbrief war in früheren Jahrhunderten die Einbürgerungsurkunde in eine Stadt und somit die Garantie der Bürgerrechte für den Inhaber. Er hatte diese Rechte „mit Brief und Siegel“ bekommen, also ganz sicher – Briefe im Sinne von Urkunden trugen immer echte Siegel.
Die ältesten erhaltenen Briefe in deutscher Sprache stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert. Im ersten Moment verwundert es, dass es keine früheren deutschen Schriftzeugnisse gibt; es liegt vor allem daran, dass die Schriftsprache Mitteleuropas im Mittelalter das Lateinische war. Die Römer hatten es als Sprache der Verwaltung und des Militärs in Europa verbreitet, die Kirche als wichtigster Kulturträger des Mittelalters pflegte Latein weiter. Es bot die Möglichkeit, sich auch über Landesgrenzen hinweg zu verständigen, so wie Englisch das heute tut. Auch der Unterricht in den Klosterschulen wurde in lateinischer Sprache gehalten, alle wichtigen Bücher waren in lateinischer oder griechischer Sprache geschrieben, Latein war die Sprache der Gelehrten und Gebildeten. Martin Luther etwa schrieb sowohl seinen berühmten Brief an Albrecht von Brandenburg als auch seine 95 Thesen auf Latein. Auch wenn dieses Buch sich auf deutsche Briefe konzentriert, sind einige wenige lateinische Briefe dennoch enthalten; bei ihnen handelt es sich um wichtige Zeugnisse der deutschen Geschichte, die nicht ausgelassen werden dürfen. Sie sind jedoch nicht auf Latein transkribiert, sondern wurden übersetzt.
Volkssprachen wie die deutschen Dialekte waren die Sprachen des Alltags, für Fürsten und Kirchenleute ebenso wie für alle anderen Menschen. Ein überregional gleiches Standard-Deutsch mit Rechtschreib- und Grammatikregeln wie heute gab es noch nicht, als die ersten Briefe auf Deutsch geschrieben wurden. Sie sind deshalb sehr schwer zu lesen – denn die Schreiber schrieben, wie sie sprachen. Es hilft, die Briefe laut zu lesen, um sie zu verstehen. Bei einigen der älteren Briefe in diesem Band ist jedoch zur Erleichterung der Lektüre eine Übertragung in modernes Deutsch beigefügt. Denn manche Wörter der deutschen Sprache haben ihre Bedeutung im Lauf der Jahrhunderte verändert, manche Begriffe früherer Zeiten sind heute vergessen.
Auch das Medium, auf dem ein Brief geschrieben steht, hat sich regelmäßig verändert. Im europäischen Mittelalter schrieb man auf Pergament, dünner Tierhaut. Daraus bestanden auch alle Bücher des Mittelalters. Pergament war teuer, daher wurde möglichst platzsparend darauf geschrieben, und viele Häute wurden mehrmals verwendet, denn die Tinte konnte davon abgeschabt werden. Auch dies ist ein Grund, warum nur so wenige Briefe aus dem Mittelalter erhalten sind und diese vor allem offiziellen Charakter haben. Privatbriefe mit Grüßen, Klatsch und Tratsch zu verschicken war ein kostspieliges Vergnügen – zu kostspielig für die meisten Menschen.
Papier wurde in Deutschland erst ab 1390 hergestellt. Tinte und Papier blieben für die nächsten Jahrhunderte die Mittel der Fernkommunikation. 1490 ließ Kaiser Maximilian I., selbst ein begeisterter Briefeschreiber, in seinem Reich Poststationen einrichten – diese verbesserten das Botennetz und dessen Organisation. Die Reiter mit den Briefen im Gepäck wechselten sich gegenseitig ab und tauschten an den Stationen auch Briefe aus, damit nicht mehr jeder Brief einzeln transportiert werden musste. Die Post wurde jetzt zum wichtigen Kommunikationsmittel, das Postnetz in Europa wurde immer weiter verbessert. Fürsten eröffneten ihre eigenen Landespostagenturen. Der aus dem heutigen Bayern stammende Generalpostmeister der Kaiserlichen Reichspost und der Spanischen Niederlande, Eugen Alexander von Thurn und Taxis, wurde wegen seiner Verdienste um die Post in den Adelsstand erhoben – selbstverständlich mit einem Adelsbrief.
Post zu verschicken war teuer, auch deshalb blieb die Post lange ein Privileg der Oberschicht, der Brief etwas Besonderes. Bezahlen musste die Post lange Zeit der Empfänger. Den freute das nicht immer, vor allem, wenn er den Brief vielleicht gar nicht haben wollte. Daher kamen im 19. Jahrhundert gleich mehrere Postmitarbeiter und Verwaltungsbeamte auf die Idee, die Bezahlung anders zu regeln: Der Absender sollte schon beim Wegschicken des Briefs das gesamte Porto bezahlen. Als Bestätigung dessen wurde ein Stück Papier auf den Briefumschlag geklebt und dann mit einem Stempel entwertet – die Briefmarke war erfunden. Die britische „One Penny Black“ mit einem Porträt der Königin Victoria war 1860 weltweit die Erste ihrer Art. Im Bereich des heutigen Deutschland war Bayerns „Schwarzer Einser“ 1849 die erste Briefmarke.
Die meisten Briefe in diesem Buch stammen aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert; in dieser Zeit wurden besonders viele Briefe geschrieben, die außerdem gut erhalten und heute auch verständlich sind. Schreiben war etwas, das zum Leben dazugehörte – ob man sich verabreden, seine Liebe gestehen oder mit Wissenschaftler-Kollegen in Kontakt bleiben wollte. Das Postsystem war die ganz reale Vernetzung der Welt.
Weder Telegramm noch Fernschreiber, Telefon, Telex oder Telefax konnten dem Brief ernsthaft Konkurrenz machen. Doch als der US-amerikanische Computertechniker Ray Tomlinson 1971 die E-Mail erfand, war dies der Anfang eines grundlegenden Kommunikationswandels. Die elektronische Post hat die Zeit, die zwischen dem Senden und Empfangen einer schriftlichen Botschaft liegt, auf Sekundenbruchteile verkürzt. Sie macht Papier, Kuvert, Marke und Gänge zu Post und Briefkasten überflüssig. Die interessante Post kommt heute elektronisch, als E-Mail oder auch als Kurznachricht: Freunde aus dem Ausland melden sich, Kollegen aus einer anderen Stadt schicken wichtige Informationen (oder Links zu etwas Lustigem), Verwandte mailen ein Foto aus dem Urlaub. Im Hausbriefkasten dümpeln Werbung und Rechnungen herum. Doch wirklich Bedeutendes kommt immer noch per Brief und nicht per Mail: eine handgeschriebene Einladung zu einer Hochzeit etwa. Eine Karte mit dem Foto eines Neugeborenen. Eine Mahnung vom Finanzamt. Der neue Arbeitsvertrag. Die Nachricht, dass man einen Preis gewonnen hat.
Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die heute im Briefkasten liegen – und genauso unterschiedlich sind die Briefe in diesem Band. Er versammelt eine Auswahl bedeutender Schreiben aus dem deutschsprachigen Raum – wo möglich, sind diese mit Reproduktionen der Originale abgedruckt. Es sind Schreiben von Privatleuten ebenso wie von Prominenten, von berühmten historischen Persönlichkeiten wie von ganz gewöhnlichen Menschen. Sie zeigen in einzigartiger Weise, was Menschen wichtig war, und spiegeln so oft das Weltgeschehen wider. Manche enthalten auch Informationen von Weltbedeutung, andere scheinbar Banales oder Belangloses. All diese Briefe haben eine ganz besondere Geschichte: Sie mag eine Überraschung sein oder eine, die in Geschichtsbüchern steht. Sie kann einzigartig sein oder, wie in den Weltkriegen, für das Schicksal vieler stehen, die Ähnliches erlebt haben. Auch das macht einen Brief bedeutend. In den Briefen in diesem Buch spiegelt sich ein Stück deutscher Geschichte. ■
Dr. Felicia Englmann
München, im September 2015
1305
Elsbeth von Baierbrunn an Dietmut
Jch elspet von pæierbrvne enpivt der lieben vn(d) der getriwen
der chastenærein getrawelich mine driwen dienst vn(d) wizet daz mich gar hart nah ivch petraget an mine mv eterlin daz ich niemen waize daz mv
nch da mich als hart nach pelange als nach dir liebiv diemvt der en zwai prach mir daz herze mine den lieze ich ivch vile liebiv miten trine sehen mit iwern pelzen vn mit iwer chvrsen allen vn(d) mit iwern grozen schvhen si mvzen aver schon gewischet sin da mit plege iwer der svze got grvzet mir div mvlhavs ærein
Übertragung in modernes Deutsch:
Ich, Elsbeth von Baierbrunn, entbiete der lieben und treuen Kastnerin getreulich meinen treuen Dienst. Ihr solltet wissen, dass ich sehr bekümmert bin um Euch in meinem Gemüte, weil ich nicht bei Euch in München sein kann, da es mich nach niemandem so sehr verlangt, als nach Euch. Doch ehe mir noch das Herz entzwei bricht, lasse ich Euch Pelzröckchen und mächtige Schuhe: Die wollen aber gut geputzt sein. So beschütze Euch der gütige Gott! Grüßt mir auch die Mühlhäuserin!
Das Zeugnis einer Freundschaft
Der Ort Baierbrunn ist von der Münchner Altstadt nur etwa 17 Kilometer entfernt. Ein Katzensprung, eine gemütliche Pendlerdistanz, von München aus ein Ziel für einen sonntäglichen Fahrradausflug.
Im Mittelalter lagen zwischen München und Baierbrunn Welten. Mit dem Floß ging die Reise flussabwärts schnell, zurück brauchte man einen ganzen Tag. Mal eben eine Freundin oder Verwandte zu besuchen war nicht drin. Und so schrieb Elisabeth von Baierbrunn, genannt Elsbeth, ihrer Freundin Dietmut in München Briefe. Oder vielleicht auch nur einen Brief – nämlich den einen aus dem Jahr 1305, der erhalten geblieben ist. Elsbeth hat ihn in einem Ort namens Steinhausen geschrieben, der heute nicht mehr zugeordnet werden kann. Das Dorf Steinhausen, das heute zur Landeshauptstadt gehört, gab es im Mittelalter noch nicht, ebenso wenig die schwäbische Wallfahrtskirche Steinhausen.
Wo Elsbeth auch war, sie vermisste Dietmut. Diese war „Kastnerin“ von Beruf: In einem Kloster, vermutlich dem Kloster St. Jakob am Anger in München, war sie für den „Kasten“ verantwortlich. Im Kasten sammelten die Klöster die Abgaben, die Untertanen bei ihnen ablieferten – Geldzahlungen oder auch Naturalien. In Bayern ist „Kasten“ bis heute ein Synonym für „Schrank“.
Wo Elsbeth lebte, ist nicht bekannt. Dass sie Dietmut jedoch schreiben konnte, ist im Jahr 1305 eine echte Besonderheit, denn üblicherweise konnten nur gebildete adelige Frauen oder Klosterfrauen lesen und schreiben. Die meisten Menschen jener Zeit, Männer wie Frauen, waren Analphabeten. Es gab auch kein Papier in Mitteleuropa. Man schrieb auf Pergament, dünn geschabten Häuten, die sehr teuer waren. Bücher bestanden ebenfalls aus Pergament und waren handgeschrieben.
Elsbeth und Dietmut gehörten offenbar zur geistigen Elite. Bemerkenswert ist zugleich, dass Elsbeth in deutscher Sprache an Dietmut schrieb. Im 14. Jahrhundert waren fast alle Briefe, Urkunden und Bücher in lateinischer Sprache geschrieben, der Sprache der Kirche und der Politik. Der kleine Brief der Freundinnen ist der älteste erhaltene Privatbrief in deutscher Sprache.
Die Geschenke, die Elsbeth beilegte, waren ebenso luxuriös wie das Pergament, auf dem der Brief geschrieben ist: ein Pelzröckchen und feste Schuhe. Die meisten Menschen jener Zeit besaßen weder das eine noch das andere. Elsbeth muss reich gewesen sein, um der Freundin diese Schätze schenken zu können. Vielleicht war sie, obwohl sie lesen und schreiben konnte, keine Klosterfrau, sondern eine Tochter aus gutem Haus oder Ehefrau eines reichen Adeligen. In Baierbrunn gab es im Mittelalter eine Höhenburg – möglicherweise stammte Elsbeth von dort. Ob sie dort überhaupt noch lebte oder an einem anderen Ort, ist nicht bekannt.
Ob Elsbeth mit Dietmut verwandt war, ob sie sich doch aus einem Kloster kannten, ob sie befreundet waren oder ein Paar waren, wird niemand mehr herausfinden. ■
8. Dezember 1477
Maximilian I. an Sigmund Prüschenk
Maximilian herczog zu Osterreich Burgund Brabant, etc. Brügge 8. Dezember 1477.
Lieber Herr Sigmund, ich fueg euch zuewißen, das mir von gottes gnaden wolgehet und die groß begihr, die ich hab, die ist, daß ich unsern lieben herrn undt vatter bey mir heroben hiet mit seiner persohn. hoff ich mich aller meiner feindt zuerwehren, ich hab ein schöns froms tugenhafftigs weib, daz ich mich benuegen laß und danckh Gott. sie ist so lang als die Leyenbergerin, von leib klein viel kleiner den die Rosina und schneeweis. ein prauns haar, ein kleins naßl, ein kleins heuptel und antlitz, praun und graube Augen gemischt, schön und lauter. dann daz unter heutel an augen ist etwas herdann gesenkt, gleich als sie geschlaffen hiet, doch es ist nit wol zumerckhen, der mund ist etwas hoch doch rein und rot. sonst viel schöner jungfrowen alls ich all mein taag bey einer gesehen hab und frölich. das frawenzimmer nichts bey den tag verspert die nacht uber, es ist daz gantz haus voll iungfrowen undt frowen bey xl. sie muegen auch den gantzen taag uberahl im haus umblauffen. die alt fraw unser mutter ist eine feine schöne fraw zu ihr maß und vast listig viel … hetten wir hie fried wir säßen im rosengarten. mein hoffleut kommen nu wol von den paad zue Bruckh in flandern. sagen desgleichen haben wir all khussen gelernt, mein gemahl ist ein gantze waidtmännin mit valckhen und hundten. sie hatt ein weiß windtspil, daz laufft vast bald. daz liegt zu maisten theil alle nacht bey uns, hie legt sich jedermann umb xii nieder schlaffen zue morgen wieder auff umb viii, ich bin aber der armist mensch daz ich nicht essen schlaffn spatziren stechen mag von übrigen geschefften. datum Bruckh in flandern an unser lieben frawentag conceptionis lxxvii.
p. m. p.
herrn Sigmunden Prueschnickhen.
Der junge Maximilian mit seiner Ehefrau Maria von Burgund. Lithografie nach einer Illustration aus dem 15. Jahrhundert.
Übertragung in modernes Deutsch:
Lieber Herr Sigmund, ich lasse Euch wissen, dass es mir von Gottes Gnaden gut geht, und was ich mir wünschte ist, dass mein lieber Herr und Vater persönlich bei mir hier oben wäre. Ich hoffe, mich aller meiner Feinde erwehren zu können, ich habe eine schöne, tugendhafte Ehefrau, damit begnüge ich mich und danke Gott. Sie ist so groß wie die Leyenbergerin und zierlich, noch zierlicher als die Rosina, und schneeweiß. Sie hat braune Haare, ein kleines Näschen, kleinen Kopf und kleines Gesicht, ihre Augen sind braun und grau gemischt, sie ist schön und unverdorben. Ihre Lider sind etwas gesenkt, als hätte sie geschlafen, aber es fällt nicht auf, und der Mund sitzt etwas hoch, ist aber makellos und rot. Ansonsten ist sie eine viel schönere Jungfrau als ich je eine gesehen habe, und fröhlich. Tagsüber und auch nachts sind die Frauengemächer nicht abgesperrt, und das ganze Haus ist voller Jungfrauen und Frauen, an die 40. Sie dürfen auch den ganzen Tag lang überall im Haus herumlaufen. Meine Schwiegermutter ist eine feine, schöne Frau; sie ist maßvoll und sehr gescheit ... hätten wir hier Ruhe, wir säßen im Rosengarten. Meine Hofleute kommen nun wohl bald nach Brügge in Flandern. Sie sagen auch, dass wir alle das Küssen gelernt haben. Meine Gattin ist eine ganze Waidmännin mit Falken und Hunden. Sie hat einen Windhund, der rennt irre schnell. Der Hund liegt die meiste Zeit der Nacht bei uns; hier legt sich jedermann um zwölf hin zum Schlafen und steht um acht morgens wieder auf. Ich bin aber der ärmste Mensch, dass ich nicht essen, schlafen, spazieren und Lanzen stecken kann, vor lauter anderer Beschäftigungen. Datum Brügge in Flandern am Tag Mariä Empfängnis
Des Kaisers neue Gattin
Auch ein Kaiser braucht Freunde, nicht nur Berater, Lehrer, Ritter, Kanzler. Der Habsburger Herrscher Maximilian I. (1459-1519) hat einen sehr guten Freund: Sigmund Prüschenk, den Grafen von Hardegg. Er ist ein Freund im echten Leben, aber auch ein Brieffreund, mit dem sich Maximilian austauscht, wenn Prüschenk nicht am Hof ist.
Die beiden lernen sich schon als junge Männer kennen. Sigmund und sein Bruder Heinrich gehören zum Hofstaat, Sigmund ist Kaiserlicher Rat und Hofmarschall bei Kaiser Friedrich III., Maximilians Vater. Maximilian I. von Habsburg, 1459 geboren, wächst als Erbprinz an Wiener Hof auf. Seine Mutter Eleonore Helena von Portugal ist für seine Erziehung zuständig, der Vater Friedrich III. kümmert sich wenig um den Sohn. Vertrauen fasst Maximilian zu dem etwa 15 Jahre älteren Sigmund Prüschenk.
Im Sommer 1477 ist Maximilian in den habsburgischen Niederlanden und heiratet 18-jährig am 19. August die 20-jährige Erbprinzessin und Herzogin Maria von Burgund: eine Vernunftehe. Maria braucht einen Gatten, um ihre Rechte auf das Herzogtum besser gegen Frankreich verteidigen zu können. Maximilian wird so Herzog von Burgund. Dort liegen die mächtigen und wichtigen Handelsstädte Gent und Brügge, die zu den reichsten Metropolen der Zeit gehören. Sigmund und Heinrich Prüschenk bleiben am Wiener Hof.
Maximilian ist ein Fremder in Burgund, die Stände der Niederlande waren gegen seine Einheirat, er muss sich erst einleben. Im Dezember schreibt er an Sigmund, dass er seinen Vater vermisst, und beschreibt dem väterlichen Freund die neue, hübsche Ehefrau. Er erwähnt auch, dass sie ihren weißen Windhund mit ins Eheschlafzimmer bringt.
Maria stirbt 1482 bei der Geburt ihres dritten Kindes Franz. Zwei weitere Male heiratet Maximilian; eine Ehe wird nach wenigen Monaten aufgelöst, die dritte Ehefrau überlebt er.
1486 wird Maximilian römisch-deutscher König. Bis 1493 schreiben sich Prüschenk und Maximilian Briefe. Dann stirbt Kaiser Friedrich III., Maximilian wird 1493 Erzherzog von Österreich. 1508 wird er Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.
An Maximilians Hof haben die Prüschenks deutlich weniger Einfluss, als sie sich vielleicht erwartet haben. Das Verhältnis zwischen dem Kaiser und seinem väterlichen Freund kühlt deutlich ab. Dennoch erhebt sie Maximilian 1495 in den Stand von Reichsgrafen. Sigmund Prüschenk stirbt 1502. Maximilian regiert bis zu seinem Tod 1519. ■
8. September 1506
Albrecht Dürer an Willibald Pirckheimer
Venedig, 8. September 1506
Hochgelerter bewert weiser, viller sproch erfarner, bald ferstendiger aller vürprochten lügen vnd schneller erkener rechter worheit, ersamer hochgeachter her Wilbolt Pirkamer. Euer vnterteniger diner Albrecht Dürer günd ewch heill, große vnd wirdige er. Cu diawulo tanto pella czansa chi tene pare. Io vole denegiare cor woster, dz Ir werd gedencken, ich sey awch ein redner von 100 partire. Es mus ein schtuben mer den 4 winkell haben, doreinman dy gedechtnus götzen setzt. Ich voli mein caw nit domit inpazare, ich will ewchs rekomandare, wan ich glawb, dz nit so multo kemerle im kopff sind, dz Ir in iettlichs ein pitzelle behalt. Der margroff word nit so lang audientz geben; 100 artickell vnd ietlicher artigkell 100 wortt prawchen eben 9 dag 7 schtund 52 mynuten an dy suspriry, derhab ich noch nit gerechnett. Dorum wert Irs awff ein moll nit reden werden etc., es wolt sy verlengen wis Tettels red.
Item allen fleis hab ich ankertt mit den tewichen, kan aber kein preiten ankumen, sy sind al schmall vnd lang; aber noch hab ich altag forschung dornoch, awch der Anthoni Kolb. Ich hab Pernhart Hirsfogell eweren grosß geseit, hett er vch wigerum ettpotten sein dinst; vnd er ist gantz vol betrübnus, wan sein sun ist im geschtorben, der ertigst pub, den ich al mein dag gesehen hab.
Item der narnfederle kann ich keins bekumen. Oh wen Ir hy wert, was wurd Ir hüpscher welscher lantzknecht finden; wy gedenck ich so oft an ewch, wolt got, dz Irs vnd Kuntz Kame[r]er solten sehen. Do haben sy runckan mit 278 spiczen, wo sie ein lanczknecht mit anrüren werden, so schtirbter , wan sy sind all vergift[!]. Hey, ich kan woll thon, will ein welscher lanczknecht. Dy Fenedier machen groß folk, des gleichen der pobst, awch der kung von Franckreich, was traws wirt, dz weis ich nit, den vnsers künix spott man ser etc.
Item wünscht mir Steffen Pawmgartner vill glüx, mich kann nit verwunderen, dz er ein weib hatt genumen. Grüst mir den Porscht, her Lorenczen vnd vunser hüpsch gesind als awch ewer Rechenmeisterin vnd danckt mir ewrer schtuben, dz mich grüst hatt, sprecht, sy sey ein vnflott. Ich hab ir olpawmen holtz lassen füren von Fenedich gen Awgspurg, do los ichs ligen, woll 10 tzentner schwer vnd sprecht, sy hab sein nit wollen erbarten, pertzo el sputzo.
Item wist, dz mein thafell sagt, sy wolt ein dugaten drum geben, dz Irs secht, sy sey gut und schon fon farben. Ich hab gros lob dordurch überkumen, aber wenig nutz. Ich wolt woll 200 dug[aten] der tzeit gwunen haben vnd hab groß erbett awsgeschlagen, awff dz ich heim müg kumen, vnd ich hab awch dy moler all geschtilt, dy do sagten, im stechen wer ich gut, aber im molen west ich nit mit farben vmzwgen. Itz spricht ider man, sy haben schoner farben nie gesehen.
Item mein frantzossischer mantell lest ewch großen und mein welscher rochk awch. Item mich dunckt, Ir schtinckt von huren, dz ich ewch hy schmeck vnd man sagt mir hy, wen Ir pult, so gebt Ir fur, yr seit nit mer den 25 jor alt, ocha, multiplitzirtz, so hab ich glawben tran. Lieber, eß sind so leichnam fill Walhen hy, dy eben sehen, wy Ir, ich weis nit, wy es zwgett.
Item der hertzog vnd der patryach haben mein thawfell awch gesehen. Hymit last mich eweren befolhen diener sein. Ich mus werlich schlaffen, wan es schlecht eben 7 in der nacht, wan ich hab awch itz dorfor geschriben dem prior zw den Awgustineren, meinem schweher, der Trittrichin vnd meinem weib vnd sind schir eitell pogen voll. Dorum hab ich geilt. Lestz noch dem sin, Ir wert ewch sein woll pesseren mit furschten zw reden. Vill guter nacht vnd dag awch. Geben zw fenedig ann vnser frawen dag im september.
Item Ir dürft meinem weib vnd müter nix leihen, sy haben itz geltz genug.
Albrecht Dürer
Übertragung in modernes Deutsch:
Hochlehrter und bewährt weiser, vieler Sprachen kundiger, bald verstehender aller vorgebrachten Lügen und schneller die echte Wahrheit erkennender, ehrsamer hochgeachteter Herr Willibald Pirckheimer! Euer untertäniger Diener Albrecht Dürer gönnt Euch Heil, große und würdige Ehre. Einen Teufel interessiert mich solches Geschwätz! Ich wette drauf, dass Euer Herz stehen bleibt, wenn Ihr sowas lest, und ihr werdet mich auch für so einen Schwätzer halten. Ein Zimmer muss mehr als vier Ecken haben, um da die Gedächnisgötzen hineinzusetzen. Aber damit lasse ich mich nicht verrückt machen. Ich will Euch etwas empfehlen, weil ich glaube, dass es im Kopf gar nicht so viele Kämmerlein gibt, dass ihr euch jede Kleinigkeit merken könnt. Der Markgraf wird keine so lange Audienz geben, 100 Schriftabschnitte, und etliche Abschnitte brauchen 100 Worte, das braucht schnell mal neun Tage, sieben Stunden und 52 Minuten, ohne die Atempausen, die habe ich noch gar nicht mitgerechnet. Daher werdet ihr auf ein Mal nicht reden etc., man wird Sie langweilen wie das Gerede eines Tattergreises.
Ich habe mich um den Posten Teppiche gekümmert, kann aber keinen breiten bieten, sie sind alle schmal und lang; aber noch suche ich täglich danach, auch der Anton Kolb sucht. Ich habe Bernhard Hirschvogel ihren Gruß bestellt, er hat auch seine Hilfe angeboten; und er ist sehr traurig, weil sein ältester Sohn gestorben ist, den ich jeden Tag gesehen habe.
Von dem Posten Narrenfedern [gemeint sind Kranichfedern] habe ich ebenfalls nichts bekommen.
Oh, wenn Ihr nur hier wärt, was würdet Ihr hübscher italienischer Landsknecht finden; wie oft denke ich an Euch. Wollte Gott nur, dass Ihr und Kunz Kammerer das sehen könntet. Da haben sie Spieße mit 218 Spitzen [gemeint sind gezähnte Schneiden der Spitzen]; wenn die ein Landsknechte berührt, dann stirbt er, denn die sind alle vergiftet. Hey, ich könnte auch ein italienischer Landsknecht werden. Die Venediger ziehen viele Soldaten zusammen, desgleichen der Pabst, auch der König von Frankreich; was daraus wird, weiß ich nicht, denn unser König wird sehr verspottet etc.
Grüßt mir Stefan Paumgartner; es wundert mich nicht, dass er geheiratet hat. Grüßt mir den Porst, Herrn Lorenzen, unser hübsches Gesinde und Eure Rechenmeisterin und dankt mir in Eurer Stube, dass sie mich gegrüßt hat, und richtet ihr aus, dass sie ein Unflat ist. Ich habe ihr Olivenholz von Venedig nach Augsburg geschickt, dort lasse ich es lagern, es sind wohl zehn Zentner, und sagt ihr, sie hat es ja nicht erwarten können, daher der Gestank.
Wisst, dass man mein Bildchen [gemeint ist die Karikatur im Brief] bedeutet, dass sie mir dafür einen Dukaten geben wollte, dass ihr sagt, es sei gut und von schöner Farbe. Ich habe dafür großes Lob bekommen, aber wenig Nutzen. Ich wollte in der Zeit 200 Dukaten verdient haben und habe gute Angebote ausgeschlagen, damit ich nach Hause könnte, und ich habe auch die Maler alle zum Schweigen gebracht, die da sagten, dass ich gut im Stechen wäre, aber im Malen mit Farben wäre ich für nichts zu gebrauchen.
Sodenn lässt Euch mein französischer Mantel grüßen und mein italienischer Rock auch. Ich glaube, Ihr stinkt nach Huren, so dass ich Euch bis hier rieche, und man sagt mir hier, dass wenn ihr buhlt, so gebt ihr vor, Ihr seid nicht mehr als 25 Jahre alt. Multipliziert das, dann glaube ich es. Lieber, es gibt hier so viele Italiener, die so aussehen wie Ihr, ich weiß gar nicht, wie das zugeht.
Der Doge und der Patriarch haben mein Bild auch gesehen. Hiermit empfehle ich mich Ihnen als Ihr Diener. Ich muss jetzt wirklich schlafen, denn es schlägt eben sieben Uhr [gemeint ist ein Uhr Nachts; Dürer benennt die zeit nach venezianischer und nürnbergischer Stundenrechnung], weil ich vorher schon dem Prior der Augustiner, meinem Schwiegervater, der Dietrichin und meiner Frau geschrieben habe, da sind nun etliche Bogen voll. Darum habe ich mich beeilt. Lest noch dem seinen, ihr werdet dadurch geschickter werden, mit Fürsten zu reden. Vielmals gute Nacht und auch guten Tag. Geschrieben in Venedig am Tag Mariä Geburt.
Ihr dürft meiner Frau und meiner Mutter nichts leihen, sie haben jetzt Geld genug.
Freundschaftsgrüße aus Venedig
Der Künstler Albrecht Dürer und der Ratsherr und Gelehrte Willibald Pirckheimer kannten sich aus ihrer Heimstadt Nürnberg und verstanden sich prächtig. Albrecht Dürer (1471-1528) arbeitete in der Nürnberger Altstadt, seit 1497 in einer eigenen Künstlerwerkstatt, und verdiente seinen Lebensunterhalt mit Auftragswerken. Vor allem waren dies Porträts der Reichen und Mächtigen seiner Zeit, aber auch Werke religiösen Inhalts für Kirche und Kirchenfürsten. Willibald Pirckheimer (1470-1530) stammte aus einer reichen Patrizierfamilie, war ein „Pfeffersack“, wie man damals sagte. Um das Jahr 1495 sollen sie sich kennengelernt haben. Pirckheimer, studierter Jurist, war Ratsmitglied in Nürnberg und juristischer Berater, er konnte von seinem Vermögen leben, ein wenig Handel betreiben, sich aber vor allem als Universalgelehrter profilieren. Er schrieb Satiren und gelehrte Texte, interessierte sich für die Ursprünge der Weisheit im Orient (ein Modethema der Zeit) – und liebte es, mit dem ebenso unkonventionellen Dürer zusammenzusitzen und sich zu unterhalten. Beide gehörten zur geistigen Avantgarde in der alten Kaufmannsstadt, sahen sich dem Humanismus verpflichtet, diskutierten gerne neue philosophische Strömungen, bewunderten die Renaissancekultur Italiens und unterstützten die Reformthesen Martin Luthers.
Dürer war begeistert von der Malkunst Italiens; schon als junger Mann reiste er nach Italien, 1505 zog es ihn erneut nach Venedig, wo seine Idole arbeiteten: die Künstler Tizian, Giorgione, Palma der Ältere, Giovanni Bellini. Auch Pirckheimer war Italienfan, hatte in Padua und Pavia studiert und den Geist der Renaissance aufgesogen. Er lieh Dürer Geld für seine Reise und gab ihm ein paar Handelsaufträge mit, vor allem Waren sollte Dürer einkaufen.
Der Maler schrieb seinem Freund und Gönner regelmäßig, zehn Briefe sind erhalten. Dürer schildert darin, was er in Venedig erlebt, wie seine künstlerische Arbeit vorangeht und ob er die von Pirckheimer gewünschten Waren besorgen konnte. Er schreibt an Pirckheimer nicht in dem förmlichen Stil, in dem Geschäftsbriefe der Zeit formuliert sind, sondern wie ein Freund an einen Freund, mit Insiderwitzen, Sprüchen, Anspielungen und kleinen Zeichnungen im Text. Im Jahr 1506 arbeitete Dürer in Venedig an einem großformatigen Altarbild, das „Rosenkranzfest“ für die Kirche San Bartolomeo in Venedig, der Kirche der deutschen Kaufleute. Es sollte ihn europaweit berühmt machen.
Am 8. September 1506 schreibt Dürer, mit schwarzer Tinte und Feder, wieder einen langen Brief nach Nürnberg – den hier gezeigten. Wie auch in den anderen Briefen ist für Außenstehende nicht alles verständlich, Jahre einer Männerfreundschaft stecken zwischen den Zeilen. Daher weiß heute niemand, wer mit der lustigen Zeichnung unten auf dem Blatt gemeint ist. Da hat der berühmteste und beste Porträtmaler seiner Zeit nämlich mal schnell eine Karikatur hingekritzelt: ein lachendes Menschlein mit prominenten Zähnen, irrem Blick, großer Nase und abstehenden Krisselhaaren. Lustig. Fand Pirckheimer sicher auch. Nur – wer ist da karikiert? Die Forschung rätselt. Ist damit „die Rechenmeisterin“ Pirckheimers gemeint, der Dürer in dem Brief Grüße bestellt? War sie Pirckheimers Geliebte, die vielleicht nicht schön war, aber andere Qualitäten hatte? Sind damit die im Brief erwähnten „bulen“ und „unser hüpsch gesind“ gemeint, wie Dürer die Nürnberger Ratsherren despektierlich bezeichnet? Das wohlriechende Stück Ölbaumholz, das Dürer mit dem Brief schickt, soll sicher nicht die Toilette in Pirckheimers Stube beduften helfen, wie der Dürer-Kenner Horst Figge in einem Aufsatz schreibt, sondern es dürfte sich um ein antikes Kultbild der Göttin Athene gehandelt haben; ein Humanistenscherz, den man vermutlich nur in der Renaissance verstanden hat. Die Göttin Athene soll den Anbau von Ölbäumen in die Welt gebracht haben, und ihr Kultbild sollte Städte beschützen. Die Krakelei könnte eine Karikatur der Statuette gewesen sein.
Pirckheimers Antwortbriefe an Dürer sind nicht erhalten, auch keine Athene-Statue aus seinem Nachlass. Die Unflätigkeit in der Nürnberger Stube – was immer sie auch gewesen sein mag – bleibt ein Geheimnis ihrer Männerfreundschaft. ■
1517
Johann Tetzel, Papst Leo X. und Albrecht von Brandenburg an die Gläubigen
Zusammenfassung und Übertraguung in modernes Deutsch:
Albrecht, von Gottes Gnaden Erzbischof von Mainz und Mageburg, Erzkanzler des Heiligen Römischen Reichs, Kurfürst, Apostolischer Administrator des Stifts Halberstadt, Fürst von Burggau und Nürnberg, Markgraf von Brandenburg, Herzog von Stettin, Pommern, Kassuben, Beschützer des Franziskanerordens, verkündet eine Entscheidung Papst Leos X. für die Provinzen Mainz und Magdeburg, für die Stadt und Diözene Halberstadt ebenso wie für die Ländereien und Gebiete des edelsten Fürsten und Markgrafen von Brandenburg.
Allen und jedem einzelnen seiner direkten und indirekten Untertanen, Subkommissarien und Botschaftern, ist bekannt zu machen, dass unser Heiliger Vater Papst Leo X. Kraft der göttlichen Allmacht allen und jedem einzelnen Christgläubigen aus Anlass der Renovierung der Peterskirche in Rom verfügt hat: Die Christgläubigen können einen umfassenden und vollständigen Ablass und andere Vorzüge erwerben.
[...]
Deinem Tod folgt nichts Schlimmes nach, wenn du um völligen Ablass ansuchst und der Sündenstrafe dadurch entgehst. Der Ablass und der bevorstehende Sündenerlass gelten für das Leben und den Tod. Dennoch sind die Feier der heiligen Eucharistie (besonders an Karfreitag und Ostern) stets auszuführen.
[...]
Und so widmet [... Eintragungen in Fremdhand] Adam Rost [?] selbiger Erneuerung der Basilika unseres ersten Apostels nach der Anordnung unseres hochheiligen Paptes zu seinem eigenen Wohl den von ihm gegebenen Beitrag von 06 [?], als Zeichen dessen er diesen Brief von uns empfangen hat. Aus derselben Vollmacht gewähren wir jenem den Ablass und er selbst möge sich freuen und möge wohlbehalten sein und so verbleiben. Gegeben in Göttingen mit unserem Siegel und durch Anordnung am ersten Tag des Monats Juli im Jahr des Herrn 1517.
Absolutionsformel, im Leben stets und immer wieder verwendbar
Unser Gott erlöst Dich durch die Verdienste und das Leiden Jesu. Durch die mir von Ihm verliehende Macht: Ich spreche Dich von all deinen Sünden frei und erteile Dir den Ablass. Im Namen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen Geistes – Amen
Absolutionsfomel und völlige Vergebung im Leben ebenso wie im Tod
Unser Gott erlöst Dich durch die Verdienste und das Leiden Jesu. Und ich vergebe Dir durch die mir verliehende Macht Deine Süden und spreche Dich frei. Von allen Dir auferlegten Schuldenstrafen und danach von allen Deinen Sünden löse ich Dich los und entlasse Dich mittels der Schlüssel der Kirche aus den Dir auferlegten Strafen des Fegefeuers. Im Namen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen Geistes – Amen
Der unheilvolle Briefehändler
Johann Tetzel (ca. 1460-1519) hätte vermutlich sogar einem Walross ein Stärkungsmittel andrehen können und einer Ente ein Federkissen. Niemand schaffte es wie er, seinen Zeitgenossen für Fantasiepreise völlig Sinnloses zu verkaufen. Tetzel war der Kopf einer unheilvollen kirchlichen Drückerkolonne, die mit Ablassbriefen handelte; dabei verdiente er sich und seinen Arbeitgebern goldene Nasen.
Ablassbriefe waren im 15. und 16. Jahrhundert heiß begehrte Ware: Wer einen kaufte, dem wurden Sündenstrafen erlassen. Je nach Preis bekam der Käufer die Strafe für eine einzelne Sünde erlassen, für mehrere oder gleich für alle Sünden und die seiner Verwandten gleich mit! Auf einem Zettel oder Dokument, dem „Ablassbrief“, den er quasi als Quittung ausgehändigt bekam, war der Wert und Umfang des Erlasses genau verzeichnet.
Ein Ablassbrief war ein Vertrag zwischen dem Käufer und der Kirche als irdischer Erbin Christi und aller Heiligen. Er war aus theologischer Sicht nur in Zusammenhang mit der Beichte und echter Reue gültig, nicht nur durch den Kaufbetrag. Der Ablassbrief „löschte“ auch keine Sünden aus dem Strafregister, er verkürzte lediglich die Zeit, die der Sünder nach seinem Tod im Fegefeuer verbringen würde. Da es den Ablasshändlern aber ums Geschäft ging, vernachlässigten sie bei ihren Verkaufspredigten die Theologie und und boten Seelenheil gegen Geld.
Der organisierte Ablasshandel war in der Renaissance ein Geschäftsmodell der katholischen Kirche und der kirchlichen Landesfürsten. Der Neubau der Peterskirche in Rom wurde zu großen Teilen durch ihn finanziert, Bischöfe konnten die Finanzen ihrer Bistümer damit sanieren.
Der Ablasshändler Johannes Tetzel, studierter Theologe und Mitglied im Dominikanerorden, arbeitete als Ablasshändler für verschiedene Auftraggeber – immer erfolgreich. Ab 1504 zog er als Wanderprediger durch die Lande und ließ sogar erfahrene Marktschreier alt aussehen. Der Spruch „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“ soll von ihm stammen. Der Sage nach wurde er zweimal ausgeraubt – von Leuten, die bei ihm einen Ablass für erst noch zu begehende Sünden gekauft hatten und ihm diesen Zettel hämisch unter die Nase hielten, bevor sie sich mit den Geld auf- und davonmachten. Bei den eigenen Sünden nahm es übrigens Tetzel nicht so genau; Spielen, Sex und Saufen waren die drei großen S, denen er angeblich verfallen war.
Hier abgebildet ist einer der von Tetzel im Namen des Erzbischofs Albrecht von Brandenburg verkauften Ablassbriefe zum Besten des Neubaus der Peterskirche in Rom. Wie alle kirchlichen Dokumente dieser Zeit ist er in lateinischer Sprache verfasst. Es war bereits vorgedruckt; nur die Käuferdaten mussten noch ausgefüllt werden.
Doch es regte sich Widerstand gegen die Geldschneiderei mit falschen Heilsversprechen – angeführt vom Wittenberger Mönch Martin Luther und dessen Lehrer, dem Theologen Andreas Bodenstein. Tetzel bezichtigte Luther der Ketzerei, der Verbreitung falscher Lehren (siehe Seite 23). Denn die Ablassbriefe, die er verkaufte, waren mit der Kirchenpolitik völlig konform. 1519 sollten Tetzel und Luther zu einer theologischen Disputation über den Handel mit Ablassbriefen aufeinandertreffen. Es kam nicht dazu. Tetzel starb am 11. August 1519 an der Pest. Ob er in den Himmel gekommen ist, ist nicht bekannt.
Ablass gibt es in der katholischen Kirche übrigens immer noch, wenn auch gratis. Der Segen „Urbi et orbi“, „der Stadt und dem Erdkreis“, den der Papst zu Weihnachten und Ostern spendet, bietet einen kompletten Erlass der Sündenstrafen für alle, die den Pontifex dabei hören und/oder sehen – live auf dem Petersplatz in Rom oder live über Radio, Fernsehen und Internet. ■
23. Oktober 1517
Martin Luther an Albrecht von Brandenburg
Übertragung aus dem Lateinischen ins Deutsche:
Dem hochwürdigen Vater in Christo
und durchlauchtigsten Herrn, Albert,
Erzbischof der Kirchen zu Magdeburg und Mainz, Primas,
Markgraf zu Brandenburg usw.,
seinem Herrn und Hirten in Christo,
geachtet in Ehrerbietung und Liebe!
Jesus.
Gnade und Barmherzigkeit Gottes und alles, was er vermag und ist!
Verzeiht mir, ehrwürdigster Vater in Christo, durchlauchtigster Kurfürst, daß ich, der geringste unter den Menschen, so unbesonnen und vermessen bin und es wage, an Eure höchste Erhabenheit einen Brief zu richten. Der Herr Jesus ist mein Zeuge, daß ich, eingedenk meiner Niedrigkeit und Nichtswürdigkeit, lange aufgeschoben habe, was ich jetzt mit unverschämter Stirn vollbringe. Mich bewegt vor allem die Verpflichtung zu treuem Dienst, den ich Euch, hochwürdigster Vater in Christo, zu leisten mich schuldig weiß. Daher möge Eure Hoheit sich unterdessen würdigen, ein Auge auf mich zu richten, der ich nur Staub bin, und mein Votum entsprechend Eurer bischöflichen Milde zur Kenntnis nehmen.
Es werden Päpstliche Ablässe im Namen Euer Kurfürstlichen Gnaden zum Bau von St. Peter herumgetragen. Dabei klage ich nicht so sehr das Ausschreien der Ablaßprediger an, das ich nicht gehört habe, sondern ich bin schmerzlich besorgt über die überaus falschen Anschauungen des Volkes, die aus dem entstehen, was man überall und allerorts im Munde führt: etwa, daß die unglücklichen Seelen glauben, daß sie, wenn sie die Ablaßbriefe gekauft hätten, ihres Heiles sicher sind; desgleichen, daß die Seelen sofort aus dem Fegefeuer herausfliegen, sobald sie ihren Betrag in den Kasten gelegt haben; ferner, daß diese Gnaden so stark sind, daß keine Sünde so groß sei, als daß sie nicht erlassen werden könnte, sogar (wie sie sagen), wenn jemand etwas Unmögliches getan und die Mutter Gottes geschändet hätte; schließlich, daß der Mensch durch diese Ablässe von jeder Strafe und Schuld frei sei.
Ach, lieber Gott, so werden die Eurer Sorge anvertrauten Menschen zum Tode unterwiesen! Und es entsteht und erwächst die härteste Rechenschaft, die Dir für all diese abzulegen ist. Deshalb konnte ich nicht länger davon schweigen. Der Mensch wird nämlich nicht durch irgendein Geschenk des Bischofs seines Heiles sicher, da er ja nicht einmal durch die von Gott eingegossene Gnade gewiß wird; vielmehr befiehlt uns der Apostel in Furcht und Zittern unser Heil zu wirken [Phil 2,12] und der Gerechte wird kaum gerettet werden [1 Petr 4,18]. Schließlich, so eng ist der Weg, der zum Leben führt, daß der Herr durch die Propheten Amos [Am 4,11] und Sacharja [Sach 3,2] diejenigen, die gerettet werden, aus dem Feuer gerissene Holzscheite nennt. Und überall verkündigt der Herr die Schwierigkeiten des Heiles.