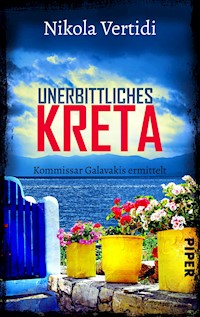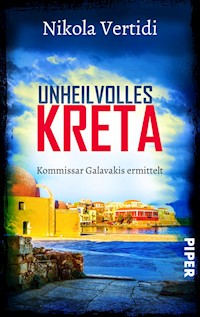6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der verschrobene Kommissar Hyeronimos Galavakis ermittelt in seinem vierten Fall mit deutscher Gründlichkeit und kretischem »Siga-Siga« Ein Griechenland-Krimi zum Wegträumen und eine Reise zu den schönsten Stränden Kretas und in die urigsten kretischen Tavernen! Kommissar Hyeronimos Galavakis gerät in die Mühlen von Geheimdiensten, Mafia und zu vielen persönlichen Befindlichkeiten. Was hat es mit dem unautorisierten Helikopterflug vor der Ostküste Kretas auf sich und wer sind die beiden Toten? Wie hängen die Schicksale dreier Frauen damit zusammen und welche Rolle spielt das Pärchen, das auf eigene Faust recherchiert? Hyeronimos und die Pathologin Penelope ermitteln in einem Fall, der ein wenig an James Bond erinnert und doch vollkommen real ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Bedrohliches Kreta« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Triggerwarnung: Dieser Roman behandelt explizit das Thema Angststörung.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Julia Feldbaum
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Personenregister
Zitat
Die Abwehrphase
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Die Atemanhaltephase
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Dyspnoische Erstickungsphase
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Generalisiertes Krampfstadium
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
Atemstillstand
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
Finale Schnappatmung
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
Tod durch Ertrinken
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
Epilog
Zusatzmaterial
Kretische Rezepte für vier Personen
Frittierte Zucchini aus der Taverne in Exo Mouliana
Titikas Lamm mit Ei-Zitronen-Soße
Titikas Gastrin
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Personenregister
Hyeronimos Galavakis – Kommissar der Mordkommission
Athina – seine Mutter
Anatolis – sein Vater
Ekaterini, genannt Titika – seine Großmutter/Yaya
Kassia – die Frau, die er liebt
Stelios Mentakis – sein Chef
Maria – Mentakis’ rechte Hand
Zacharis Zentakis – sein Mitarbeiter und Assistent
Christos Papadakis – sein Kollege
Elonidas Spectros – Kapetan der Einheit für Cyber-Kriminalität
Penelope Demostaki – leitende Pathologin der Insel
Giorgia – ihre Sektionsassistentin
Eleni Pentulaki – Influencerin und Penelopes Freundin
Aristidis, Fischer
Elara – seine Frau
Selena, Iraklis und Alexia – seine Kinder
Vangelis, Fischer
Gaia – seine Frau
Maria und Iasonas – seine Eltern
Manolis, Fischer
Dorea – seine Frau
Irini – seine Tochter
Dimitris Stefanakis – Minister in Athen
Iota – seine Ex-Frau
Nicholas – sein älterer Sohn
Konstantinos – sein jüngerer Sohn
Melina – Konstantinos’ Freundin
Michalis Serpantakis – Mafiaboss aus Zoniana
Filomena – Serpantakis’ Schwester, bekannt als »Die Wohltäterin«
Achilleas Serpantakis – Filomenas Sohn
Costas Xylouris – Mitarbeiter des Nachrichtendienstes (EYP)
Prokopios Kaptakis – Mitarbeiter der Direktion für kriminologische Ermittlungen (DEE)
Überfluss des Leids um die Toten ist Wahnsinn; denn er verletzt die Lebenden, und die Toten erfahren nichts davon.
Xenophon, griechischer Schriftsteller
Die Abwehrphase
1. Kapitel
Oktober 2014
»Aristidi!« Manolis’ Stimme überschlug sich vor Panik, als er den Freund über die Bordwand kippen sah. Eben noch hatten sie staunend aufs Meer geblickt, ihre Angeln in den Händen gehalten und alberne Witze gerissen, in denen Aliens und Poseidon eine Rolle spielten, und nun lag der Mann, den er seit Kindertagen kannte, mit voller Montur im Wasser.
Es war ein kalter und grauer Morgen. Die Sonne war noch nicht durch die Wolkenschicht gebrochen, und der Himmel kündigte nach den regnerischen Wochen einen weiteren nassen Tag an. Das Meer hatte sich über den Winter auf fünfzehn Grad abgekühlt, und sie trugen Gummistiefel, Regenhosen und schwere Regenjacken. Aristidis hatte sogar mit gackerndem Lachen einen Anglerhut aufgesetzt, und sie hatten ihn schubsend als »Weichei« betitelt.
Sie hatten sich wieder einmal zu jenem ganz besonderen Fanggrund aufgemacht, der fast zwölf Meilen vom Festland entfernt lag. Vangelis’ und auch Aristidis’ Vater kannten ihn. Die beiden alten Knochen hatten sich immer mal wieder hier herausgewagt, denn die vollen Netze und die großen Fische, die sie mit den Hochseeangeln auf das Boot holten, waren das Risiko immer wert gewesen. Sie hatten die Söhne ein- oder zweimal mitgenommen und sie mit der Umgebung vertraut gemacht. Doch die Jugend fuhr nur sehr selten her, denn sie hatten alle Familie, und das Meer konnte hier draußen unbezwingbar ungestüm werden.
Die ersten Fänge hatten sie schon hereingeholt und ihr Glück kaum fassen können. Doch dann war das Unfassbare geschehen, und der Ozean hatte begonnen, wie ein wütendes Tier zu brodeln. Aristidis hatte nah an der Reling gestanden, breitbeinig, den lächerlichen Hut tief in die Stirn gezogen, mit der Angel in der Hand, als das oft erprobte Fischerboot angefangen hatte, wie eine Nussschale hin und her zu torkeln. Dann war er gefallen. Manolis hatte die Panik in sich gespürt, und sie hatte ihn für einen Moment bewegungslos gemacht.
Jetzt winkte er seinem Freund hektisch zu, brüllte seinen Namen aus Leibeskräften über das Strudeln hinweg und streckte ihm seine Arme entgegen. »Aristidi, nimm meine Hand!«
Verdutzt paddelte der junge Fischer in Richtung Boot, bevor die See ihn erneut packte und fortzerrte.
Manolis sah die allumfassende Angst in Aristidis’ Gesicht, als ihn die Unterströmung ergriff und seinen Kopf unter Wasser zog. »Vangeli«, schrie er, »wir müssen ihn da rausholen.«
Doch der dritte Mann an Bord schien zu Stein erstarrt und bewegte sich nicht. Er saß an die Bordwand gelehnt auf dem Boden und hielt das Netz, an dem er noch eben konzentriert geknüpft hatte, verkrampft in den Händen.
»Vangeli?« Manolis beugte sich vor und riss am Arm des Fischers, doch der Mann schüttelte ihn ab und starrte wie paralysiert auf die Stelle, an der Aristidis eben noch zu sehen gewesen war. Manolis folgte seinem Blick, riss sich die Jacke vom Körper und streifte die hohen Stiefel ab, mehr Zeit blieb ihm nicht, wenn er seinen Freund den Fluten entreißen wollte.
Mit einem beherzten Satz sprang er in das kalte graugrüne Wasser, nicht ohne den angeleinten Rettungsring mit sich zu ziehen. Wieso kämpfte Aristidis nicht? Sie waren alle gute Schwimmer, und nicht zum ersten Mal ging einer von ihnen über Bord. Sie waren am Meer aufgewachsen, und ihre Väter hatten sie mit rausgenommen, kaum dass sie sicher stehen gelernt hatten. Manolis schwamm wie ein Fisch, daran konnte auch die Bekleidung erst einmal nichts ändern. Doch das Meer blubberte wie ein Kochtopf voller Wasser am Siedepunkt. Was war hier los? Es gab keine Seeungeheuer, daran glaubte er fest. Doch das hier ließ ihn zweifeln. Zog es gerade seinen Freund in die Tiefe? Er musste ihn erreichen. Er musste ihn retten. Warum half Vangelis ihm nicht?
»Aristidi«, schrie er japsend, als das Meer ihm eine Welle ins Gesicht warf und die Strömung an seinen Füßen zu zerren begann. Er hätte die Hose auch ausziehen sollen. Wo war sein Freund? Suchend blickte er sich um, denn es war doch unmöglich, dass der Kerl nicht mehr auftauchte. Mit einem Arm hielt er den Ring, mit der anderen paddelte er vorwärts.
»Vangeli, du musst Hilfe rufen«, brüllte er erneut den Mann auf dem Boot an, der wohl noch immer an derselben Stelle saß und keine Anstalten machte, ihnen zu Hilfe zu eilen. Gott, verdammt, was lief hier nur schief? Warum hatte er nicht als Erstes einen Hilferuf abgesetzt?
»Vangeli, verdammt noch mal, ruf Hilfe!« Seine Stimme überschlug sich, und er schluckte Wasser. Dann sah er zu seiner Erleichterung eine Bewegung an Bord. Er ließ den Rettungsring los und tauchte, er musste Aristidis finden. Dessen Frau Elara war im fünften Monat schwanger, und auch Selena und Iraklis brauchten ihren Vater. Die Strömung ergriff ihn und zerrte an seinen Hosenbeinen. Er tauchte tiefer, doch das Wasser war so dunkel, dass es schien, als würde er mit geschlossenen Augen suchen. War dort nicht ein Umriss zu sehen? Er spürte den Druck auf seiner Brust und wusste, dass er auftauchen musste, um seine Lunge mit Sauerstoff zu füllen, doch das Meer schien andere Pläne mit ihm zu haben und zog unbarmherzig an seinem Körper.
Auch er hatte Frau und Kind und träumte mit ihr gemeinsam von einer großen Familie. Er durfte nicht aufgeben, er durfte nicht sterben!
2. Kapitel
Zurück in der Gegenwart
»Ich bin dieses Gerangel wirklich leid.« Stelios Mentakis’ Hand sauste mit einem lauten Knall auf die Tischplatte, und Hyeronimos senkte beschämt den Kopf. Es gab keine logische Erklärung, warum er auf Christos so reagierte, wie er es tat. Es entsprach weder seiner Art noch seiner Erziehung und schon mal gar nicht seiner Vorstellung von kollegialem Verhalten. Er konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie Christos Papadakis den Kopf ein wenig in den Nacken legte, was den Eindruck erzeugte, dass er sich sicher war, im Recht zu sein. Das war dem kleinkarierten Kollegen mit am wichtigsten: Er wollte immer recht behalten und damit im Gegenzug verdeutlichen, dass Hyeronimos im Unrecht war. Die Rivalität zwischen ihnen befeuerte der Kollege, dessen Hemden mit Karomuster seiner Einstellung entsprachen, jedoch nicht ganz allein. Das musste Hyeronimos sich eingestehen, denn auch er unterstützte den beständigen Wettkampf zwischen ihnen und schaffte es nicht, sich zu distanzieren. Christos triggerte etwas in seinem Inneren, was ihn immer wieder auf dessen Provokationen anspringen ließ, so, wie die Pawlow’schen Hunde auf das Läuten einer Glocke hin zu sabbern begannen. Er wusste selbst, dass dies weder erwachsen noch vernünftig war, und auch Stelios legte den Finger nun genau in diese Wunde.
»Selbst Fünfjährige benehmen sich besser als meine beiden leitenden Ermittler«, fuhr der Chef fort und hörte sich nun mehr enttäuscht als frustriert an, »ich habe mir das seit dem Ariakis-Fall nun lange genug angeschaut. Ich erwarte von euch, dass ihr das endlich in den Griff bekommt. Daher habe ich beschlossen, dass ihr zwei Tage mit einem Mediator in den Bergen verbringt. Das ist keine Option, sondern ein Befehl!«
Hyeronimos stockte der Atem, und er hob den Kopf, um festzustellen, ob Stelios es wirklich ernst meinte. Selbst Christos schien es die Sprache verschlagen zu haben. Na bravo! Das waren ja großartige Neuigkeiten. Er wollte aufbegehren, doch ein Blick in Mentakis’ Gesicht gebot ihm zu schweigen.
3. Kapitel
Das Flugzeug setzte sanft auf, und die Frau neben ihr bekreuzigte sich dreimal und küsste dazu ihre Finger. Penelope selbst war weit entfernt davon, diesem kirchlichen Brauch nachzuhängen, und doch war es beruhigend gewesen, als die Frau dieses Ritual schon beim Start durchgeführt hatte.
Sie sah das Meer, das so nah an der Landebahn türkisblau schimmerte, und rang mit den unterschiedlichen Gefühlen. Sie hatte einige Wochen mit Eleni in Deutschland und Frankreich verbracht und das Leben mit der mutigen Influencerin genossen. Es hatte lange genug gedauert, bis sie endlich zueinandergefunden hatten, und zu ihr zu fliegen, war eine wirklich gute Entscheidung gewesen. Alles war so anders gewesen als auf Kreta, und sie hatte sich schon lange nicht mehr so frei und leicht gefühlt. Sie liebte ihren Job sehr und trug die Verantwortung als leitende Pathologin der Insel meist gern, doch in diesem Augenblick schien es ihr kaum vorstellbar, sich und ihr Leben wieder einzusperren. Natürlich gab es auch hier Menschen, die Bescheid wussten und sie nicht verurteilten. Doch die kulturellen Verkrustungen der kretischen Gesellschaft ließen es nicht zu, sich offen zu bekennen, wenn man keine Lust verspürte, angegriffen zu werden. Sie hatte tatsächlich wenig Interesse an gesprayten Parolen auf ihrem Auto oder gar Drohbriefen. Sie verbarg nicht, wer sie war. Sie log nicht. Sie kommunizierte ihre Beziehungen eben nur nicht offen. Es war auch auf ihrer Reise ein Drahtseilakt gewesen, nicht zu viel preiszugeben, denn dafür stand Eleni zu sehr im öffentlichen Interesse und trat eben auch für die LGBT-Gemeinschaft in ihrem Blog und ihren Posts mit klaren Worten ein. Sie hatten viele Gespräche dazu geführt und sich sogar heftig gestritten, als Penelope die junge Frau um Diskretion gebeten hatte. Nicht nur, weil sie den Kampf auf Kreta in ihrer Position nicht führen wollte, sondern auch, weil sie mehr als zwei Jahrzehnte älter war als ihre Geliebte. Sie hatte schon die hämisch gierigen Gesichter der Männer vor ihrem inneren Auge gesehen. Homosexuelle Frauen gaben meist Anlass für Fantasien und wurden damit oft sexualisiert. Kaum auszudenken, was die Kerle in ihrem Umfeld mit diesem Wissen alles anstellen würden. Sie schüttelte sich schauernd bei diesen Gedanken, und die zarte Freude, wieder zurück zu sein, löste sich auf.
Das Flugzeug war voll besetzt, und sie wartete, bis der erste Pulk nach draußen gestürzt war. Die Touristen drängelten sich in dem schmalen Gang, als bedeutete eine Sekunde Vorsprung mehr Urlaubsgenuss. Am Gepäckband würden sie einander wiedertreffen und warten, denn dort wurde der kretische Siga-siga-Gedanke – das »Immer mit der Ruhe« – mit Akribie praktiziert. Es gab auch Zeiten, in denen man überrascht seinen Koffer nach wenigen Minuten in Empfang nahm, doch es war normaler, dreißig Minuten oder mehr zu warten. Der Flughafen in Irakleio war zu klein für den Andrang während der Saison, und es würde noch Jahre dauern, bis der neue in Kastelli seine Pforten öffnete. Bis dahin übte man sich eben in Geduld.
Sie wechselte einige Worte mit den attraktiven Stewardessen und verabschiedete sich auch von dem Kapitän, dann trat sie auf die Treppe und spürte die frühsommerliche Wärme auf der Haut. Auf Kreta wartete Hyeronimos, und auch ihre Freundschaft mit Stelios Mentakis hatte sich gefestigt. Sie war nicht allein.
4. Kapitel
Hyeronimos trug sein Sakko ordentlich gefaltet über dem Arm. Es war viel zu warm dafür, doch es gehörte eben für ihn zu einem gepflegten Outfit, und das war ihm wichtig. Also nahm er es auch im Sommer mit. Er öffnete die Tür seines Wagens, und brütende Hitze schlug ihm entgegen, sicher würde sein Hemd binnen Sekunden auf seinem schwitzenden Oberkörper kleben. Das Wetter war hervorragend. Das war gut für den Tourismus und meist auch für die Abteilung »Gewaltverbrechen mit Todesfolge«. Alle waren damit beschäftigt, Geld zu verdienen, und kamen dadurch nicht so oft auf dumme Gedanken. Selbst die Hirten in den Bergen posierten für die Touristen, die immer häufiger mit Jeeps durch die Natur gekarrt wurden, anstatt sich gegenseitig Kugeln in die Brust zu jagen. Er vergewisserte sich mit einem Blick auf die Uhr, dass er pünktlich am Flughafen sein würde, um seine beste, er berichtigte sich in Gedanken, seine einzige Freundin abzuholen. Kassia war zwar irgendwie auch als Freundin in ihm verankert, doch seine Liebe zu ihr war anders geartet als die für Penelope. Kassia war so sehr Teil seines Herzens, dass es ihr gehörte und er sich nicht vorstellen konnte, jemals eine andere Frau an diesen Platz zu lassen. Doch sie war nun einmal verheiratet, und damit war ihre Liebe in der Regel mehr platonischer Natur. Sie sahen sich nur sehr selten, telefonierten aber, so oft sie konnten. Sie war seine Vertraute, seine Geliebte. Penelope war anfangs nur seine Kollegin gewesen. Bei der Mordkommission jedoch kam man nicht an der Pathologie vorbei. Daher hatten sie regelmäßig miteinander zu tun gehabt und rasch festgestellt, dass sie auf einer Wellenlänge funkten. So waren sie enge Freunde geworden, was ihn noch immer erstaunte.
Sie hatte ihn gelehrt, manches mit mehr Humor zu nehmen, und bei gemeinsamen Ermittlungen hatte sie sich als hervorragende Partnerin herausgestellt, sodass sein Vorgesetzter es mittlerweile fast als Normalität ansah, dass sie ihn zu Befragungen begleitete. Als Leiterin der Abteilung hatte sie auch die Möglichkeit, sich diesen Freiraum zu verschaffen. Zudem war ihre Sektionsassistentin Giorgia eine ausgezeichnete Mitarbeiterin, der das Vertrauen ihrer Chefin in sie, viele Situationen selbstständig zu meistern, sehr guttat.
Er fuhr auf die Nationalstraße auf und ließ es zu, dass der Wind sein Haar zerzauste, denn diesen Tick hatte er mittlerweile wirklich gut im Griff. Das Schicksal hatte ihn mit einigen Sonderlichkeiten geschlagen, und die ständig zum Haar zuckende Hand hatte dazugehört. Vor allem, wenn er unter Stress stand oder nervös war, erwies sie sich als kaum zu bändigen. Doch er hatte es so sehr gewollt, gerade die offensichtlichen Dinge beherrschen zu können, um sich nicht ständig in der Öffentlichkeit wie ein kompletter Freak zu gebärden, dass es ihm gelungen war, den Impuls bewusst wahrzunehmen und dann zu unterbrechen. So entstand nun lediglich noch ein winziges Zucken in den Fingern, was für andere kaum bemerkbar war.
Er freute sich auf Penelope. Sie war lange weg gewesen und hatte die Zeit mit Eleni genossen, zumindest hatte sie es ihm bei einigen Telefonaten so geschildert. Als sie im vergangenen Winter den Tod des weltberühmten Sängers Callistus Ariakis aufgeklärt hatten, hatte ihre Psyche irgendwie einen Knacks erlitten, und die Reise war Teil des notwendigen Heilungsprozesses gewesen. Er konnte das nur zu gut verstehen, denn schließlich begab er sich regelmäßig in die Berge, um dort mit seiner Vergangenheit aufzuräumen. Die Hoffnung, seinen Eigenheiten damit die Macht zu rauben, hatte er noch immer nicht aufgegeben. Wenn es also notwendig war, die Insel zu verlassen, um zu gesunden, dann war das eben so. Er mochte es sehr, Zeit mit Penelope zu verbringen, kam jedoch auch gut mit sich selbst zurecht. Er verbrachte Stunden lesend auf seinem Sofa, schwamm regelmäßig und saß oft mit seiner Yaya zusammen, die ihn trotz ihres hohen Alters bekochte und mit Klatsch und Tratsch aus Agia Pelagia versorgte. Er hatte alle Ferien bei den Großeltern in dem kleinen Fischerdorf unweit von Irakleio verbracht und kannte Mensch, Getier und Region daher in allen Facetten.
Es war wenig los auf der Straße, die Touristen lagen um diese Zeit gewiss am Strand und ließen sich die Sonne auf ihre blasse Haut brennen. Das Gespräch mit Stelios Mentakis geisterte ihm durch den Kopf, und rein kognitiv war ihm vollkommen bewusst, dass sein Chef recht hatte und die Idee gut war. Christos und er mussten einen Weg finden, kooperativ zu arbeiten. Sie würden sicher niemals Freunde werden, doch es war ihre Aufgabe, gemeinsam für Recht und Ordnung zu sorgen, und das war ein hilfreiches Fundament. Im ersten Moment hatte ihn Stelios’ Ansinnen sprachlos gemacht, doch dann hatte er die Bedeutsamkeit hinter dem Ärger wahrgenommen. Vielleicht ließ es sich jedoch umgehen, irgendwo in den Bergen kampieren zu müssen – er würde sich so kooperativ wie möglich zeigen.
Hyeronimos parkte den Wagen am Seiteneingang nahe der Ankunftshalle und hatte das Glück, trotz des wuselnden Andrangs am Flughafen sogar in der ersten Reihe stehen zu können. Sein Handy zeigte ihm ein Koffersymbol und ein Emoji mit einem erhobenen Daumen. Penelope hatte also bereits ihr Gepäck und würde gleich bei ihm sein. Er stieg aus, öffnete den Kofferraum und hielt nach ihr Ausschau. Dann tauchte seine Freundin winkend an dem Durchgang am Zaun auf. Sie zerrte ein Ungetüm hinter sich her, das gewiss nicht in den Kofferraum seines Octavia passen würde, also öffnete er die hintere Tür, um den rollenden Schrank auf die Rückbank zu packen.
»Hey, Hyeronimo«, hörte er ihre Stimmen, bevor sie ihm sanft die Hand auf den Arm legte. Sie wusste nur zu genau, wie er zu Berührungen stand, und ging immer respektvoll damit um.
»Penelope!« Er drehte sich um, sie hob die große Sonnenbrille an, und er spürte die plötzlich aufwallende Freude, sie zu sehen, so stark, dass er sie kurz in die Arme schloss. »Schön, dass du endlich wieder da bist!«
»Ich bin auch froh und auch irgendwie nicht«, sie zuckte unentschieden mit den Schultern und erwiderte die Umarmung, »du hast mir gefehlt, Hyeronimo!«
Er hob das monströse Gepäckstück in den Wagen, knallte die Tür aufatmend zu, als es endlich drin war, und hielt ihr gentlemanlike die Beifahrertür auf. Schon heute früh war er bei ihrem gemeinsamen Lieblingsbäcker gewesen und hatte eine bunte Auswahl an Leckereien besorgt. Die Tüte erwartete sie, und aufseufzend roch sie an den gewohnten Köstlichkeiten, zog ein Stück Karottenkuchen heraus, wartete, bis er das Auto entgegen allen Verkehrsregeln gewendet hatte, und reichte ihm dann eine Knusperstange mit Sonnenblumenkernen, während sie gedankenverloren an ihrem Gebäck zu knabbern begann. Das waren die Kleinigkeiten, die er sich erlaubte, wenn es um Gesetzesverstöße ging. Er war in Deutschland aufgewachsen und hatte es von Kindesbeinen an gelernt, Regeln als etwas Gutes zu erachten. Hier auf der Insel musste man jedoch immer mal wieder fünfe gerade sein lassen, und er hatte sich entschieden, es bei den für ihn weniger wichtigen Aspekten umzusetzen, sodass ihm niemand vorwerfen konnte, dass er sich nicht genügend integrierte.
»Was ist los mit dir, Pen?«, fragte er, denn sie war zwar da, schien aber trotzdem Meilen entfernt zu sein.
5. Kapitel
»Herzlich willkommen bei uns!« Gaia lächelte die Gäste an, die durch den Eingang des Hotels auf sie zutraten. In den letzten zwei Jahren hatte sich das Haus zu einer Art Geheimtipp entwickelt, denn sie hatten schöne Zimmer mit einem wundervollen Blick auf das Meer, und ihre Schwiegermutter Maria kochte wie eine Göttin. Ihr Schwiegervater fuhr jeden Morgen aufs Meer hinaus, kam meist mit reicher Beute zurück, und Maria brachte den Fang virtuos veredelt auf den Tisch. Das führte zu hervorragenden Bewertungen in den gängigen Onlineportalen, und Gaia konnte sich nicht über mangelnde Arbeit beschweren. Sie hatte nie geplant, ein Hotel zu bauen und zu führen, doch so war das Leben eben. Es gab einem Zitronen, und man konnte Limonade daraus machen oder versauern. Sie hatten sich für Ersteres entschieden, auch wenn das alles wahrlich nicht leicht gewesen war und noch immer viel Unmut bei einigen Bewohnern der Region erregte.
Sie hatte so lange den Kopf gesenkt gehalten, und es war wirklich an der Zeit, etwas daran zu ändern. Sie hatten sich nichts zuschulden kommen lassen, ganz im Gegenteil. Wie konnte es daher sein, dass sie sich schämen sollte. Sie hatte so vieles in den letzten Jahren nicht verstanden, und auch ihre Schwiegereltern waren anfangs vollkommen überfordert gewesen, doch dann hatten sie sich zusammengesetzt. Sie hatten so darauf geachtet, von niemand belauscht zu werden, dass noch nicht einmal ein Telefon im Raum gewesen, und die massiven Holzfensterläden hatten sie von innen verriegelt. Danach hatten sie das Grundstück am Wasser gekauft und mit dem Hotelbau begonnen. Ihre Eltern waren schon seit ein paar Jahren tot, und ihr Bruder lebte in Holland. Ihre Familie war schon lange nur noch Maria und Iasonas. Die harten Jahre hatten sie zusammengeschweißt, und sie waren eine Einheit, auch wenn Iasonas aus seiner Trauer keinen Hehl machte, während Maria und sie sich in die Arbeit stürzten, um vor ihren Gefühlen zu fliehen.
Gaia war beileibe nicht dumm. Sie hatte in der Schule zu den besten Schülerinnen gezählt und auch komplexe Inhalte immer rasch durchdrungen. Doch all das, was in den letzten Jahren passiert war, hatte sie nicht vollumfänglich begreifen können. Anfangs hatte sie noch nächtelang gegrübelt, war abgemagert, hatte sogar einige graue Haare bekommen, obwohl sie noch nicht einmal dreißig gewesen war. Dann hatte sie begriffen, dass sie damit aufhören musste, wenn sie überleben wollte. Sie hatte sich einen guten Friseur gesucht, die Haare zu einer flotten Frisur schneiden lassen und mit Farbe das Grau überdeckt. Das war der Anfang gewesen. Eine neue Frisur war immer ein neuer Anfang. Nach ein paar Monaten hatte sie wieder Rundungen an den richtigen Stellen gehabt, und ihre Energie war zurückgekehrt. Das Hotel war nun ihr Baby und würde vielleicht auch bis an ihr Lebensende ihr einziges Kind bleiben. Sie verweigerte sich nicht gegen kleine Flirts, aber sie war nicht bereit, eine neue Liebe einzugehen. Sie liebte jetzt das Hotel so, wie sie einst Vangelis geliebt hatte. Doch ihr Mann war fort. Sie verscheuchte die verwirrenden und dunklen Gedanken, denn als Gastgeberin musste man strahlen.
Das »Evangelos« würde in absehbarer Zeit das beste Haus am Platz sein, dafür würde sie mit Marias Hilfe sorgen. Sie brauchten beide diese Aufgabe und ein großes Ziel. Sie hatte große Ziele, und der Erfolg gab ihr recht. Sie waren Frauen, und es waren immer die Frauen, die aus den Trümmern ein neues Zuhause errichteten. So wie damals ihre Großmutter geholfen hatte, das niedergebrannte Dorf Anogia wieder zu errichten. Jeder auf der Insel hatte in seiner Familie eine Frau, die genau dies getan hatte, und Gaias Umstände waren wesentlich besser als nach einem Krieg oder während einer Hungersnot. Sie hatte gelernt zu kämpfen, aber auch zu akzeptieren, und das war viel schwerer gewesen als der Kampf.
6. Kapitel
Konnte man lernen, in einem Meer aus Schmerz zu leben, oder war es tatsächlich besser, darin zu ertrinken? Der Schmerz pflügte sich seine Straße durch jede Zelle des Körpers und glich irgendwann jenen Trampelpfaden durch die Natur, auf denen kein Bewuchs mehr zu finden war. Über der Pein konnte auch nichts mehr gedeihen. Nichts konnte die verkrustete Schicht durchbrechen, und so blieb nur die Öde. Nicht immer war es besser, entkommen zu sein. Doch das Schicksal spannte seine Fäden nach eigenem Gusto, und es gab nichts, was Menschenhand dagegen unternehmen konnte. Egal, wie sehr man es auch so manches Mal hasste, dem ausgeliefert zu sein. Der Mensch war machtlos gegen die Kräfte des Universums und die Entscheidungen, die metgeschwängerte Götter trafen.
Plötzlich stand man also da – am Rande eines Abgrunds. Wurde hineingestoßen in die Fluten des Leids, und je mehr man kämpfte, umso tiefer versank man darin, und man konnte sich vollkommen sicher sein: Die Wahrheit ging so manches Mal unter, doch eines war gewiss: Sie würde nie ertrinken! Ihr war ewiges Leben beschert, und mit jedem verzweifelten Klagen über die zu ertragende Qual wurde sie zu dem Klotz am Bein, der dafür sorgte, dass man vom Schmerz verschlungen wurde, während man verzweifelt versuchte, seine Zähne zu schärfen, um die Fesseln, die das Gewicht fixierten, eines Tages doch noch zerbeißen zu können. Und dennoch würde alles bleiben, wie es war. Die Moiren hatten es entschieden.
7. Kapitel
Die Rotorblätter drehten sich und warfen windige Wellen auf den Ozean, dessen Oberfläche sich unter dem Flattern aufbauschte. Er passte den Winkel der Rotorblätter mit dem Stick feinfühlig an, um das Fluggerät ein wenig nach links auszurichten, und stabilisierte den Hubschrauber geübt über die Fußpedale. Er musste die angegebenen GPS-Daten des Rendezvous-Punktes außerhalb der Zehnmeilenzone in spätestens fünfzehn Minuten erreicht haben, so lautete der unmissverständliche Auftrag. Er senkte den Pitch nach unten, um die Flughöhe zu verringern, so blieb er unter dem Radar. Noch befand er sich innerhalb des Radius, der von Kreta kontrolliert wurde.
Die Gischt warf feine Tropfen auf die Frontscheibe. Er machte sich oft sogar einen Spaß daraus, mit den Kufen die Wasseroberfläche zu streifen. Heute hielt er jedoch genügend Abstand, denn er war schließlich nicht zum Spaß unterwegs. Ganz im Gegenteil: Er wollte zeigen, wie professionell und zuverlässig er war. Das Geld, das ihn erwartete, war mehr als großzügig berechnet, und er hatte daher nicht gezögert, den Flug zu tätigen, obwohl es keine der üblichen Aufgabenstellungen war. Unterm Strich machte er es genau deshalb und nicht, weil es ein Job war.
Verwirrt spürte er plötzlich Wind durch sein Haar wehen. Er drehte sich rasch seitlich, um herauszufinden, wie das möglich war, als ihn ein stechender Schmerz durchfuhr. Dann umhüllte ihn Dunkelheit.
8. Kapitel
»Holst du bitte Papa zum Essen, Irini?« Dorea hörte den Klang ihrer eigenen Stimme und hasste sich dafür, wie stumpf und hoffnungslos sie klang.
»Mama …« Irini transportierte all ihre Empörung wie immer ungefiltert, und Dorea atmete tief ein, während ihre Finger sich am Rand des fleckigen Spülbeckens verkrampften. »Ich hab noch Englischaufgaben zu erledigen.«
Der Unterricht war teuer, und sie sparte sich ihn wirklich im wahrsten Sinne vom Munde ab. Das Kind und der Mann bekamen volle Teller, und sie tat so, als hätte sie schon in der Küche gegessen. Oft hatte sie das tatsächlich getan, um fertig zu sein, bevor die anderen beiden an den Tisch kamen, und dann beide Hände frei zu haben, um sich vollkommen auf ihre Aufgabe konzentrieren zu können. Doch regelmäßig verzichtete sie eben auch auf eine Portion für sich und hatte somit noch für den nächsten Tag etwas zu essen im Kühlschrank.
Sie hasste ihr Leben. Sie hasste ihr Spiegelbild, hasste das heruntergekommene winzige Loch, in dem sie lebten, und nicht selten hasste sie auch Mann und Kind. Sie tat wirklich alles, damit Irini nicht hinter den anderen Kindern zurückfiel, und nähte ihr regelmäßig moderne Kleidung auf ihrer alten Maschine. Früher hatte sie davon geträumt, eine kleine Änderungsschneiderei zu eröffnen und nebenbei ein paar Auftragsarbeiten für das ein oder andere hübsche Outfit zu bekommen. Schon als junges Mädchen hatte sie ihre Freundinnen in Modefragen unterstützt und oft mit wenigen Handgriffen dafür gesorgt, dass aus einer alltäglichen Kombination etwas Besonderes mit Wow-Effekt entstand. Sie wohnten zwar nicht in der großen Stadt, aber Petras war im Sommer immer gut von Touristen besucht, und daher hatten sie es genossen, sich chic zu machen, wie die jungen Frauen in Irakleio oder auf den Covern der Magazine. Ihre Eltern waren nicht reich gewesen, hatten aber doch genügend verdient, um ihr die Nähmaschine zu kaufen, und ihre Mutter hatte dafür gesorgt, dass immer Stoffe, Knöpfe und glänzende Bänder im Haus waren. Dorea hatte die Hosen des Vaters geflickt, die Röcke der Mutter am Saum mit Borten verziert und auch ihre eigene Kleidung immer wieder verwertbar gemacht. Dadurch hatte sie die Ausgaben für ihre Leidenschaft rasch wieder eingespart.
Dann hatte sie sich in Manolis verliebt. Der gut aussehende Fischersohn hatte die Blicke aller Mädchen auf sich gezogen, und auch die Töchter der Urlauber waren ihm schnell verfallen gewesen. Doch er hatte nur Augen für sie gehabt, und so war ihr bereits mit sechzehn ein fester Freund vergönnt gewesen. Als er zwei Jahre später offiziell um ihre Hand angehalten hatte, war sie überglücklich gewesen. Sie hatten beide die Schule beendet, und Manolis war danach mit seinem Vater raus aufs Meer gefahren und hatte die Restaurants bis Sitia mit frischem Fisch beliefert. Dorea hatte einen guten Job in einer nahe gelegenen Hotelanlage gefunden und während der Saison genug verdient, um etwas für ihre Änderungsschneiderei auf die Seite zu legen. Manolis hatte nie etwas dagegen gesagt, auch wenn seine Mutter nicht verstanden hatte, warum er das so unterstützte. Sie waren ein modernes Paar gewesen und hatten Träume für eine wundervolle Zukunft geschmiedet. Als sie dann schwanger geworden war und für ein Jahr mit dem Hoteljob hatte aussetzen müssen, war das eben noch greifbare Ziel weiter weggerückt. Irini war knapp achtzehn Monate alt gewesen, als Dorea ihren alten Job wieder zurückergattert hatte, und sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwiegermutter hatten ihr mit dem Kind geholfen, und Manolis war ebenfalls ein hervorragender Vater gewesen. Sie hatten die Ersparnisse angegriffen, um ein Zimmer an ihr Haus anzubauen und dabei auch das Fundament für ein weiteres Bad, ein zweites Kinderzimmer und ein großes Wohnzimmer gegossen. Stück für Stück hatten sie sich so ihre gemeinsame Vorstellung vom Leben erfüllt. Es war viel Arbeit gewesen, und ihr Mann war häufig abends kaum aus den staubbedeckten Klamotten gekommen vor lauter Müdigkeit. Irinis Zimmer war klein, aber das machte nichts, denn zumindest hatte sie ein eigenes Zimmer, und Manolis und Dorea hatten wieder wie ein junges Ehepaar ungestört das Ehebett teilen können.
Ein Schauer lief ihr bei dem Gedanken über den Rücken, denn das Thema Sexualität war für sie zu einem roten Tuch geworden. Sie löste langsam die verkrampften Finger von dem stumpfen Edelstahl. »Irini«, rief sie erneut, diesmal mit unverhohlenem Ärger in der Stimme, »das ist keine Bitte!«
Die Tür zu dem Zimmer des Mädchens fiel mit einem Knall ins Schloss: »Warum holst du ihn nicht selbst, Mama? Warum versklavst du mich dazu?«
Dorea war fast so weit aufzugeben. Sie war die täglichen Diskussionen so leid und versuchte, sich daran zu erinnern, ob sie es jemals gewagt hatte, ihren Eltern gegenüber einen solchen Ton anzuschlagen. Wahrscheinlich eher nicht, denn in ihrer Generation war der Respekt den Eltern gegenüber noch tief in der Tradition verwurzelt. Die Grundhaltung des Filotimo, basierend auf Ehre und Respekt, auf Würde und Verbundenheit, ging immer mehr verloren, je mehr Facebook und Instagram auf die Kinder Einfluss nahmen.
»Hol! Deinen! Vater! Zum! Essen!« Sie betonte jedes Wort und versuchte, nicht sofort zu explodieren. Sie war hungrig und müde.
Abends besserte sie Kleidung aus, um zumindest ein paar Euro zu verdienen. Die Nähmaschine arbeitete nicht mehr so zuverlässig wie früher, und Dorea hatte sich angewöhnt, mit besonderen Stichtechniken mit der Hand zu nähen. Doch das Geld reichte hinten und vorn nicht, und auf den Staat war kein Verlass. Knurrend und schimpfend machte Irini endlich, was sie ihr aufgetragen hatte, und schon bald ruckelte der einfache Rollstuhl quietschend und schabend durch den schmalen Flur.
An so etwas hatten sie damals nicht gedacht. Doch wer plante schon sein Leben auf eine solche Art? Wer bedachte schon das Schicksal, wenn er jung und voller Lebensfreude war?
9. Kapitel
Hyeronimos’ Telefon klingelte, bevor Penelope zu einer Erklärung ansetzen konnte, was ihr gerade alles durch den Kopf ging. Sie liebte, was sie tat, obwohl das sicher für viele Menschen unverständlich war, denn wie konnte man es lieben, einen toten Körper aufzuschneiden, Organe zu entfernen oder gar eine Scheibe vom Gehirn so selbstverständlich zu filetieren, als würde man ein Brot in Stücke schneiden. Sie hatte sich ganz bewusst für die Pathologie entschieden und nicht etwa dort angefangen, weil ihr nichts anderes übrig geblieben war. Ihre Mutter hatte ihr die Entscheidung mehr als übel genommen und sie sogar für den Tod ihrer Großmutter verantwortlich gemacht, denn wer konnte schon den Gedanken ertragen, dass das Enkelkind, anstatt chic in einer Privatpraxis zu residieren, lieber Leichenschändung betrieb! Doch es war eine sinnvolle Tätigkeit, denn nicht selten waren es genau ihre Erkenntnisse, die halfen, einen Mörder zur Strecke zu bringen oder Familien im Krankenhaus die Gewissheit einer Todesursache zu geben, um danach besser mit dem Geschehenen abschließen zu können. Sie liebte die Pathologie auch oder genau deshalb, weil sie mit ihren Besuchern zwar in stummer Zwiesprache stehen konnte, es am Ende aber nur auf wissenschaftliche Fakten ankam und nicht auf zwischenmenschliches Geplänkel, auf Lügen oder gar Verschlagenheit. Ein toter Körper sagte stets die Wahrheit.
Sie lauschte auf das Gespräch, denn ganz offensichtlich handelte es sich um ein berufliches Telefonat, jedoch war sie sich sicher, dass der Kommissar nicht mit seinem Chef sprach. Sie hatte ihn schon mehrfach gebeten, wenn sie mit im Wagen war, über die Freisprecheinrichtung zu telefonieren, doch egal, wie sehr er sich sonst an bestehende Regeln hielt, das Handy hielt er sich anscheinend gern ans Ohr. Er war ein sonderbarer Kerl, doch sie mochte ihn genau so, wie er war – mit all dem Licht und den Schatten, die ihn umgaben. Das machte ihn menschlich, verletzlich und greifbar. So, wie Menschen nun eben einmal waren.
Sie hatte in den letzten Wochen immer mehr das Gefühl bekommen, gegen alles aufbegehren zu müssen, was Unterdrückung nach sich zog, und das war ein gefährliches Fahrwasser. Es ging ihr um Unterdrückung jedweder Art, auch wenn man sich selbst oder einen Teil von sich unter Verschluss hielt und somit unterdrückte, aber eben auch jeder Form der gesellschaftlichen Unterdrückung. Ihr komplettes Arbeitsumfeld war männlich dominiert, und obwohl es völlig normal war, dass Frauen arbeiten gingen, um Geld für die Familie zu verdienen, so hatte es trotzdem keinen Einfluss auf das traditionelle Rollenbild auf der Insel. Zudem indoktrinierte die Kirche das gesamte System und kolportierte damit auch weiterhin die Unterordnung der Frau. Gern wurde jedoch das Prinzip kommuniziert, dass es die Frauen waren, die in den Familien die letzte Entscheidung trugen: Ein Kind übergab sich bei einem Fest, es heulte dreißig Minuten jämmerlich, endlich erhob sich auch der Vater nach dem fünften Tsikoudia, um nach Hause zu gehen. Wenn die Mutter dann entnervt darum bat, doch bitte auch ihren Teller leer essen zu dürfen, hoben die Vertreter dieser verqueren Auffassung den Zeigefinger und erklärten überzeugt, dass das ihre These beweise. Denn schließlich sei der Vater ja bereit gewesen zu gehen, und sie fälle nun die Entscheidung zu bleiben. Vergessen wurde, dass die Frau des Hauses nun im vollgerotzten Pullover dasaß und in dieser Zeit mehrfach Erbrochenes aufgewischt hatte.
Penelopes Geduld mit all dem schwand zusehends, und das machte ihr Angst.
»Was meinen Sie mit verschwunden?«, hörte sie Hyeronimos fragen und horchte auf.
Der Kommissar lauschte konzentriert auf den Wortschwall seines Gesprächspartners. Sie konnte jedoch nur wenige Wortfetzen aufschnappen.
»Jawohl, Herr Minister, selbstverständlich.« Es klang beinahe so, als würde er salutieren, und jetzt war sie wirklich neugierig auf das, was noch kommen würde, denn ganz sicher war dort Athen am Apparat. Sie spitzte konzentriert die Ohren und versuchte, anhand dessen, was sie hören konnte, und Hyeronimos’ Kommentaren herauszufinden, um was es ging. Der Mann neben ihr ließ resigniert die Schultern sinken, seine Miene versteinerte zusehends, und sie war sich plötzlich sicher, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Kaum dass sie einen Fuß auf heimischen Boden gesetzt hatte, war sie also schon wieder mittendrin im Leben. Unterm Strich war das vielleicht sogar gut, denn so würde sie nicht dauernd in dieses depressive Grübeln verfallen, denn in ihren Gedanken gab sie der Beziehung zu Eleni kaum eine Chance, und das belastete sie sehr. Der Altersunterschied war einfach zu groß, und auch ihre Lebenswege waren zu unterschiedlich. Noch einmal fühlte sie die Arme der jungen Frau um sich und ihre Lippen auf den ihren, sanft und fordernd zugleich. »Du bedeutest mir sehr viel, Penelope«, hatte Eleni geflüstert und sie erneut geküsst. Sie hatten am Eingang zum Security-Check-in am neuen Berliner Flughafen gestanden, und niemand hatte sich um sie gekümmert oder gar mit abwertenden Blicken bedacht. Sie waren einfach ein Paar gewesen, das sich voneinander verabschiedete.
Hyeronimos beendete das Telefonat, und fast sah es so aus, als wollte er das Handy aus dem geöffneten Fenster werfen. Sie schaute zu ihm, ließ ihm aber seine Zeit. Dann zuckte er entschuldigend mit den Schultern, griff unter seinen Sitz, holte das Blaulicht heraus, aktivierte es und setzte es aufs Dach.
Das hatte sie bisher noch nie erlebt, und sie war erstaunt, dass das Ding entgegen allen Mythen funktionierte.
»Was ist passiert, Hyeronimo?«, wollte sie wissen, denn sie mutmaßte, dass er sie nicht unter Blaulicht nach Ammoudara fuhr.
Mit quietschenden Rädern sauste er auch sogleich die nächste Abfahrt hinunter und nahm in einem halsbrecherischen Manöver die Auffahrt auf die andere Seite. Es ging also gen Osten.
10. Kapitel
»Was tust du da, Mama?« Elara fuhr hoch, als Selena neben ihr stand und ihr die Hand auf die Schulter legte. »O nein! Du schreibst schon wieder einen Brief an den Präsidenten. Bitte, Mama …«
Elara bedeckte das Schreiben mit einer Hand. Sie schämte sich nicht für das, was sie tat, wollte aber das Kind schützen und nicht in ihren ganz eigenen Kampf hineinziehen, obwohl sie genau wusste, dass es vollkommen unmöglich war, die Kinder da herauszuhalten. Es war ihr aller Leben, und ihre kleine Familie kannte es kaum anders. Sie war niemals eine Kämpferin gewesen, hatte niemals vorgehabt, ihr Leben so auszurichten, und doch verlor sie den Glauben daran nicht, dass sie eines Tages die Wahrheit erfahren würde – das war für sie zu einer Art Antrieb geworden. Es gab ihr die Kraft, jeden Tag aufzustehen und ihren Kindern eine gute Mutter zu sein.
Selena war bereits viel zu erwachsen für ihre elf Jahre und versuchte, sie überall zu unterstützen. Sie kümmerte sich um die kleine Alexia, die mit ihren sieben Jahren noch wirklich klein war, auch wenn sie nach den Sommerferien zur Schule gehen würde. Iraklis war ein Wildfang und tat alles, um jede Form von Aufmerksamkeit zu bekommen. Er war neun und kannte keine Angst oder zumindest vermittelte er diesen Eindruck, sie lebte also in ständiger Furcht um den Jungen. Er war seinem Vater in allem so ähnlich, dass sie manchmal verwirrt innehalten musste, wenn sie mit ihm sprach und dabei das Gefühl hatte, in Aristidis’ Augen zu blicken. Wenn Menschen davon sprachen, dass die Zeit alle Wunden heile, konnte sie nur trocken auflachen, denn es war eine Lüge. Die Zeit heilte gar nichts, ganz im Gegenteil: Sie machte es vor allem dann schlimmer, wenn sich nichts maßgeblich veränderte.
»Mama«, erneut war es Selenas Stimme, die sie aus ihren Gedanken zurück in die Realität holte, »bitte hör doch endlich auf damit. Ich … ich …« Das Mädchen wurde leiser und verstummte dann.
Elara straffte sich und legte ihrer Tochter eine Hand auf die Wange. Sie war so schön! Das schwarze Haar fiel ihr lockig auf den Rücken und umgab ihr Gesicht wie eine wellige Wolke. Die Sonne hatte ihre Haut in Bronze getaucht, und damit stachen ihre grünen Augen ganz besonders aus dem Gesicht hervor. Bald würde sie zur Frau werden, und die Jungen würden sich nach ihr umdrehen. Es war ihre Aufgabe, Selena zu beschützen. Sie schluckte trocken und unterdrückte ein würgendes Aufschluchzen. Ihre nicht enden wollende Verzweiflung half den Kindern nicht, sondern zog auch sie hinab. Hinab in diese dunkle Tiefe, in der die Monster nur darauf warteten, sich in das wehrlose Fleisch zu beißen und sich in das Innere des Menschen zu fressen. Der dabei entstehende Schmerz war nicht auszuhalten, und sie schaffte es oft kaum, sich aus dem Strudel wieder nach oben ans Licht zu kämpfen. Doch die Kinder durften sie nicht verlieren. Sie nicht auch noch.
11. Kapitel
Minister Dimitris Stefanakis fuhr sich entnervt durch das Haar. Er wusste, dass das aktuelle Geschehen weit mehr als kleine Wellen schlagen konnte oder ganz sicher sogar würde. Es lag an ihm und seiner Vorgehensweise, das zu verhindern oder herbeizuführen. Er war sich nicht sicher, welche Richtung er einschlagen wollte, und er konnte dies auch nicht komplett allein entscheiden. Doch er hatte nicht lange überlegt, wen er in vorderster Front sehen wollte, denn diese Wahl würde sich in alle Richtungen auszahlen. Er wusste auch, dass es nicht korrekt gewesen war, den vorgesetzten Major zu übergehen, dennoch war es wichtig, die Weichen gleich so auszurichten, dass er sein Engagement unter Beweis stellen konnte, denn er musste schlussendlich an niemand anderen als den Präsidenten berichten. Vielleicht reagierte er auch über, und alles war nicht so schlimm. Doch besser so als andersherum: Lieber warf man ihm vor, zu viel zu tun als zu wenig, denn geriet er in ein Kreuzfeuer der Befindlichkeiten – und das war etwas, was immer geschehen konnte – so war er auf der sicheren Seite. Soweit man politisch gesehen je auf der sicheren Seite sein konnte. Er fühlte sich seiner Heimat Kreta sehr verbunden, sein ältester Sohn Nicholas hatte sich dort mit einer Privatpraxis niedergelassen, nachdem er lange im Athener Generalkrankenhaus Ippokrateio gearbeitet hatte. Der Junge hatte seine Karriere vorbildlich gesteuert, angemessen geheiratet und lebte und praktizierte im schicken Elounda. Er war stolz auf diesen Teil seiner Familie. Über Sohn Nummer zwei dachte er jedoch weniger gern nach. Iota, seine Ex-Frau, hatte ihn vollkommen verzogen, und so war Konstantinos auch vollkommen aus der Spur gelaufen. Dimitris war sogar häufig versucht zu leugnen, dass er zwei Söhne hatte. Konstantinos pendelte zwischen dem Festland und der Insel hin und her, schien mal im Geld zu schwimmen und mal auf die Almosen seines Vaters angewiesen zu sein, denn dann stand er bettelnd bei ihm in der Tür. Dimitris hatte schon einige Male mit dem Gedanken gespielt, ihn hinauszuwerfen oder seine Bodyguards anzuweisen, den jungen Mann einfach nicht durchzulassen. Doch er scheute sich vor dem, was das nach sich ziehen konnte. Schlimmstenfalls würde sich daraus eine Rufmordkampagne entwickeln, die er nicht mehr stoppen konnte. So gab er Konstantinos regelmäßig Geld. Er hatte gerade erst wieder eine unschöne Begegnung mit dem Bengel gehabt und war noch mental angegriffen.
Als der Anruf ihn erreicht hatte, dass eine englische Touristin die Küstenwache über ein sonderbares Ereignis vor der kretischen Küste informiert hatte, war ihm daher das Herz mehr als in die Hose gerutscht. Die Frau hatte mit ihrer Familie eine Jacht gechartert und schipperte durch die Ägäis. Sie hatten das gute Wetter genutzt und auf dem offenen Meer geankert, um einige Runden mit dem Jet-Ski, der zur Jachtausstattung gehörte, zu drehen. Die Tochter im Teenageralter hatte gerade mit dem Ding ihre Bahnen gezogen, und die Mutter hatte das Mädchen mit Argusaugen und einem Fernglas im Blick behalten. So war sie auf das niedrig fliegende Objekt aufmerksam geworden, das von einer Sekunde auf die andere ins Wasser gefallen und verschwunden war. Sicherheitshalber, so hatte sie es den Polizisten erklärt, habe sie die Behörden informiert, auch wenn ihr Mann gemeint habe, sie sei einer Fata Morgana zum Opfer gefallen. Die resolute Frau hatte sich jedoch nicht abbringen lassen und so den Stein ins Rollen gebracht.
Der mittlerweile zu einem Felsbrocken angewachsene Stein lag nun in seinen Händen, und er hatte versucht, alles so schnell wie möglich in die Wege zu leiten, um aus dem Vorkommnis keinen Staatsakt werden zu lassen. Sicher hatte er bei aller kühlen Berechnung mit der Beauftragung der Mordkommission zu viel getan, doch sein Bauch sagte ihm, dass es der richtige Schritt war. Okay, der Pilot konnte auch einen Herzinfarkt erlitten haben, oder eine falsche Reaktion hatte den Hubschrauber zum Absturz gebracht. Doch er sei extrem niedrig geflogen, hatte die Augenzeugin berichtet, also hatte er gewiss unter dem Radar bleiben wollen, und das sprach aus seiner Sicht dafür, dass hier etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zuzugehen schien. Und selbst wenn Galavakis nicht in seinem originären Berufsfeld zum Einsatz kommen würde, so war er ein cleverer Ermittler, und das würde überall den Eindruck vermitteln, dass Dimitris alles tat, um das Geschehen aufzuklären. Wohl wissend, dass Flüge unter dem Radar nie etwas Gutes bedeuteten und in ganz bestimmte Richtungen wiesen.
12. Kapitel
»Es tut mir leid, dass ich dich einfach so entführe.« Einerseits tat es ihm wirklich leid, dass sie nicht erst einmal nach Hause gehen durfte, nachdem sie die Insel gerade erst betreten hatte, und andererseits war er extrem froh, dass sie just in diesem Augenblick in seinem Auto saß und mit ihm in diese sonderbare Situation geriet.
»Kann ich jemanden anrufen für die Lösegeldverhandlungen?«, fragte sie und knabberte an einem weiteren Gebäckstück aus der Emmanouil-Pâtisserie, während sie die Tüte mit hochgezogenen Augenbrauen in die Luft hielt. »Denn das hier reicht echt nicht aus für eine Fahrt nach … Wohin fahren wir eigentlich?«
»Wir fahren nach Sitia, also eigentlich auf die Landzunge nahe Akra Faneromeni«, gab er wieder, was er gehört hatte.
»Akra…was?« Penelope zückte ihr Handy, rief Google Maps auf und ließ sich das ins Meer hineinragende Gebiet anzeigen.
»Da ist nichts«, meinte sie und hielt ihm das Gerät hin.
Hyeronimos warf einen raschen Blick darauf. »Ja, der Teil ist unbewohnt, ein Stück Richtung Sitia ist noch eine kleine Ansammlung von Gebäuden, und dann enden auch die Straßen, aber du hast ja gute Schuhe an«, er warf ihr erneut einen Blick zu, »wir müssen wahrscheinlich ein Stück laufen.«
»Verrätst du mir bitte endlich, was passiert ist und wer dich da angerufen hat?«
»Quasi die rechte Hand unseres Präsidenten«, gab er stöhnend zu und wurde sich erneut der Tragweite des Befehls bewusst, »die Küstenwache wurde von einer englischen Touristin alarmiert, die ein Flugobjekt hat ins Wasser stürzen sehen.«
Penelope sog scharf den Atem ein. »Echt oder Aliens?«
»Leider wohl ziemlich echt, denn die Kollegen haben ein Rotorblatt gefunden, was für einen Hubschrauber spricht, und die Ortung und die Taucher sind schon unterwegs«, führte er aus.
»Das klingt nicht gut«, bestätigte die Pathologin, »haben sie Überlebende gefunden? Was sagt die Flugsicherung?«
»Das ist das, was es zu so einer ›besonderen‹ Sache macht«, er ließ das Lenkrad kurz los und setzte das Adjektiv in Anführungszeichen, »denn der Flug war weder angemeldet noch sichtbar.«
»Er ist unter dem Radar geflogen?« Ihre Stimme klang überrascht.
»Ja … und in diesem Bereich dort draußen ordnet unsere Regierung das offensichtlich eher unter kriminelle Aktivität ein«, fuhr er fort.
»Also Waffen? Drogen? Oder ein illegaler Personentransport?«, sinnierte Penelope.
»Das könnte sein, aber die Frage ist natürlich auch, wo der Hubschrauber hinwollte, denn da gibt es einfach weit und breit … nichts.« Er spürte, wie seine Neugier immer mehr erwachte. »Es war übrigens Dimitris Stefanakis, der mich da angerufen hat.«
Penelope ließ ihren Unterkiefer herunterklappen, wandte ihm den Kopf zu und schob mit einer Hand das Kinn wieder hoch.
»Mhh, so ging es mir eben auch«, meinte er nickend.
»Unser Minister für internationale Beziehungen, auweia, Hyeronimo. War der Hubschrauber schon in internationalen Gewässern? Warum ruft er dich an?«
»Ich weiß es nicht, habe aber meine Vermutungen. Ich muss jetzt erst einmal mit Stelios telefonieren. Ich muss wissen, was der Minister ihm gesagt hat.« Hyeronimos nahm das Handy erneut ans Ohr, während er den Wagen mit Blaulicht über die Nationalstraße jagte.
»Darf ich mithören?«, bat sie.
»Entschuldige!« Er klemmte das Handy in den Halter, und es verband sich mit der Freisprecheinrichtung.
»Hyeronimo«, rief Stelios scheppernd, »was ist das für eine verdammte Scheiße?«
»Penelope sitzt neben mir, ich habe sie eben vom Flughafen abgeholt«, informierte er seinen Chef einerseits, damit er wusste, dass sie mithörte, und andererseits, um ihn davon abzuhalten, weiterhin so zu fluchen, denn normalerweise entsprach dies gar nicht Stelios’ Art.
Stille entstand, dann räusperte sich Mentakis und sagte: »Hallo, Penelope, kaum zurück und schon mittendrin. Entschuldige meine harsche Ausdrucksweise, aber ich bin echt außer mir.«
»Sei unbesorgt, ich habe schon mal jemanden fluchen hören, Stelio, und kann das selbst auch ganz gut«, beruhigte ihn Penelope.
»Dimitris Stefanakis hat mich angerufen«, begann Hyeronimos.
»Malakka«, fluchte Stelios erneut, »der Mann ist wirklich ein durchtriebener Mistkerl!«
»Lass uns den Wissensstand abgleichen«, versuchte Hyeronimos erneut, seinen Chef zu beschwichtigen, denn dessen Unmut brachte ihnen aktuell nichts, »ich fahre nämlich gerade zu einem GPS-Datenpunkt im Gebiet von Sitia, weil dort wohl ein niedrig fliegender Hubschrauber ins Meer gestürzt ist. Keine Ahnung, warum die Mordkommission da sofort ins Spiel kommt. Weißt du mehr?«
»Er hat mir mitgeteilt, dass er dich auf den Fall ansetzen möchte, was sich in meiner Welt ja eher so anhört, als wäre das der zweite Schritt, aber bitte nicht der erste«, ereiferte sich der Major der Polizeibehörde. »Seine Erklärung war, dass der Pilot bisher noch nicht aufgetaucht sei und man daher von einem gewaltsamen Tod ausgehe. Klingt das nur für mich konstruiert oder auch für euch?«
»Er könnte auch einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten haben«, schaltete sich Penelope ein.
»Richtig«, blaffte Mentakis.
»Es könnte aber auch etwas dran sein bei einem Flug unter dem Radar«, warf Hyeronimos ein.
»Hat er das gesagt? Also das mit dem Radar?« Stelios wurde wieder lauter.
»Er hat nichts dergleichen gesagt«, Hyeronimos blieb ruhig, »nur, dass der Hubschrauber sehr niedrig flog, denn das hat wohl auch die Zeugin mit ihrem Fernglas beobachtet.«
»Also Drogen«, knurrte sein Chef, »verdammtes Kokain oder irgendein chemischer Dreck!«
»Wäre möglich. War ein Schiff irgendwo in der Nähe? Kein Hubschrauber fliegt so niedrig ins Nirgendwo, und nach Gyanisada oder Dragonada bringt ja auch nur etwas, wenn jemand dort vor Anker geht. Ist die Touristin denn wirklich eine … Touristin?«, wollte Hyeronimos wissen.
»Ich gehe davon aus. Sie haben mit der Familie eine Jacht gechartert. Das hat der Herr Minister wohl sofort überprüfen lassen«, erklärte Stelios Mentakis nun etwas ruhiger.
»Zurück zum Schiff«, warf Penelope erinnernd ein.
»Unserem aktuellen Wissensstand nach gab es kein Schiff, außer der Jacht in der Nähe«, gab der Polizeichef sein Wissen weiter, »ich habe es jedoch noch nicht selbst überprüft.«
»Lass das doch Zacharis machen«, brachte Hyeronimos seinen Mitarbeiter ins Spiel. Der Mann war zwar sonderbar – gut, wer war das nicht? –, aber er war hervorragend, wenn es darum ging zu recherchieren. »Wenn es etwas zu finden gibt, dann findet er es.«
»Sehr lobenswerte Idee«, gab Stelios zu.
»Mal im Ernst, Stelio, was vermutest du, warum mich ein hohes Tier wie Stefanakis persönlich anruft und damit die normale Befehlskette bewusst umgeht?«, hakte Hyeronimos nach.
»Ich habe wirklich keine Ahnung, was das soll. Ich kann es mir nur so erklären, dass er etwas vermutet oder gar weiß, was er nicht preisgeben möchte, und nun sind wir, also du, da mittendrin.«
»Und was, wenn ich das gar nicht will?«, begehrte Hyeronimos kurz auf. Er hatte wirklich keine Lust, sich wieder in politische Ränkespiele und Befindlichkeiten zu begeben, so wie bei dem Fall mit den drei Toten am Strand von Vai im vergangenen Jahr. Sein Cousin Costas, rechte Hand eines Ministers, hatte ihn damals gezielt mit der Aufklärung des politisch brisanten Falls betraut und einiges von ihm verlangt. Er konnte es nicht ausstehen, wenn man ihn instrumentalisierte, doch genau das schien hier erneut der Fall zu sein.
»Die Vorgehensweise ist doch ganz einfach«, ergriff Penelope nun das Wort, »Athen schickt einen sehr guten Ermittler an die Front, und zwar, ohne irgendwelche Zuständigkeiten zu berücksichtigen. Die Kollegen vor Ort haben unseren Eingriff damals schon ertragen dürfen, nun sind wir wieder da, und du, Stelio, hast auch keine Befehlsgewalt. Die hat dir Stefanakis abgenommen, was so viel bedeutet, wie: Wir in Athen halten die Fäden in diesem Fall in der Hand.« Im Auto war es still, und sie setzte an, ihre Gedanken weiter zu erläutern, als es laut hörbar an Stelios’ Tür klopfte.