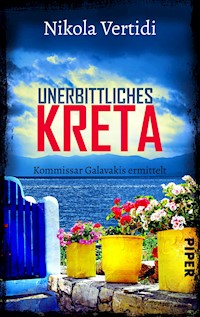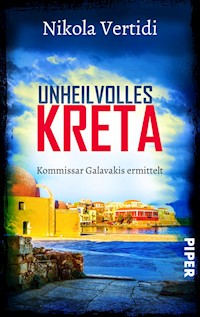10,48 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine gläserne Villa, eine wohlhabende Familie, eine Frau zwischen Verantwortung und Liebe: Die große Kreta-Saga von Nikola Vertidi »Sie hatte sich nicht in einen bösen Menschen verliebt, auch wenn sie vielleicht noch zu jung und unerfahren gewesen war, um so etwas erkennen zu können. In jedem Menschen war so ein Kern, der die Saatkörner des Verabscheuenswerten beherbergte, und es gab gewiss in jedem Leben genügend Dünger, um diese zu nähren und wachsen zu lassen.« Nach dem Tod ihres Onkels übernimmt die Innenarchitektin Katharina die Aufgabe, seine Villa in den kretischen Bergen zum Verkauf herzurichten. Alte Briefe ihres ebenfalls verstorbenen Vaters und Notizen ihres Onkels erlauben ihr einen unerwarteten Blick in die Vergangenheit ihrer Familie. Katharina kommen Zweifel an dem Bild, das sie von ihren Angehörigen hat. Ihre fast hundert Jahre alte Großmutter Hera erzählt ihr zudem von einem Geheimnis, das die Frauen ihrer Familie seit Generationen hüten. Doch erst als Katharina einen Mann kennenlernt, der ihr auf unerklärliche Weise vertraut vorkommt, erkennt sie, was es mit dem Familiengeheimnis auf sich hat und worauf es im Leben wirklich ankommt. »Den Leser erwartet ein emotionaler, packender, geheimnisvoller und zugleich romantischer Roman, in dem es um ein altes Geheimnis geht. Was hat es mit dem Familiengeheimnis für eine Bewandtnis? Kommt mit nach Kreta und lüftet mit Katharina dieses Geheimnis...« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Das Erbe des Meeres – Eine kretische Familiensaga« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Julia Feldbaum
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Verwendung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorbemerkung
Die Magie des Meeres
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
Nachwort
Danksagung und mehr
Triggerwarnung
Stammbäume
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Liebe Leser:innen,dieser Roman enthält mögliche triggernde Inhalte. Deshalb befindet sich hier eine Triggerwarnung und am Ende des Buches – um die Gefahr des Spoilerns zu umgehen – eine detaillierte Liste über die Themen.
Die Magie des Meeres
Du bist fremd und so vertraut,
tief, verschwiegen, still.
Alles, worauf Hoffnung aufbaut,
was des Lebens Ziel nur will.
Dir geb ich ungehindert mein Herz,
bezahle mit Steinen und Blut,
du nimmst mir ab jeden Schmerz,
spülst ihn hinfort mit der Flut.
Welle für Welle voller Kraft,
zeigst du stets deine Stärke und Macht.
1. Kapitel
Litsa, 1824
Der Hase hatte ein flauschiges Fell. Es war so weich, und seine kleine Nase mit den feinen Härchen zitterte. Sie hielt ihn an sich gepresst, hatte ihn dabei beobachtet, wie er durchs Gebüsch hoppelte, und er hatte so winzig und einsam ausgesehen. Bestimmt hatte er keine Mama und brauchte jemanden, der auf ihn aufpasste.
Sie würde ihn mit hinabnehmen, sobald sie in die Höhle zurückkehrte, aber noch genoss sie die frische Luft und die Sonnenstrahlen, obwohl ihre Mutter Aelia ihr verboten hatte hinauszugehen. Sie hatte sich fortgeschlichen, als die Mutter das Baby an die Brust nahm und ihre Augenlider vor lauter Müdigkeit zu flattern begannen. Obwohl die Höhle sehr groß war und mit ihren kleinen Einbuchtungen und Unterteilungen durch die Steine, die aus dem Boden und von der Decke wuchsen, Raum für viele Menschen bot, war es doch laut und voll dort. Es waren sehr viele Mütter und Kinder und nur ein paar wenige Männer, die auf sie achtgaben. Die Lehrerin hatte gesagt, es seien rund dreihundertsiebzig Menschen, die in der Höhle voller Zauber Schutz suchten vor den bösen Leuten.
Sie hatten ihr Zuhause verlassen und nur wenige Dinge mitgenommen, deshalb wollte sie nun wenigstens den kleinen Hasen behalten. Doch sie ängstigte sich, dass die Männer ihn an einem Stock über dem Feuer braten würden, anstatt ihn ihr zum Liebhaben zu überlassen.
Sie lehnte sich an einen Stein und kraulte den flauschigen Nacken. Er war so süß, und sie hatte ihn schon jetzt so gern, sie konnte ihn unmöglich sich selbst überlassen. Es war Nachmittag, und wenn es dunkel würde, fürchtete er sich gewiss. Sie hatte auch oft Angst, denn in der Höhle gab es nur eine kleine Feuerstelle, weil der Rauch nicht gut für sie alle war und beim Einatmen in der Lunge brannte.
Morgens fand Schulunterricht für die Kinder statt, und sie lernten zu rechnen, Geschichten zu erzählen und ihre Namen zu schreiben. Das war vorher nicht so gewesen, denn da mussten sie auf den Feldern und beim Ziegenhüten helfen. Insofern hatte es auch etwas Gutes, dass sie aus dem Dorf geflohen waren. Denn in der Höhle durften sie viel mehr spielen, auch wenn sie immer darauf achten mussten, nicht zu laut zu sein. Nach draußen durften sie nur ganz selten und nur, wenn die Männer ganz genau nachgesehen hatten, dass keines der bösen Monster in der Nähe war. Ihr Papa, Manolis, war mit vielen anderen Papas fortgegangen, um gegen die Bösen zu kämpfen und sie fortzujagen. Erst wenn die Monster alle tot oder geflüchtet waren, würden sie die Höhle verlassen und ins Dorf zurückkehren.
Sie hatte aufgehört zu fragen, wann das sein würde. Anfangs wollte sie es noch jeden Tag von der Mutter wissen, doch die zuckte immer nur mit den Schultern und sah so aus, als wollte sie gleich weinen. Also fragte sie nicht mehr, hoffte aber jeden Tag und betete zu Gott, dass ihr Papa viele der bösen Männer umbringen würde.
Das kleine Tier in ihrem Arm begann, heftig mit den Ohren zu zucken, und drängte sich plötzlich eng an sie. »Hab keine Angst, mein Kleines«, flüsterte sie dem Hasenkind zu und streichelte ihm mit langen Strichen über den Rücken. Sie musste überlegen, was sie nun machen sollte. Ihre Sorge, dem kleinen Kerlchen zu schaden, wenn sie es in die Höhle schmuggelte, war groß, aber ein kleines schutzloses Kind war hier draußen doch auch in Gefahr. »Du musst ganz still sein, wenn ich dich mit hinunternehme«, sagte sie und schaute dem Hasen in seine dunklen wissenden Augen. Er konnte sie verstehen, dessen war sie sich ganz sicher.
Dann hörte sie, was das Fellknäuel wahrscheinlich schon vernommen hatte: Stimmen näherten sich der Höhle. Sie konnte sie sehr gut hören, und sie wusste, sie waren nah. Die Worte klangen kehlig und unverständlich, aber ihr war sofort klar, dass die Situation zu bedrohlich war, um nun aufzustehen und zu der Öffnung zu laufen, die hinab in die schützende Höhle und in die Arme ihrer Mutter führte. Ängstlich drückte sie sich an den noch sonnenwarmen Stein, zerdrückte dabei wohl einige Oreganopflanzen, denn der typische Duft des Gewürzes stieg ihr in die Nase, und ihr Magen begann auffordernd zu knurren.
Dann sah sie die Männer, denen die Stimmen gehörten, und blickte erstaunt auf die sonderbaren Kopfbedeckungen, die sie trugen: Anscheinend hatten sie sich Tücher umgewickelt und Federn und Tand hineingesteckt. Manche hatten auch Hüte auf, die wie kleine Eimer aussahen, nur dass sie bunt waren. Sie trugen lange Gewänder und an den breiten Gurten und Gürteln konnte sie Waffen erkennen, die im Sonnenlicht blitzten. Das waren die Teufel! Sie kamen und würden sie entdecken und dann all die furchtbaren Sachen mit ihr machen, vor denen ihre Mutter sie stets gewarnt hatte. Sie wollte nicht, dass man ihr die Eingeweide herausriss, während sie dabei zusah, denn sie war sich sicher, dass das sehr wehtat. Sie konnte nicht mehr zurück in die schützende Höhle, der Feind war schon zu nah. Sie presste den Hasen ängstlich an sich, doch offenbar fügte sie dem Tier Schmerzen zu, denn es begann mit seinen kleinen Krallen um sich zu schlagen. Eine ritzte ihre Hand, und ein blutiger Kratzer erschien. Dann zappelte der kleine Kerl wild, und sie konnte ihn nicht mehr halten. Das Tier hoppelte durch das Gebüsch davon, und sie presste die Hand mit dem Riss an ihren Mund, um nicht vor Panik aufzuschreien.
Die Männer postierten sich vor dem Eingang. Sie stiegen nicht hinab, sondern warteten auf weitere wild aussehende Kerle, die begannen, Steine von hölzernen Wagen herunterzuheben und sie vor dem Eingang der Höhle aufzustapeln.
Als es dunkelte, war der Zugang nicht mehr zu sehen, nur einige Lücken in der steinernen Mauer zeigten, dass dort einst das große Loch gewesen war, durch das man hatte hinabgehen können. Sie hatte sich mittlerweile eingenässt und fror erbärmlich, traute sich aber nicht, sich zu bewegen. Diese Kerle schleppten Reisig und knorriges Olivenholz herbei. Würden sie jetzt gemütlich hier hocken und sich etwas zu essen über den Flammen zubereiten? Sie verstand die Männer nicht, die nun ein qualmendes Feuer entzündeten und dabei sonderbare lachende Laute von sich gaben. Als der Rauch durch die Lücken der Steine kroch, bekam sie noch mehr Angst.
Irgendwann hörte sie dumpfe Schreie aus der Höhle. Es dauerte sehr lange, bis sie verstummten, und währenddessen tanzten die Teufel mit wilden Gesängen, und der Feuerschein warf ihre Schatten an die Felswände. Sie spürte ihre Beine nicht mehr, und ihre Hände kribbelten von der Sitzposition, in der sie bewegungslos verharrte.
Erst als die Männer schlafend neben dem glühenden Feuer zur Ruhe gekommen waren, kroch sie davon, folgte dem kleinen Hasen, der wohl gewusst hatte, wo er sicher war, und kam vor lauter Angst kaum voran. Sie wusste nur, dass sie nicht mehr in die Höhle zurückkonnte und dass sie vor den grausamen Wesen fliehen musste.
2. Kapitel
Katharina, Gegenwart
Sie griff sich in den Nacken, hob das dicke schwarze Haar an und steckte es mit geübtem Griff hoch. Es war glatt und schimmerte wie poliertes Ebenholz. Sie hatte es von ihrer Mutter geerbt. Olympias Haare waren etwas ganz Besonderes gewesen. Andreas, Katharinas Vater, hatte oft davon erzählt, dass die Kombination aus dem im Wind schwingenden Haar und dem frohen Lachen ihn unmittelbar ins Herz getroffen habe. Er hatte sich so sehr in ihre Mutter verliebt, dass er keinen Augenblick seines Lebens mehr ohne sie verbringen wollte.
Die Verbindung zwischen ihren Eltern war einzigartig gewesen, das hatte man immer gespürt. Natürlich hatten sie auch mal gestritten, waren laut und emotional geworden, doch stets hatte sie bei alldem Liebe und Respekt getragen. Nach Olympias Tod war Andreas nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen. Doch er hatte nicht lange ohne sie sein müssen, denn er war ihr zwei Jahre später gefolgt. Es waren geplatzte Adern gewesen, die ihr beide Eltern so schnell hintereinander geraubt hatten – bei ihrer Mutter die Aorta nahe dem Herzen und beim Vater eine Hirnblutung.
Sie war erwachsen, doch das änderte nichts daran, dass sie nach dem Tod der Eltern auch keine Tochter mehr war; sie war niemandes Kind mehr! Es gab keine Mama und keinen Papa, in deren Armen man selbst als erwachsene Frau Trost finden und ungehemmt weinen konnte oder sich einfach nur geborgen fühlte. Nachdem sie ihre Mutter zu Grabe getragen hatten, war ihr überdeutlich klar geworden, dass man nie genug Zeit hatte, um etwas zu tun – all die Orte, die sie noch gemeinsam bereisen wollten, all die Gespräche, die sie aufgeschoben hatten. So viele ungesagte Worte, so viele nicht geschenkte Umarmungen!
Sie hatte Angst, dass eines Tages die Erinnerungen verblassen würden, dass sie sich nicht mehr an die Stimmen ihrer Eltern erinnerte oder vergaß, wie sie gelächelt hatten. Anfangs reichte bereits ein Musikstück aus oder eine Bluse im Schaufenster, die Olympia gefallen hätte, und die Tränen flossen, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Doch mit der Zeit hatte sie gelernt, die Trauer zu kontrollieren, und weinte nur noch, wenn sie allein war oder sich unbeobachtet fühlte.
Ihr Bruder Elonidas war ganz anders mit dem Verlust umgegangen. Er hatte seine nicht verarbeitete Wut über den Tod der Mutter am Vater ausgelassen. Olympia war einfach so gestorben – ohne vorher Bescheid zu sagen. Er wusste heute natürlich, dass seine Vorwurfshaltung albern gewesen war, hatte sie aber weder ändern können noch wollen. Elonidas, der mit dem Vater und dessen Bruder Giorgos die Hotel- und Restaurantgruppe leitete, hatte Katharina mehr als einmal beiseitegenommen, um zu verdeutlichen, dass ihr Vater soff, um sein Leben noch zu ertragen, und dass dies für ein Unternehmen mit ihrem Renommee nicht länger tragbar sei. »Er muss in Rente gehen, Katha, oder was auch immer. Aber er darf nicht mit wirrem Haar und diesem ungepflegten Gestrüpp im Gesicht, das er Bart nennt, durch die Anlage geistern. Er erschreckt die Gäste!«
Sie hatte ihn bestürzt angeblickt und nicht zum ersten Mal den Gedanken gehegt, dass Elonidas Giorgos mehr glich als dem eigenen Vater. Es ging ihm um Ansehen, um Reichtum und die Außenwirkung. »Du solltest dich schämen«, hatte sie auf solche Aussagen seinerseits gekontert, »sie war die Liebe seines Lebens, und etwas in ihm ist zerbrochen, seit Mama … weg ist.«
»Deine Kleinmädchenträume in Ehren, Schwesterlein … Liebe seines Lebens. Das ist schön und gut, aber es entschuldigt nicht, dass er hier für Unruhe sorgt und den Geschäftsbetrieb stört. Ich habe schon genug mit Onkel Giorgos und seinem oft peinlichen Bonzenverhalten zu tun. Ich kann nicht noch mehr Baustellen vertragen!« Er hatte sich so aufgeregt, dass sein Kopf ganz rot geworden war.
Schon als Kind hatte er sich furchtbar über Kleinigkeiten empört, und Katharina stellte sich oft vor, dass sein Kopf immer dicker wurde und dann wie ein Luftballon, in den man zu viel Luft hineingeblasen hatte, einfach platzte. Wo sich bei anderen das Gen für Lebensfreude befand, war bei Elonidas die Pflichterfüllung gelandet.
Er hatte unter dem enormen Druck gestanden, Vater und Onkel beweisen zu müssen, dass das Management bei ihm in guten Händen lag.
Nun war alles anders, denn durch den beinahe gleichzeitigen Tod der beiden alten Herren war Elonidas schneller an der Spitze gelandet als geplant, und die Last auf seinen Schultern wog zu viel, auch wenn er dies nie zugeben würde.
Giorgos’ Söhne waren zu sehr mit ihren eigenen Leben beschäftigt, und keiner der beiden Cousins hatte auch nur eine Sekunde lang darüber nachgedacht, was alles zu tun war, wenn man gemeinsam ein Familienunternehmen besaß und die Alten nach und nach verstarben.
Sie selbst war Innenarchitektin und keine Juristin, und auch wenn sie es ihrem Vater bis zu seinem Tod verschwiegen hatte: Ihre Mutter hatte immer geahnt, dass Katharinas Ehe mit dem erfolgreichen Strafverteidiger Lambros Panteris schon kurz nach dem Jawort zu Ende gewesen war. Ihn einzubinden, um Rechtliches zu klären, war also niemals infrage gekommen. Vielmehr hatte sie die schlimmste Phase der Trauer genutzt, um sich endgültig von ihrem Mann zu trennen. Sie hatten zu spät begonnen, über Kinder nachzudenken, und Emmanouil und Markos waren erst zehn und acht Jahre alt. Für die Jungs kam die Trennung einem Schlag ins Gesicht gleich. Sie hatten den Tod des Großvaters nur mühsam verkraftet, und als Lambros sich mit dem Koffer in der Hand theatralisch zu ihnen hinabbeugte, ihnen über die Köpfe streichelte und sie »meine Lieblinge« nannte, flossen Sturzbäche an Tränen. Sie hätte ihn am liebsten geohrfeigt, denn er hatte die Jungs sonst, so gut es ging, ignoriert. Nur wenn sie Gäste hatten oder sie irgendwo eingeladen waren – oder eine öffentliche Veranstaltung stattfand –, besann er sich auf seine Familie und die Rolle des stolzen Vaters. Erleichterung hatte sich in ihr breitgemacht, als er die Tür hinter sich mit einem lauten Knall ins Schloss geworfen hatte, aber die Jungs litten noch immer.
Zudem war jede Besuchszeit eine wirkliche Herausforderung für ihre Nerven. Lambros war nie pünktlich – weder beim Abholen noch beim Bringen. So konnte es unter Umständen sein, dass die Kinder sonntags kurz vor Mitternacht zu Bett gingen, da der Vater sie erst nach elf brachte – natürlich vollkommen überdreht und die Taschen voll mit neuem Kram. Nicht dass sie nicht genügend Geld hatte, um den beiden Wünsche zu erfüllen, sie modern zu kleiden und ihnen die besten Lernhilfen zur Verfügung zu stellen. Daran lag es nicht. Es war seine Art, die Jungs auf seine Seite zu bringen. Wahrscheinlich würde er sie demnächst mit geladenen Pistolen und Päckchen voller Munition versorgen, falls sie beim Anblick eines der zerschossenen Straßenschilder in den Bergen Interesse an diesem »Volkssport« äußerten. Hauptsache sie ärgerte sich, das war das Ziel all seiner Aktionen.
Sie wusste, wie emotionsgeladen ihre Reaktionen waren, konnte sich jedoch trotzdem nicht davor schützen. Noch immer wollte sie ihm die Faust in sein provokativ lächelndes Gesicht rammen, tat es aber nicht, weil sie umgekehrt auch nicht von ihm geschlagen werden wollte. Doch die Wut lauerte direkt unter ihrer Haut, und irgendwann musste sie verschwinden, damit sie wieder glücklich sein konnte.
Katharina hatte noch keine Ahnung, wie das funktionieren sollte, denn aktuell war sie die Meisterin des Bluffens und machte gute Miene zum bösen Spiel. Wahrscheinlich saß sie deshalb auch hier oben in den Bergen und blickte vom gläsernen Palast »Seiner Majestät« hinab auf das einfache Volk. Auch wenn Onkel Giorgos stets geschworen hatte, niemals zu vergessen, woher er kam, so sprach dieses Haus hier eine ganz andere Sprache. Und was er getan hatte, passte noch viel weniger zu dem, wo er herkam.
Sie saß auf der atemberaubenden gläsernen Terrasse und schaute in die Ferne. Die Bergwelt hob sich in sanften Schwingen vom Horizont ab und schimmerte grün im Sonnenlicht. Manche Erhebungen reckten ihre Zacken, die teilweise oberhalb der Baumgrenze lagen, gezähnt in den Himmel, und andere sahen aus, als hätte ein Maler sie mit gleichmäßig schwungvollen Pinselstrichen abgebildet. Es war bezaubernd, und sie konnte gut verstehen, warum Giorgos gerade hier gebaut hatte. Nur wenn der Wind kräftig blies, konnte man manchmal die Glocken des nahe gelegenen Klosters hören, ansonsten war es so still, dass sie ihren Herzschlag vernahm und auch das Rauschen des Blutes in ihren Adern.
Sie hatte die Jungen nur widerwillig bei Lambros abgegeben, doch hier oben wartete eine Aufgabe auf sie, die sie viel zu lange vor sich hergeschoben hatte. Und mit dieser Aufgabe war sie mutterseelenallein. Ihre Cousins, Panagiotis und Athanasios, hatten abwehrend die Hände gehoben, und Elonidas war sowieso nicht infrage gekommen, denn er hatte keinen Hehl daraus gemacht, wenn möglich nie mehr an Giorgos denken zu müssen. Also nicht mehr, als er tagtäglich musste, wenn er in den Hotels und Restaurants die Aufgabenbereiche seines Onkels übernahm.
Wer also außer ihr sollte es auf sich nehmen, dieses Monument des Reichtums auszuräumen? Ihre beiden Cousins wollten es verkaufen. Sie selbst hatte es damals für Onkel Giorgos eingerichtet, also hatten die zwei es als naheliegend empfunden, dass Katharina es auch wieder ausräumte. Sie hatte knapp zehn Tage Zeit, länger konnte und wollte sie ihre Söhne nicht bei Lambros lassen, und sie war sich sicher, dass das auch ausreichte.
Die Fahrt war angenehm gewesen. Sie hatte auf der Strecke in Meronas einige Lebensmittel eingekauft und sich vorgenommen, den exklusiven Weinvorrat, den ihr Onkel gehortet hatte, zu sichten und sich damit gepflegt zu betrinken. Das hatte dieser Idiot wirklich verdient: Mit jedem Glas würde sie seinen Namen aussprechen und ein Schimpfwort hinzufügen!
3. Kapitel
Litsa, 1824
Ihre Knie waren aufgeschürft und eine helle Flüssigkeit tropfte aus den Wunden. Sie konnte den Gestank riechen, der davon ausging, wenn sie versuchte, sich zusammengerollt auszuruhen. Der Hase war fort, genau wie all die Menschen, zu deren Gemeinschaft sie noch vor wenigen Tagen gehört hatte. Nun war sie allein.
Sie hatte bisher nicht gewusst, was das bedeutete, denn immer war jemand da gewesen. Bevor der Vater mit den anderen Männern in die Berge aufgebrochen war, war ihre Mama stets um sie herum gewesen. Ihre Yaya kochte für sie und nahm sie mit zu den Carobbäumen, um diese mit den anderen Frauen des Dorfes zu pflegen und die Früchte zu ernten. Nikos – ihr winziger Bruder – lag in seinem Körbchen und lutschte fröhlich glucksend an seinen rosigen Händchen. Sie sah ihm begeistert dabei zu, wie er es schaffte, auch die kleinen süßen Zehen in den Mund zu stecken. Nachts schliefen sie alle gemeinsam in einem Zimmer, und sie kuschelte sich an ihre Eltern. Doch dann mussten sie in die Höhle, und der Vater ging fort. Sie weinte oft, denn sie vermisste ihn – aber auch, weil die Mutter immer trauriger und kraftloser wurde.
Litsa wusste, dass Mutter und Vater sich sehr lieb hatten, und sie versuchte, ihrer Mama Trost zu spenden, wann immer sie konnte. Nachts nahmen sie sich auf ihrem Lager in die Arme, doch es war anders als zu Hause im Kreise ihrer Lieben. Um sie herum weinten viele Mütter und Großmütter leise, sobald es dunkel wurde. Sie begriff schnell, dass alle Angst vor den Teufeln hatten und sich um die eigenen Männer in den Bergen sorgten. Doch sie waren eine Gemeinschaft und man war nie allein gewesen.
Als sie nach dem Schock über das, was an der Höhle geschehen war, instinktiv die Flucht ergriffen hatte, hatte sie nicht nachgedacht, wohin sie fliehen wollte: Nur fort – das war der einzige treibende Gedanke gewesen. Vielleicht hatte sie gehofft, den flauschigen Hasen wiederzufinden und mit ihm im Arm Trost zu erfahren. Doch ihr war bisher kein Lebewesen begegnet, während sie angsterfüllt auf allen vieren durch das Gebüsch gekrabbelt war. Sie hatte auf nichts geachtet, denn die blinde Furcht hatte sie weggetrieben von den tanzenden Monstern. Ihre Finger hatten sich mehrfach an stacheligen Büschen festgeklammert, und die Fingerkuppen brannten mittlerweile und waren blutig. Der getrocknete Urin in ihren Kleidern roch furchtbar.
Dann war der Durst gekommen. Sie hatte nicht gewusst, wie entsetzlich es war, durstig zu sein, und vor lauter Verzweiflung war sie dazu übergegangen, Blätter von Büschen und Bäumen zu reißen, sie zu zerkauen, um so ein winziges bisschen Flüssigkeit aufzunehmen. Zweimal hatte sie sich bereits erbrechen müssen, und auch davon war einiges auf ihrer Kleidung gelandet.
Sie war müde, spürte, wie der Durst sie schwach machte und der Hunger in ihren Eingeweiden knurrte. Immer wieder wollte sie nach ihrer Mama rufen, doch etwas in ihr sagte ihr, dass die Mama sie nie mehr würde hören können. Die Teufel hatten sie getötet. Genau wie ihre Großmutter – ihre Yaya – und Nikos. Sie hatte bereits Menschen sterben sehen und wusste, was der Tod bedeutete: einen immerwährenden Schlaf. Es waren in letzter Zeit häufig Leute für immer eingeschlafen. So hatte ihre Yaya es ihr erklärt: Es war ein ewiger Schlaf, aus dem man eben nicht mehr erwachte.
Litsa hatte gesehen, wie die Dorfbewohner Löcher im Boden ausgehoben hatten, um die Körper dort hineinzulegen und sie dann wieder zuzuschütten. Grauen hatte sich in ihr breitgemacht, als sie gesehen hatte, dass man Erde auf die Gesichter der Toten warf. Sie wollte nicht tot sein, wollte keine Erde in ihrem Mund und ihrer Nase haben. Sie wollte dies auch nicht für den kleinen Bruder, dessen Mündchen im Schlaf immer leicht geöffnet war. Das, was ihr die Kraft gegeben hatte, von dem Ort der schrecklichen Geschehnisse zu fliehen, schien sich verflüchtigt zu haben, und übrig waren die Furcht vor dem Tod, vor dem Alleinsein, vor dem Durst und dem nagenden Hunger.
Doch ihr Körper schien sich trotz aller erlebter Schrecken zu verselbstständigen. Er wollte weiter fort, und Meter um Meter bewegte sie sich voran, verletzte sich weiter an den niedrigen dornigen Büschen, blutete aus vielen schmalen Striemen. Obwohl sie ein kleines, vollkommen verängstigtes Mädchen war, schien eine schier unendliche Stärke in ihr zu wohnen, die ihr die Energie gab weiterzufliehen.
Die zweite Nacht war bereits vergangen, und sie hatte sich, sobald die Furcht einflößende Dunkelheit die Natur in schaurige Schatten tauchte, an einem Busch oder an einem Felsen zusammengekauert und zu dem allmächtigen, gütigen Gott gebetet, sie zu beschützen. Auch wenn sich leise Zweifel in ihrem Kopf regten, wie es sein konnte, dass ein gütiger Herr es zuließ, dass Nikos nicht mehr gurrend lachen konnte und sie, vollkommen auf sich gestellt, vor den Teufeln fliehen musste. Sie war ein Kind. Kinder brauchten ihre Eltern, ihre Familien und die ganzen anderen Leute, die sich um sie kümmerten. Sie hatte einen Fehler gemacht und sich, ohne zu fragen, aus der Höhle entfernt. War das vielleicht die Strafe? Gottes ausgestreckte Hand, die sie sogleich für die Missetat büßen ließ und ihr alles nahm, was sie zum Leben brauchte? Ihre Yaya hatte oft davon gesprochen, dass Gott die Seinen prüfe, aber er strafe eben auch, wenn man ihn ignorierte. Hatte sie – indem sie das Verbot der Mutter unbeachtet ließ – Gott missachtet, und jetzt zeigte er ihr, wie grausam die Welt war, damit sie verstand, dass man Gott nicht erzürnen durfte? Würde er ihr ihre Familie wiedergeben, wenn sie ihn nur genügend um Verzeihung bat und ab jetzt immerzu seinem Wort folgte?
Ihre Hände schmerzten, und sie konnte sich kaum noch richtig festhalten, wenn sie Anhöhen erklimmen oder Unwegsamkeiten überwinden musste.
»Diptam heilt jede Entzündung«, hörte sie die sanfte Stimme ihrer Mutter, und erleichtert drehte sie sich um, in der Gewissheit, dass die Mama hinter ihr stand und sie sich einfach nur in ihre Arme werfen musste, damit sich alles als böser Albtraum entpuppte. Sie übersah einen spitz herausragenden felsigen Brocken, und während sie stolperte und fiel, wurde ihr erneut bewusst, dass sie allein war. Die Stille durchbrachen nur einige Vögel und jetzt ihr eigener Schrei, als sie stürzte und mit dem Rücken über die raue steinige Oberfläche schrappte, während sich ihr krauses Haar in einem Busch verhedderte und sie zurückzuzerren schien.
Es tat weh. Sie wollte weinen, wollte ihre Mama bei sich haben, wie sie tröstend den Arm um sie legte und sie an den nach Oregano und Muttermilch duftenden Körper presste. Doch ihre Augen blieben tränenleer. Sie war so ausgetrocknet, dass sie nicht einmal mehr weinen konnte. Auch ihre Stimme versagte nach dem Sturz, und aus ihrem Mund kamen nur leise wimmernde Töne, mehr nicht. Sie würde einfach hier liegen bleiben und sich ausruhen – nur für einen Moment. Nur für einen … kurzen … Moment.
Dann verlor sie das Bewusstsein.
4. Kapitel
Carsten, Gegenwart
Er erhob sich von dem recht bequemen Sitz der Businessclass und streckte sich. Die Stewardess in der dunkelblauen Uniform lächelte ihn an, und er dachte erneut, dass ein Auswahlkriterium für die Flugbegleiterinnen deren Schönheit sein musste. Auch wenn das ganz und gar nicht der Zeit entsprach.
Eine junge Mitarbeiterin versperrte den Durchgang, sodass er und vier weitere Personen einen Transferbus für sich allein bekamen. Egal, wie snobistisch ihm das oft erschien: Er genoss diesen Service, erklomm dann die legendären Stufen zum Flughafengebäude und atmete dabei ganz bewusst die warme, salzhaltige Luft ein.
Im Gebäude entschied er sich für die normale Treppe, froh darüber, sich ein wenig bewegen zu können, bevor er sich am Kofferband platzierte, um auf sein Gepäck zu warten, das die Dame am Schalter in Deutschland mit einem neonorangefarbenen Aufkleber markiert hatte, auf dem fett Priority prangte. Den Rucksack mit seinen wichtigsten Arbeitsutensilien hatte er auf dem Rücken und mit dem eng sitzenden Brustgurt gesichert.
Nach und nach kamen die anderen Fluggäste ebenfalls am Band an und platzierten sich frech direkt davor, sodass man sie quasi beiseiteschieben musste, um ein Eckchen des eigenen Koffers im Vorbeifahren zu erhaschen. Heute war es besonders nervtötend. Er hatte zwar den Beginn der Diskussion nicht mitbekommen, beobachtete aber nun die Eskalation, als eine Frau mit Gehstützen eine davon anhob und ganz offensichtlich laut fluchend damit auf ein Pärchen einschlug, das ein Gepäckstück vom Band ziehen wollte. Er überlegte kurz, ob er sich einmischen sollte, doch dann hielten schon zwei jüngere Frauen die ältere zurück und wirkten beruhigend auf sie ein. Zumindest ließ die Dame im Anschluss die schlagkräftige Gehstütze sinken und sich zu einem der Sitzplätze in der Nähe geleiten. Er konnte noch aus dem Augenwinkel sehen, wie andere Reisende die Handys senkten, und war sich sicher, dass die kleine Schlägerei in Kürze im Netz zu finden sein würde. Vielleicht sollte er die Filmenden darauf hinweisen, dass Persönlichkeitsrechte zu verletzen kein Kavaliersdelikt war? Doch er verkniff sich die Klugscheißerei und machte sich daran, seinen Koffer zu finden, der mittlerweile schon dabei war, eine Runde durch die Halle zu fahren.
Kurz darauf zog er das verbeulte Ding nach draußen und stellte erneut fest, dass es ein sehr warmer Tag gewesen sein musste, denn trotz Einbruch der Dunkelheit lief ihm der Schweiß in einem langen Rinnsal den Rücken hinunter. Er schaute sich suchend um, denn der Autovermieter hatte ihm den Flocafé-Stand als Treffpunkt genannt.
Carsten hatte sich für die Zeit seines Aufenthalts einen kleinen Geländewagen gemietet, denn er wusste, dass es besser war, etwas Bodenfreiheit zu haben, wenn er all seine Vorhaben in die Tat umsetzen wollte. Er hatte in vielen Reiseführern diesen Tipp immer wieder gefunden und sich für einen Suzuki Jimny entschieden.
Um ihn herum sirrten Stimmen in vielen Sprachen, und Menschen strömten auf die Schalter der Reiseunternehmen zu, um den Transfer zum Hotel zu finden. Er genoss das Treiben und entdeckte den Meetingpoint kurz hinter dem Eingang der Abflughalle. Suchend blickte er sich um, denn dort standen einige Leute, füllten Unterlagen aus und zuckelten mit ihrem Gepäck auf diverse Kleinwagen zu.
»Hallo, Carsten?« Ein älterer Herr kam mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf ihn zu. »Ich bin Menelaos, wie geht es dir?« Er sprach ein paar Worte Deutsch, und sie unterhielten sich über den Flug, während der gestandene Autovermieter ihn um Ausweis und Führerschein bat, um die nötigen Formalien zu erledigen. Dann überquerten sie den Vorplatz des Flughafens, und kurze Zeit später saß er in dem weißen Jeep mit Faltdach und fuhr konzentriert in Richtung Nationalstraße.
Für seine ersten Nächte hatte er ein kleines Apartment in Lygaria gebucht. Der Ort war kaum eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt und lag direkt am Meer. Er hatte seine Reise mit Bedacht geplant, wusste aber, dass es vor Ort doch immer wieder Hürden zu überwinden gab und Pläne entsprechend angepasst werden mussten. Daher hatte er sich in dem beschaulichen Örtchen eingemietet, um in Ruhe anzukommen und sich zu sortieren. Auch wenn die Reportage klar umrissen war, so waren da noch einige Themen mehr, die ihn beschäftigten.
Das vergangene Jahr hatte sein Leben gewaltig durchgeschüttelt. Er war sich mehr als einmal so vorgekommen, als hätte man ihn entwurzelt, und es war ihm nur notdürftig gelungen, sich nicht vollkommen heimatlos und verloren zu fühlen. Wenn sich alles, was man bisher als normal empfunden hatte, plötzlich als falsch herausstellte, katapultierte einen das gewaltig aus der Umlaufbahn. Nicht, dass sein Leben bisher in linearer Gleichförmigkeit verlaufen wäre …
Er hatte die Netflix-Serie Stranger Things sehr gemocht: Der Erzählfluss, die Achtzigerjahre, in denen er ähnlich alt gewesen war wie die Protagonisten, Musik und Setting, alles war fesselnd eingesetzt. Doch die parallele Welt, die dunkel und kalt war, vom Bösen durchdrungen und nur darauf wartete, das Gute zu verschlingen – die war ihm immer als Narrativ der Filmemacher erschienen. Es war schlicht unrealistisch, denn Tore in andere Dimensionen gab es nicht, auch wenn die Gesetze der Quantenmechanik Paralleluniversen durchaus für möglich erachteten. Er hatte eine gut recherchierte Arte-Dokumentation zu diesem Thema angeschaut, und noch lange war deren Inhalt durch seinen Kopf gegeistert.
Aber sich ähnelnde Welten waren anders gestrickt als Dimensionen, in denen alles, was man bisher für gut gehalten hatte, plötzlich böse wurde. Er war noch immer nicht bereit, an Tore zu glauben, doch mittlerweile war er vollkommen davon überzeugt, dass alle Menschen aus Hell und Dunkel bestanden – aus Gut und Böse – und es nur eine Frage der Umstände war, welcher Anteil zutage trat, um die Macht zu übernehmen.
Diese Erkenntnis hatte ihn erschüttert, und auch wenn ihm im Zuge seiner Tätigkeit als Kriegsberichterstatter schon so viel Grausames begegnet und er dadurch mehr als einmal in brenzlige Situationen geraten war, so war es doch erheblich leichter gewesen, Menschen als Schafe zu betrachten, die einigen Bösewichten folgten. Dieses Weltbild trug eine gewisse Einfachheit in sich, die er gerade in diesem Kontext nur zu gern kultiviert hatte. Doch so war es eben nicht! Gewiss gab es jene Schafe, die blindlings in eine vorgegebene Richtung rannten, aber das Gros der Menschheit entschied sich bewusst für die eine oder die andere Seite. Natürlich hatte er das schon von Kindesbeinen an im Geschichtsunterricht gelernt, und doch war alles ferne Theorie geblieben. Man hatte nur in dem Rahmen hinterfragt, der möglich gewesen war, hatte Antworten geglaubt oder eben auch nicht. Hatte Schlagzeilen aufgeworfen, die provozierten, und war dann zum nächsten Auftrag übergegangen.
Vielleicht hatte ihn all das, was er in seinem Leben schon an Grausamkeit und Gewalt gesehen hatte, auch stumpf gemacht. Dieses Stumpfsein hatte er sich jedoch nie eingestehen wollen, das war nur anderen Menschen passiert – weniger professionellen Kolleginnen und Kollegen –, aber nicht ihm. Reportagen über ironisch scherzende Ärzte, die Witze rissen, während ihre Hände versuchten, von Tellerminen zerfetzte Körper wieder zusammenzuflicken, hatte er diesen speziellen Persönlichkeiten zugeordnet, denn es waren ja grundsätzlich schon besondere Leute, die Chirurgen wurden, und noch »besonderere«, wenn sie in Kriegsgebieten im Einsatz waren.
Er schüttelte unwirsch den Kopf und versuchte, sich zu orientieren. Diese Gedankenkonstrukte rissen ihn mittlerweile regelmäßig aus der Realität, und wenn er wieder auftauchte, konnten mehrere Minuten vergangen sein, ohne dass er konkret hätte sagen können, was währenddessen geschehen war. Hatte er die Abfahrt in den kleinen Badeort schon verpasst?
Er griff nach seinem Handy und tippte rasch auf den Google-Maps-Link, dann nahm er erleichtert wahr, dass die Ausfahrt erst in zwei Kilometern kam. Er schaute auf die Straße, fuhr mit zwei Rädern auf dem Standstreifen, um einem schnelleren Fahrzeug hinter sich Platz zu machen, und erhaschte nun immer wieder den Blick auf das im Mondlicht schimmernde Meer. Es war schön. Wenigstens das war gut. Die Schönheit der Insel hatte etwas Magisches – zumindest hatte er das in jeder Menge Foren und Reiseführern gelesen.
Widersprüchliche Gefühle wallten für einen kurzen Augenblick in ihm auf, und er schimpfte sich selbst einen Narren, sich so um den Auftrag bemüht zu haben und nun auf dieser griechischen Insel unterwegs zu sein. Er bog von der Nationalstraße ab, der Begriff klang im Zusammenhang mit der mittelmäßig ausgebauten Fahrbahn in teils schlechtem Zustand sehr beschönigend, und schlängelte sich auf einer schmalen kurvigen Straße hinab in das Dorf. Die Google-Stimme quäkte bis zur Unkenntlichkeit verzerrte griechische Namen durch den Lautsprecher seines Handys, und er hielt seinen Blick nun auf den Weg gewandt, um nicht versehentlich falsch abzubiegen und dann im Dunkeln irgendwo herummanövrieren zu müssen.
»Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt auf der rechten Seite«, blökte das Smartphone, und er war froh über diesen Hinweis, da sich links von ihm ein Parkplatz und das Meer befanden.
»Super, dass ich nicht im Wasser schlafen muss«, sagte er zu dem Mobilgerät und kam sich für einen Moment albern vor, dann schüttelte er über sich selbst den Kopf, stellte den Wagen ab, schulterte den Rucksack, zog den weit gereisten Koffer vom Rücksitz und schloss das Dach des Suzuki Jimny so gut wie möglich. Er schaute sich um, sah das Schild mit dem Namen der Villa, in der er das Apartment gemietet hatte, und ging auf die nahe gelegene Taverne zu, um den Schlüssel in Empfang zu nehmen.
Die Wellen schlugen sanft an den Strand, und er konnte erkennen, dass die Bucht durch einige Felsen geschützt war. Er sah die Lichter der Restaurants an der kurzen, aber einladend aussehenden Promenade, und der Wind wehte Fetzen griechischer Weisen zu ihm herüber. Er musste darauf achten, sich nicht versehentlich im Urlaub zu wähnen, denn das war er ganz und gar nicht.
Plötzlich überkam ihn jene tiefe Müdigkeit, die er in den vergangenen Monaten immer wieder empfunden hatte, so, als wäre er lange durch nassen, hüfthohen Sand gewandert. Er schob es auf die Reise, die leichte Zeitverschiebung, das Wetter und den mangelnden Schlaf der letzten Nächte. Doch mit der Müdigkeit kam auch die Leere, die wie ein betäubender Luftstoß durch ihn hindurchpustete und seine Gedanken unendlich schwer werden ließ. Eben im Auto hatte er die Vorboten schon erkannt, aber gehofft, es im Griff zu haben. Sich im Griff zu haben, doch die Depression folgte keinen Anweisungen.
Das durfte jetzt nicht sein, er konnte sie hier nicht brauchen, nicht heute und auch nicht in den kommenden Tagen.
Er stieß die Tür zur Taverne so hart auf, dass sie mit einem satten Wumms an die Wand knallte. Alle Köpfe drehten sich und alle Blicke ruhten auf ihm. Dann rief eine fröhliche Frauenstimme: »Carsten!« Es war mehr eine Aussage als eine Frage, so, als würde sie ihn bereits kennen. Er nickte schnell, und die anderen Gäste nahmen ihre Gespräche wieder auf.
Die betagte Dame kam auf ihn zugerauscht – anders konnte er das nicht beschreiben. »Carsten, mein Junge, setz dich, setz dich. Ich bringe dir einen hausgemachten Likör und ein paar Meze. Du bist sicher vollkommen ausgehungert.«
Er wollte widersprechen, ihr erklären, dass er müde war und allein sein musste, doch sie legte ihren Arm mütterlich um seine Schultern und schob ihn auf die Terrasse zu einem Tisch. Ihre Stimme transportierte ehrliche Freundlichkeit, aber er war wirklich geschafft. Es wäre keine Ausrede. Sie drückte ihn auf einen Stuhl und wiederholte: »Setz dich, Junge, setz dich. Du bist ja schon ganz blass vor Hunger.« Dann drehte sie sich um, ihre Armreife klimperten bei dieser Bewegung sanft, und rief: »Toma, bring dem Jungen unsere Begrüßungsleckereien.« Sie ließ sich derweil auf den zweiten Stuhl am Tisch fallen und fragte: »Wie war der Flug? Ging alles gut? Diese Dinger sind mir noch immer sehr unheimlich. Haben sie euch wenigsten etwas zu trinken serviert, die werden doch immer geiziger in diesen Fliegern. Ich höre da Sachen …«
Er lächelte matt und wunderte sich nicht einmal über die vertrauliche Anrede. Sie war eine Art Naturgewalt. Er versuchte, sie genauer zu betrachten, ohne wie ein starrender Psycho zu wirken: Ihr Gesicht war braun gebrannt und um die Augen, Mundwinkel und auf der Stirn zeichneten Falten Lebenserfahrung in ihre Züge. Das Haar war glatt und dunkel. Sie trug es offen. Er fand es gut, obwohl es jede Menge Leute gab, die ohne ersichtliche Argumentationsgrundlage das Statement in die Welt posaunten, dass ältere Frauen besser eine fesche Kurzhaarfrisur haben sollten oder, wenn sie das Haar lang trugen, dann zumindest als Knoten am Hinterkopf. Es war sonderbar, wo Emanzipation überall endete und wie oft die harschen Verurteilungen gerade von Geschlechtsgenossinnen formuliert wurden. Er fand, dass ihr die Frisur ausgezeichnet stand. Ihr Kleid war lang und wallend, ihre Figur fraulich.
»Ich bin übrigens Fotini. Toma, soll der Junge verhungern und verdursten?«, kommandierte sie, und Carsten konnte trotzdem das Lächeln in ihrer Stimme hören.
Ein Mann, den Carsten als ungefähr gleichaltrig mit sich einschätzte, kam mit einem Tablett voller Schälchen und Teller angetrabt, nickte kurz in Richtung der Frau und sagte: »Meine Mutter meint es nur gut. Wir freuen uns, dass du da bist. Du bleibst nur kurz. Das ist schade, denn hier bei uns ist es wirklich wunderschön.« Das Englisch des Mannes war leichter verständlich als das seiner Mutter. Tomas stellte einige duftende Kleinigkeiten auf den Tisch, goss ihm ein Glas des dunkelroten Likörs ein, den er in einer kleinen Glasflasche mitgebracht hatte, und kredenzte auch seiner Mutter ein Glas.
»Danke, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen«, bedankte sich Carsten überwältigt. Er hatte auf seinen Reisen schon häufig mit der Gastfreundschaft der Einheimischen Bekanntschaft gemacht, doch daran wollte er jetzt nicht denken und konzentrierte sich auf die Frau ihm gegenüber.
Fotini begann zu erklären, was er vor sich hatte: »Das ist Granatapfellikör. Den habe ich selbst gemacht. Nach einem Rezept meiner Großmutter. Eine Tradition also und noch dazu wirklich lecker. Also noch einmal: Willkommen auf Kreta, Carsten. Yámas!«
Während sie das Getränk munter hinabkippte, nippte er vorsichtig. Normalerweise trank er keinen Alkohol, vor allem dann nicht, wenn die Depression ihn im Würgegriff hatte, denn das ging nicht gut aus. Er hatte schon oft versucht, sie zu ertränken, und es war ihm nicht besser gegangen, sondern um ein Vielfaches schlechter. Doch in diesem Augenblick schien es ihm unhöflich, nicht zu kosten. Die freundliche Wärme der Gastgeberin strahlte über den ganzen Tisch und erreichte seine Haut. Er konnte sie zumindest dort spüren, und das war besser als nichts. »Yámas, Fotini«, erwiderte er und spürte, dass er das nicht nur aus Höflichkeit tat, sondern weil gerade vielleicht ein Funken der Kretamagie auf ihn übergesprungen war und er sich für den Moment eines Blinzelns sogar geborgen fühlte. Das war doch verrückt. Gaben sie Drogen in ihre Getränke, um die Gäste gefügig zu machen oder gar zu überlisten? Gleich am ersten Abend? Nein, das wäre mehr als dumm. Konnte es sein, dass die Frau ihm gegenüber einfach liebenswürdig war, weil sie das Herz am rechten Fleck trug und das ungefiltert zeigte?
Er griff sich den Löffel und schob sich eine Portion des hellgelben Pürees in den Mund. »Hm.« Er war erstaunt darüber, dass die Fava, eine leckere Linsencreme, so gut schmeckte. Er spürte, wie die Anspannung aus seinem Körper wich, und nahm sich vor, den Augenblick zu genießen. Morgen war schließlich auch noch ein Tag.
5. Kapitel
Katharina, Gegenwart
Die Welt war über ihnen allen zusammengebrochen, als Andreas und Giorgos im Dikti-Gebirge verunglückt waren. Andreas, ihr geliebter Vater, war dort oben in den Bergen gestorben, als das Aneurysma in seinem Gehirn platzte, seinen Bruder Giorgos hatte man aus dem abgestürzten Porsche gerettet und ins Krankenhaus geflogen, doch er war kurze Zeit später seinen Verletzungen erlegen. Gott sei Dank war durch eine Obduktion sichergestellt worden, dass Andreas an der Hirnblutung verstorben war und nicht durch die Hand seines Bruders. Die Hand eines vermeintlichen Mörders!
Katharina dachte darüber nach, wie es überhaupt zu dieser Fahrt in die Berge und dem vorausgegangenen Mordverdacht gekommen war. Eine junge Frau hatte ein Skelett in der Samaria-Schlucht gefunden, und im Zuge der Ermittlungen war ein Kommissar aus Irakleio auf Katharinas Familie gestoßen. Einer ihrer ehemaligen Mitarbeiter war nach Auskunft von dessen Frau zu diesem Zeitpunkt bereits seit sechs Jahren spurlos verschwunden. Dimitris Zacharakis war Personalchef im Hotel ihrer Familie in Agios Nikolaos gewesen und hatte nach Angaben ihres Onkel Giorgos damals mehrfach versucht, die Familie Dalaras zu erpressen. Laut dem Polizeibericht und der Beichte, die Giorgos nach dem Absturz mit dem Porsche auf dem Sterbebett abgelegt hatte, war Zacharakis’ Tod ein Unfall gewesen. Giorgos hatte ihm angeblich das Geld dort überreichen wollen, und es war zu einem Handgemenge gekommen, das für den Erpresser tödlich ausgegangen war. Allerdings war die Samaria-Schlucht wirklich ein sonderbarer Ort für ein Treffen dieser Art, und ihr Onkel hatte das verlassene Dorf unten in der Schlucht sicher nur unter immensen Anstrengungen erreicht.
Katharina ging daher nicht davon aus, dass man sich dort einfach zu einer Geldübergabe getroffen hatte. Aber was sonst hatte Giorgos dort vorgehabt? Gemütlich nach Agia Roumeli zum Schlucht-Ausgang wandern, dort ein Gläschen mit Zacharakis trinken, während man gemeinsam auf die Fähre wartete?
Ein Versehen habe angeblich zu dem tödlichen Schlag geführt, beichtete Giorgos kurz vor seinem Tod. Er sei danach in seinen Alltag zurückgekehrt, während ein von ihm bezahlter Mann die Leiche des Toten weggeschafft habe. Woher er diesen kannte und warum er sich seiner bedient hatte, war allen ein Rätsel geblieben. Klar war jedoch, dass ihr Onkel einen Mann getötet hatte, und egal, wie sehr sie alle versuchten, es so zu erklären, als wäre es ein Unfall gewesen: Er hatte die Tat verheimlicht! Und nicht selten geisterte eine giftige Stimme durch Katharinas Kopf, die sagte: Papa könnte gewiss noch leben, doch Giorgos hat ihn auf die Lasithi-Hochebene geschleppt und ihn dort mit irgendeiner Nachricht zu Tode erschreckt. Ein guter Arzt hätte die Blutung behandeln können, und ich wäre heute keine Vollwaise.
Ihr Vater war nach dem Tod ihrer Mutter zu einem Sonderling geworden, der mit niemandem über seine Befindlichkeiten sprach. Auch wenn es auf Kreta vollkommen normal war, dass man sich nach dem Tod einer geliebten Person Haare und Bart nicht mehr schnitt, so war es doch nicht üblich, dies über Jahre hinweg zu unterlassen. Mit schlohweißer wallender Mähne und einem bis auf das Brustbein reichenden Bart glich Andreas mehr einem verwirrten Geist denn einem erfolgreichen Unternehmer. Während Giorgos mit maßgeschneiderten Hemden umherstolzierte und sich mit ständig wechselnden langbeinigen jungen Frauen umgab, vergaß Andreas schon mal, dass er ein löchriges Hemd trug und seine Jeans erdige Flecken aufwies. Giorgos nannte eine schmucke Protzkarre sein Eigen und demonstrierte mit dem Cayenne seinen Reichtum, während ihr Vater in seinem klapprigen Suzuki wie ein verarmter Tagelöhner daherkam.
Egal, wie sehr sie den zur Schau getragenen Materialismus ihres Onkels regelmäßig verurteilt hatte, so war ihr ihr Vater durchaus das ein oder andere Mal peinlich gewesen: Er hatte vergessen, sich zu kämmen, hatte abwesend gewirkt, und seine Augen waren oft verquollen gewesen. Wie alle anderen hatte auch sie befürchtet, dass er den erlittenen Verlust in Alkohol zu ertränken versuchte.
Hätte sie doch nur mehr Verständnis für ihn aufgebracht, dann wäre ihr vielleicht aufgefallen, dass seine Kopfschmerzen nicht nur von der Migräne kamen. Aber sie war zu sehr damit beschäftigt gewesen, ihren eigenen Schmerz zu vergessen, denn die Trauer um ihre Mutter hatte sie von stumpfer Gefühllosigkeit bis zur vernichtenden Wut leidvoll durch alle Phasen wandern lassen. Auch sie hatte versucht, sich mit Wein zu betäuben, hatte Dinge zerschlagen und sich die Haare gerauft, bis es wehtat. Zudem hatte sie begreifen müssen, dass man nicht immer gemeinsam trauern konnte, sondern dass jeder Mensch sein eigenes Tempo einhielt.
Ihr Bruder hatte sich in die Arbeit gestürzt wie ein Berserker. Der plötzliche Tod von Vater und Onkel hatte ihm von heute auf morgen die gesamte Verantwortung auf die Schultern gelegt, und sie wartete auf den Tag, an dem er unter diesem Druck zusammenbrach. Noch rannte er herum wie die Maus auf der Flucht vor der Katze. Es war beachtlich, wenn man bedachte, dass er das nun seit rund achtzehn Monaten durchhielt.
Es war ihm gelungen, den guten Ruf der Unternehmensgruppe wiederherzustellen, und die Gäste kamen wie eh und je von nah und fern. Die Saison war gerade gestartet, und seinem letzten Bericht hatte sie entnehmen können, dass es kaum noch freie Kapazitäten gab. Finanziell waren sie alle abgesichert. Ihre Cousins hatten zudem eigene Unternehmen und waren zufrieden mit Elonidas’ Führung. Katharina war gleichzeitig davon überzeugt, dass es den beiden egal war, wie die Geschäfte liefen. Sie waren auf die Gewinne nicht angewiesen. Zumindest das hatten Giorgos und Andreas schon zu Lebzeiten immer gut gemacht – sie hatten ihren Kindern mit warmen Händen gegeben und sie nicht auf das Erbe verwiesen, wenn sie erst kalt und steif unter der Erde lagen. Man konnte mit vielem hadern und Verwünschungen aussprechen, doch im Vergleich zu jeder Menge anderer gut situierter Familien war das bei ihnen vorbildlich gelaufen.
Sie wusste, dass ihre Mutter maßgeblich dazu beigetragen hatte, jedoch wäre es auch Olympia niemals gelungen, Giorgos zu etwas zu zwingen, was dieser ganz und gar ablehnte. So musste wohl doch ein Funken Gutes in ihm gewesen sein. Er hatte es aber hervorragend verborgen, denn Katharina war er meist gefühlskalt, berechnend und abweisend erschienen.
Es hatte lange gedauert, bis sie den schlimmsten Groll gegen ihn in den Griff bekommen hatte, und nur deshalb hatte sie zugestimmt, seinen Palast zu räumen, der eines ihrer außergewöhnlichsten Projekte gewesen war. Er hatte ihr jedoch nie gestattet, das Haus für eigene Werbezwecke zu nutzen, obwohl es ganz klar ihre beste Arbeit war. Nur er hatte damit prahlen dürfen. Natürlich hatte er angeberisch – wo auch immer es möglich war – ihren Graduiertenstatus erwähnt, aber ganz offensichtlich hatte er sie nie explizit an Besuchende empfohlen. Denn es war zu keinem Zeitpunkt jemand gekommen und hatte sich auf den Glaspalast ihres Onkels bezogen und sie deshalb engagiert. Er hatte seine Nichte zudem nie eingeladen, das Haus in seiner stilsicheren schlichten Pracht zu genießen. Mit ein Grund, warum sie nie ein Giorgos-Fan geworden war.
Doch Dinge änderten sich. Auch wenn sie keine Begeisterung für ihn empfand und noch weniger dafür, in seinem privaten Eigentum zu kramen, seine Unterhosen auszuräumen oder Ähnliches zu tun, so war sie doch von etwas angetrieben, was sie sich selbst kaum erklären konnte: Sie wollte in Erfahrung bringen, wer dieser Giorgos gewesen war, denn sie wusste aus zuverlässiger Quelle, dass ihr Vater und dessen Bruder einst eine unzertrennliche Einheit gebildet hatten. Ihre Großmutter sprach oft von der Beziehung zwischen den Brüdern, als wäre diese auch in den vergangenen Jahren noch existent gewesen, genau wie sie Geschichten von früher erzählte, die sonderbar anmuteten und alle in der Familie zu Helden stilisierten.
Katharina spürte, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben angelangt war, an dem sich etwas ändern musste. Was auch immer das sein sollte. Sie war zu jung, um ihr Leben als alleinerziehende Mutter ohne Partner zu verbringen, aber auch zu alt, um ständig irgendwo das Abenteuer zu suchen. Sie hatte bereits jede Menge Wagnisse und Experimente erlebt. Ihre Zeit in London war davon geprägt gewesen.
In ihrer Familie wusste niemand, was sie fernab der Heimat getrieben hatte. Ihre guten Noten und die Fähigkeit, sich rasch zu integrieren, hatten es ihr leicht gemacht, einen hervorragenden Abschluss zu bekommen. London hatte sie einerseits beflügelt und andererseits hart auf dem Boden der Tatsachen aufschlagen lassen. Das Leben in der pulsierenden Metropole war unglaublich gewesen und mit Kreta nicht zu vergleichen. Hätte sie ihre Eltern nicht so sehr geliebt, wäre sie wohl dortgeblieben, aber zu den beiden hatte eben auch stets das Unternehmen gehört. Sie hatten es gemeinsam mit Giorgos und seiner Frau Maria aufgebaut und waren so sehr damit verwoben gewesen, dass alles für immer untrennbar miteinander verbunden war.
Sie und ihr Bruder, auch Giorgos Kinder waren auf Hotelbaustellen groß geworden, und das führte entweder dazu, dass sie diese Welt ebenso von ganzem Herzen liebten oder sich davon distanzierten. Auch wenn sie und ihre Cousins nicht so sehr in das Unternehmen eingetaucht waren wie ihr Bruder, so profitierten sie doch alle mehr oder minder von der Oneiro-Gruppe.
Giorgos’ Tat, den ehemaligen Mitarbeiter betreffend, hatte den Namen der Familie Dalaras kurzzeitig besudelt, denn die Presse hatte einen Riesenaufriss aus der Tatsache gemacht, dass der ehemalige Mitarbeiter tot war und Teile der Leiche nach wie vor verschwunden waren. Man hatte angezweifelt, dass Giorgos’ Aussage auf dem Totenbett der Wahrheit entsprach, und daraus geschlossen, dass ihr Onkel sich durch die Nennung einer weiteren Person – in diesem Fall Nikos Brokalakis, einem geständigen Mörder – von der Verantwortung freisprechen wollte. Man hatte vermutet, dass er von vornherein geplant hatte, Dimitris Zacharakis zu töten, und ihn nur deshalb in die unwegsame Samaria-Schlucht gelockt hatte. Wenn er wirklich so agiert hatte, dann war es kaltblütiger Mord gewesen – geplant und wohlüberlegt. Dann gab es keine mildernden Umstände. Um sich dessen bewusst zu sein, hatten sie nicht einmal Lambros’ klugscheißerische Kommentare benötigt.
War er das? War ihr Onkel Giorgos ein Mörder oder hatte er die Wahrheit gesagt? Er war zum Zeitpunkt der Tat zwar bereits ein älterer Herr gewesen, doch beileibe kein Schwächling. Ein harter Schlag lag damit im Bereich des Möglichen. Doch ohne die komplette Leiche hatte nicht bestätigt werden können, dass sich der Mann bei einem unglücklichen Fall tödlich verletzt hatte. Vielleicht hatte Giorgos seinen ehemaligen Personalchef auch einfach erschossen, denn der gefundene Schädel hatte ein Einschussloch aufgewiesen. In seinem Geständnis auf dem Totenbett hatte er nur den Schlag zugegeben und die Tatsache, dass er den Rest seinem Handlanger Brokalakis überlassen hatte.
Sie würden die ganze Wahrheit niemals erfahren und mussten mit dieser Geschichte leben.
Ihre Großmutter Hera war nach dem Verlust ihrer Söhne von einer drahtigen Kommandantin zu einer verstört wirkenden Greisin mit Todessehnsucht geworden. Zeit ihres Lebens konnte sich Katharina nicht daran erinnern, ihre Yaya den Enkelkindern gegenüber rau oder gar abweisend erlebt zu haben. Doch nun schottete sie sich vollkommen ab und betonte bei jedem Gespräch ihren Groll auf Gott, der ihr nach allem, was sie in den knapp einhundert Jahren auf dieser Erde erlebt hatte, nun auch noch so etwas antat. Sie wartete auf den Tod, und wahrscheinlich missachtete er sie genau deshalb. Für Hera war es definitiv am schwersten, denn eine Mutter sollte ihre Kinder nicht überleben, dessen war sich Katharina vollkommen bewusst.
Vieles hatte also dazu beigetragen, dass Katharina nach einigem Widerstreben die Aufgabe angenommen hatte, das Haus ihres Onkels zu räumen. Vielleicht war dies auch ein weiterer Baustein auf dem Weg zum inneren Frieden, den sie alle so sehr brauchten. Bislang hatte sie häufig gedacht, dass es für ihre Söhne besser sein würde, Dalaras zu heißen, als den Nachnamen eines Mannes zu tragen, der Verbrecher vor Gericht vertrat. Aber nach den unseligen Geschehnissen war sie froh, dass die Jungs den Namen ihres Ex-Mannes trugen. Das würde ihnen in der Zukunft gewiss zugutekommen.
6. Kapitel
Hera, Gegenwart
Sie richtete sich auf und hielt sich den Rücken. Heute war einer der Tage, an denen ihr jede Bewegung schwerfiel. Bis zu jenem fürchterlichen Geschehen vor anderthalb Jahren war sie das gewesen, was man allgemein als »rüstig« bezeichnete. Ihre Söhne hatten sie oft knochig und von bissigem Gemüt genannt, doch es gab nur eine bedingte Menge an Schlägen, die ein Mensch hinnehmen konnte, und wenn man kurz davor stand, ein Jahrhundert auf diesem Planeten zu weilen, hatte man einiges aufzulisten. Es hatte Zeiten des Haderns gegeben, doch sie war immer verantwortlich für die Familie gewesen, und so hatte sie die Momente, in denen ihr alles sinnlos erschienen war und die Energie sie zu verlassen drohte, immer mit jeder Menge Arbeit und steinerner Miene weggedrückt. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Zusammenbruch. Jetzt ist nicht die Zeit, an dich selbst zu denken. Jetzt ist nicht die Zeit, dein Schicksal zu beweinen … Der rechte Zeitpunkt war niemals da gewesen, und sie hatte sich daran gewöhnt zu funktionieren und ihre Rolle als Vorbild für so viele in den Vordergrund all ihres Handelns zu stellen.
Dabei wurde man hart, denn wie sollte es sonst möglich sein, mit einer Gruppe Frauen und Kindern in die dunklen Verstecke der Andarten vorzudringen, um versteckte Waffen ausfindig zu machen oder Stein auf Stein vollkommen zerstörte Häuser wiederaufzubauen. Das war nicht machbar, gab man sich seinen Befindlichkeiten hin und versank dabei in zerstörerischem Selbstmitleid.
Während ihrer Lebenszeit hatten immer wieder Krieg und Unterdrückung geherrscht, und die Frauen mussten ihren Weg unbeirrt gehen, damit das Überleben der Gemeinschaft gesichert war. Mut und zähe Beharrlichkeit waren Teil ihres Erbes, und sie hatte mehr als achtzig Jahre danach gehandelt und sich niemals unterkriegen lassen. Doch nun war alles anders. Der Tod ihres Mannes Elonidas war schon so viele Jahre her, und sie vermisste ihn nur noch selten, auch wenn sie nach ihm nie mehr einen anderen in ihr Herz gelassen hatte. Die Enkelkinder hatten das Loch gefüllt, das sich lange Zeit in ihrem Inneren befunden hatte. Sie hatte sich immer für klug, sogar für klüger als die meisten anderen gehalten, und vielleicht war das der Makel, den der Herr strafte: ihren Hochmut. Doch ihre wache Intelligenz hatte ihr immer geholfen, Lösungen zu finden, und betrachtete sie ihr Leben heute rückwirkend, so konnte sie kaum nachvollziehen, warum sie weiterhin an Gott glaubte, in die Kirche ging, Ikonen küsste und Kerzen anzündete. Es war nicht zu verstehen, warum er so hart mit ihr ins Gericht gegangen war, obwohl sie immer nur ihr Bestes gegeben hatte.
Mit langsamen Schritten lief sie den gekiesten Weg zum Haus hinauf. Seit Elonidas’ Tod 1979 lebte sie wieder auf Kreta. Er hatte sein Wort gehalten und war nicht mehr auf die Insel zurückgekehrt, obwohl sie so sehr gehofft hatte, ihn in kretischer Erde beisetzen zu können, doch nicht einmal die Geburt seines Enkelkindes hatte ihn dazu bewegen können, in ein Flugzeug zu steigen. Sie hatte es respektiert. Tatsächlich war es nicht nur ein Akzeptieren gewesen, denn er hatte Respekt verdient und damit auch seine Entscheidungen.
Die ersten Jahre auf fremdem Boden mit einem fremd gewordenen Ehemann, der noch dazu traumatisiert war und blieb, waren hart gewesen. Ihren Giorgos zurückzulassen, war ihr ebenfalls unerträglich erschienen. Doch auch diese Entscheidung des Jungen hatte sie akzeptiert, denn sie war sich darüber im Klaren gewesen, dass es ihn zerstört hätte, Kreta zu verlassen und ausgerechnet nach Deutschland zu gehen. Die Entscheidung für Deutschland hatte Giorgos nie verstanden, und obwohl sie in den späteren Jahren einen recht guten und fürsorglichen Kontakt gepflegt hatten, so war ihr doch oft der Gedanke gekommen, dass er ihr diesen Schritt nie ganz verziehen hatte.
Sie spürte einen Stich im Rücken, und während sie weiter hinaufging, wanderte er in Richtung Herz. Sie wunderte sich, dass sie dort noch Schmerzen spürte, denn der Tod ihrer Söhne – und die furchtbare Wahrheit, die damit zutage getreten war – hatte es zersplittern lassen. Eine Mutter sollte ihre Kinder nicht überleben. So war das nicht vorgesehen.
Sie war am Haus angekommen. Eigentlich brauchte sie den Garten nicht zu pflegen, denn regelmäßig kam ein Gärtner, der dafür sorgte, dass alles wie geleckt aussah. Im Haus waren alle wichtigen Räume auf einer Etage, und nur die Gästezimmer und Bäder befanden sich im ersten Obergeschoss. Sie musste also kaum Treppen gehen. Andreas hatte damals darauf geachtet, dass alles so umgebaut wurde, dass sie ihr Zuhause nie mehr würde verlassen müssen.
Andreas … Er war immer ein guter Junge gewesen.
Das Atmen fiel ihr schwer, als sie daran dachte, wie sehr er unter dem Tod seiner geliebten Olympia gelitten hatte. Regelmäßig hatten sie gemeinsam auf ihrer Terrasse gesessen, fernab des Trubels der schicken Hotelanlage, und schweigend auf das in der Ferne schimmernde Meer geblickt. Sie hatte mit neunzig aufgehört, Auto zu fahren, da sie sich damit überfordert fühlte, auf den Verkehr um sich herum zu achten. Auch hier hatten die Söhne für Lösungen gesorgt, und wann immer ein Termin anstand oder sie zum Einkaufen musste, war ihr entweder einer von ihnen, ihre Enkeltochter Katharina oder eine junge Frau aus dem Dorf zu Hilfe geeilt. So blieb sie trotz ihres hohen Alters flexibel. Zur Kirche ging sie zu Fuß, und im Anschluss an den Gottesdienst nahmen sie hin und wieder Nachbarn mit zurück. Doch seit dem Tag, an dem sich alles für die Dalaras’ geändert hatte, fiel es ihr schwer, irgendwo mitzufahren. Sie wollte keine Fragen beantworten oder den Blicken standhalten, in denen sie wahrnehmen konnte, was die Leute dachten: Wie kann eine Mutter nicht wissen, dass ihr Sohn ein Mörder ist?
Zudem waren natürlich überall Zweifel über die Rechtmäßigkeit der Bauten der Gruppe laut geworden. Die Frau des zu Tode gekommenen Personalchefs hatte allerorts verbreitet, dass die Dalaras’ sich Baugenehmigungen erschwindelt, beziehungsweise nur durch Bestechung erhalten hatten. Nichts davon war nach so vielen Jahren noch überprüfbar, doch das war es, was die Leute interessierte: Sie wollten Bösartigkeiten loswerden, und die Wahrheit ignorierten sie daher nur zu gern. Dass der Personalchef seinen Arbeitgeber erpresst hatte, fiel unter den Tisch. Es schien vollkommen in Ordnung zu sein, Umschläge anzunehmen. Nur verteilen durfte man sie nicht, dann war man schon per se ein schlechter Mensch.
Giorgos war kein niederträchtiger Mann gewesen, doch er hatte Fehler gemacht. Aber wer machte in seinem Leben keine Fehler? Selbstverständlich hätte er nicht gewalttätig werden dürfen, er hatte die Konsequenzen solcher Taten doch nur zu gut gekannt. Auch die Entscheidung, den Toten verschwinden zu lassen, war vollkommen falsch gewesen und hatte dazu beigetragen, noch mehr Schuld anzuhäufen. So viel Schuld. Menschen konnten nicht damit aufhören, sich schuldig zu machen. Sie lernten nichts aus ihren Sünden. Die unselige Verknüpfung mit Nikos Brokalakis, der für ihn die Drecksarbeit bei dem Toten übernommen hatte, hätte es nicht geben dürfen, denn sie zeigte deutlich, dass ihr Sohn nicht aus dem Affekt heraus gehandelt hatte. Er hatte gewusst, wen er holen musste, wenn die Situation eskalierte.
Egal, wie sie es drehte und wendete: Giorgos war kein kleiner Junge mehr gewesen, mit dem die Emotionen durchgingen, weil die Lebensumstände ihm nicht fair erschienen. Er war ein erwachsener Mann gewesen, ein Vater, und seine Entscheidung hatte sich auf alle Mitglieder seiner Familie ausgewirkt.
Sie selbst war sicher ebenso wenig fehlerlos, aber sie hatte keine solchen Verfehlungen auf sich geladen. Vielleicht war sie oft streng gewesen und hatte kalt gewirkt, doch sie hatte ihren Kern schützen müssen. Den Teil in ihr, der nicht mehr leben wollte, der verzweifelt schrie und niemals damit aufhörte – ganz egal, was sie tat: ob sie die Kinder versorgte, Wiederaufbau betrieb, Feinde in die Flucht schlug oder Wolle spann und Kleidung herstellte. All das hatte keine Rolle gespielt. Sie hatte gelernt, ihr Leid in sich einzusperren, und die Taktik hatte eine lange Zeit funktioniert.