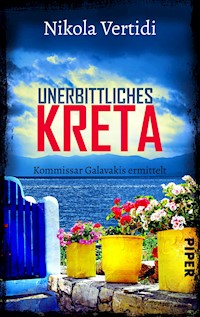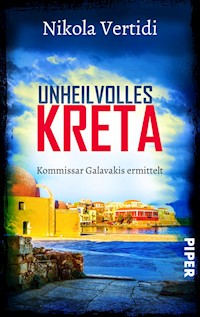6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der verschrobene Kommissar Hyeronimos Galavakis ermittelt in seinem zweiten Fall mit deutscher Gründlichkeit und kretischem »Siga-Siga«. Ein Griechenland-Krimi zum Wegträumen und eine Reise zu den schönsten Flecken Kretas sowie in die urigsten kretischen Tavernen Der bekannte Palmenstrand Vai im Osten Kretas wird durch ein furchtbares Verbrechen erschüttert: Drei schaurig zugerichtete Männerleichen hängen an dem vielbesuchten Strand an Palmen. Die drei Toten gehörten zur homosexuellen Szene auf der Insel und stammten aus wohlhabenden Familien. Galavakis erhält von höchster politischer Stelle den Auftrag zu ermitteln und befindet sich schnell in einem Drahtseilakt zwischen Diplomatie und Abgründen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Mörderisches Kreta« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Manfred Sommer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
1. Teil
Frische Brise
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
»Lass den Menschen nicht zu viel Freiheit, sag ihnen nicht, dass wir alle gleich sind, dass wir alle gleiche Rechte haben, denn sie werden sofort dein Recht mit Füßen treten, sie reißen dir dein Brot vom Munde fort und lassen dich elend krepieren.«
Nikos Kazantzakis aus Alexis Sorbas
1. Teil
Frische Brise
Kapitel 1
»Ich muss wieder rein«, sagte Lysandros, zog seine Boxershorts mühselig hoch, beugte sich vor und streifte mit seinem Mund sein Ohr. »Du verrückter Kerl, ich liebe dich.«
»Ich liebe dich.« Stephanos packte ihn glücklich am Hemd, zog ihn an sich und küsste ihn erneut leidenschaftlich.
»Was hältst du von einem Wochenende unter Palmen«, fragte Lysandros halb im Gehen, »Stavros hat für kommenden Samstag einige Liegen in der ersten Reihe gemietet, und wir könnten im Anschluss schön essen gehen und vielleicht in einem der kleinen Hotels dort übernachten.«
»Das ist eine tolle Idee, oder wir schlafen einfach am Strand und schauen uns die Sterne an«, schlug Stephanos begeistert vor.
»Ich würde lieber ein Zimmer buchen, sodass wir uns frisch machen können.« Lysandros schaute ihn an, lächelte und sagte: »Was ja nicht heißt, dass wir nicht nackt… ähm … nachtbaden können.«
Er kam noch einmal zurück und wuschelte ihm liebevoll durch das Haar, küsste ihn sanft und ging dann mit schnellen Schritten auf das Gebäude zu.
Stephanos fühlte sich noch immer aufgeputscht und erregt. Er hatte seinen Freund einfach nur überraschen wollen, und dass sich daraus eine seiner sexuellen Fantasien in Realität verwandelt hatte, war mehr als atemberaubend. Stephanos blieb noch einen Augenblick an die Wand gelehnt stehen, sein Atem beruhigte sich, und er zupfte sein T-Shirt zurecht, bevor er auf die Straße trat. Er schlenderte entspannt durch die Sonne zu seinem Wagen, als er ein sonderbar schabendes Geräusch hörte. Sein Körper versteifte sich, und er merkte, wie sein Herzschlag sich beschleunigte. Es hörte sich an, als würde eine knisternde Jacke an einer Mauer reiben. Hatte sie etwa jemand beobachtet? Vorsichtig blickte er sich um, in der Erwartung einer Bedrohung direkt hinter ihm, doch da war nichts. Die schäbige Gasse war leer. Trotzdem überkam ihn ein mulmiges Gefühl und machte ihn atemlos.
Sie hatten geknutscht und auch heftig rumgefummelt. Es war irgendwie alles noch so neu für ihn, er wollte alles erleben und erfahren. Lysandros hatte bereits seine Erfahrungen gesammelt und erfüllte seine Wünsche nur zu gern. In einer Hausecke rumzumachen war reizvoll, aber dabei wirklich beobachtet zu werden, ohne zu wissen, von wem, fühlte sich nicht gut an. Es war einfach zu gefährlich, denn wenn seine Neigung ans Tageslicht kommen würde, landete er gewiss irgendwo in einer Klinik, um ihm diese Krankheit auszutreiben.
Er hatte schon lange gespürt, dass mit ihm etwas anders war. Aber erst eine lange Europareise mit seiner Mutter hatte ihm die Augen geöffnet, denn es waren nie die Mädchen gewesen, die er bewundernd angeblickt hatte, weil ihr Streetstyle so großartig war. Es waren die schlanken Franzosen, die ihn um den Verstand gebracht hatten – und nicht selten hatte er im Anschluss Probleme gehabt, seine Erektion zu verbergen. In den noblen Designerläden der pulsierenden Großstadt arbeiteten die attraktivsten Männer, die er je gesehen hatte. Seine Gefühle hatten ihn verwirrt und er hatte an sich zu zweifeln begonnen. Das Internet war voll von Schmähungen, aber gleichzeitig auch voller Verlockungen. Als sie in Irakleio von Bord gegangen waren und er wieder zu Hause in seinem Zimmer gesessen hatte, war er sich klar darüber gewesen, dass er schwul war und dass sein Vater das nie erfahren durfte.
Michalis Lamdakis saß nämlich jeden Sonntag in der ersten Kirchenbank, und der Bischof war einer seiner engsten Freunde. Die Familie Lamdakis spendete jedes Jahr hohe Summen, und die Verbundenheit des Vaters zur Kirche war enorm. Daher wusste Stephanos, dass sein Vater es niemals akzeptieren würde, dass er sich gegen die Ideologie der klassischen Familie wandte. Anfangs hatte er mit dieser Erkenntnis gehadert und sich von sich selbst abgewandt, voller Scham über seine »Entgleisung«. Doch dann war ihm klar geworden, dass es nicht nur um Sexualität ging, sondern auch um Liebe, und diese Liebe bezog sich auf einen Menschen. Es war gleichgültig, welches Geschlecht die Liebe hatte. Sich seinem Vater zu stellen traute er sich dennoch nicht, und so lebte er sein Leben als homosexueller Mann im Verborgenen.
Sein Schwager Achilles hatte ihm im letzten Sommer angeboten, in seinem Hotel einige Verbesserungen am Buchungssystem vorzunehmen und als Gegenleistung ein schickes Zimmer mit direktem Zugang zum Meer zu bewohnen. Freudig hatte Stephanos zugestimmt und so die Semesterferien in Saus und Braus verbracht.
Dabei hatte er Lysandros kennengelernt. Der junge Psychologe saß regelmäßig in dem für die Öffentlichkeit zugänglichen Barbereich und schien sich dort glänzend zu amüsieren. Irgendwie wurde dann rasch mehr daraus als nur leichtfüßiges Flirten. Sie trafen sich in Stephanosʼ Zimmer, und der erfahrene Mann verführte und beglückte den Jüngeren nach allen Regeln der Kunst. Obwohl Stephanos dann wieder nach Irakleio an die Uni zurückgemusst und Lysandros den Job in Sithia angenommen hatte, war der Kontakt nicht abgerissen. Stephanos war verliebt, und zwar zum ersten Mal in seinem Leben. Er nutzte die Wochenenden, um die Insel zu erkunden, traf sich mit Lysandros und lernte einige weitere Männer aus dessen sozialem Umfeld kennen. Es war ein illustrer Kreis, und die Verschwiegenheit zwischen ihnen war wie ein ungeschriebenes Gesetz.
Die Menschen auf der Insel waren zwar auf ihre Art offen und durch den Tourismus viel gewöhnt, in ihren eigenen Reihen jedoch herrschten Tradition und eine klassische Rollenverteilung vor – vor allem bei der älteren Generation. All die jungen Männer, mit denen er Kontakt hatte, entstammten den besten Familien der Insel und hatten nun einmal Eltern in genau dieser traditionsbewussten und engstirnigen Altersklasse. Also lebten sie ihre Liebe unerkannt. Es war wie eine Art Geheimklub, und man kam nicht so einfach hinein.
Nach außen mimten sie das reine Partyvolk. Sie waren lustig, tranken teuren Whiskey und gaben gutes Trinkgeld. Sie luden auch immer hübsche Mädchen ein, und so kam nie ein Verdacht auf. Die Clique war gern gesehen und fiel nie negativ auf.
Das Geräusch war verklungen, und er stakste weiter in Richtung Auto. Plötzlich glaubte er Schritte hinter sich zu hören. Diesmal drehte er sich nicht um. Er beschleunigte seine Bewegungen. Kurz bevor er den Wagen erreicht hatte, hörte er erneut dieses seltsame Geräusch. Es war, als würde jemand mit eigentlich laut klappernden Sohlen versuchen, leise schlurfend zu gehen. Er wollte nicht rennen, spürte aber den kaum zu kontrollierenden Impuls in sich, es trotzdem zu tun. Was war nur los mit ihm, er war doch sonst kein solcher Angsthase? Vielleicht hätten sie sich doch zurückhalten und die Situation nicht so zur Eskalation bringen sollen, sie konnten es sich einfach nicht erlauben, ihre Sexualität so offen zu leben. Sein Atem ging schnell, als er die Fahrertür erreichte, die sich dank moderner Technik durch seine Berührung öffnete. Er schlüpfte in die Sicherheit des Innenraums und verschloss die Türen per Knopfdruck. Dann spähte er hinaus, sah aber nichts und kam sich daher ein wenig verrückt vor. Sein Herz pochte. Er schalt sich selbst einen Narren, ließ den Wagen an und drehte die Musik auf. Ein Wochenende am Palm Beach von Vai, bequeme Liegen in der ersten Reihe, Alkohol, Musik und vor allen Dingen den muskulösen, erregenden Körper seines Freundes neben sich, wie er sich in der engen Badehose in der Sonne rekelte … Es würde wunderbar werden.
Sie brauchten eigentlich nicht viel, um glücklich zu sein. Die Woche würde mit seinen Aufgaben an der Uni rasch verfliegen. Wenn er mit der Clique unterwegs war, verzog sein Vater den Mund nur ein wenig, denn seine Freunde waren nicht als Partyboys verschrien, sondern studierten oder gingen wie Lysandros bereits einer sinnstiftenden Arbeit nach. Das war für das Familienoberhaupt wichtig, und Stephanos wusste nicht, ob der Vater ihn sonst einfach so hätte losziehen lassen.
Stephanos runzelte seine Stirn in Denkerfalten, Lysandros streichelte oft mit seinem Daumen darüber und frotzelte, dass sein Gesicht so stehen bleiben könne. Würde er sich von seinem Vater tatsächlich aufhalten lassen? Der Mann würde ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, alle Vergünstigungen streichen und ihn sogar auf die Straße setzen. Dessen war er sich sicher. Auch wenn seine Mutter ihn nicht mittellos dahinvegetieren lassen würde, wäre es doch etwas anderes, auf all die lieb gewonnenen Dinge zu verzichten … angefangen bei seinem Wagen mit der Tankkarte, bis hin zum prall gefüllten Kühlschrank, seinen Klamotten und all den diversen Pflegemitteln, die er so gern benutzte. Er war eben privilegiert aufgewachsen, und das wurde ihm vor allem dann bewusst, wenn er sich vorstellte, ob er tatsächlich nur von Luft und Liebe würde leben können. Auch wenn die Zuneigung zu Lysandros und der körperliche Rausch des perfekten Sex seine Sinne vernebelten, so war ihm doch klar, dass er nicht ohne all das leben wollte. Er genoss es, reich zu sein, daher widersetzte er sich seinem Vater nicht, brachte gute Bewertungen nach Hause und sorgte auch dafür, dass über seine Jobs gesprochen wurde, sodass der Alte es immer mitbekam, wie fleißig und gut sein Junge war. Er hatte sogar schon darüber nachgedacht, wie es sein könnte, eine komplette Lebenslüge zu etablieren und sich eine Freundin zu suchen, mit der er den Sex bis zur Hochzeitsnacht hinausschieben würde, um sie dann zu einem Teil seines Arrangements zu machen. Nichts davon hatte er bisher besonders ausführlich mit Lysandros besprochen, der es ähnlich hielt wie er. Sie gehörten denselben gesellschaftlichen Kreisen an, und auch die Eltern seines Freundes waren alles andere als aufgeschlossen. Doch Lysandros war mutiger als er, denn er sagte oft: »Bevor ich eine Lüge lebe, bleibe ich offiziell Single.«
Er hatte es seinen Eltern vor Jahren gesagt, und das hatte nicht gut geendet, doch er sprach nicht gern darüber, und so wusste Stephanos nur, dass sein Freund keinen Kontakt mehr mit seiner Familie hatte.
Stephanos hatte seinen Plan B. Das passende Mädchen würde er schon noch finden oder seine Mutter finden lassen. Er war nicht so kaltherzig, wie sich dieser Plan anhörte, es war eher purer Pragmatismus. Es waren die gesellschaftlichen Tabus, die ihn in diese Richtung zwangen. Sie lebten im einundzwanzigsten Jahrhundert, und doch kam es ihm wie das tiefste Mittelalter vor. Die Macht der Kirche und politische Interessen unterschiedlichster Gruppierungen sorgten für diese Art von Stillstand. Wobei ihm bei seiner Europareise in vielen Ländern ebenfalls eine unterschwellige Homophobie aufgefallen war. Er hasste es, im Verborgenen lieben zu müssen. Es ging dabei nicht um Sex, sondern darum, dem Ruf des Herzens folgen zu können.
Er löste seinen Blick von der schalen Fassade des Hauses, in dessen Eingang er noch vor wenigen Minuten den vollkommenen Rausch der Sinne erlebt hatte, ließ den Wagen an und fuhr mit Schwermut im Herzen davon.
Den sich an der Hausecke lösenden Schatten sah er nicht, denn er warf keinen Blick mehr in den Rückspiegel, sondern versuchte sich auf die Straße vor ihm zu konzentrieren und das aufgeregt glückliche Gefühl zurückzuholen, das er vorhin empfunden hatte, als er an das nächste Wochenende dachte.
Kapitel 2
Hyeronimos ging auf sein Büro zu, als die Tür gegenüber aufgerissen wurde und Christos wie einer dieser böse dreinblickenden Clowns, die aus Überraschungskisten sprangen, auf den Flur kam. »Guten Morgen, Christo«, zwang er sich zu einem freundlichen Gruß.
»Pah, was soll an diesem Morgen gut sein«, fauchte ihn der Kollege an, und Hyeronimos machte unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Habe ich etwas verpasst?«, fragte er perplex, ohne genauer über seine Fragestellung nachzudenken.
»Was soll ich dazu sagen«, stieg Christos auch sofort darauf ein, »wenn du nicht informiert bist über das, was hier los ist?« Er machte eine ausladende Bewegung. »Ich bin ganz sicher nicht dein Informationszentrum.«
Damit dampfte er ab, und Hyeronimos stand einen Augenblick lang verblüfft an derselben Stelle und schaute ihm nach. Dann entschied er sich, kurz bei seinem Chef Stelios Mentakis anzuklopfen, um in Erfahrung zu bringen, was seinen Kollegen so aufregte. Vielleicht war es eine typische Christos-Sache, und er machte wie so oft aus einer Mücke einen Elefanten, aber vielleicht gab es tatsächlich etwas, was wirklich wichtig war. Er ging in das Vorzimmer und lächelte die Mitarbeiterin seines Chefs an. Maria hatte Haare auf den Zähnen, wenn es darauf ankam, Stelios zu beschützen, aber sie hatte auch ein gutes Herz. Sie war ein kretisches Urgestein. Er mutmaßte, dass sie bereits unter König Minos in Knossos ihren Dienst verrichtet hatte, denn sie wusste alles über die Insel und kannte so ziemlich jeden. Zumindest machte es diesen Eindruck. Wer es sich mit Maria verdarb, war hier für immer verloren. Also gab er sich jede nur erdenkliche Mühe, sie bei Laune zu halten.
»Guten Morgen, Maria«, sagte er und hoffte, dass seine Stimme wirklich freundlich klang. Ihre Aura war meist rot wie ihre Nägel. Sie tippte auf ihrer Tastatur herum, und es sah aus, als wollten ihre langen blutrot lackierten Nägel die Tasten aufspießen. Er war immer wieder fasziniert, dass sie damit schreiben konnte. Sie beendete ihren Satz und blickte zu ihm auf, ihr stählerner Blick durchbohrte ihn und wurde von den vielen Lachfältchen, die ihre Augen umgaben, Lügen gestraft. Wenn man sie privat erlebte, konnte man es kaum fassen, dass die Frau, die Stelios’ Tür beschützte wie der Kerberos den Eingang zur Unterwelt und die liebevolle Gastgeberin, die sie sonst sein konnte, ein und dieselbe Person waren. Sie konnte hervorragend kochen und genießen, daher klappte es meist, sie gutmütig zu stimmen, wenn er etwas von einer schönen Genusserfahrung berichtete. »Neulich habe ich oben in den Bergen hervorragend zubereitete Eier in Tomatensoße gegessen, wirklich ein Gedicht«, schwärmte er und hatte den Geschmack sofort wieder auf der Zunge.
»Ja, das ist eines der besten Gerichte der Welt, wenn es richtig zubereitet wird. War Lorbeer an der Soße?«, wollte sie wissen, und ihre rauchige Stimme dröhnte durch den Raum.
»Der Geschmack war so mild, dass das Blatt wohl nur sehr kurz mitgekocht wurde«, fachsimpelte er, dann deutete er mit dem Kopf auf Stelios’ Tür, denn er wusste, dass Maria Geschleime nicht ausstehen konnte. »Ist er da?«
»Er ist da, und seine Laune ist im Keller«, sagte sie, und als sie die unausgesprochene Frage in seinem Gesicht sah, erklärte sie ihm kurz, warum.
»Es gab wieder eine Budgetkürzung, und obwohl mindestens vier unserer Fahrzeuge kaum noch als solche zu bezeichnen sind, besser würden sie nämlich Stehzeuge heißen, bekommen wir keinen Ersatz, und das, was für die Reparaturen zur Verfügung steht, bedeutet, minderwertige Ersatzteile einkaufen zu müssen und …« Sie ließ den Satz ausklingen, ohne ihn zu beenden, und ihre schweren Ohrringe schwangen anklagend vor und zurück.
»Ah, und eines der Autos ist das von Christos. Liege ich richtig?«, wollte er wissen, und sie nickte bestätigend. »Dann lasse ich den Chef besser mal in Ruhe, denn sicher hat Christos ihm schon lautstark seine Meinung und seinen Frust kundgetan.«
»Da kannst du einen drauf lassen«, sagte Maria derb, und ihre dunklen Augen funkelten.
Hyeronimos nickte ihr grinsend zu, drehte sich um und ging über den Flur in sein Büro. Es war bereits am Vormittag so warm, dass seine Jacke unnötig war, und er hängte sie ordentlich an den Haken. Er öffnete das Fenster und ließ frische Luft herein. Gott sei Dank stand das Wochenende vor der Tür, und er würde der Langweile, die ihn aktuell bei der Arbeit umgab, entfliehen können. Dieses Nichtstun, also nichts zum Ermitteln zu haben, machte ihn noch dünnhäutiger, als er es zur Zeit sowieso schon war. Er sehnte sich nach Kassias Stimme und überlegte, ob er es wohl wagen konnte, sie anzurufen. Ein später Freitagvormittag konnte ebenso gut wie schlecht sein.
Seine Hand glitt zum Handy und tippte auf ihren Namen. Ihr Bild erschien, und wie immer stockte ihm der Atem, wenn er ihr lächelndes Gesicht sah. Sie hatten sich nicht oft getroffen in den letzten Jahren, aber diese Aufnahme stammte von einem jener Augenblicke gestohlener Zweisamkeit. Sie strahlte liebevoll in die Kamera, und ihre Augen schienen ihn zu streicheln. Sie hatten ein kompliziertes System entwickelt, um sie nicht zu gefährden. Also schickte er ihr eine kurze, offiziell klingende Mail mit einer Anfrage für ein Statement, basierend auf ihrer Rolle als Stabsmitglied eines einflussreichen Politikers, der eben dummerweise auch ihr Mann war. Sie würde ablehnend antworten, wenn ein Gespräch gerade unmöglich war. Wenn sie auf die Pressestelle hinwies, konnte er ihr eine SMS senden, und dann würden sie eine Uhrzeit vereinbaren. Sie konnten nur frei sprechen, wenn sie ohne Bodyguards unterwegs war. Es war kompliziert, aber perfekt. Er würde niemals ihre Sicherheit gefährden, denn er liebte sie mehr als alle andere auf der Welt.
Kurze Zeit später plingte eine Mail mit einem Pressestelle-Hinweis auf, und er spürte, wie ihn die Freude überkam, bald ihre Stimme hören zu dürfen. Obwohl alle ihn für skurril hielten, war er ein vollkommener Romantiker und zelebrierte die Liebe wie ein kostbares Geschenk, denn das war sie schließlich auch. Er schickte die Kurznachricht, und ihre Antwort kam rasch: In zwei Stunden war sie frei für ihn. Sein Herz begann vor Vorfreude zu flattern, er würde rasch etwas Papierkram erledigen und dann zum Telefonat den Feierabend einläuten. Es gab keine Toten, also brauchte man auch keinen Kommissar zum Ermitteln.
Kapitel 3
Lysandros Spanodakis setzte sich kurz hin, er war froh, einen guten Job gefunden zu haben, ohne dass sein Vater ihn protegiert hatte. Er war sogar sicher, dass sein Erzeuger sich zusätzlich für ihn schämte, weil er mit Menschen arbeitete, die dabei waren, ihr Leben zu vergessen, anfingen zu sabbern oder sich gar einkoteten. Sein Vater gab ihm die Schuld für alles, was in seiner Familie geschehen war, und ein Spyridos Spanodakis vergab so etwas nicht.
Lysandros wusste, dass es zwischen ihm und seinem Vater keine goldene Linie mehr gab. Nur ihre Gene verbanden sie noch miteinander. Er hasste ihn nicht, sondern empfand eher Gleichgültigkeit, es war fast noch weniger als einem Fremden gegenüber, den man zufällig auf der Straße traf. Doch sein Vater hasste ihn, hatte ihn als Verräter der Familienehre beschimpft. Daher hatten sie keinen Kontakt mehr. Er hatte seine Mutter niemals verletzen wollen, doch ihre Reaktion auf sein Outing war grauenvoll gewesen. Er verscheuchte die trüben Gedanken. Er hatte eine sinnvolle Arbeit, und der Wochenenddienst würde ihn auf Trab halten.
Er freute sich bereits auf das nächste freie Wochenende, denn sie würden jede Sekunde am Strand genießen. Er mochte den Palm Beach von Vai sehr. Der Sand war hell schimmernd und das Wasser klar und so türkisblau, dass man es fast nicht glauben konnte.
Seitdem die Regierung dort für Ordnung gesorgt hatte, war der Strand sehr sauber und gepflegt. Eine Liege zu mieten war nicht billig, und das Personal hatte immer ein Auge auf die Besucher, sodass niemand mehr seinen Müll einfach liegen lassen konnte. Sie würden die erste Reihe mit den besonders bequem gepolsterten Liegen belagern und mit ihren durchtrainierten eingeölten Körpern die Blicke der anderen Besucher auf sich ziehen.
Die Saison hatte zwar noch nicht begonnen, doch in Vai war immer etwas los. Der Strand mit seinen natürlich gewachsenen Dattelpalmen hatte seine ganz besondere Berühmtheit einer Werbung für einen kokosgefüllten Schokoriegel zu verdanken, daher war es für die Besucher der Insel wohl fast unmöglich, den Ort nicht gesehen zu haben. Im Sommer war es furchtbar voll, und man musste schon ein bisschen Trinkgeld fließen lassen, damit man die Liegen in der ersten Reihe bekam.
Er stand auf, ging zum Fenster und schaute träumerisch hinaus. Anfangs war die Beziehung mit Stephanos nur ein Spiel für ihn gewesen, er war jung und hatte einen unglaublichen Körper. Er war voller Begierde, alle Spielarten auszuprobieren, und sie hatten großartigen Sex. Doch dann, eines Tages, hatte er den lächelnden Mann angesehen, seine dunkelbraunen Augen hatten geglänzt, die Wangen noch leicht gerötet vom Liebesspiel und das glatte schwarze Haar vollkommen zerzaust … Es war wie ein Blitz in ihn gefahren, als er erkannte, dass da mehr war, dass sein Herz sich öffnete, wenn er in dieses Gesicht sah. Damals war er einen Moment lang fast verzweifelt gewesen, denn wer liebte, konnte auch verletzt werden, aber dann hatte er sich seinem Schicksal ergeben, und Stephanos erwiderte seine Liebe leidenschaftlich.
Er sah zur Straßenecke, an der eben noch das Auto des Geliebten gestanden hatte. Er hatte es noch wegfahren sehen und sich kurz gewundert, was Stephanos noch so lange dort gemacht hatte.
In diesem Moment fuhr ihm ein Schrecken durch die Glieder, als er einen sich von der Hausecke lösenden Schatten wahrnahm. Er konnte das Gesicht nicht klar erkennen, war sich aber sicher, dass es ein Mann war. Und sein Gefühl sagte ihm, dass er diesen Mann, der nun durch die schmale Gasse davonschlich, von irgendwoher kannte.
Kapitel 4
Michalis Lamdakis blickte von seinen Unterlagen auf, als sich die Tür zu seinem Büro leise öffnete. Er war es nicht gewohnt, ohne Vorwarnung gestört zu werden, und Ärger wallte in ihm auf. Doch dann sah er, wer da im Türrahmen stand, und der Ärger verwandelte sich in Erstaunen und Interesse. Sein Besucher kam mit ausgreifenden Schritten auf ihn zu, und er erhob sich rasch von seinem Platz. Er hatte gerade beschlossen, ihm entgegenzugehen, als dieser schon seinen Schreibtisch erreicht hatte und ihm nachlässig die Hand hinhielt. Michalis nahm sie, führte sie an den Mund und küsste sie, dann schaute er in die durchbohrenden Augen und strengte sich an, dem Blick standzuhalten.
»Michali, mein Lieber«, erklang die sonore Stimme, und in der leichten Begrüßung klang etwas mit, was er nicht so recht einordnen konnte, was aber Unbehagen in ihm auslöste. »Wie geht es dir?«
»Es geht mir gut«, antwortete Lamdakis ein bisschen zu schnell, »was führt dich zu mir, so ganz ohne Termin?«
»Seit wann müssen wir beide Termine machen, haben wir denn nicht immer Zeit füreinander?« Sein Besucher ließ die Frage wie eine Ansage klingen.
»Selbstverständlich«, beeilte sich Michalis zu sagen, »es ist mir eine Freude, dich hier zu sehen, Eminenz. Möchtest du etwas trinken?«
»Einen Kaffee und ein Schlückchen von deinem hervorragenden Whisky aus dem Geheimschrank«, sagte der Mann und machte damit deutlich, wie gut sie einander kannten.
Michalis bestellte rasch den Kaffee, zog die Flasche aus dem Fach und nahm zwei schwere kristallene Gläser aus dem Regal. Er goss ihnen zweifingerbreit des dreißig Jahre alten Laphroaig ein und ging mit den Gläsern zu der majestätisch wirkenden Sitzecke: Zwei hohe dunkelbraune Ohrensessel aus antikem Leder standen vor der Glasfront, die einen wundervollen Ausblick auf den Hafen von Irakleio bot. Ein länglicher, schmaler Tisch stellte eine Art Trennungslinie zwischen den Sitzmöbeln dar und bot gleichzeitig Platz für die Gläser, die er nun dort abstellte. Dann setzten sie sich und ließen den Blick erst über den Hafen schweifen, bevor sie die Gläser hoben und einander dabei kurz in die Augen blickten.
»Er verführt die Nase wirklich mit unglaublich intensiven Aromen von karamellisierten Früchten, herber Schokolade und Tabak.« Der Mann schnalzte mit der Zunge und schnüffelte mit Kennermiene: »Ergänzt durch Noten von Lakritz, Pfeffer und einigen anderen Gewürzen. Am Gaumen ist er sehr charaktervoll, präsent und komplex. Es ist so, als würde man Honig schmecken, der verschiedene Arten von gelbem Obst umgibt, wirklich ein ausgesprochen köstlicher Tropfen.« Er nahm noch einen kleinen Schluck. »Und kostbar ist er auch. Manchmal wissen wir gar nicht, was uns alles Wertvolles dargeboten wird, oder wir schätzen es einfach auch nicht genug.«
Michalis schwieg, nippte an seinem Glas und dachte an die eintausendzweihundert Euro, die er für die Flasche hingeblättert hatte. Es machte ihm nichts aus, so viel Geld für etwas Besonderes zu bezahlen, und gleichzeitig störte es ihn dann doch, den Whisky zu leeren, obwohl er ihn wirklich zum Genießen erworben hatte. Er war kein Sammler, er war einer von den handfesten Männern, die sich etwas leisteten, nicht nur, um es zu besitzen, sondern auch, um es zu benutzen.
Männer wie er waren es, die dafür sorgten, dass die Insel nicht im Stillstand verharrte, davon war er felsenfest überzeugt. Er machte keinen Hehl daraus, dass er seine Welt so gestaltete, wie er es für richtig erachtete, und dass er eben auch genaue Vorstellungen davon hatte, wie das Leben, die Strukturen und der wirtschaftliche Fortschritt auf Kreta beschaffen sein sollten.
Seit dem panorthodoxen Konzil, das vor wenigen Jahren hier stattgefunden hatte, hatten sich die Bischöfe weiter an ihren Kurs gehalten, die traditionelle christliche Familie in den Vordergrund zu stellen, was vollkommen in Michalis’ Sinn war. Der Bischof und er waren zusammen aufgewachsen, und auch wenn sich ihre Leben vollkommen unterschiedlich entwickelt hatten, so waren sie doch immer in Kontakt geblieben, und oft hatten sie gemeinsam an den wichtigsten Schrauben der Insel gedreht. Sie trafen sich regelmäßig und tauschten sich immer wieder aus, um das Beste für Kreta zu erreichen. Zumindest sahen sie es so. Selten geschah so etwas wie heute, eigentlich sogar fast nie, denn im Regelfall verabredeten sie sich miteinander und stolperten nicht unangemeldet in die Räume des anderen.
Michalis sprach ihn zwar mit Eminenz an, da er ihn seit Jahrzehnten unter Ioannis kannte und sich mit seinem neuen Namen »Bischof Emmanuel« nicht so recht anfreunden konnte, duzte ihn aber, denn das Siezen erschien ihnen beiden albern, nachdem sie zusammen die Schulbank gedrückt und gemeinsam über Schulkameradinnen geklatscht hatten. Er war einerseits neugierig, was dieser unerwartete Besuch bedeutete, und andererseits auch beunruhigt, denn das Verhalten des Freundes erschien ihm irgendwie sonderbar.
»Wir haben gelernt, das Kostbare wirklich zu achten, es hochzuhalten und für seinen Weiterbestand zu sorgen«, sagte er mit fester Stimme und wandte dem Bischof den Blick zu, »was treibt dich heute hierher, Eminenz?«
»Oh, mein lieber Freund«, sagte der Mann, und in seiner Stimme klang so etwas wie Bedauern mit, »es ist nicht immer leicht, all die Lasten des Weltlichen zu tragen und trotzdem den Blick geweitet zu halten auf das, was gut und richtig ist.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause und widmete sich dem Glas, das er, wenn er nicht trank, langsam in seinen Händen drehte. Die bernsteinfarbene Flüssigkeit glitzerte im hellen Licht, und Michalis spürte die Unruhe, die in ihm aufkam. Sie war wie ein leichtes Flattern in der Magengegend, so wie früher, wenn er etwas angestellt hatte und zum Lehrer hatte gehen müssen, um dafür geradezustehen – oder auch zu Hause zu seinem Vater. Es fühlte sich an, als müsste er ein schlechtes Gewissen haben, ohne zu wissen, wofür. Er mochte das Gefühl nicht und versuchte es abzuschütteln, indem er seinen Blick durch sein Büro schweifen ließ: Der Raum war großzügig und ging über Eck, eine große Fensterfront gab den Blick auf den Hafen und das Meer frei. Die Möbel waren erlesen, aus feinstem Mahagoni gefertigt, sein Schreibtisch dominierte den Raum, und sie hatten ihn mit einem Kran durch das Fenster hereingehoben, da er nicht durch die Flure gepasst hatte. Sein Schreibtischstuhl war mit demselben antiken dunkelbraunen Leder bezogen wie die Sessel, und der Boden glänzte aus poliertem Marmor. An der Wand hinter seinem Schreibtisch stand ein maßgefertigtes Regal, ebenfalls aus Mahagoni, nur durchbrochen von einigen Glasböden, auf denen schwere Kristallgläser für Wasser, Wein und Whisky thronten, sowie eine eingebaute Bar, aus der er die normalen Besucher bediente. Es klopfte an, und seine Mitarbeiterin streckte vorsichtig den Kopf herein. Er wusste, dass sie verunsichert war, weil sie den Bischof nicht angekündigt hatte, doch er wusste auch, dass Emmanuel ihr ganz sicher keine Wahl gelassen hatte, also bat er sie mit offensichtlicher Nachsicht in der Stimme herein. Sie brachte den Kaffee und blickte ihn entschuldigend an. Dann verschwand sie so leise, wie sie gekommen war.
»Tragen wir nicht alle Lasten«, sagte er nun, um die bedeutungsschwere Stille zu durchbrechen, die nun entstanden war.
»Gewiss, gewiss«, der Bischof nippte an seinem Kaffee, »die Frage ist immer: Gibt es Lasten, die schwerer wiegen als andere?«
»Das erscheint mir eine philosophische Frage zu sein«, sagte Michalis und versuchte seiner Stimme einen leichteren Klang zu geben, »ich freue mich immer, wenn wir beide philosophieren.«
»Ja, das beherrschen wir tatsächlich vortrefflich, und was mich heute bewegt, geht wirklich auch ein wenig in diese Richtung, und gleichzeitig ist es auch so, dass ich über Wichtigeres mit dir reden muss, über Geschehnisse und deren Auswirkungen, über den Flügelschlag eines Schmetterlings und den Sturm, der dadurch ausgelöst werden kann«, fuhr der Bischof fort.
Das Gefühl in Michalis’ Magengrube verstärkte sich, und er nahm ganz bewusst einen großen Schluck des göttlichen Getränks, in der Hoffnung, dass der Alkohol das Gefühl betäuben würde oder gar beseitigen konnte. Was war nur los mit ihm, er war doch sonst kein Weichling, der sich so leicht aus der Ruhe bringen ließ? Es lag an dem Bischof, der im vollen Ordinat unangekündigt neben ihm saß und in Rätseln sprach. Es war die Kombination aus Bekanntem und Unbekanntem, die sein Gehirn in Alarmbereitschaft zu versetzen schien, und er hoffte, dass man ihm das nicht zu sehr ansah. Er versuchte ganz bewusst, seine Gesichtszüge zu kontrollieren, befürchtete aber, dass der Mann ihm gegenüber all das schon bemerkt hatte, was er zu verbergen versuchte.
»Eminenz, worüber reden wir hier?«, fragt er jetzt und kam zur Sache, auch wenn er sich dabei mehr als unwohl fühlte.
Kapitel 5
Er hatte es sich an einem abgelegenen Stück des Hafens bequem gemacht. Das Meer war heute glatt und tiefblau, die Sonne spiegelte sich darin und ließ die Wasseroberfläche glitzern. Der Stein, auf dem er saß, war warm. Er hatte seine Jacke im Auto gelassen, die Hemdsärmel aufgekrempelt und genoss die Wärme und den salzigen Geruch. Er liebte das Meer, und er liebte Kassia. Gleich würde sein Telefon klingeln und er ihre Stimme hören. Das wohlige Gefühl der Vorfreude breitete sich in ihm aus, und er atmete tief ein. Sie erfüllte ihn vollkommen, so war es seit jenem Abend in Athen, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Ihre Blicke hatten sich ineinander versenkt, und es hatte ihn irritiert, dass diese wunderschöne Frau ihn wahrnahm. Für ihn war sie alles: Geliebte, Freundin, Seelenverwandte. Sie gab ihm Halt, wenn er ins Trudeln kam, er fühlte sich ganz in ihrer Nähe, und er fragte sich oft, ob das, was er ihr gab, all das aufwiegen konnte. Pünktlich läutete es, und er nahm das Telefonat über die Kopfhörer an – je näher ihre Stimme war, umso besser.
»Liebste«, sagte er und merkte, dass seine Stimme vor Glück leicht zitterte.
»Maki«, sie klang atemlos. Nur sie und seine Großmutter durften ihn mit diesem Kosenamen ansprechen.
»Wie geht es dir?«, wollte er wissen und lauschte dann begierig ihren Ausführungen.
»Die Stadt ist einfach ein Moloch, und das ist oft sehr mühselig«, schloss sie und fragte dann: »Wie geht es dir, mein Liebster?«
»Es gibt viele gute Tage, aber auch viele, die mich sehr anstrengen«, gab er unumwunden zu, »oben in den Bergen geht es mir im Moment gut, aber hier unten fühle ich mich oft irgendwie beengt.«
Er spürte, wie sehr ihn diese Aussage erstaunte, denn er liebte das Meer sehr und schwamm zu jeder Jahreszeit.
»Sprichst du mit Penelope oder deiner Yaya darüber?«, wollte sie wissen.
Er verneinte halbherzig. »Nicht oft, ich möchte nicht immer wieder dasselbe aufwärmen, aber ich weiß auch, dass es wichtig ist zu reden«, schob er nach.
»Rede mit mir, Maki«, ihre Stimme streichelte ihn, »wir sprechen viel zu selten.«
»Du hast recht«, sagte er und spürte wie immer, wie gut es ihm tat, mit ihr zu reden, »doch ich will dich eben einfach nicht in Gefahr bringen.«
»Das weiß ich, aber unser System ist gut, und ich vermisse dich so oft ganz schrecklich«, gestand sie.
»Ich werde dir alles sagen, Liebste. Morgen fahre ich wieder hinauf zum Andartis«, begann er seine Erzählung, lehnte sich an die sonnenduftende steinerne Mauer und schloss die Augen. Es tat einfach gut, bei ihr zu sein und alles auszusprechen, was ihn bewegte. Sie fragte an den richtigen Stellen nach, bestätigte ihn oder sprach tröstende Liebeserklärungen aus. Sein Herz schlug gleichmäßig, und ihre Gefühle umgaben ihn wie ein schützender Mantel. Sie hatte vollkommen recht, sie mussten öfter telefonieren. Liebe war so mächtig und konnte sogar heilen. Das las er immer wieder in den von ihm favorisierten Romanen mit Happy End.
Dann mussten sie sich verabschieden. Er blieb noch lange sitzen und genoss es, in den Kokon ihrer Herzenswärme eingehüllt zu sein.
Kapitel 6
Penelope schaute auf die Uhr. Sie war mit Eleni verabredet, die ihr etwas Wichtiges erzählen wollte. Etwas, was so wichtig war, dass sie es nicht am Telefon machen wollte, sondern sich stattdessen in ihr kleines Auto setzte und lieber die zweistündige Strecke von Chania nach Irakleio gurkte.
Der aufsehenerregende Fall im letzten Herbst, bei dem Penelope in ihrem rechtsmedizinischen Institut einen Schädel rekonstruiert hatte, hatte durch die Hilfe der jungen Influencerin viel Aufsehen erregt und ihren Bekanntheitsgrad durch das dramatische Ende des Mordfalls noch um einiges erhöht. Eleni hatte den Torso damals gefunden und sich selbstbewusst an den ermittelnden Kommissar Hyeronimos Galavakis gewendet, der sie dann sogar ganz offiziell als Praktikantin in die Ermittlungen eingebunden hatte. Das hatte ihr den ersehnten Zulauf an Sponsoren gebracht. Ein Autohaus hatte ihr einen Kleinwagen vor die Tür gestellt und sogar den Führerschein finanziert. Sie war überglücklich und fuhr sehr gern über die Insel, auch wenn das Benzin verdammt viel kostete.
Penelope freute sich sehr auf Elenis Besuch, denn sie mochte die junge Frau. Der Kontakt zwischen ihnen war lose gewesen, sie war der jungen Frau auf Instagram gefolgt und hatte so mitbekommen, was sich in deren Leben tat. Zudem hatten sie regelmäßig Nachrichten ausgetauscht und sich lustige Emojis geschickt. Heute würden sie sich, nach fast fünf Monaten, zum ersten Mal wieder persönlich gegenüberstehen. Sie war leicht hibbelig, durchquerte ihre Wohnung mehrfach, checkte alle Vorbereitungen in Form von Snacks, Getränken und Musik und überlegte, ob sie einen Spaziergang am Meer anbieten sollte.
Sie schaute gerade erneut auf die Uhr, als ihr Handy den Eingang einer Nachricht meldete: Ich habe gerade geparkt und komme hoch. Du musst dir aber unbedingt mein Auto anschauen.
Penelope grinste über Elenis Freude. Jetzt gleich oder nachher?, textete sie rasch zurück.
Reicht nachher.
Kurz darauf klingelte es, und dann stand die junge Frau im Türrahmen. Wie selbstverständlich fielen sie einander um den Hals und blieben einen Moment lang eng umschlungen stehen. Penelope genoss es und atmete Elenis frischen Duft ein: Sie roch nach Sonne und Wind. Der kurze Undercut, den sie im Herbst getragen hatte, war etwas nachgewachsen, und sie trug das Haar jetzt als modernen Pixie.
Penelope löste sich aus der Umarmung, bevor sie auf dumme Gedanken kam. »Hey, du siehst klasse aus, das ist eine tolle Frisur, die dir ausgezeichnet steht«, überschlug sie sich beinahe, haute sich dann innerlich auf den Mund und dachte: Mensch, Penelope, benimm dich wie eine Erwachsene und nicht wie ein Kind auf Zuckerwatte.
»Meine Friseurin probiert immer Trends an mir aus.« Eleni fuhr sich verschmitzt durch die Haare. »Du siehst aber auch spitze aus. Warum haben wir uns eigentlich so lange nicht gesehen?«
»Das ist eine gute Frage, und ich habe echt keine passende Antwort«, lachte Penelope und schob das Mädchen in den Flur, »komm rein, ich freue mich sehr, dass du da bist.«
Sie gingen auf den Balkon, Penelope goss Eleni ein Glas Wasser ein und schob es ihr hin: »Magst du auch ein Glas Wein, oder musst du heute wieder zurück? Das Gästezimmer ist gerichtet, du könntest also über Nacht bleiben, es ist ja auch Wochenende.« Jetzt schlug sie sich auch real die Hand auf den Mund. »Ich rede wieder, ohne Luft zu holen. Komm erst einmal an.«
»Ich nehme gern ein Glas Wein, und ich habe meine Übernachtungstasche im Auto stehen.« Eleni lächelte verhalten. »Ach, Penelope, ich habe dich wirklich vermisst.« Dann trank sie einen großen Schluck Wasser und nahm dankend das Weinglas. Es war leicht beschlagen, so kühl war der Weißwein.
Sie prosteten einander zu und füllten die plötzlich entstandene Stille mit dem Getränk.
»Es ist schön, dass du da bist«, sagte Penelope, nahm einen weiteren Schluck Wein und lächelte das Mädchen an.
»Es ist viel passiert in den letzten Wochen und ich wollte es dir persönlich erzählen und nicht nur eine Nachricht im Messenger senden.« Eleni lächelte zurück, nahm sich ein Häppchen von der liebevoll angerichteten Platte und kaute genießerisch.
»Jetzt bin ich aber wirklich gespannt.« Penelope war neugierig auf das, was nun kommen würde, und als sie ebenfalls zur Platte griff, berührten sich ihre Hände kurz, und sie sahen einander an.
»Ich glaube, dass sich ein Teil meiner Träume erfüllen wird«, sagte die junge Frau und nahm die Berührung ganz selbstverständlich hin, so, als hätten sie sich erst gestern zum letzten Mal gesehen.
»Wollen wir lieber etwas laufen? Du hast ja lange im Auto gesessen.«
»Am Strand spazieren wäre toll, das geht hier in Ammoudara so wunderbar«, lächelte Eleni.
»Das Wasser ist sehr angenehm. Ich war letzthin schon mit Hyeronimos schwimmen, obwohl ich mich sonst eigentlich nicht vor Mai ins Wasser wage«, erklärte Penelope.
»Wie geht es ihm?«, wollte Eleni wissen, und ihr Blick wurde ernster.
»Er ist verschlossen wie eine Auster, und ich mutmaße, dass er am Wochenende wieder oben ist«, die Pathologin zuckte mit den Achseln.
»Ist das noch normal, oder gilt das schon als Obsession?«, fragte das Mädchen.
»Was ist schon normal?« Penelopes Blick glitt kurz in die Ferne.
Eleni seufzte und legte der Pathologin sanft eine Hand auf den Arm. »Lass uns ans Wasser gehen. Vieles ist irgendwie leichter, wenn man sich bewegt und die Brandung spürt.«
»Wann bist du eigentlich vierzig geworden du lebenskluges Ding?« Penelope schmunzelte kurz, trank den letzten Schluck Wein, aß noch etwas von dem leckeren Dakosbrot aus Carob, das sie mit Wasser etwas angefeuchtet, dann mit Olivenöl aus leicht unreifen Oliven beträufelt und mit Feta- und Tomatencreme bestrichen hatte. Eleni tat es ihr gleich. Kauend gingen sie in die Küche, stellten dort Gläser und Platte ab, und Penelope holte eine kleine Tasche mit zwei Handtüchern aus dem Bad. »Damit wir uns die Füße abtrocknen können«, erklärte sie.
Sie fuhren mit dem Aufzug nach unten, Eleni präsentierte stolz den Wagen und sprudelte dann heraus: »Weißt du, ohne unseren Fall wäre mein Leben noch genauso perspektivlos wie letzten Sommer, doch jetzt sponsert mir jemand ein Auto und mal eben den Führerschein, und ich schreibe in meinem Blog vermehrt über meine Weltsicht. Ich habe jetzt nämlich auch eine richtige Homepage.« Sie zückte ihr Handy und tippte einige Male darauf, dann hielt sie es Penelope hin. »Sie ist gestern erst fertig geworden.«
»Wow, du hast sogar ein eigenes Logo!« Penelope bewunderte den geschwungenen Schriftzug in lateinischen Buchstaben.
»Wir haben extra diese Buchstaben gewählt, damit es auch in ganz Europa lesbar ist, und meine Texte schreibe ich auf Griechisch und Englisch und eine Freundin, die in England lebt, liest das dann noch mal und berichtigt die Fehler.« Eleni klang aufgeregt.
»Worüber schreibst du dort?«, wollte Penelope wissen.
»Ich habe mit einigen kritischen Themen angefangen, erst dachte ich, dass das niemanden interessiert, aber es ist tatsächlich gut, schon eine so stabile Fanbase zu haben wie ich. Auf Instagram bist du ja zeichentechnisch begrenzt und kannst nicht wirklich sehr lange Beiträge schreiben, doch gerade die, die sich mit Themen wie Zukunftsperspektive, der Krise oder der Kirche«, sie verzog kurz schmerzhaft das Gesicht, »beschäftigten, bekamen die meisten Likes. Also habe ich mich getraut und einen längeren Gastartikel für den Blog eines jungen Mannes geschrieben, der sich vor allem mit der sexuellen Freiheit unserer Generation befasst, also mit der, die eigentlich da sein sollte, es aber nicht ist. Und so funktioniert auch mein Blog: Es gibt immer interessante Gastartikel und meine kritische Stimme dazu.«
Penelope zog interessiert die Augenbrauen hoch und scrollte über den Bildschirm. »Das muss ich mal in Ruhe durchlesen. Ich gehe also jetzt mit einem richtigen Star spazieren«, wollte sie schmunzelnd wissen.
»Ach Quatsch, davon bin ich noch weit entfernt, na ja oder zumindest noch ein bisschen entfernt, aber ich bin auf dem richtigen Weg!« Das Mädchen machte das Victory-Zeichen, und Penelope konnte den Stolz in ihrer Körperhaltung erkennen.
Spontan hakte sie sich bei Eleni unter und reichte ihr das Handy zurück, als sie Richtung Strand gingen. Es war tatsächlich ein wenig skurril, dass ausgerechnet ein Skelett dazu beigetragen hatte, dass dieses Mädchen nun ein Auto hatte, Öffentlichkeit genoss und es scheinbar ja noch mehr zu berichten gab.
Eleni steckte das Handy ein und sagte: »Ich glaube, dass ich tatsächlich bald von der Insel runterkomme.«
»Das finde ich einerseits großartig, und andererseits ist es irgendwie traurig, wenn du weit fortgehst.«
»Ich denke, der erste Weg wird mich aufs Festland führen«, Eleni lächelte leicht, »es ist etwas Profanes, aber für den ersten Schritt schon ganz gut. Ein Produzent nachhaltiger Mode hat mich eingeladen. Ich soll für eine neue T-Shirt-Serie nicht nur als so was wie sein Model fungieren, sondern auch als Inspiration für die Kollektion. Dann sehe ich weiter, es sind noch ein paar andere Anfragen da, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das alles seriös ist. Manolis, mein Bruder, prüft alles ganz genau.«
»Da bin ich aber erleichtert, denn genau das wollte ich gerade fragen …« Sie hatten den Strand erreicht, zogen die Schuhe aus und schlenderten plaudernd durch die Brandung. Penelope freute sich aufrichtig für das Mädchen, auch wenn sie mit ein wenig Wehmut an das wunderbar prickelnde Gefühl dachte, das Eleni in ihr auslöste – und wie aussichtslos es war. Aber jetzt würde sie einfach die Zeit mit der selbstbewussten jungen Frau genießen.
Kapitel 7
Michalis Lamdakis saß auf dem Sessel und hatte das Gefühl dort eingefroren zu sein. So, als würde die Zeit stillstehen und er wäre dazu verurteilt, nun für immer in dieser Position zu verharren. Der Bischof war schon lange gegangen. Er hatte seine Bombe fallen lassen und dabei so viel Schaden angerichtet wie möglich. Michalis war zerstört, von den Splittern getroffen fühlte es sich an, als würde sein Leben aus ihm rinnen. Ja, genauso war es, denn alles, woran er glaubte, war erschüttert worden, und seine Grundfeste schienen zu wanken. Er war reich, er hatte Einfluss, und den machte er auch bewusst geltend, um die Welt, seine Welt, zu erhalten. Seine Welt hielt das Gefüge auf der politisch strapazierten Insel auf gewisse Art in einem Gleichgewicht. Solange die Familie das Fundament allen Handelns war, so lange ließ sich alles rechtfertigen. Jedes Geschäft, jeder Kontakt, egal ob kritisch oder gar zwielichtig sah in diesem Licht betrachtet anders aus: Man tat es für die Familie, damit war es in Ordnung. Familie war Tradition, und die primäre Aufgabe einer Beziehung lag vor allem darin Kinder zu zeugen und diese zu Menschen zu formen, die für ihre Familie, deren Vorankommen und Fortbestand oberste Priorität hatte. So hatten Stavroula und er es auch gehalten. Sie war wunderschön und gebildet, keine Frage, aber die Kinder standen im Vordergrund, und er sah es nicht gern, wenn sie sich in das Tagesgeschäft einmischte. Sie hatten zwei verheiratete Töchter und schon drei Enkelkinder. Sie waren eine Bilderbuchfamilie! Er wusste, wie viele Menschen ihn darum beneideten. Die Mädchen hatten studiert und waren klug und schön wie ihre Mutter, obwohl seine Frau ihm oft zu verstehen gab, dass sie eher ihm ähnelten und Stephanos derjenige war, der ganz nach ihr kam.
Er konnte nicht einmal die Hand heben, um sich über die brennenden Augen zu streichen, so erstarrt war er. Nichts war möglich. Er saß dort und stierte aus dem Fenster auf die langsam herannahende Dunkelheit. Nichts würde je mehr sein wie früher. Er stellte alles infrage und war sich vollkommen bewusst, dass er etwas tun musste. Er konnte das, was er nun wusste, nicht ignorieren, zu weitreichend waren die Konsequenzen. Und diese konnten alles zerstören, was er mühsam aufgebaut hatte. Der Bischof hatte ihm alles in den schillerndsten Farben ausgemalt: Wie der Name Lamdakis besudelt werden würde, wie seine Werte nicht nur einfach den Bach runtergingen, sondern öffentlich dem Gespött preisgegeben werden würden, wie seine Familie zerbrach und auch das Unternehmen litt, vielleicht Verluste einfahren oder sogar vollkommen kaputt gehen würde. Was sollte er tun? Der Bischof hatte nichts weiter gesagt als: »Wir müssen eine Lösung finden!«
Damit hatte er verdeutlicht, dass sie irgendwie im selben Boot saßen. Sie hatten beide weitreichende Kontakte, nicht nur nach Athen, sondern auch nach Europa und Übersee. Vielleicht fand sich ja dadurch eine Lösung. Er musste nachdenken, klar und bewusst die Situation von allen Seiten beleuchten und dann diverse Szenarien durchlaufen, die zu einer Lösung führen konnten. Alles musste wohl bedacht werden, doch er konnte nicht. Seine Gedanken blieben immer wieder stecken und holperten umher.
War das sein Lebenswerk? Würde das alles nun alles Bisherige überlagern? Er hatte sich seinen Reichtum hart erarbeitet und nichts geschenkt bekommen. Gut, das stimmte nicht ganz, denn Stavroula hatte eine großzügige Mitgift in die Ehe eingebracht, und seine Eltern hatten ihnen ein kleines Haus gebaut, sodass sie schon früh ein eigenes Zuhause gehabt hatten. Das hatte ihnen finanzielle Entlastung gebracht. Zudem war die Familie seiner Frau sehr gut auf der Insel vernetzt, und so hatte er gute Kontakte knüpfen können und diese dann entsprechend ausgebaut. Er war beredt und erkannte rasch, was die Leute wirklich wollten. Es war eine Gabe, ein Talent, und er nutzte es jeden Tag, bis die Firma glänzend dastand und ihnen zu jenem Einfluss verhalf, auf den er es abgesehen hatte: Politik zu machen ging leichter, wenn man wichtig war. Er war wichtig, ohne Frage, und er hatte geplant, Stephanos langsam in alles einzuweihen, um mit ihm gemeinsam die Geschicke der Insel zu lenken. Die Kirche war ein unabdingbarer Faktor dabei.
Er hatte eine Vereinbarung mit dem Bischof getroffen, lange bevor dieser in dieses Amt aufgestiegen war, und sie hatten einander nie im Stich gelassen. Emmanuel war sogar Taufpate und Namensgeber seiner Tochter Emmanuela. Er war ein Freund der Familie und früher oft zu Besuch bei ihnen gewesen, doch dann hatten ihn die Aufgaben seines Amtes immer mehr gebunden und sie sich seltener gesehen. Dies hatte dem, was sie verband, jedoch keinen Abbruch getan. Er würde sich positionieren müssen, das war ihm klar. Das war der erste Schritt, und dann würden weitere folgen müssen. Er versuchte sich zu bewegen, doch sein Körper blieb steif und unbeweglich, sodass er für einen Augenblick geneigt war zu glauben, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte und nun irgendwie aus dem Schneider war. Doch dann kehrte die Kontrolle über seine Gliedmaßen zurück, und er schaffte es, sich zu erheben. Lange stand er an den Fensterrahmen gelehnt, blickte auf den beleuchteten Hafen und sammelte seine Kräfte.
Kapitel 8
Emmanuel hob seinen Blick, er hatte den Ikonen den Rücken zugekehrt, so, als würde er sich für sein Handeln schämen. Doch er schämte sich nicht, denn die Verantwortung, die er trug, war eben manchmal auch eine Last, und er musste weitsichtig sein. Die Kirche bot den Menschen Halt und Richtung. Sie konnte keine Verwässerung der Traditionen zulassen, denn egal, wie man es drehte und wendete: Die Familie war das, worauf es ankam. So hatte Gott es gewollt, und es gab keinen interpretativen Spielraum. Für ihn war es wichtig, seine Linie zu halten, aber er achtete auch darauf, nicht zu streng zu erscheinen, denn er wollte die Gemeinschaft der Gläubigen stärken und nicht dauerhaft verschrecken. Er hatte gesehen, wie seine Brüder auf dem Festland massive Fehler begangen hatten, indem sie sich außerordentlich verächtlich, ja geradezu hasserfüllt in der Öffentlichkeit geäußert und damit der Kirche mehr geschadet als genutzt hatten. Daraus hatte er einmal mehr für sich die Lehre gezogen, bestimmte Wege im Stillen zu gehen. Er hatte Michalis einweihen und warnen müssen, in der Hoffnung, dass der Freund etwas unternehmen würde, bevor er selbst aktiv werden musste. Es war nicht gut, es zu lange hinauszuzögern, und doch wollten alle Taten wohl überlegt sein, denn er konnte es nicht zulassen, dass die Kirche einen Schaden erlitt. Er hatte intensiv gegrübelt und verschiedene Szenarien ins Auge gefasst.
Wie hatte das alles geschehen können, und warum hatten die Lamdakis’ es nicht bemerkt? Warum hatte er selbst es nicht bemerkt? Er war oft genug zu Gast bei seinem Freund und seinem Patenkind gewesen. Hätte er die Zeichen nicht sehen müssen? Hätte Gott ihm nicht die Wahrheit hinter dem Schleier zeigen müssen? Dann hätte er frühzeitig handeln können und das Übel ganz sicher schon im Keim erstickt. Es war eine Krankheit, und die konnte man mit der richtigen Medizin heilen. Jetzt war es jedoch zu spät, und schlimmstenfalls musste er sich von den Lamdakis’ abwenden. Das würde aber der Spendenkasse sicher nicht guttun, denn Michalis füllte sie immer großzügig. Wie gern hätte er jetzt geflucht, doch er spürte die Blicke der Heiligen auf seinem Rücken. Er musste endlich handeln. Entschlossen tippte er die Nachricht und drückte auf senden.
Nun würde alles seinen Lauf nehmen. Er tat eben, was getan werden musste, und dabei durfte er sich nicht von seinen Gefühlen und persönlichen Befindlichkeiten leiten lassen. Er seufzte schwer und versuchte, die Bürde auf seinen Schultern erträglicher zu machen, indem er sich nun langsam umdrehte und dann auf die erste Ikone zuging, um sie ehrerbietig zu küssen.
Kapitel 9
Der Andartis, das steinerne Monument für den Frieden, lag vor ihm im Sonnenlicht. Er konnte immer nur einen kleinen Teil des riesigen, aus mehr als fünftausend Gesteinsbrocken bestehenden Mahnmals überblicken, und genauso kam ihm seine Gesamtsituation vor: Er sah nur einen Teil. Das gesamte Bild jedoch blieb ihm noch verborgen.
Er erinnerte sich nicht mehr daran, wann er das erste Mal in seinem Leben darüber nachgedacht hatte, Polizist zu werden, schon immer hatte ihn eine ungewöhnliche Neugierde angetrieben, den Dingen auf den Grund zu gehen. Nun saß er hier, um die fehlenden Puzzlestücke zu finden, sich mit der Schuld auszusöhnen und auch, um seinem Großvater zu verzeihen und all den anderen, die dazu beigetragen hatten, die Kreter und Kreta zu verletzen und unterjochen zu wollen. Er wusste, dass seine Großmutter sich Vorwürfe von ihrer Tochter, seiner Mutter, anhören musste, und er hatte eine recht anschauliche Vorstellung von dem Verhalten seiner Eltern. Es gab aber nichts, wofür Titika oder er sich entschuldigen mussten, also würde seine Familie mit sich selbst klarkommen müssen. Er hatte intensiv mit Kassia über alles gesprochen und wollte nun nicht mehr darüber reden.
Er wusste, warum es ihn hierherzog, hatte aufgehört, sich dafür zu rechtfertigen, erklärte nicht mehr, wie seine Tage aussahen, und verteidigte seine Ausflüge nicht mehr mit minutiösen Berichten. Er setzte sich einfach ins Auto und fuhr verschiedene Wege in die bergige Landschaft hinauf, alle mit dem Ziel Andartis. Manchmal parkte er weit entfernt, lief lange, wanderte durch die zerklüftete Natur und sprach mit den Menschen, die ihm begegneten. Er, der sonst Kontakte mied, suchte bewusst den Austausch: sprach die Alten an, die selber knorrig wie Bäume auf den Feldern ihre Arbeiten verrichteten oder auf kleinen Hocker saßen und in die Natur schauten. Er suchte sich immer eine kleine Taverne in einem der Dörfer auf seinem Weg, in der er aß, was es gab. Und er war jedes Mal beseelt von den köstlich einfachen Speisen, die all seine Sinne berührten.
Er fühlte sich verbunden mit den Menschen, ihrer Lebensweise, ihrer Weisheit und der Liebe, mit der sie das, was die Erde ihnen gab, zubereiteten. Er hatte es schon immer genossen, gut zu essen, doch die köstlichsten Gerichte waren ihm in den letzten Wochen abseits der größeren Straßen in den winzigen Dorftavernen begegnet, in denen die Köchinnen im Alter seiner Yaya zu sein schienen und die Fähigkeit besaßen, aus einer Scheibe trockenen Brotes einen Gaumenschmaus zuzubereiten.
Heute hatte er mal wieder eines seiner Lieblingsgerichte gegessen: Frische Eier – er hatte gesehen, wie die Tochter des Hauses sie den Hühnern quasi unter dem Hintern weggesammelt hatte –, in einer Soße aus geriebenen sonnig-süßen Tomaten pochiert, darüber etwas Oregano und dazu frisches Brot aus dem steinernen Backofen, noch so warm, dass er sich fast den Mund verbrannt hatte. Er hatte einen halben Laib Brot verputzt, um jeden Tropfen der exquisiten Soße aufzudippen und auch ja jedes Fitzelchen Eigelb mit dem locker duftigen Gebäck aufzunehmen. Danach war nur noch Platz für ein bisschen Joghurt mit Berghonig gewesen, selbstverständlich von den eigenen Bienen, nur noch verfeinert mit einigen Sesamkörnern. Er hatte dazu ein Glas Wein und nach dem Dessert den selbst gebrannten Tsikoudia getrunken, nicht eisgekühlt, wie er den Touristen am Meer oft kredenzt wurde, sondern zimmertemperiert. So breitete sich der milde Geschmack, der sich hinter den 22 Prozent Alkohol verbarg, angenehm im Gaumen aus.
Der Polizist in ihm war sich im Klaren darüber, dass er es mit Schwarzgebranntem zu tun hatte, aber der Polizist hatte frei, und er würde einen Teufel tun und hier jemandem eine Strafpredigt zum Thema Gesetzesübertretungen halten.
Ende der Leseprobe