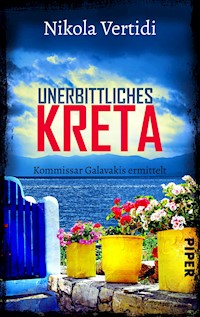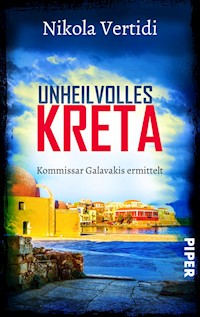
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
GÜNSTIGER EINFÜHRUNGSPREIS. NUR FÜR KURZE ZEIT! Der verschrobene Kommissar Hyeronimos Galavakis ermittelt in seinem fünften Fall mit deutscher Gründlichkeit und kretischem »Siga-Siga« Ein Griechenland-Krimi zum Wegträumen und eine Reise zu den schönsten Stränden Kretas und in die urigsten kretischen Tavernen! Stelios Mentakis, Chef der Mordkommission in Irakleio, kuriert seinen Burnout in einer Berghütte. Er steht nur mit der Pathologin Penelope in Kontakt. Plötzlich erreicht sie ein erschreckender Anruf: Stelios ist schwerverletzt und ringt um sein Leben. Wer hatte ein Motiv und wusste gleichzeitig, wo sich Mentakis aufhielt? Wen hat sich der Polizist in seiner Laufbahn zum Feind gemacht? Findet sich der Täter vielleicht sogar in den eigenen Reihen? Ein Fall, der allen an die Substanz geht, fordert das Ermittlerteam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Unheilvolles Kreta« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Julia Feldbaum
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Personenregister
Zitat
Hoffnung auf Irrtum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Die Frage nach dem Warum
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Wunsch nach Aufschub
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Trauer um vergebene Chancen
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
Abkopplung von der Umwelt
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
Im Angesicht des Todes
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
Das Leben geht weiter
120. Kapitel
121. Kapitel
Kretische Rezepte für vier Personen
Gebratene Leber mit Rosmarin
Marathos Pites
Titikas Chalvas
Zusatzmaterial
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Personenregister
Hyeronimos Galavakis – Kommissar
Stelios Mentakis – Hyeronimos’ Chef (aktuell krankgeschrieben)
Maria Chrisaki – Stelios Mentakis’ rechte Hand, derzeit Interimschefin
Elonidas Spectros – Leiter der Cyber-Einheit, derzeit Interimschef
Zacharis Zentakis – Hyeronimos’ Mitarbeiter
Christos Papadakis – Hyeronimos’ Kollege
Kostoula Banaki – Stelios Mentakis’ Ex-Frau
Dr. Helena Makri – Hyeronimos’ Ex-Freundin, Expertin für Hämatologie
Penelope Demostaki – leitende Pathologin der Insel
Giorgia – Penelopes Sektionsassistentin
Eleni Pentulaki – Influencerin, T-Shirt-Designerin und Penelopes Freundin
Michalis Serpantakis – Mafiaboss aus Zoniana, der Boss
Filomena Serpantakis – seine Schwester, die Wohltäterin
Dimitris Stefanakis – Minister in Athen
Ignatios Mavrakakis – Feldarbeiter
Anna-Maria – eine Frau aus den Bergen
Anna-Marias Söhne Kimon und Gavril
Nie wird der Feind zum Freunde, selbst im Tode nicht.
Sophokles
Hoffnung auf Irrtum
1. Kapitel
Der drahtige Mann dehnte seinen Rücken, beugte sich zu den Fußspitzen hinab und berührte leicht den Boden. Dann richtete er sich auf und begann zu laufen. Er hatte sich einen der holprigen Pfade entlang der Steilküste am Meer ausgesucht. Dort musste er sich konzentrieren und konnte gleichzeitig die salzige Luft inhalieren und die Spiegelung der aufgehenden Sonne auf dem azurblauen Wasser auskosten. Das war Leben, so musste es sich anfühlen, lebendig zu sein und frei.
Rasch kam er in den angenehmen Rhythmus eines geübten Läufers, sein Atem ging gleichmäßig, und seine Beine bewegten sich wie von selbst. Trotzdem war er immer aufmerksam, das hatte er gelernt und konnte es nicht ablegen. Hier erwies sich diese Fähigkeit als hilfreich und notwendig, denn der steinige Untergrund war tückisch. Wenn man nicht aufpasste, konnte man stolpern, vielleicht sogar ins Meer hinabstürzen und ertrinken. Er war sich dessen vollkommen bewusst, und sein Körper signalisierte ihm die stets vorhandene Bereitschaft, schnell zu reagieren – wie eine Art zuverlässiges Messgerät.
Er war im Nordwesten der Insel aufgewachsen, hatte sich nun jedoch ganz bewusst dafür entschieden, auf der Südseite zu leben. Sie war dünner besiedelt, rauer und ursprünglicher, und die Menschen stellten weniger Fragen. Die Gefahr, dass ihn hier jemand erkannte, war ebenfalls geringer, denn die Leute hatten mit ihren eigenen Problemen und Sorgen genug zu tun.
Er hatte ein bescheidenes Zimmer gemietet und half auf den Feldern für ein kleines Entgelt aus. Das reichte ihm, denn er hatte sich daran gewöhnt, nichts zu besitzen, und empfand schon den Genuss von frischen Früchten und Gemüse als absolute Bereicherung seiner Lebensqualität. Ebenso wie die Stille um ihn herum, wenn er abends vor dem Zimmer auf dem einfachen Holzstuhl saß und zum Horizont blickte.
Es mangelte ihm an nichts, und er hätte vollkommen zufrieden sein können, wäre da nicht dieses brennende Gefühl in seinem Inneren gewesen. Es ließ sich nur im Zaum halten, indem er rannte, jeden Tag aufs Neue seine Füße über den felsigen Weg befahl und am Ende der Strecke endlich ein wenig Erleichterung empfand.
Wenn ihm eines über die Jahre hinweg klar geworden war, dann dass alles im Leben seine Zeit hatte: das Verzeihen, das Trauern, das Hadern, die Wut, das Bedürfnis nach Vergeltung. Und allen, die behaupteten, dass es verschiedene Phasen gebe, die linear aufeinanderfolgten, konnte er sehr klar entgegnen, dass dem nicht so war. Es gab zwar all diese Phasen, doch sie waren keineswegs eindimensional, und vor allem endeten sie niemals.
Der Stand der Sonne zeigte ihm an, dass es Zeit war, sich auf den Weg zu machen, sollte er heute noch erfolgreich in die Tat umsetzen wollen, was er sich vorgenommen hatte.
2. Kapitel
Er trat hinaus und hielt kurz inne, um seinen Blick schweifen zu lassen, so wie jeden Morgen in den letzten Wochen. Seine Augen erfassten die Berggipfel des Psiloritis, die sich majestätisch in das zartrosa gefärbte Himmelblau reckten. Die Sonne hatte sich gerade erst aus ihrem Schlaf erhoben und strahlte den Gebirgszug wie ein magischer Scheinwerfer an. Seitdem er hier war, wurde sein Tag von der wandernden Sonne bestimmt: Er stand mit ihr auf und ging mit ihr schlafen. Niemals hätte er sich das vorstellen können, doch mittlerweile tat es ihm einfach nur gut. Er war merklich ruhiger geworden, seitdem er wieder gelernt hatte zu schlafen. Hier war es so still, dass er erst hatte begreifen müssen, dass es jede Menge Geräusche gab, die nur aus ihm selbst heraus entstanden: das aufgeregte Rauschen des Blutes in seinen Adern, das fordernde Knurren seines Magens, das laute Pochen seines Herzens in seinem Brustkorb, das knirschende Knacken seiner Gelenke. Das war er. Die Stille um ihn herum ließ all diese Laute deutlicher hervortreten, und was ihm in den ersten Tagen unaushaltbar erschienen war, war nun einer wohlwollenden Haltung all seinen Gefühlen gegenüber gewichen. Nur langsam kam er mit sich in Kontakt und machte sich mit seinen Bedürfnissen wieder vertraut. Oder vielleicht auch zum ersten Mal in seinem Leben, denn er war immerzu beschäftigt gewesen.
Die Hütte, die sein Großvater noch vor dem Zweiten Weltkrieg in dem abgelegenen Winkel des Gebirges erbaut hatte, hatte der Zeit getrotzt und bot alles, was nötig war, wenn man der fordernden, immer schneller werdenden Welt entfliehen wollte.
Er holte erneut tief Luft, ging zurück in den größeren Raum des steinernen Baus, der als Wohn-Esszimmer und Küche diente, fachte die Glut wieder an, legte einige Holzscheite auf und begann, das Wasser für seinen Kaffee zu kochen. Diesen Ellinikó würde er gleich auf der Bank vor dem Haus genießen: ein echter griechischer Kaffee, bei dem man darauf achten musste, dass sich das Pulver am Boden der Tasse absetzte, bevor man zu trinken begann.
Bald durchzog der aromatische Duft jeden Winkel des Zimmers. Sein Herz schlug gleichmäßig, während seine Hände sorgfältig hantierten. In absehbarer Zeit würde er wieder gesund sein. Er würde gewiss nie mehr der Alte werden, dazu hatte er zu viel über sich gelernt, in all den Stunden, die er nur in seiner Gesellschaft und ohne jede Ablenkung verbracht hatte, aber er würde eine bessere Version von sich selbst mit hinab in die Stadt bringen. Davon war er überzeugt.
3. Kapitel
Hyeronimos blickte von seinem Schreibtisch auf und versuchte, sich auf seinen aktuellen Fall zu konzentrieren. Er hasste »häusliche Gewalt mit Todesfolge« und war daher sehr erpicht darauf, alles so zu erledigen, dass der Staatsanwalt eine Verurteilung erreichen konnte. Gleichzeitig war es jedoch eine Form von Routinearbeit, die er zu erledigen hatte, und das ermüdete ihn auf gewisse Weise. Nicht, dass er dauerhaft mit Fällen wie seinem letzten, bei dem es nicht nur um Mord gegangen war, sondern um tief greifende Bösartigkeit, konfrontiert werden wollte, doch für reine Schreibtischarbeit war er einfach nicht geschaffen. Dafür hatte er seinen pedantischen Mitarbeiter Zacharis Zentakis, doch der blasse Sonderling war mit seiner Freundin in den Urlaub entschwunden und damit nicht verfügbar.
Der heiße August hatte alles auf der Insel komplett lahmgelegt, und Hyeronimos hatte genau wie alle anderen begonnen, sich nach kühlen Herbstnächten und Regen zu sehnen, doch bis dahin würden wohl noch einige sonnige Wochen vergehen. Er freute sich auf den Abend, denn dann würde er sich in die samtigen Fluten stürzen und den Schweiß des Tages abspülen. Ganz sicher würde Penelope ihn wieder begleiten. Seine beste Freundin, die leitende Pathologin der Insel, war eine reine Schönwetterschwimmerin, und an herrlichem Sommerwetter mangelte es zurzeit keineswegs.
Es klopfte harsch, und Klopfen und Türaufreißen waren quasi eins. Maria streckte ihren Kopf herein: »Auf ein Wort, Hyeronimo!«
Er nickte ergeben. Seit Stelios Mentakis, der Leiter der Mordkommission, sich vor einigen Monaten hatte krankschreiben lassen, waren dessen rechte Hand, Maria Chrisaki, und der Abteilungsleiter der Cybereinheit, Elonidas Spectros, seine Vorgesetzten. Alles in allem machten beide einen guten Job, und er hatte vor allem Spectros’ besonnene Art schätzen gelernt, doch tief in seinem Inneren haderte er noch immer ein wenig mit Stelios’ Entscheidung, ihn vollkommen zu übergehen. Gut, er hatte einige Probleme, aber wer hatte die nicht? Rational war ihm vollkommen bewusst, dass Mentakis richtig gehandelt hatte, doch emotional nagte es an ihm. Auch, wenn der Major dadurch nicht nur ihn wie einen unartigen Schuljungen in seine Schranken gewiesen hatte, sondern auch seinen Kollegen und immerwährenden Kontrahenten Christos Papadakis.
Hyeronimos hatte es sich nie so recht erklären können, warum der etwas ältere Ermittler ihn so auf dem Kieker hatte. Irgendwann war ihm der Gedanke gekommen, dass es nichts mit seinen Eigenheiten zu tun hatte, sondern mit seiner Herkunft. Seine Eltern waren Anfang der 1970er-Jahre nach Deutschland ausgewandert, um im Rahmen des Abkommens mit dem Land dort zu arbeiten. Sie waren geblieben und hatten sich hervorragend integriert. Hyeronimos war in einer mittelgroßen schwäbischen Stadt aufgewachsen, sprach Griechisch und Deutsch ohne Akzent und vereinte auch die Gewohnheiten beider Nationen in sich. Er hatte in Deutschland nie verleugnet, ein Kriti zu sein, doch hier auf der Insel ging er mit seiner deutschen Vergangenheit nicht hausieren. Nicht etwa, weil er sich schämte, sondern weil er als Kommissar der örtlichen Mordkommission kein Fremder sein wollte. Und vielleicht war es genau das, was Christos gegen ihn aufbrachte: dass dieser den Fremden in ihm sah und auch noch einen Deutschen!
Fast jede Familie auf Kreta hatte während des Zweiten Weltkriegs herbe Verluste durch die deutsche Wehrmacht erlitten. So auch Christos’ Familie. Maria hatte es ihm vor einigen Jahren erzählt: Die kranke Urgroßmutter hatte sich geweigert, ihr Haus zu verlassen, und war im Anschluss bei lebendigem Leib in den Mauern verbrannt. Die Soldaten hatten das Gebäude angezündet, in dem Wissen, dass sie darin umkommen würde.
Hyeronimos dachte an seine Yaya, ihr hundertster Geburtstag rückte immer näher, und er versuchte, sich vorzustellen, was es in ihm anrichten würde, wenn sie auf eine solch furchtbare Art sterben müsste. Ob er dann ebenso hasserfüllt reagieren würde? Wer wusste das schon!
Das machte Christos’ Verhalten nicht erträglicher oder entschuldbar, denn schließlich hatte sich Hyeronimos nichts zuschulden kommen lassen. Und auch seine Familie war mit reiner Weste davongekommen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er erfahren, dass sein Großvater anfangs auf der falschen Seite gestanden hatte, im Begriff, seine Landsleute an die Besatzer zu verraten. Er hatte seine Familie beschützen wollen und war bereit gewesen, das Leben anderer Familien dafür zu opfern. Doch dann hatte er gesehen, was der Verrat anrichtete, und sich besonnen. Seine Yaya hatte ihrem Mann verziehen. Hyeronimos’ Mutter jedoch hatte mit dem Wissen nicht umgehen können, und das war einer der Gründe gewesen, der Heimat den Rücken zu kehren. Ebenso wie die Gräueltaten der Militärjunta, die bis 1973 überall im Land ihr Unwesen getrieben hatte. Athina und Anatolis waren sich einig gewesen, auf Kreta kein Kind großziehen zu wollen, zudem hatten sie beide von mehr geträumt und sich diese Träume in Süddeutschland erfüllt.
Doch für Hyeronimos war Kreta immer Heimat gewesen, und als er vor der Entscheidung gestanden hatte, was er nach dem Abitur mit seinem Leben anfangen wollte, hatte er die Vitamin-B-Karte gezogen und die Polizeischule in Athen besucht. Er hatte seinen Onkel gebeten, ihm dies zu ermöglichen, und zu dieser Zeit hatte ein einflussreicher Anruf noch jede Menge Gewicht gehabt.
Nun saß er in seinem akribisch aufgeräumten Büro und blickte in die fordernden Augen seiner neuen Chefin.
»Keine Ahnung, wo du gerade bist, aber ich bin immer noch hier«, knurrte sie mit ihrer rauen Stimme und stand zu seinem Erstaunen nun direkt vor seinem Schreibtisch. Er war tatsächlich gedanklich komplett abgeglitten.
»Entschuldige, Maria«, bat er sogleich zerknirscht. »Was kann ich für dich tun?«
»Kennst du eine Maria Xylouri?«, wollte sie wissen.
»Aus Agia Pelagia?«
»Ja.«
»Was ist mit ihr? Ist ihr was passiert?«, fragte er alarmiert.
»Alles ist gut, Hyeronimo«, beruhigte sie ihn, »sie hat einen Post auf Facebook geschrieben, über eine Katze, die mit Säure schwer verletzt wurde. Das arme Tier sieht furchtbar aus. Wer so was tut, gehört genauso hinter Gitter wie jemand, der Menschen verletzt!« Sie machte ihren Standpunkt vehement deutlich, und er wartete geduldig ab, worauf das Ganze hinauslief. »Spectros’ Einheit nimmt solche Hinweise sehr ernst, denn Tierschutz ist wichtig, und nach dem Säureattentat im vergangenen Jahr in Athen sind alle noch aufmerksamer geworden. Er wollte eine Streife hinschicken, um mit der Frau zu reden und deutlich zu machen, dass man sich darum kümmert. Ich habe gesagt, dass ich dich frage, ob du sie kennst und beim nächsten Besuch in Agia Pelagia kurz mit ihr reden magst.« Sie schaute ihn appellierend an.
Er nickte.
»Bedeutet das, du kennst sie und redest mit ihr?«
Er nickte wieder. »Ich kenne Maria gut. Sie ist sehr engagiert. Ich rede gern mit ihr. Soll ich einfach nur Interesse zeigen, oder wollen wir auch ihre Mutmaßungen wissen? Das könnte nämlich etwas komplizierter werden …«
»Ich bin auch von hier«, sagte sie nun leicht belustigt, »und kenne die Leute sehr gut. Gewiss wird sie keine Namen nennen, denn wenn sie eindeutige Beweise hätte, hätte sie Anzeige erstattet. Ich würde so einen Tierquäler liebend gern in Handschellen abführen!«
Jetzt klang sie angriffslustig, und er konnte sich sehr gut vorstellen, wie sie so jemanden an dem metallenen Armschmuck durchs Dorf zerrte. »Ich rede mit ihr und verdeutliche damit, dass die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung ernst nimmt«, bestätigte er.
Zufrieden hob sie die Hand wie zum Gruß, deutete dann mit einem ihrer blutrot lackierten Nägel auf ihn und sagte: »Danke, Hyeronimo!« Sie drehte sich auf dem Absatz um und ging zur Tür, dann besann sie sich anscheinend ihrer Rolle, wandte sich noch einmal um und fragte: »Ist sonst alles in Ordnung? Brauchst du etwas?«
Er dachte kurz nach und schüttelte dann den Kopf. »Ich bin kurz davor, alles für den Staatsanwalt fertig zu haben, und Penelope hat ihre Ergebnisse auch so weit zusammengefasst, dass er den Typ dingfest machen kann.«
4. Kapitel
Sie lächelte angestrengt und hob das Glas prostend: »Stini igia sas!« Mehrfach wiederholte sie in alle Richtungen das »Auf unser Wohl!« und trank dann einen Schluck des prickelnden Champagners.
Michalis hatte keine Kosten gescheut und für die Veranstaltung nur die teuersten Produkte geordert. Früher hatte ihr das auch alles etwas bedeutet, doch nach Achilleas’ Tod war nichts mehr wie vorher. In den Tagen nach seiner Ermordung war etwas in ihr abgestorben.
Das Verhalten ihres Bruders hatte zusätzlich dafür gesorgt, dass es auch nie mehr anders werden würde. Er hatte an seinem eigenen Fleisch und Blut ein Exempel statuiert, hatte dafür gesorgt, dass ihr Junge in der Gerichtsmedizin in einem dunklen Sack in der Kälte lag, fern von den Menschen, die ihn liebten und von ihm Abschied nehmen wollten und mussten. Es war nicht nur eine gesellschaftliche oder gar kirchliche Verpflichtung, sondern wichtig für die Seele des Verstorbenen, dass man von ihm Abschied nahm. Der Tote musste ansehnlich hergerichtet im offenen Sarg liegen, der Deckel gehörte vor die Tür, und alle, die Abschied nehmen wollten, sollten an dem Sarg stehen und Zwiesprache mit dem Dahingeschiedenen halten dürfen. Dann brachte man den Sarg unter die Erde, um nach vierzig Tagen den ersten Gedenkgottesdienst abzuhalten. Weitere folgten traditionell nach drei, sechs und neun Monaten.
Sie strich sich über das schwarze Kleid und sah Michalis steinernen Blick auf sich ruhen. Er war ein harter und kalter Mann, doch gemeinsam hatten sie das Imperium zu dem gemacht, was es heute war, und sie beherrschten nicht nur in einem kleinen Radius, sondern in der Welt vieles und viele.
Dass er nicht davor haltmachen würde, sie so sehr zu verletzen, hatte sie niemals kommen sehen. Sie war die Wohltäterin, die dafür Sorge trug, dass die Menschen auf der Insel in ausgewogener Weise Ehrfurcht und Furcht vor den Serpantakis’ empfanden. Michalis führte eisern, war gnadenlos, und sein langer Arm reichte bis hoch hinauf in die politischen Ebenen vieler Nationen. Er verbreitete Angst und Schrecken unter seinen Feinden, und derer hatte er mittlerweile einige. Ohne seine albanischen Aufpasser ging er noch nicht einmal auf die Toilette.
Fast hätte ein verachtendes Zucken ihres Mundwinkels sie verraten, doch sie schaffte es gerade noch zu lächeln, sodass er sie nicht im Anschluss rügen konnte, dass sie ihren Gefühlen so unverhohlen Ausdruck verlieh. Sie würde jedoch nie wieder anders für ihn empfinden können. Ihr Sohn lag nicht in einem sonnigen Grab mit dem Panorama der sanft geschwungenen Hügelkette des Ida-Gebirges im Hintergrund, sondern sein geschundener Körper befand sich auf einem Armenfriedhof in Heraklion. Michalis hatte ihr alles verweigert, und es war nur der leitenden Pathologin zu verdanken gewesen, dass ihr Junge ein Begräbnis bekommen hatte. Sie war nicht dumm oder naiv, sie wusste, womit ihre Familie ihr Geld verdiente, und Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel machten ihr kein schlechtes Gewissen. Jeder und alles hatte seinen Preis, kannte man diesen, war es nicht mehr schwer, sich rein auf den geschäftlichen Part zu fokussieren. Sie hatte nie Probleme damit gehabt, den Unternehmenszweck so zu sehen.
Das schwarze Kleid passte ihr hervorragend, sie hatte es sich extra für diesen Anlass schneidern lassen, und auch zu Hause trug sie nur noch gedeckte Kleidung. Sie würde bis ans Ende ihres Lebens Trauer tragen, denn sie hatte ihr einziges Kind verloren. Das ließ sich nie mehr ändern, und sie würde den Schmerz auch niemals verkraften können.
Die Tage nach seinem Tod hatten sie an den Rand des Wahnsinns getrieben, und sie erinnerte sich noch immer genau daran, wie kurz sie davor gewesen war, über diese schmale Linie hinwegzutreten und sich dem alles verzehrenden Verlustgefühl hinzugeben. Fast zwei Wochen lang hatte sie sich weder gewaschen noch umgezogen. Sie hatte nichts mehr gespürt, und nichts war mehr wichtig gewesen. Achilleas war tot, ihr Achalaki würde sie nie mehr zum Lachen bringen oder sie wegen ihrer bizarren Aufmachung als braves Mitglied der Upperclass necken.
Der Schmerz begann aufs Neue, in ihren Eingeweiden zu rumoren. Sollte sie sich wünschen, dass er endlich nachließ oder auf das genaue Gegenteil hoffen?
5. Kapitel
Penelope fuhr sich durch das Haar, es flatterte ihr offen über den Rücken. Nur selten trug sie die lange dunkle Pracht so, denn im Job war es störend, wenn sich Haare auf den geöffneten Leibern der Toten verirrten. Doch für heute war sie fertig mit dem Zersägen von Brustkörben und Organen. Sie hatten durch die Hitze des Sommers einiges zu tun gehabt, denn die Temperaturen hatten dafür gesorgt, dass die Menschen unleidig wurden, und das führte oftmals zu Auseinandersetzungen. Manche davon endeten tödlich, und wenn es sich um eine Gewalttat handelte, bei der die Polizei antraben musste, dann war auch sie mit im Boot.
Sie hatte die Scheiben ihres Minis heruntergelassen und genoss den warmen Wind auf der Haut. Der August war geradezu unerträglich heiß gewesen. Sowie sie sich ächzend auf den Sitz hatte fallen lassen, hatte sie die Klimaanlage voll aufgedreht und nur ja keinem Hauch Außenluft die Chance gegeben, in das Wageninnere einzudringen. Sie wählte die Playlist, die Eleni ihr zusammengestellt hatte, und der Sound einer schmeichelnden französischen Frauenstimme vermischte sich mit dem Geruch von Sonne und Meer. Eine Zeile in dem Song hatte es ihr besonders angetan: Wir müssen nach Liebe suchen, um uns selbst vor Terror zu schützen. Zudem hatte der spröde Sprechgesang etwas Verzauberndes, und sie fühlte sich der erfolgreichen jungen Bloggerin und Influencerin, die durch die Welt reiste, dadurch irgendwie nah. Eleni hatte sich ihren Traum verwirklicht, von der Insel herunterzukommen, und setzte sich nun mutig und klug für Gleichberechtigung ein. Zudem verkauften sich ihre T-Shirts mit aussagekräftigen Sprüchen ebenfalls sehr gut. »Aber manchmal finden wir die große Liebe«, sang Carla Bruni, und Penelopes Herz öffnete sich bei dieser Zeile ganz besonders, sie konnte das Lächeln auf den Lippen der Sängerin bei diesen Worten geradezu hören.
Sie fuhr die Strecke am Meer entlang, hinaus aus der Stadt Richtung Ammoudara, um noch einen Zwischenstopp in ihrer Wohnung einzulegen, bevor sie sich mit Hyeronimos zum Schwimmen treffen würde. Gott sei Dank waren die Strände nicht mehr ganz so brechend voll wie im Juli und August, und man konnte tatsächlich seine Bahnen in Ruhe ziehen und im Anschluss sogar auf einer der Liegen der Blue hour entspannt beim Hereinziehen zuschauen.
Ihre Beziehung zu Eleni war von Höhen und Tiefen geprägt, und sie führten regelmäßig lange Skype-Gespräche, die nicht immer harmonisch endeten, auch wenn sich Penelope im Frühsommer vorgenommen hatte, das, was ihr das Leben darbot, zu genießen. Doch es gab immer wieder Situationen, in denen sie die Realität einholte, und ohne Hyeronimos wäre sie verdammt einsam gewesen. Ihre Freundin war tausende Kilometer entfernt, mehr als zwanzig Jahre jünger als sie und ein aufstrebender Stern in dieser verrückten Social-Media-Blase. Eleni hatte bereits einen Manager engagiert, der sich ganz und gar auf ihre Karriere konzentrierte. Penelope war das hin und wieder einfach zu viel, unter Umständen auch deshalb, weil sie es von ferne und mit aufkeimendem Argwohn betrachtete. Sie liebte die starke Frau, die kein Blatt vor den Mund nahm und vehement für Liebe, eine faire Gesellschaft und Gleichberechtigung eintrat. Feminism is for everyone, besagte eines ihrer Shirts, das Penelope besonders gern trug.
Sie hatte den Parkplatz erreicht, stürmte rasch nach oben, schlüpfte in Bikini und Strandkleid, packte ihre Badetasche und den Roman, den sie gerade zu lesen begonnen hatte. Sie würde es sich am Strand bequem machen, einen Frappé trinken und schmökernd auf ihren besten Freund warten, der sicher auch bald kam. Sie hatten ihre Unterlagen für den aktuellen Fall häuslicher Gewalt akribisch überprüft und alles so aufbereitet, dass es dem Staatsanwalt ein Leichtes sein würde, den eifersüchtigen Totschläger einzubuchten. Solche Fälle machten sie rasend, denn Gewalt gegen Frauen, Kinder oder Anderslebende war nicht nur ein unbegreiflicher Akt, sondern häufig auch ein komplexes Unterfangen für die Anklageseite. Emotionen und ihre Auswirkungen, wenn sie dysfunktional wurden, konnten so zerstörerisch wirken, und gleichzeitig musste man sich durch das Dickicht der Täteraussagen lavieren, ohne vom rechten Pfad abzukommen.
Kurze Zeit später saß sie wieder im Auto auf dem Weg zum Strand, an dem sie verabredet waren. Eine Kurznachricht pingte auf, Hyeronimos bat sie, nach Agia Pelagia zu fahren, da er dort noch etwas zu erledigen hatte.
Die Bucht war schön, war noch sonnenbeschienen, und sie mochte die Yaya ihres Freundes sehr, die er gewiss noch besuchen wollte. Er hatte ihr während ihres letzten großen Falles im Frühjahr verraten, dass er menschliche Persönlichkeitspräferenzen als farbige Aura um die Person herum sehen konnte. Seine Großmutter und Penelope einte ein kräftiges Lila, das er als besonders bezeichnete, und sie nahm das als Auszeichnung an.
Sie drehte die Musik lauter, summte die Melodie und dachte kurz an Stelios Mentakis. Der Chef der Mordkommission hatte sich vor einigen Monaten, inmitten eines komplizierten Falles, zurückgezogen, um einem drohenden Burn-out zu entgehen. Er meldete sich regelmäßig bei ihr, denn seit dem vergangenen Jahr waren sie Freunde geworden. Erst hatte sie das Gefühl gehabt, er sei an ihr interessiert, obwohl er gewiss aufgrund ihrer Akte Kenntnis davon gehabt haben musste, dass sie homosexuell war. Doch dann hatte sich herausgestellt, dass er nach seiner schlimmen Scheidung jemanden brauchte, mit dem er reden konnte. Ihre Freundschaft mit Stelios war anders geartet als die mit Hyeronimos. Major Mentakis war manchmal so korrekt und wohlerzogen, dass sie ihn provozieren musste, um den Kokon aufzubrechen, den er als Schutz um sich trug. Seine Frau hatte ihn verlassen, und er hatte dadurch nicht nur die Geliebte verloren, sondern auch seine engste Vertraute. Penelope wollte nicht mit ihm tauschen, und das, obwohl ihre eigene Familiensaga auch mehrere Bände umfasste und sie ihre Mutter mied wie der Teufel das Weihwasser. Sie war froh, dass man sich seine Freunde aussuchen konnte, wenn man schon mit Familie geschlagen war, aber die Lebenspartnerin zu verlieren, mit der man hatte alt werden wollen, war extrem desillusionierend.
Nachdenklich erreichte sie die Abfahrt nach Agia Pelagia. Sie nutzte die offizielle Straße, obwohl Hyeronimos ihr einen Schleichweg hinunter gezeigt hatte, und genoss den Blick auf die Bucht. Ihr Haar strich ihr flatternd über den Rücken, Carla Bruni sang ein Lied von »Keith und Anita«, und sie war wieder einmal vollkommen entzückt von der Weite, die sich vor ihren Augen auftat. Das war eben Kreta. Man konnte diese Insel nur lieben, egal, wie sehr man sie vielleicht manchmal hasste.
6. Kapitel
Christos Papadakis spürte die Wut in sich brodeln. So war es seit Monaten, und egal, was er tat, sie ging nicht weg. Koula, seine Frau, hatte ihm schon geraten, häufiger in die Kirche zu gehen und Gott um Unterstützung zu bitten, doch auch alle Gebete halfen nicht gegen das Gefühlschaos in seinem Inneren. Er konnte nicht anders, als wütend auf Stelios Mentakis zu sein. Er hatte ihm als Chef vertraut und immer sein Bestes gegeben, und dann hatte ihn der Mann quasi entehrt. Nichts gegen Maria, er mochte die gradlinige Frau wirklich gern, doch als seine Vorgesetzte? Das war doch eine Farce! Gegen Elonidas Spectros in dieser Rolle konnte er auch einiges anbringen, doch was Rang und fachliche Befähigung anging, sprach nichts gegen den Kerl, und er war in der Reihe derer, die Aufstiegschancen hatten, immer ein ernst zu nehmender Kollege gewesen.
Aber das machte ihn nicht zum besten Mann für die Leitung der Mordkommission, denn hier hatte Spectros keinerlei Erfahrungen vorzuweisen. Er kannte sich im Internet aus und durchschritt bereits sein ganzes Berufsleben lang nur virtuelle Welten. Doch das hier war die Realität. Das hier waren Tote, die vor ihnen lagen und deren Ableben sie mit aller Härte des Gesetzes zu ahnden hatten. Hier ging es nicht um irgendwelche Schmierereien auf Facebook. Er hätte auf Stelios’ Platz sitzen müssen – er und sonst niemand.
Christos öffnete die Schreibtischschublade und nahm das gläserne Fläschchen mit den Tabletten heraus, die ihm der Arzt gegen die Magenschmerzen verschrieben hatte. »Übertreiben Sie es nicht, und nehmen Sie die nur, wenn es gar nicht anders geht«, hatte der Arzt mit gewichtiger Miene gesagt. Jetzt ging es nicht anders, denn der zornig-hitzige Schmerz brannte in seinen Eingeweiden wie eine alles vernichtende Flamme. Man hatte ihn noch nie in seinem Leben so erniedrigt, selbst Galavakis als Kollegen an die Seite gestellt zu bekommen, war nicht so demütigend gewesen. Obwohl er noch nach Jahren damit haderte, vor allem weil er zu Stelios’ Zeiten das Gefühl gehabt hatte, dass sein Chef den Mann nicht nur regelmäßig gedeckt, sondern auch noch bevorzugt hatte, obwohl vollkommen klar war, dass der Deutsche an einer psychischen Störung litt. Er verstand bis heute noch nicht, wie man so jemanden ermitteln lassen konnte. Galavakis hatte Panikattacken und war an keinem Dreizehnten eines Monats einsatzfähig. Das war doch vollkommen lächerlich. Dass Stelios Galavakis bei seiner Interims-Nachbesetzung ebenso verschmäht hatte, war das Einzige an der ganzen Sache, was Christos guttat. Es zeigte, dass der Chef wohl doch erkannt hatte, dass sein Protegé nicht ganz so tadellos war, wie er nach außen hin tat.
Er spülte die bittere Tablette mit einem Schluck Wasser hinunter und hoffte, dass sie ihm diesmal den Schmerz nehmen würde. Er war noch nicht alt genug, um in Rente zu gehen. Und ein solcher Schritt käme sicher auch einer Art Bestätigung gleich, dass er nicht das Zeug dazu hatte, Karriere zu machen, denn jeder Mensch im gesamten Präsidium wusste genau, was Stelios’ Wahl bedeutete: Er, Christos, war nicht gut genug.
Er erhob sich von seinem Stuhl, um in der Küche seine Wasserflasche erneut zu füllen. Dann öffnete er die Tür und stieß beinahe mit Maria zusammen.
»Komm bitte in mein Büro, Christo«, sagte sie, und es hörte sich nicht wie eine Bitte an, sondern wie ein Befehl. Ihre Hände mit den langen roten Nägeln hielten eine Mappe, und Hoffnung stieg in ihm auf. Hatte sie vielleicht einen interessanten Fall für ihn?
»Ich hole mir noch rasch ein Wasser und bin dann sofort bei dir«, erwiderte er und ging schnellen Schrittes in die kleine Küche.
Wenige Minuten später klopfte er an die Tür ihres Büros, und der Anblick von Maria, wie sie hinter Mentakis’ großem Schreibtisch thronte, versetzte ihm einen erneuten Stich. Er setzte sich und fragte jovial: »Was kann ich für dich tun?«
»Spectros und ich teilen die Mitarbeitergespräche unter uns auf, und ich wollte dich persönlich darüber in Kenntnis setzen, dass du mit mir vorliebnehmen musst.« Sie beugte sich etwas vor und sah ihn durchdringend an.
Er hatte sie nie so gefürchtet wie viele andere, als sie noch der Zerberus im Vorzimmer gewesen war und ihren Chef vor allem und jedem beschützt hatte. Doch jetzt lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Nahm denn dieses Elend gar kein Ende? »Was heißt das im Klartext?«, erkundigte er sich.
»Rückschau, Vorschau, Ziele, Feedback«, ratterte sie herunter, und ihre raue Stimme gab dem Ganzen einen beinahe bedrohlichen Anstrich.
»Rückschau, Vorschau«, wiederholte er perplex.
»Ja, wir schauen uns deine Arbeit in den vergangenen Monaten an, dein soziales Interagieren, deine Teamfähigkeit und so weiter, und dann sprechen wir über deine Vorstellungen für die kommenden Monate.«
Der Ärger kroch wie glühende Lava durch seine Eingeweide und seine Speiseröhre hinauf. Er hatte Bedenken, gleich einen Strahl auf ihren Tisch zu erbrechen, so sehr regte ihn das kurze Gespräch auf. Vorsichtig holte er Luft, um sich zu vergewissern, dass er würde sprechen können. »Ist das dein Ernst, Maria, oder machst du Scherze mit mir?«
»Krieg dich wieder ein, Christo! Ich mache hier meinen Job, und solange Stelios nicht wieder zurück ist, gehört eben auch das dazu.«
Er erhob sich so ruckartig von seinem Stuhl, dass dieser umfiel. »Nein!« Dann drehte er sich um und verließ den Raum. Er schloss noch nicht einmal die Tür, aber Maria rief ihm nichts hinterher. Hatte er sie überrumpelt und ihr deutlich gemacht, dass er das alles nicht mit sich machen ließ? Hatte er gewonnen, oder war ihr Schweigen nur die Ruhe vor dem Sturm?
Er ließ die Tür zu seinem Büro so hart ins Schloss fallen, dass man es sicher im ganzen Gebäude hören konnte.
7. Kapitel
Eleni tupfte sich den Schweiß von der Stirn. Seitdem sie berühmt geworden war, hatte sie ein straffes Programm zu absolvieren. Dazu gehörte auch der Sport mit einem Personal Trainer. Sie stand schließlich regelmäßig vor der Kamera und war selbst das Model für ihre T-Shirt-Kollektion, daher musste sie gewisse Ansprüche erfüllen.
Manchmal war ihr das alles zu viel. Sie hatte versucht, es Penelope zu sagen, doch sie hatten sich wieder einmal in den Fallstricken ihrer komplizierten Beziehung verloren, und deshalb hatte sie dann vergessen, darüber zu sprechen. Dabei war es ihr mehr als wichtig, denn in der Welt des Scheins, in der sie sich nun bewegte, waren echte Beziehungen rar. Alles war auf Hochglanz poliert, und manchmal fragte sie sich, wie lange sie diesen ganzen Hokuspokus noch mitmachen konnte. Gleichzeitig brachte ihr steigender Bekanntheitsgrad genau jene Aufmerksamkeit mit sich, die sie für ihre weiterhin kritische Meinung benötigte. Wer würde schon Eleni aus einem Randbezirk von Chania zuhören? Es war die Menge an Followern, die dafür sorgte, dass ihre Stimme Gewicht hatte, und das konnte sie nicht leichtfertig wegwerfen. Doch sie spürte auch die aufkeimende Sorge davor, sich selbst zu verlieren, immer mehr zu einer Kunstfigur zu werden, die die Agentur aus ihr formte. So wie jetzt gerade, nach dem fünften Kilometer auf dem Laufband.
»Auf zum Endspurt«, feuerte der drahtige Trainer sie an und klatschte dabei in die Hände wie ein Dompteur.
Sie erhöhte die Geschwindigkeit und gab sich dem Gefühl hin, sich auszupowern. Vielleicht würde das helfen, die trüben Gedanken zu verscheuchen. Doch der ganze Zinnober hier ging ihr schon nach weniger als zwei Jahren unfassbar auf die Nerven. Dabei hatte sie sich das damals in ihrem Kinderzimmer toll vorgestellt. Es war nicht nur Heimweh, so wie sie es kurz vor dem letzten Weihnachtsfest empfunden hatte. Es war mehr und gleichzeitig weniger, denn sie fühlte sich irgendwie leer. So, als würden ihre Ansprüche an sich selbst, an die Botschaft, die sie transportieren wollte, durch den professionellen Aufbau ihrer Marke dazu führen, dass sie ausgehöhlt wurde und als schöne Hülle agierte. Gott, was war sie undankbar!
»So, jetzt machen wir mit dem Krafttraining weiter«, holte sie der Trainer aus ihren Gedanken.
Sie schaltete das Laufband ab, trabte langsam aus und wischte sich den Schweiß mit dem bereitliegenden Handtuch ab. Er reichte ihr die Flasche mit dem isotonischen Drink und triezte sie dann weiter mit den Gewichten. Sie hatte grundsätzlich nichts gegen Sport. Aber sie wollte nicht gleichzeitig ein Vorbild für Gleichberechtigung, Frauen- und Queerrechte sein und parallel mit einem unrealistischen Körperideal Druck auf junge Mädchen ausüben. Es war, als würde sie sich in einem Netz verfangen und mit jeder Bewegung weniger Freiraum haben. Sie musste mit Penelope darüber sprechen und sich nicht wieder auf Diskussionen über Themen wie »Du bist jung, und ich bin zu alt, du eroberst die Welt, und ich schnipple auf einer Mittelmeerinsel an Toten herum« einlassen, die einfach zu nichts führten. Sie wusste genau, dass sie eine tiefe Liebe für Penelope empfand, und trotzdem wollte sie … Ja, was wollte sie eigentlich? Sie musste sich langsam darüber klar werden, das wurde ihr immer deutlicher bewusst. Ungestüm presste sie das Gewicht nach oben, ließ die Stangen einrasten und sagte: »Nein!«
Dann stand sie auf und verließ unter dem verblüfften Blick des Mannes den schicken Trainingsraum.
8. Kapitel
Hyeronimos fuhr die Straße zum Dorf hinunter und war guter Dinge. Er freute sich auf das Meer und einen netten Abend mit Penelope. Er hatte Manolis schon länger versprochen, mal wieder zum Essen zu kommen, und heute schien es zu passen, denn seine Yaya war bei einer Nachbarin zum Geburtstag eingeladen, und somit würde sie nichts kochen. Manchmal saß er einfach gern bei seinem Freund, mit dem Blick auf das Meer, das sich mit der aufkommenden Dunkelheit in ein geheimnisvolles Glitzern hüllte.
Er lenkte den Wagen an die Schranke, die das Dorf vor wahnwitzigen Parkern schützte, und winkte dem Wärter zu, der gemütlich zu ihm kam.
»Hyeronimo, wie geht es dir?«, fragte er.
Man kannte ihn hier einfach, er hatte schon als Kind alle Ferien bei seiner Yaya verbracht und war daher kein Fremder für die Dorfbewohner.
»Gut, gut«, antwortete er und schickte die gleiche Frage zurück an sein Gegenüber. »Und wie geht es dir, Gianni?«
Der Befragte bestätigte, dass es ihm ebenfalls gut gehe, und öffnete die Schranke für ihn, winkte ihm freundlich zu und wandte sich dann harsch an das Auto hinter ihm. Hyeronimos konnte noch hören, dass er den Fahrer anwies, auf dem wenige Meter entfernten großen Parkplatz zu parken. Er lächelte kurz und stellte seinen Wagen vor dem Aura Shop ab.
Maria Xylouri erkannte ihn sofort und kam lächelnd aus ihrem Laden. Ein großer heller Hund folgte ihr, und mehrere Katzen rekelten sich vor den Schaufenstern, eine sogar darin. Sie wirkte wie eine kunstvolle Dekoration inmitten der hübsch gekleideten Schaufensterpuppen.
»Hallo, Maria!«, grüßte er und beugte sich hinab zu dem Hund, der vertrauensvoll zu ihm kam. »Hallo, Nefeli!«
»Hyeronimo, wie schön, dich zu sehen. Willst du schwimmen gehen?«
»Ja, ich will gleich ins Wasser, aber vorher möchte ich noch mit dir über die arme Katze sprechen.«
Ihr Gesicht verzerrte sich. Er erkannte eine Mischung aus Schmerz und Ärger in ihren Zügen. Sie zog ihn in den Laden, verschwand hinter einer Tür und kam kurz darauf mit einer Box zurück, die sie sodann vorsichtig öffnete, um ihm das von Menschenhand verstümmelte winzige Tier zu zeigen.
»So etwas macht nur ein Monster, Hyeronimo«, sagte sie aufgebracht.
Er konnte nur nicken. Er war kein Tierliebhaber, doch das, was er hier sah, berührte sein Herz zutiefst. »Wir nehmen deinen Hinweis sehr ernst, Maria«, erklärte er. Er sah ihr zu, wie sie das verletzte Tier, das über und über in eine dicke Schicht Salbe eingehüllt war, mit säuselnder Stimme beruhigte.
Hyeronimos und Maria unterhielten sich noch eine Zeit lang über das Thema Tierschutz und ihre Vermutungen, dass es sich nicht um ein Versehen gehandelt habe, sondern um einen gezielten Akt der Gewalt gegen ein hilfloses Katzenkind. Dann verabschiedete er sich von ihr.
»Wir bleiben in Kontakt über alles, was dir noch ein- und auffällt. Du kannst mich gern jederzeit anrufen und ich leite es dann weiter.« Er war stolz auf sich, denn er klang nicht nur einfühlsam, sondern er fühlte sich auch so. Er war kein grober Klotz, es fiel ihm aber oft sehr schwer, empathisch zu sein. Marias Aura begann, grün zu leuchten, und zeigte ihm, wie wichtig ihr Harmonie und Geborgenheit waren – Herzlichkeit und Mitgefühl waren ganz normale Teile ihrer Persönlichkeit. Seine Fähigkeit, Auren zu sehen, half ihm dabei, den Menschen ein wenig passgenauer zu begegnen, nahm ihm aber nicht ab, sich auch verbal ausdrücken zu müssen.
Er holte seine Tasche vom Rücksitz, ließ den Wagen vor dem Laden stehen und schlenderte zum Strand. Er genoss den Blick auf die Insel Dia, die der Sage nach ein von Zeus versteinertes Meeresungeheuer darstellte. Etwas näher zur Bucht formierte sich ein Felsen im Wasser, der wie ein schlafender Drache aussah. Er liebte diesen Ort sehr. Der Strand war noch belebt, aber nicht überfüllt. Dann sah er Penelope auf einer der gemütlichen neuen Holzliegen nahe dem Sokrates. Sie war in ein Buch vertieft, und er war gespannt, was sie da wohl las. Seine Leidenschaft für seichte Liebesromane mit Happy End behielt er noch immer für sich. Nicht, dass er sich dafür schämte, aber er hatte sich schon so sehr geöffnet, dass es ihm vollkommen in Ordnung schien, ein oder zwei kleine Geheimnisse zu verschweigen. Schließlich wusste Penelope seit dem Frühsommer von seiner Beziehung mit der verheirateten Politikergattin Kassia, die in Athen lebte. Das hatte er ihr nicht ganz freiwillig erzählt, doch er wollte nicht wieder über die hässliche Geschichte nachdenken, die ihn in diese Art von Zugzwang gebracht hatte. Er schlüpfte rasch aus den weichen beigen Mokassins und trat auf den warmen Sand hinaus. Seine Zehen sanken ein, und er fühlte sich blitzschnell wieder wie der kleine Junge, der seine Sommer an diesem Strand verlebt hatte.
»Da bist du ja.« Penelope freute sich und lächelte zu ihm hoch. »Ich habe uns die Plätze gesichert, damit Manolis uns schon hier versorgen kann. Passt das für dich?«
»Sehr weise vorausgedacht«, lobte er, »so können wir nach dem Schwimmen ein Glas Wein trinken.« Er streifte seine Hose ab, faltete sie ordentlich und hielt es mit seinem Hemd genauso, dann wickelte er sich in sein Handtuch, um die Boxershorts gegen die Badehose zu tauschen. Im Anschluss verstaute er Handy und Brieftasche in dem Strandtresor, den er aus seiner Tasche zog. »Gibst du mir deine Sachen?«, forderte er seine Freundin auf. Dann packte er ihr Handy und einen kleinen Geldbeutel mit in den Tresor hinein, kettete das mit einem Zahlenschloss gesicherte Teil an den Sonnenschirm und ging die wenigen Schritte zum Wasser.
Sie folgte ihm, und gemeinsam schwammen sie durch die Bucht an den schaukelnden Booten vorbei hinaus bis zur Begrenzungsboje. Solange die Touristen mit den gemieteten Motorbooten herumschipperten, war es gesünder, nicht zu weit hinauszuschwimmen, denn die Sorge, von einem solchen Boot übersehen zu werden, war tatsächlich nicht unberechtigt.
Anfangs schwiegen sie und gaben sich der belebenden Wirkung des klaren und angenehm temperierten Wassers hin, dann ergriff Penelope das Wort. »Ich weiß, dass du nicht so gern über Stelios sprichst, aber ich mache mir gerade so meine Gedanken und vielleicht auch ein paar Sorgen.«
Er schwamm in regelmäßigen Zügen weiter und antwortete gelassen: »Ich habe das mittlerweile verarbeitet, Pen. Im Unterschied zu anderen Leuten …!«
»Ja, ich höre so einiges, Christos steckt das nicht so beherrscht weg.«
»Stelios hat seine Entscheidung getroffen, und es ist eine Entscheidung gegen mich, die ich rational auch nachvollziehen kann. Es ist auch eine Entscheidung für Maria und Spectros, und die beiden machen ihre Arbeit wirklich gut. Spectros ist ein professioneller Mann.« Er meinte, was er sagte. Er hatte seinen Frieden mit der Sache geschlossen, Kassia hatte ihm zugehört, als er noch betroffen und frustriert gewesen war, hatte aber auch die richtigen Fragen gestellt und die passenden Worte gefunden, um sein verwundetes Ego zu besänftigen.
»Christos meutert, und ich mache mir Sorgen um ihn!« Sie hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich mit seinem Kollegen verstand.
»Was befürchtest du?« Er verlangsamte seine Armbewegungen und schaute sie an.
»Keine Ahnung. Es ist nur so ein Gefühl. Da ist so viel Wut in ihm, und ich finde, er sieht auch nicht mehr gesund aus. Eben irgendwie, als würde ihn etwas von innen heraus verzehren.«
Er konnte die Sorge in ihrer Stimme nun deutlich hören. Er wollte das Ganze mit einem Scherz entkräften, denn er war doch hier, um sich zu entspannen, und nicht, um die Probleme seines ungeliebten Kollegen zu lösen, doch ihm fiel partout nichts Passendes ein. Und so blieb er stumm.
»Vielleicht täuscht mich meine Intuition auch«, fuhr sie fort, »und ich sehe Dinge, die nicht da sind, oder übertreibe, aber irgendwas ist nicht in Ordnung.«
»Ich verstehe dich gut«, sagte er entgegenkommend, »aber Christos ist stur, unnachsichtig mit anderen Menschen, und er ist häufig unbeherrscht.«
»Menschen können sich doch ändern«, sagte sie leise, »wenn ich daran nicht mehr glauben kann, dann fühle ich mich auf diesem Planeten nicht mehr wohl. Ebenso wie ich daran glauben möchte, dass in jedem Menschen ein guter Kern steckt!«
»Das möchte ich doch auch, aber unser Job zeigt uns immer wieder, wie schnell das Pendel in die andere Richtung ausschlagen kann. Bitte sei mir nicht böse, Penelope, aber das hier …« Er drehte den Kopf und zeigte mit einer Hand auf die Weite, die vor ihnen lag. »… machen wir doch, um uns zu entspannen, die Sorgen und alles, was uns belastet, quasi abzuwaschen. Können wir daher bitte, bitte das Thema wechseln?« Sie wurde ein wenig langsamer. Er hatte Bedenken, sie mit seinem Wunsch enttäuscht zu haben, doch dann schlug ihre Stimmung um.
»Ganz wie du willst, Galavaki«, sagte sie, tauchte unter ihm hindurch und bespritzte ihn mit dem salzigen Nass.
»Wenn das so ist.« Er grinste und startete eine Wasserschlacht. »Das kann ich auch!«
Sie waren weit genug draußen, um sich frei und albern zu benehmen, den Ermittler und die Pathologin abzustreifen und einfach nur zwei Freunde zu sein, die sich amüsierten. Doch tief in seinem Inneren spürte er den Widerhall ihrer Worte und wusste, dass das Thema noch nicht beendet war.
9. Kapitel
Er ging zu Bett, sowie die Sonne unterging, nicht jeden Abend, aber doch häufig. Manchmal saß er noch auf der Bank und betrachtete die unendlichen Lichter im Himmel, fragte sich, wie weit sie fort waren, ob sie noch lebten oder ob er lediglich ihr letztes Strahlen wahrnehmen konnte.
So hatte er sich zu Beginn gefühlt – als wäre er schon erloschen und das, was ihn aufrecht hielt, würde das letzte Flackern seines Lebenslichtes sein. Doch dann war er sich langsam wieder nähergekommen, hatte gelernt, seinen Herzschlag zu spüren und auf seinen Atem zu achten. Erstaunt war ihm bewusst geworden, dass die Luft beim Einatmen etwas kühler war als beim Ausatmen. Es hatte einige Wochen gedauert, bis er sich in seinem Spiegelbild wiedergefunden hatte, und die Kargheit seines momentanen Lebens hatte ihm dabei geholfen. Er lenkte sich nicht mehr dauernd ab, auch das war anfangs ungewohnt gewesen. Das Bett war ihm erst zu weich und dann zu hart erschienen. Das Essen zu einfach und manchmal dann doch zu üppig. Er war sich selbst unbequem gewesen. Nun konnte er mit Fug und Recht sagen, dass er sich mit sich selbst angefreundet hatte – vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Er hatte vollkommen vergessen, wie er in seinen jungen Jahren empfunden hatte und ob er je wirklich glücklich gewesen war oder einfach nur äußeren Bedingungen und Ansprüchen genügt hatte. Er hatte sich für einen Beruf entschieden und sich seinen Aufgaben gewidmet, hatte sich für eine Frau entschieden und sich seinen Aufgaben gewidmet. So, als wäre er einer Programmierung gefolgt und nicht seinem Herzen. Dabei hatte man ihm genau das sehr oft nachgesagt: dass er das Herz am rechten Fleck habe! Doch er hatte es nicht mehr fühlen können, oder es war tatsächlich nie dort gewesen, und er hatte nach etwas gesucht, was ihm verdeutlichte, dass er lebte. Er wusste, dass er darüber hätte reden müssen. Doch er hatte diese Erkenntnis immer zur Seite geschoben, alles heruntergespielt und sich befohlen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern sich zu konzentrieren.
Nun lag er hier. Allein. Es war, als wäre er in die Stille der herannahenden Nacht eingehüllt wie in eine Decke. Anfangs war sie kratzig gewesen, und er hatte sie abstreifen wollen, doch dann, eines Abends, hatte sie sich plötzlich anschmiegsam und so samtig angefühlt, dass er sich nicht vorstellen konnte, je wieder ohne sie einzuschlafen und vor allem durchzuschlafen. Denn auch das gelang ihm nun. Es war ihm, als hätte er zuvor nie im Leben auch nur eine Nacht geschlafen, ohne durch grausame Träume geweckt worden zu sein und dann ruminierend wach zu liegen.
Seine Lider wurden schwer, und er glitt in den tiefen, erholsamen Schlaf, den er hier schätzen gelernt hatte.
10. Kapitel
Maria legte ihr Kinn auf ihre gefalteten Hände und starrte in den Raum. Sie hatte sich den Job auf dieser Seite des Schreibtischs komplex und herausfordernd vorgestellt, aber auf Dinge wie Mitarbeiterjahresgespräche hätte sie wirklich gern verzichtet.
»Ich habe ja nur ein kleines Team, und meine Jungs sind etwas anders als die anderen Kinder«, setzte Elonidas Spectros erklärend an, der ihr schräg gegenübersaß. Er hatte nie infrage gestellt, dass sie hinter dem Schreibtisch saß und er davor. Er war einer von den Guten, und sie arbeiteten auf Augenhöhe miteinander.
»Daher laufen die Gespräche meist recht unkompliziert ab«, fuhr er fort, »aber …«
»Aber hier ist es etwas anders«, griff Maria den Gesprächsfaden auf, »und deshalb habe ich diesen kratzbürstigen Christos an der Backe und du Hyeronimos.« Sie zog die Flasche mit dem selbst gebrannten Tsikoudia ihres Onkels über den Tisch und goss sich zwei Finger breit der klaren Flüssigkeit ein. Spectros nickte ihr zu und bekam auch einen Schluck. Man konnte das Zeug nur als Medizin ansehen, denn es war so beißend und ruppig, dass es wie Sandpapier die Kehle aufraute. Oft benutzte sie den Trank als Mutprobe für ihr Gegenüber oder um in herausfordernden Situationen den Kopf wieder klar zu bekommen. Man schüttete es in einem Schluck hinunter, die Mundschleimhaut fing leicht an zu brennen, die Kehle etwas stärker, dann schüttelte man sich und war wieder wach. Sie tranken in stillem Einvernehmen.
»Wann kommt er wieder?«, erkundigte sich Elonidas. »Ich war nie scharf auf diese Position und würde gern in meinen beschaulichen Alltag zurückkehren!«
»Mir geht es ähnlich, aber ein paar Lorbeeren möchte ich schon noch einsacken, nach dem Desaster, mit dem wir beide hier unseren Einstieg hatten.« Sie spielte auf den Fall im Frühsommer an.
Er nickte bestätigend, sagte dann aber: »Dafür können wir uns auch nichts kaufen.«
»Aber eine positive Bilanz wirft ein gutes Bild auf unsere Abteilungen, und ich möchte gern weiterhin erhobenen Hauptes durch die Vordertür kommen und gehen und nicht wie ein Feigling durch den Seiteneingang hereinschleichen müssen.«
Er nickte wieder. »Das wird schon nicht passieren. Unsere bisherige Bilanz ist doch ganz in Ordnung. Hat Hyeronimos ein gutes Gefühl bei seinem aktuellen Fall?«
»Zumindest hat er mir diesen Eindruck vermittelt. Penelope hat alte Brüche und Prellungen am Körper der Frau gefunden, die auf eine Serie an Misshandlungen schließen lassen. Er hat die Tatwaffe gefunden, und ganz offensichtlich hat sie sich damit nicht selbst den Schädel eingeschlagen. Die Fingerabdrücke des Täters sind drauf, und auch wenn der meint, dass er in seinem Haus doch anfassen dürfe, was er wolle, so befinden sich eben nur seine und die des Opfers darauf. Diese an den Haaren herbeigezogene Geschichte vom Einbrecher mit Handschuhen ist lächerlich … Dr. Demostaki sagt deutlich, dass das zu Verwischungen auf dem Objekt hätte führen müssen, die aber nicht vorhanden sind. Unsere Leute haben gute Arbeit geleistet, und wenn der Staatsanwalt keinen Mist baut, dann landet der Typ für die nächsten fünfzehn Jahre hinter Gittern!« Sie klopfte bestätigend mit ihren knalligen Nägeln auf den Tisch.
»Hört sich gut an.«
»Ja. Jetzt müssen wir nur noch die Gespräche meistern. Ich dachte, Christos springt mir mit dem nackten Hintern ins Gesicht, als ich ihm sagte, was ich besprechen möchte.«
»Wann kommt Stelios wieder?«, wiederholte Elonidas seine Frage.
»Ich weiß es nicht. Er meldet sich nicht bei mir, und wir sind nach wie vor Bis auf Weiteres-Interimschefs. Bereust du es?«, hakte sie nach.
Er zuckte mit den Schultern, schob das Glas zu ihr hinüber und sagte dann: »Ich bereue es nicht. Mein Respekt für Stelios wächst nur noch mehr, und wenn er morgen vor der Tür steht, freue ich mich von Herzen und trete zufrieden wieder zurück.«
»So geht es mir auch!« Sie goss die Gläser erneut voll und spielte gedankenverloren mit dem Flaschendeckel, bevor sie die Flasche wieder zuschraubte. »Wollen wir tauschen?«, feuerte sie die Frage ab, die ihr schon die ganze Zeit auf der Zunge lag, obwohl sie genau wusste, wie die Antwort lautete.
»So betrunken bin ich noch nicht, Maria, und werde ich auch nicht sein. Daher lautet die Antwort: Nein!«
»Einen Versuch war’s wert«, sagte sie, und sie grinsten einander verstehend an.
»Wir werden das Kind schon schaukeln!« Spectros schaute zu ihr, und dann begannen sie beide aus vollem Hals zu lachen.
Und das Lachen hatte eine befreiende Wirkung.
11. Kapitel
Er hatte die kleine Siedlung erreicht und musste sich nun dringend ausruhen. Obwohl er wirklich gut zu Fuß war, war es anstrengend gewesen, so weit zu laufen. Doch es gab eben Situationen, die dafür sorgten, dass man mehr leisten konnte als gedacht oder erwartet.
Er hatte stets viel von sich gefordert, und als ihm dann alles entglitten war, hatte er begonnen zu hassen. Er hatte schon immer vieles verabscheut, aber eben nach seinen eigenen Regeln und Wahrnehmungen, und diese waren nicht zwingend mit den gesellschaftlichen Erwartungen kompatibel. Das hatte er verstanden, aber letztlich war es nicht er gewesen, der dafür gesorgt hatte, dass sein Leben zu einem Trümmerhaufen geworden war. Ausnahmsweise war es nicht seine eigene Schuld gewesen. Kein Argument, keine Beweise hatten ausgereicht – wer auch immer diese anführte oder herbeibrachte – oder genügend Kraft, um seine Schuld zu belegen. Er konnte vor Gott knien und schwören, denn nicht er war der Böse in dieser Beziehung gewesen.
Er hatte sie geliebt. Auf seine Weise und wahrscheinlich viel zu sehr, um dann all das zu ertragen, was sie ihm angetan hatte. Das Ende hatte er so nicht gewollt, und deshalb war es nicht seine Schuld. Doch man hatte ihn verurteilt, mit dem Finger auf ihn gezeigt und ihm damit letztlich sogar seine Würde geraubt.
Er konzentrierte sich darauf zu atmen. Er musste sich ausruhen, musste schlafen. Denn war er müde, würde er Fehler machen, und er konnte sich keine Fehler mehr erlauben. Heute noch weniger als früher. Er hatte sich alles zurechtgelegt und jeden Schritt genau durchdacht, nachdem er die Information durch die Nachrichten erhalten hatte. Er hatte in vielen schlaflosen Nächten darüber nachgegrübelt, was zu tun war, und dabei unterschiedlichste Szenarien ins Auge gefasst.
Doch wer zu viele Pläne machte, über den lachten sich die Götter schlicht ins Fäustchen. Irgendwann war ihm das aufgegangen, und er hatte aufgehört etwas auszutüfteln. Seine Tage und Nächte waren in ödem Gleichklang vergangen, und nur das Lesen hatte ihn letztlich am Leben erhalten, hatte seine Seele genährt und vielleicht sogar dafür gesorgt, dass er ein anderer Mensch geworden war. Er wagte nicht zu sagen, ob besser oder schlechter, denn er hatte sich den größten Teil seines Lebens nicht für schlecht gehalten.
Die Nacht war still, und nur das Zirpen einiger Zikaden war zu hören, die die Dunkelheit mit ihrem Gesang füllten. Morgen früh würde er seinen Weg fortsetzen, doch jetzt verlangte sein müder Körper nach Ruhe. Obwohl er körperliche Anstrengungen gewohnt war, hatte ihn der Tag Kraft gekostet. Er ruckelte auf der harten Unterlage ein wenig hin und her, um eine einigermaßen bequeme Position zu finden.
Die Müdigkeit legte sich über ihn, seine Lider schlossen sich.
Dann glitt sein Unterbewusstsein ab in die Welt der Träume, und er sah das Gesicht, nach dem er suchte, klar und deutlich vor sich.
12. Kapitel
Penelope drehte ihr Weinglas gedankenverloren in der Hand. Das Essen war wirklich lecker gewesen. Sie hatten sich verschiedene Gerichte bestellt und sie ganz klassisch geteilt, indem die Platten und Teller in der Mitte des Tisches gestanden und sich jeder genommen hatte, was er mochte: frittierten Käse, cremige Fava mit ein paar karamellisierten Zwiebeln darauf, gegrillten Oktopus, der so zart gewesen war, das er auf der Zunge zerschmolz; eine Schüssel mit kretischem Salat, in der sich Tomaten und Gurken in großen Stücken befunden hatten, dazu feine Oliven, etwas Dakosbrot, Feta und alles gekrönt mit leckerem Olivenöl. Frittierte Tintenfischringe, außen köstlich knusprig und innen butterweich, kross gebratene Leberstücke mit Rosmarin verfeinert und eine Portion Pites mit Gemüsefüllung. Manolis hatte ihnen, wie in den meisten Tavernen üblich, einen Nachtisch und Obst gebracht, ohne dass sie es bestellt gehabt hätten. Es war ein Geschenk des Hauses an die Gäste. Gekochte Sahne mit Schokoladensoße, Eis, ein saftiger Schokokuchen und frische Trauben standen nun zwischen ihnen sowie ein Fläschchen mit Limoncello und eines mit Tsikoudia. Der Inhaber hatte eine Zeit lang bei ihnen am Tisch gesessen und über dies und das geplaudert. Hyeronimos und er hatten sich über Bekannte und Neuigkeiten aus dem Dorfleben ausgetauscht.
Nun waren sie wieder allein. Sie hatten nach dem Schwimmen das Thema Stelios nicht erneut aufgegriffen, doch nun würde sie ihn nicht so einfach davonkommen lassen.
»Stelios«, sagte sie daher mit hochgezogenen Augenbrauen.
Hyeronimos seufzte kellertief. »Wenn es unbedingt sein muss. Ich hatte das gerade effektiv verdrängt.«
»Ich habe lange nichts von ihm gehört und weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.« Sie nahm einen Schluck aus dem Glas in ihren Händen. Der Wein war fruchtig und kühl.
»Warum ist es gerade jetzt ein so wichtiges Thema für dich?«, fragte er. »Du redest doch sonst nur sehr selten und äußerst zurückhaltend über das, wovon du Kenntnis hast, und du weißt auch, dass ich das wirklich respektiere.«
»Ich kann dir nicht genau erklären, warum es so ist. Ich mache mir oft Sorgen um ihn. Er war immer eine Art Fels in der Brandung. Hat die Geschicke des Dezernats umsichtig geleitet und immer die richtigen Worte gefunden. Dann haut es ihn plötzlich so aus der Bahn.«
»Die Scheidung hat ihm zugesetzt, und ich glaube, die Reaktion darauf in seinem Freundeskreis auch«, wandte er ein.
»Ich habe auch keinen Spaß mit meinem Umfeld – also speziell mit meiner Familie.« Sie spielte auf die Situation mit ihrer Mutter an, die sie für den Tod der Großmutter verantwortlich machte, weil sie lieber Tote »massakrierte«, anstatt in einer schicken Privatpraxis zu residieren. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass eine lesbische Tochter nichts war, womit ihre Mutter sich schmücken würde.
»Die Vergangenheit meiner Familie ist auch nichts, womit ich gerne in der Welt hausieren gehe«, erwiderte er.
»Ist das jetzt gemein, wenn wir sein ganz persönliches Befinden und seine Lebenssituation nach unseren Parametern bewerten?« Sie nahm grüblerisch noch einen Schluck Wein und schaute Hyeronimos direkt in die Augen. Diese strahlend blauen Augen, die so gar nicht in sein griechisches Gesicht passten und die viele Menschen wirklich irritierten. Er war ein attraktiver Endvierziger mit dunklem vollem Haar und einem gepflegten Vollbart. Mittlerweile hatte er auch seinen kleinen Bauchansatz wieder in den Griff bekommen. Seine Augen konnten einen durchbohren und gaben einem das Gefühl, bis tief in die Seele durchschaut zu werden. Seitdem sie wusste, dass er Auren sehen konnte, schien ihr dieser Gedanke vollkommen schlüssig, denn sie setzte die Fähigkeit mit dem In-die-Seele-Blicken gleich.
»Puh, was ist gemein? Es ist wahrscheinlich nicht fair, denn jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich persönlich weiß zu wenig über Stelios’ Privatleben und seinen Weg vom einfachen Polizisten zum Leiter der Mordkommission.« Er hob entschuldigend die Schultern.
»Er hat eine ganze Menge erlebt, und da waren auch harte Fälle dabei, die ihn bis heute nicht loslassen.«
»Er hat das Recht dazu, sich eine Auszeit zu nehmen«, sagte Hyeronimos in einem Ton, als wollte er das Thema abschließen.
Doch sie war noch nicht bereit dazu. »Ich kann das irgendwie gerade nicht wegdrücken. Vielleicht bin ich durch all die unfruchtbaren Gespräche mit Eleni überempfindlich geworden, aber die Gesamtsituation bekümmert mich: Christos mit seiner brodelnden Aggression, von der er glaubt, er würde sie gut verbergen, die Funkstille bei Stelios … Ich weiß nicht, Hyeronimo.« Sie hob erneut den Blick.
»Was willst du damit andeuten?« Er hörte sich ein wenig alarmiert an.
»Ich glaube nicht, dass Christos ausflippt, aber wir haben schon sonderbare Dinge erlebt«, meinte sie.
Hyeronimos schüttelte sich leicht, als wollte er den Gedanken an diese Erlebnisse loswerden. »Ich kann den Kerl nicht ausstehen, Pen, das weißt du ganz genau, aber das? Das ist so weit von allem entfernt, was für mich vorstellbar ist. Mal eine ganz blöde Frage: Wenn du dich so sorgst, warum rufst du Stelios nicht an?«
»Er macht das Handy nur an, wenn er telefonieren will. Sonst ist es immer aus. Also ist es sinnlos, ihn anzurufen. Wahrscheinlich hat er einfach nichts zu erzählen oder will nicht reden«, beruhigte sie sich selbst. Sie nahm die kleine Flasche mit dem Tsikoudia und schenkte ihnen etwas ein.
Prostend erhoben sie die Gläser und tranken schweigend.