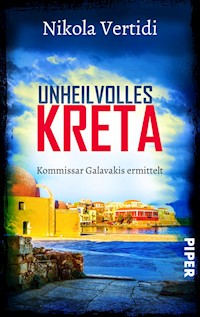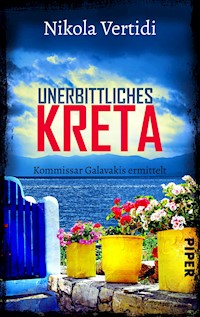
6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der verschrobene Kommissar Hyeronimos Galavakis ermittelt in seinem ersten Fall mit deutscher Gründlichkeit und kretischem »Siga-Siga«. Ein Griechenland-Krimi zum Wegträumen und eine Reise zu den schönsten Stränden Kretas sowie in die urigsten kretischen Tavernen »Wenn alles in ihm drunter und drüber ging, fokussierte er sich auf das Meer. Er hatte seine Wohnung vollkommen danach ausgerichtet. Seine Fenster und die großzügige Terrasse über den Dächern Heraklions gingen zum Meer. Er konnte es sehen und in seine Weite eintauchen.« In der berühmten Samariaschlucht werden nach einem Unwetter menschliche Knochen gefunden. Wer ist hier wie gestorben und warum wurde niemand als vermisst gemeldet? Was hat die junge Bloggerin Eleni, die die Leichenteile gefunden hat, damit zu tun? Kommissar Hyeronimos Galavakis deckt in seinem ersten Fall ein Verbrechen von erschreckender Brutalität auf, dessen Wurzeln bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Denn wer seine Landsleute verraten hatte, wurde nach dem Krieg bestraft und seiner Familie verzeiht niemand wirklich, auch wenn oberflächlich alles in Ordnung zu sein scheint ... »Neben der Tatsche, dass mir der Krimi richtig gut gefallen hat, war das auch ein richtig schöner Kurzurlaub auf der wunderschönen Insel Kreta.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Unerbittliches Kreta« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Julia Feldbaum
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
–
Prolog
1. Teil
Der Torso
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
2. Teil
Der Kopf
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
3. Teil
Herz und Verstand
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Epilog
Köstliche griechische Rezepte
Fein-würzige Dakos
In Tomaten pochierte Eier
Galaktobureko
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Während des Zweiten Weltkrieges wehrten sich die Kreter stolz und mutig gegen ihre deutschen Besatzer. Sie gewährten Alliierten Schutz in ihren Häusern, versorgten sie mit Nahrungsmitteln oder halfen ihnen auch dabei, durch das libysche Meer zu fliehen.
Egal, ob Mann, Frau oder Kind, in jedem Dorf gab es Rebellen – die Andarten –, die für die Freiheit ihrer Insel kämpften und bereit waren, alles dafür zu riskieren oder gar zu verlieren. Auch ihr Leben.
Die deutschen Besatzer hatten mit einer solchen Gegenwehr nicht gerechnet und versuchten mit unnachgiebiger Härte, das Rebellentum auszumerzen: Dörfer wurden niedergebrannt und mit Granaten dem Erdboden gleichgemacht. Männer, Frauen und Kinder wurden exekutiert. Kaltblütige Gräueltaten, die dem Haager Abkommen von 1907 komplett widersprachen, fanden als Vergeltungsaktionen gegen Alte und Junge statt, so auch die Zerstörung des Dorfes Anogia am Rande des Ida-Gebirges. Hier wurde ein besonderes Exempel statuiert, dem aber noch viele weitere folgen sollten. Kaum eine Familie auf Kreta hat keine Verluste aus dieser Zeit zu beweinen.
Befehl vom 13. August 1944
»Da die Stadt Anogia ein Zentrum der englischen Spionagetätigkeit auf Kreta ist, da die Einwohner Anogias den Sabotageakt von Damasta ausgeführt haben, da die Partisanen verschiedener Widerstandsgruppen in Anogia Schutz und Unterschlupf finden, und da die Entführer Generals Kreipes ihren Weg über Anogia genommen haben, wobei sie Anogia als Stützpunkt bei der Verbringung nutzten, befehlen wir, den Ort dem Erdboden gleichzumachen und jeden männlichen Einwohner Anogias hinzurichten, der innerhalb des Dorfes oder in seinem Umkreis in einer Entfernung bis zu einem Kilometer angetroffen wird.«
Chania, den 13. August 1944, der Kommandant der Festung Kreta Friedrich-Wilhelm Müller
Ein Gedenkstein in Anogia erinnert an dieses Ereignis. Dort heißt es:
Hier wurde am 13. August 1944 kaltblütig hingerichtet:
Stefanis Xylouris, 8 Jahre alt.
Ein unbewaffnetes Kind wurde Opfer des deutschen Besatzers,
und es vergingen sechs Tage und Nächte, bevor er begraben werden konnte.
Als das Dorf brannte, war es ein schwarzer Tag,
und den Vater von Stefanis traf die erste Kugel.
Dimos Anogia 2006
Prolog
Die Katzen zerrten an den Knochen, diese rochen nicht mehr nach Fleisch oder Leben, und doch hatten sie diesen ursprünglich menschlichen Duft. Sie waren eingeklemmt in der felsigen Spalte, bewegungslos dazu verurteilt zu verrotten. Gut versteckt und für immer vor den Augen der Menschheit verborgen.
Doch nichts ist für die Ewigkeit, und so werden ein paar kleine Katzen und der kalte Regen des Schicksals willige Helfer, und die Bewegung die durch diese vielleicht sogar nur spielerische Neugier entsteht, ist der Beginn eines unaufhaltsamen Reigens an Geschehnissen. Am Anfang steht so der Tod und nicht das Leben.
Wird sich der Kreis schließen?
1. Teil
Der Torso
Kapitel 1
Der Wind blies durch das offene Fenster und ließ seine Haare fliegen. Er mochte den salzigen Geruch der Luft. Er genoss das idyllische Panorama, während er die kurvige Strecke von Irakleio nach Chania fuhr, die ihn manchmal nur wenige Meter vom Meer trennte und dann wieder einen kleinen Schlenker machte, sodass er die blaue Pracht kurzzeitig aus den Augen verlor. Egal, wie oft er dieses Schauspiel erlebte, er konnte sich einfach nicht sattsehen. Er liebte das Meer. Anders ließen sich die Gefühle nicht beschreiben, die ihn überkamen, wenn er die meist sanft gewellte Oberfläche des Wassers, das sich bis zum Horizont erstreckte und mit ihm zu verschmelzen schien, sah. Das Gefühl war wohlig und erfüllte ihn mit tiefer Wärme. Mit Freude. Das konnte nur Liebe sein. Vielleicht die einzige bedingungslose Liebe seines Lebens.
Es war ihm egal, ob die See spiegelglatt oder stürmisch war, sonnenwarm oder winterkalt. Es gab keine Jahreszeit und auch kein Wetter – außer natürlich ein schlimmer Sturm oder ein tosendes Gewitter –, die ihn davon abhielten, sich regelmäßig in die Fluten zu werfen. Und sich dabei auszupowern und auch zu reinigen, seelisch wie körperlich.
Im Meer störte ihn nichts. Er hatte es an vielen Stellen kennengelernt, und nirgendwo hatte es ihn so berührt wie hier auf der Insel. Es hatte ihn mitten ins Herz getroffen, und daher hatte sich für ihn nie die Frage gestellt, wo er denn leben wollte.
Schon als kleiner Junge hatte er, nach seiner Heimat gefragt, wie aus der Pistole geschossen »Kreta« geantwortet. Seine Großeltern erfüllte das mit Stolz, und seine Eltern lächelten dann stets milde. Er war immer ein besonderer Junge gewesen, und sie hatten ihm seinen Freiraum gelassen. Seine Mutter war Professorin für griechische Geschichte an der Uni in Tübingen und hielt an ihrem Lehrstuhl fest wie die Queen von England an ihrer Krone. Der Dekan hatte sie schon ein paarmal dezent auf die Endlichkeit einer Professur hingewiesen, aber seine knapp über siebzig Jahre alte Mutter war auf diesem Ohr scheinbar taub.
Sein Vater hatte sich in einem technischen Unternehmen in Süddeutschland vom einfachen Bandarbeiter bis zum Vorstand hochgearbeitet und genoss nun seinen Ruhestand in vollen Zügen. Die beiden verspürten keinen Drang, auf der Insel zu leben, der sie 1974 den Rücken gekehrt hatten, um im Rahmen des Abkommens mit Deutschland als Griechen dort arbeiten zu können.
Er war zweisprachig aufgewachsen und beherrschte Deutsch und Griechisch aus dem Effeff und ohne störenden Akzent. Das war auch ein wichtiger Aspekt für ihn gewesen, als er seinen Beruf und seinen Wohnort wählte, denn wenn er nicht wollte, dass man etwas über seine Vergangenheit in Deutschland wusste, dann bemerkte es auch niemand. Normalerweise war das für seine Arbeit nicht relevant, aber Ausnahmen bestätigten ja bekanntlich jede Regel.
Er hatte alle Ferien bei seinen Großeltern verbracht, die in einem schönen Haus am Meer in Agia Pelagia, einem kleinen Fischerdorf zwischen Irakleio und Rethymno, wohnten. Sein Großvater hatte ihm das Schwimmen beigebracht, ihn das Meer lieben gelehrt, und seine Großmutter hatte ihm gezeigt, wie gut Essen sein konnte. Ihre grundehrliche Küche hatte ihn für alles, was in Deutschland auf den Tisch kam, für immer verdorben. Er aß alles, was seine Mutter zubereitete, doch sie hatte weder das Händchen dafür noch Lust dazu, und so waren die Tütengerichte, zu denen sie vermehrt griff, für ihn zum Synonym des Grauens geworden. Er hatte gegessen, um sie nicht zu verletzen, doch es glich eher einem Schlingen.
Wenn er nach Kreta gekommen war, war er wie ausgehungert gewesen, und nicht selten hatte er bei jedem Essen eine zweite Portion verlangt.
Er hatte immer seinen Teller abgeleckt und ihn dann der Großmutter hingestellt, als habe sie vergessen ihm etwas zu geben. Sein Großvater war dabeigesessen und hatte auch mal leicht gelächelt. Aber das war selten vorgekommen. Er war ein lieber Pappous und immer geduldig gewesen, hatte aber lieber geschwiegen, und schien oft tief in seine eigene Welt versunken zu sein. Als er gestorben war, hatte Hyeronimos einen regelrechten Gefühlsmix durchgemacht: Von tiefer Trauer bis zu einer sonderbaren Erleichterung war alles dabei gewesen.
Seine Yaya war mittlerweile sechsundneunzig und erwartete ihn nach wie vor regelmäßig zum Essen. Sie schrumpfte immer mehr, hatte kaum noch Zähne im Mund, und ihre klugen braunen Knopfaugen stachen aus dem faltigen Gesicht hervor wie dunkle Bernsteine. Er musste lächeln, als er an sie dachte, und sein Magen begann vernehmlich zu knurren.
Der Wind zauste an seinem Haar, und er fokussierte die Straße, um dem Drang zu widerstehen, es zu glätten, dabei wollten seine Hände es unbedingt tun. Doch seine Hände wollten viel, und er sah es als seine immerwährende Aufgabe an, sie bewusst daran zu hindern. Das war nicht leicht, denn sein Gehirn befahl den Händen einfach so, Dinge zu tun, ohne ihn großartig um Erlaubnis zu bitten. Also ritualisierte er die Momente, die ihm bewusst waren, so wie jetzt im Auto.
Er passierte den Ortseingang der venezianisch anmutenden Hafenstadt und parkte den Wagen in der Nähe des alten Ortskerns. Jetzt war es auch völlig in Ordnung, dass seine linke Hand die Fensterscheibe schloss und die rechte das Haar glatt strich. Er schnappte seine Tasche vom Beifahrersitz und freute sich auf das köstliche Essen bei seinem Freund Giannis, der ein Restaurant direkt an der Promenade betrieb. Im Sommer wimmelte es dort zwar nur so von Touristen, aber er akzeptierte dies als gegeben und blendete die Menschenmassen aus. Das konnte er hervorragend, und mit einem guten Essen auf dem Teller und einem kühlen Weißwein im Glas gelang es ihm sogar noch besser.
Er schulterte die Tasche und ging mit beschwingtem Schritt die kleine Anhöhe zur Altstadt hinauf. Jetzt war die Stadt merklich leerer. Die Saison neigte sich ihrem Ende zu, und bald würde es in vielen Orten still werden.
Kapitel 2
Elenis Blick glitt auf den Weg, der noch vor ihr lag. An manchen Stellen war er so steil, dass sie befürchtete, nicht hinabzukommen. Der gut gefüllte Rucksack auf ihrem Rücken machte den Abstieg nicht leichter. Einige Male hatte sie sich nach Atem ringend gefragt, warum sie das hier machte, war kurz stehen geblieben und dann doch weitergestapft. Sie hatte sich etwas vorgenommen, und davon ließ sie sich nicht so leicht abbringen. Das machte ihre Persönlichkeit aus, zumindest war ihre Familie dieser Ansicht.
Von deren Seite klang es aber eher nicht freundlich, sondern vielmehr wie ein Stigma oder gar eine Beleidigung. »Störrisch wie ein Esel« oder »eigensinnig wie eine Kri-Kri« benannten sie sie. Also wie eine der Ziegen, derer es Unmengen auf der Insel gab und die frei umherliefen und taten, was immer sie wollten. Es gab ganze Landstriche, die durch die sich frei bewegenden Schafe und Ziegen kahl gefressen waren. Nur die stacheligen Gewächse verschmähten sie, und das gab den Hügeln eine sonderbar anmutende Kargheit, durchzogen von grünen Linien, an denen man sich die Beine unschön aufritzen konnte.
Für die Touristen war es immer ganz wundervoll, wenn sie in den Bergen umherkurvten und plötzlich eine Horde haariger Paarhufer auf der Straße umherstolzierte. So, als hätten sie noch nie eine echte Ziege gesehen. Eleni wusste, dass es auch in anderen Ländern Ziegen gab und dass es sich bei den müffelnden Viechern keinesfalls um zauberhafte Einhörner handelte, die man wie ein Wunder bestaunen musste.
Auf Kreta gab es nur Superlative. Zumindest wenn es nach den Verfechtern der kretischen Einzigartigkeit ging: die höchsten oder tiefsten Schluchten, den rosafarbensten Strand, den größten natürlichen Palmenwald oder was auch immer. Alles war am größten, besten oder schönsten. Sonderbar war nur, dass sie es bei all dem Großartigen nicht auf die Reihe bekamen, wirtschaftlich auf einen grünen Zweig zu kommen. Doch diese Meinung wollte niemand zu Hause hören. Damit machte sie sich unbeliebt bei den sonntäglichen Familienessen, doch da sie diese Zusammentreffen mittlerweile ohnehin durch und durch verabscheute, war es ihr egal geworden, ob alle den Kopf über sie schüttelten.
Wahrscheinlich war auch ihr heutiges Vorhaben genau aus einer solchen Stimmung heraus entstanden: Sie hatte die Schnauze voll von dem Getue am Tisch und von den ärgerlichen oder mitleidigen Blicken der anderen. Ihre Schwägerin Emmanouela blickte sie immer an, als sei sie Opfer eines furchtbaren Unfalls und schwer am Hirn verletzt worden, und ihr Vater begann regelmäßig so laut mit den Zähnen zu knirschen, dass sowohl ihre Mutter als auch ihr Bruder ihr flehentliche Blicke zuwarfen, ihre Worte aufzuhalten. Doch sie hatte keine Lust mehr zu schweigen und sich unterzuordnen. Sie war achtzehn und nicht sieben. Sie wusste, was in der Welt vor sich ging, und war fähig, das politische Dickicht auf der Insel zu durchdringen. Und was sie am meisten hasste, waren der verfluchte Aberglaube, der sich wie eine genetische Manipulation von Generation zu Generation zu vererben schien – und natürlich die patriarchalische Rollenverteilung. Ihr Vater machte im Haus keinen Finger krumm, und falls man ihn bat, ein Glas aus der Küche zu holen, war es, als verlange man von ihm, den Boden der Küche abzulecken. Er werkelte nur im Garten und der Scheune herum. Benötigte er aber zum Beispiel bei der Reparatur eines Zaunstückes Hilfe, so hatte er kein Problem damit, ihren Namen oder den der Mutter zu brüllen. Da stimmte doch irgendwas in dem Kopf der Männer nicht.
Sie konnte nicht verstehen, warum die Mutter auf dieser sonntäglichen Bürde bestand. In ihren Gedanken hatte Eleni ihre Schwägerin bereits mehrfach mit einem der Fleischmesser feinstreifig filetiert, und auch für ihren Bruder Manolis hatte sie mehr als einmal blutige Todesarten ins Auge gefasst. Der Achtundzwanzigjährige hatte sich den Vater als Vorbild genommen, geheiratet, zwei Kinder gezeugt und seiner Frau verdeutlicht, dass er sie vor allem zur Aufzucht seines Nachwuchses geehelicht hatte. Na, wenn das nicht eine wunderbare Grundlage für eine respektvolle Beziehung war! Eigentlich konnte einem Emmanouela nur leidtun, aber sie hatte es sich irgendwie bequem gemacht in ihrem Leben. Sie war nach dem zweiten Kind wirklich fett geworden und hatte die Rolle der kretischen Ehefrau und Mutter ganz angenommen. Ihr Bruder hatte es sogar eingeführt, dass seine Frau ihn um das gemeinsame Auto bitten musste, falls sie irgendwohin fahren wollte. Das war keine Ehe, das war moderne Sklaverei.
Eleni war so in ihre Gedanken versunken, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht genug auf den steilen Abstieg richtete. Sie stolperte und konnte sich im letzten Moment noch an einer Baumwurzel, die aus dem felsigen Geröll ragte, festhalten.
Schwer atmend und leicht zittrig in den Knien verharrte sie. Vielleicht war es eine dumme Idee gewesen, hier einzudringen. Der offizielle Zugang zur Schlucht war seit Mitte Oktober geschlossen, und egal, welchen Reiseführer man las: Es wurde dringend davon abgeraten, sich allein auf diese gefährliche Tour zu begeben. Man konnte während der offiziellen Öffnungszeiten schon allein los, so war es nicht, aber da das Zutrittsticket nicht nur am Eingang, sondern auch am Ausgang der Schlucht kontrolliert wurde, fiel es auf, wenn jemand nicht ankam, egal ob freiwillig oder unfreiwillig. Da die Handyverbindung in der Schlucht nicht funktionierte – böse Zungen behaupteten, die Amerikaner hätten einen Störsender eingebaut, da sie rund um Chania herum geheime Waffenlager aufgebaut hätten –, war es tatsächlich nicht ungefährlich, allein hier unterwegs zu sein.
Sie aber war ganz allein, und niemand würde bemerken, ob sie am Ausgang ankam oder nicht. Niemand würde wissen, wo man sie finden konnte, falls sie übel stürzte, denn sie hatte keine Nachricht hinterlassen und keinem Bescheid gesagt. Es war ein Abenteuer – ihr Abenteuer!
Sie sah schon die ersten steinernen Umrandungen des verlassenen Dorfes Samaria und den Felsvorsprung, unter den sich einige der Ruinen schmiegten, als das Wetter plötzlich umschlug. Dabei hatte sie extra einen Tag ausgewählt, an dem der Wetterbericht stabile zweiundzwanzig Grad und klaren Himmel voraussagte. Die Wolkenfetzen flogen von Süden herbei und sahen unheilschwanger aus. Nicht einfach nur so, als würden sie ein paar Tropfen abwerfen und sich dann entzerren und den blauen Himmel wieder rasch freigeben, nein, es sah nach einem verdammten Unwetter aus.
Sie warf einen Blick nach oben und bemühte sich, die letzten Meter des Abstiegs so schnell und so sicher wie möglich zu schaffen, um dann in einem der verlassenen Häuser Zuflucht zu finden. Sie hangelte sich den Abhang hinab, setzte die einfachen wanderbeschuhten Füße sorgsam in die ausgetreten steinernen Mulden und erreichte gerade noch, bevor sich der wolkenverhangene Himmel schleusentorartig öffnete, das erste leer stehende Haus. Hastig eilte sie durch den steinernen Rundbogen in die schützende Trockenheit. Sie ließ den Rucksack fallen und beobachtete das Spektakel draußen mit großen Augen. Der Regen platschte in dicken Tropfen herab, und es sah so aus, als würden die Götter einen großen Wassereimer über der Schlucht ausgießen. Ganz sicher würde der Fluss dadurch über die Ufer treten und die hölzernen Brücken, die über das Flussbett führten, würden dann kaum noch zu sehen, geschweige denn zu benutzen sein.
Sie atmete tief durch, irgendwie würde es schon klappen, den Weg bis zur Eisernen Pforte zurückzulegen. Sie würde gewiss nicht versuchen, den Berg wieder hinaufzukraxeln, denn das tat man unter diesen Umständen tatsächlich nur, wenn man lebensmüde war. Allerdings stand sie unter Zeitdruck, denn wenn sie noch heute wieder nach Hause kommen wollte, musste sie die Fähre erreichen, die sie von Agia Roumeli nach Sougia bringen würde, um dann dort den Bus nach Chania zurück nehmen zu können.
Sie blickte vorsichtig durch den Bogen zum Himmel hinauf, um nicht nass zu werden, und stellte fest, dass es unvermindert wie aus Kübeln goss, ein markerschütterndes Donnergrollen kam näher. Erste Blitze zuckten grell aufleuchtend durch das Grau, und der Hall des dumpfen Dröhnens schien sich in den Anhöhen der Schlucht zu fangen und dort zu vervielfachen.
Sie war ein mutiges Mädchen mit dem Herz am rechten Fleck, war nicht kleinzukriegen und behauptete sich mühelos gegen ihren älteren Bruder oder dämliche Typen in der Innenstadt, doch nun wurde ihr doch ein wenig mulmig zumute. Ihre Mutter würde durchdrehen und ihr Vater ganz sicher die Polizei alarmieren. Na bravo, das Desaster war perfekt. Anstatt gestärkt aus dem abenteuerlichen Marsch hervorzugehen, würde sie die Spitzen ihrer Familie für immer und ewig ertragen müssen.
Sie stieß einen lauten, unwirschen Fluch aus, während der Jahrhundertregen anfing, Gesteine zu unterspülen und Felsbrocken anzuheben. Sie saß offensichtlich erst einmal hier fest und war nun froh, dass sie es bis Samaria geschafft hatte und nicht irgendwo auf der Steinernen Treppe dieser Naturgewalt ausgeliefert war. Das verlassene Haus bot ihr Schutz vor dem Regen. Sie holte ihre leichte Jacke aus dem Rucksack und zog diese über, da das Gewitter die Temperatur merklich gesenkt hatte. Dann betrachtete sie ihren Reiseproviant. Wasser war kein Problem, denn sie konnte es sowohl am Fluss als auch an den Wasserquellen auffüllen. Sie hatte einige Müsliriegel eingepackt sowie eine Brotdose mit den restlichen Dakos von gestern. Die knusprigen Brote hatte der Saft der Tomaten angenehm durchweicht, und der bröckelige Schafskäse gab dem Gericht Würze. Sie liebte es, wenn die Dakos genauso beschaffen waren und nicht ganz frisch auf den Tisch kamen. Sie hatte sogar noch extra etwas Olivenöl dazugegeben, als sie sie heimlich in die Dose umfüllte. Die Brotscheiben ließen sich so ganz wunderbar löffeln und sättigten gut. In der Thermoskanne befand sich herrlich warmer Kaffee, und ein großes Stück Bougatsa hatte sie in Alufolie gewickelt. Der süße Grieß in Blätterteig würde sie zusammen mit dem Kaffee beleben. Sie würde das Beste aus dieser bescheuerten Situation machen und daran wachsen. Gutes Wetter konnte jeder, aber bei einem Unwetter eine schwere Schlucht zu bewältigen, das hatte schon was.
Kapitel 3
Giorgos Dalaras saß auf der Terrasse seines Sommerhauses und starrte ins Tal hinab. Normalerweise war er im Herbst und Winter nicht oft hier oben. Er genoss es, im Sommer weit weg von den ewigen Touristenströmen unten am Meer sein zu können, und floh dann regelrecht in die Berge des Psiloritis-Gebirges. Zwischen dem Ort Meronas und dem Kastro Koules Merona, einer mittelalterlichen Festung, hatte er sich sein Traumhaus gebaut. Das Haus war so in den Berghang integriert, dass es aussah, als würde es dorthin gehören. Es schmiegte sich mit der Rückseite an die steinerne Wand. Die Front zum Tal war mit bodentiefen Fenstern komplett verglast, und auch seine Terrasse hatte einen Glasboden. Die Handwerker hatten so laut geflucht, dass sich im Umkreis von Kilometern sicher alle Priester stundenlang bekreuzigten, aber das war ihm egal. Ihm war das Gefühl, über allem zu schweben, wichtig, und dies zu erleben gelang ihm auf seine Weise. Der erste Schritt nach draußen kostete immer ein wenig Überwindung, aber dann war es einfach ein absoluter Triumph. Der Berg neigte sich zum Tal hin in einem steil abfallenden Winkel, und die Vegetation war saftig grün und gleichzeitig zurückhaltend karg. Die Terrasse stand auf filigranen, stahlverstärkten Säulen und ragte über die gesamte Länge des Hauses sieben Meter breit über den Talabhang. Die statische Berechnung war ein Meisterwerk, und es gab auf der ganzen Insel kein vergleichbares Anwesen. Er hatte Geld, und es war ihm daher vollkommen egal gewesen, was das Haus am Ende gekostet hatte.
Die Einrichtung bestand aus handverlesenen Stücken und verknüpfte das historische Kreta mit der Moderne. Er hatte darauf geachtet, dass alles offen blieb, und die Möbel waren zwar in ausreichender Menge vorhanden, aber doch so zurückhaltend positioniert, dass jeder sofort erkennen konnte, dass dort nichts dem Zufall überlassen war. Nicht umsonst hatte er seinen Sohn in Mailand Architektur studieren lassen, und seine Nichte war eine bekannte Innenarchitektin, die ihr Handwerk am Royal College of Art in London erlernt hatte.
In dieses Haus lud er gerne wichtige Menschen ein. Er hatte es bauen lassen, um andere zu beeindrucken. Gleichzeitig war es, so verrückt es klingen mag, sein Kraftort, seine ganz persönliche Hommage an die Vergangenheit. Hier musste er sich nicht verstellen, konnte der sein, der er war – fühlte sich einfach frei. Am liebsten hätte er sich mittlerweile ganz in die Berge zurückgezogen, konnte jedoch seinen Bruder nicht alleinlassen, und das Hotel in der Stadt brauchte ebenfalls seinen zügelnden Griff, sonst würde alles, was sie sich so schwer erarbeitet hatten, den Bach hinuntergehen.
Er atmete tief durch. Die Luft hier oben war rein und klar.
Er brauchte Abstand. Seine aktuelle Lebensabschnittsgefährtin, er tauschte seit einigen Jahren die Frauen nach einer bestimmten Zeit aus, ging ihm gewaltig auf die Nerven. Er spürte, dass die Zeit reif war, sich nach einer neuen Begleiterin umzusehen, denn wenn er fliehen musste, um sie nicht im Hafenbecken zu ertränken, dann hatte sich wohl die Grundlage des Beisammenseins in Luft aufgelöst.
Manchmal war er fast ein wenig wehmütig, dass er sich von Maria getrennt hatte. Sie war seine erste Liebe gewesen und die Mutter seiner Kinder. Doch sein Lebensweg hatte ihn verändert. Er fand, zum Guten, sie aber war der Ansicht, dass er sich zu einem gefühllosen Despoten entwickelt habe. Nachdem die Söhne aus dem Haus gewesen waren, hatte sie den Tag verflucht, an dem er ihr am Morosini-Brunnen in Irakleio bewundernd nachgeschaut hatte, hatte ihre Koffer gepackt und war zu ihrer Schwester nach Rethymno gezogen.
Sie war durch nichts zu bewegen gewesen zurückzukommen, und die Scheidung hatte nicht nur für einen Eklat in der Familie gesorgt, sondern ihn auch immens viel Geld gekostet.
Sie sahen sich hin und wieder, denn bei Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen war es kaum möglich, sich auf der Insel aus dem Weg zu gehen.
Maria hatte seine Gier nie verstanden oder gar geteilt: das unbändige Verlangen nach Reichtum, Macht und Ansehen, das ihn antrieb – noch immer.
Er hatte beweisen wollen, dass er klug war und gerissen genug, um mit den ganz Großen mitzuspielen. Das war ihm gelungen, hatte aber alles zwischen ihnen zerstört, und jetzt musste er die Stadt verlassen, um der langbeinigen Schönheit zu entkommen, mit der er aktuell Tisch und Bett teilte. Er stöhnte auf und lehnte sich weiter in seinem Sessel zurück. Er wusste, dass das ein Luxusproblem war, denn er hatte in seinem Leben sehr viel Dreck fressen und anfassen müssen, um auf dieser Terrasse sitzen zu können und zu den reichsten Männern der Insel zu gehören. Seine aktuelle Gespielin war wirklich ein lächerlich einfach zu lösendes Problem. Er hatte ganz andere Kaliber in den Griff bekommen müssen, was ihm auch immer gelungen war, egal, was es letztlich kostete.
Giorgos hob entnervt sein piependes Handy vom Tisch. Oft wünschte er sich, es würde hier oben gar nicht erst funktionieren, aber es war ihm auch klar, dass jemand in seiner Position erreichbar sein musste, und an einen Festnetzapparat war an dieser abgelegenen Stelle nicht zu denken. Ein Blick auf das Display zeigte ihm, dass sich seine Freundin wohl nicht so leicht abschütteln lassen wollte. Oft hatte er mit Andreas darüber gestritten, denn sein Bruder warf ihm immer wieder vor, er mache sich lächerlich mit den jungen Dingern an seiner Seite, und er wiederum warf seinem Bruder dessen selbst gewählte Einsamkeit vor.
Er wohnte in einem der Hotelzimmer, hatte also kein wirkliches Zuhause. Seitdem Olympia tot war, lebte er wie ein Geist. Sein schlohweißes Haar, das er, weil ihm sein Äußeres mittlerweile vollkommen gleichgültig geworden war, fast schulterlang trug und es dann zu einem Zopf im Nacken zusammenfasste, stand ihm oft wirr um den Kopf. Der weiße Bart war so lang, dass er ihm bis ans Brustbein reichte, und unterstützte das geisterhaft wirre Aussehen seines Bruders. Man schnitt sich normalerweise nur bis zur Beerdigung weder das Kopfhaar noch den Bart, aber Olympia war schon seit einiger Zeit unter der Erde.
Wenn die Saison lief, achtete er darauf, dass Andreas zumindest so rüberkam, dass er die Gäste nicht verschreckte oder sie versehentlich auf die Idee kommen würden, ihm Geld zuzustecken. Wo bei Giorgos das Logo eines Designers prangte, war bei Andreas ein Loch oder ein Schmutzfleck zu sehen. Unvermindert blieben Giorgos Anstrengungen, seinen Bruder dafür zu kritisieren, dass er aussah wie ein Penner und nicht wie der erfolgreiche Besitzer mehrerer Hotels und Restaurants. Auch sein Auto war eine Schande. Er zuckelte in einem alten, ehemals weißen Suzuki Jimny über die Insel. Das Fahrzeug mochte der Fun-Gesellschaft als lustiger Ausflugsuntersatz dienen, doch für einen Geschäftsmann war es ein unmögliches Fortbewegungsmittel. Es rumpelte über die Straßen wie ein Traktor und war schlechter gefedert als ein Eselskarren.
Giorgos schüttelte unwirsch den Kopf, manchmal verstand er seine eigenen gedanklichen Abschweifungen nicht. Dann schob er das Smartphone so weit wie möglich von sich und konzentrierte sich auf das, was ihm sein Yogalehrer beigebracht hatte, um sich zu konzentrieren und fokussieren. Er atmete tief ein und ganz bewusst aus und spürte, wie seine Anspannung nachließ. Dann richtete er seinen Blick wieder in die Ferne und versuchte all dies auszublenden, was ihn stören konnte, so wie er es immer tat, wenn ihm die Vergangenheit durch den Kopf schwirrte.
Kapitel 4
Heute war ein Tag, an dem er frei war. Er hatte nicht nur einen Tag nichts zu tun, sondern er fühlte sich frei, denn schon morgen, nein, heute Nacht, würde die Welt wieder verdammt anders aussehen. Er roch die salzige Luft des Meeres und erkannte die Partikel in der feuchten Luft, die genau dieses Sinneserlebnis ausmachten. Er sah winzige Kleinigkeiten und konnte hervorragend riechen. Das alles machte ihn zu einem wirklich außergewöhnlichen Beobachter, aber für viele Leute war er eher schrullig oder gar angsteinflößend. Meist tat er sich auch nicht leicht mit Menschen. Das war in seinem Job regelmäßig eine Hürde, die er zu überwinden hatte, denn viele Leute konnte er im wahrsten Sinne einfach nicht riechen, und er musste sich oft bei Befragungen überwinden, denn es war dabei unmöglich, mehrere Meter Abstand zu halten.
Er war seiner wunderbaren Kollegin Penelope daher von ganzem Herzen dankbar für die Menthol-Emulsion, mit der sie ihn versorgte. Einige Pathologen benutzten sie und strichen sie sich unter die Nase, um dem extremen Leichengestank gelassener begegnen zu können. Sie nahm die Gerüche nicht als störend oder gar ekelerregend wahr, es war sogar, wenn man ihr Glauben schenken mochte, wichtig zu erfassen, wie ein Leichnam roch. Doch sie hatte Verständnis für ihn und lachte ihn niemals aus, sondern war eine Gesprächspartnerin ganz nach seiner Vorstellung.
Daher waren sie Freunde geworden. Nicht nur der Job brachte sie regelmäßig zusammen, sondern sie gingen auch gern essen, und sie begleitete ihn manchmal bei gutem Wetter sogar zum Schwimmen.
Er mochte die gelassene Pathologin sehr, und sie reagierte auf ihn auch völlig normal, soweit er das beurteilen konnte. Was war schon normal? Diese Frage stellte er sich oft, besonders dann, wenn ihn die Presse oder auch andere offizielle Stellen mal wieder als sonderbar oder gar kauzig beschrieben.
Penelope akzeptierte ihn, wie er war, ließ ihm aber auch nichts durchgehen. Sie respektierte ihn sehr, aber sie war auch tough genug, um ihm, wenn nötig, ordentlich die Leviten zu lesen.
Ohne es zu bemerken, war er am Hafen angekommen. Er hielt einen Augenblick inne, um den Blick auf den kleinen Leuchtturm, der auf der sandfarbenen Mauer die Zufahrt zum Hafenbecken markierte, zu genießen. Er mochte den hellen Stein des Turms und der Kaimauer, die sich so kontrastierend vom Meer und dem strahlend blauen Himmel abhoben.
Einen tiefen Atemzug später bog er um die Ecke und ging an der Promenade entlang zu Giannis’ Restaurant. Er sah den stämmigen, kahlköpfigen Mann schon von ferne, mit auf dem Bauch verschränkten Händen. Er stand neben der auf einem Ständer ausgestellten Speisekarte. Es verwunderte ihn immer wieder, um wie viel leichter es ihm hier auf der Insel fiel, Freundschaften zu schließen. Nein, er musste es ganz anders formulieren: dass es ihm überhaupt gelang, Freundschaften zu schließen und er es sogar mochte, Menschen um sich zu haben. Er ging gemessenen Schrittes weiter, grüßte den ein oder anderen Restaurantbesitzer und freute sich auf ein kühles Glas Malagousia und Giannis’ hervorragende Meze.
Kapitel 5
Andreas Dalaras saß am Tisch seines Multifunktionsraumes. Er hatte vor einem Jahr eine Suite im Hotel bezogen und die Einrichtung so, wie sie für den Touristengebrauch einst kombiniert worden war, übernommen. Im Laufe der Zeit waren einige ausrangierte Möbel aus anderen Räumen bei ihm gelandet, sodass es wie ein wildes Durcheinander wirkte.
Er hatte seinen Kopf in die rechte Handfläche gelegt, den Ellenbogen auf die Kante des Tisches aufgestützt und rieb sich mit Daumen und Mittelfinger die Schläfen. Man hatte von jedem der drei Zimmer Meerblick, aber er hatte die bauschigen Verdunklungsgardinen zugezogen. Aktuell konnte er weder das intensive Blau des Wassers noch die Sonne ertragen. Sein Arzt in Irakleio hatte ihm mehrfach mit ernstem Gesicht erklärt, dass das nicht nur einfache Kopfschmerzen seien, die ihn plagten, sondern dass ihn regelmäßig eine veritable Migräne heimsuche. Die stressigen Jahre forderten ihren Tribut. Er konnte noch so viel Olivenöl, Knoblauch und Zitrone essen, es machte nicht wett, was in seiner Psyche zurückgeblieben war. Manchmal reichten winzige Stressoren aus, um ihn in einen Zombie zu verwandeln.
Heute war es wieder einmal Elonidas gewesen. Der Junge machte ihn fertig. Er hatte ihn auf die besten Management-Schulen der Welt geschickt, um das Unternehmen der Familie Dalaras mitgestalten zu können, und anstatt das Gelernte auf griechische Verhältnisse zu transferieren, schien der Kerl Kreta mit Martha’s Vineyard zu verwechseln. Zigmal hatten sie erbittert über die Art und Weise diskutiert, wie er die Hotel- und Restaurantgruppe führte. Andreas war müde. Nicht nur, weil ihn der Schmerz stechend plagte und hinter seinen Augen rotschlierig tobte, sondern auch, weil er die Arbeit nicht mehr ertragen konnte. Er fühlte die Jahre in seinem Körper, und seine Lebensentscheidungen lasteten auf ihm wie zentnerschwere Felsbrocken. Er meinte es wirklich ernst, als er die Führung an Elonidas übergeben hatte.
Giorgos und er hatten sich lange darüber unterhalten. Sein Bruder war ein vollkommen anderer Typ als er. Giorgos liebte den Reichtum und zeigte das auch gern. Er jettete mit einem Porsche Cayenne über die Insel und wechselte die Frauen auf dem Beifahrersitz öfter als manch alter Bergdorfbewohner seine Unterwäsche. Zudem war er manchmal einfach kalt und so berechnend, dass Andreas sich fragte, wann sich der Bruder so verändert hatte. Sie waren in furchtbaren Zeiten in einem winzigen Bergdorf aufgewachsen und hatten es gelernt, schwierige Situationen durchzustehen, doch er machte dies stets mit dem Gefühl der tiefen Dankbarkeit, während sein Bruder mittlerweile so tat, als hätte Gott ihnen all dies geschuldet. Sie waren verschieden, und es hatte in den letzten Jahren oft Streit zwischen ihnen gegeben. Olympia versuchte diesen immer wieder zu schlichten, war dann aber selbst ins Kreuzfeuer geraten. Giorgos hatte sogar versucht, sie aus der aktiven Arbeit im Hotel zu vertreiben, was aber völlig undenkbar war bei all dem, was Olympia managte.
Vielleicht, nein, ganz gewiss sogar, lag es daran, dass sein Bruder allen zeigen musste, wie es finanziell um sie stand und wie einflussreich er war. Er hatte sich diesen Glaspalast in der Psiloritis-Anhöhe gebaut und schaute von dort auf sein Reich herab. Aus Andreas’ Sicht gebärdete sich sein Bruder wirklich wie ein neureicher Idiot, aber er war sein Bruder, und Andreas konnte sich einfach nicht mehr weiterhin ereifern.
Die bleierne Müdigkeit in seinen Knochen machte ihm deutlich, dass all die Jahre der Plackerei und des Kampfes Spuren hinterlassen hatten. Manchmal wünschte er sich, er müsste nicht mehr denken. Er umfasste seine Schläfen fester, so, als könnten sie den steten Gedankenfluss in seinem Kopf eindämmen. Er presste seine Nägel in die Haut, bis der Schmerz dem Migräneschmerz gleichkam.
Was sollten sie nur mit seinem Sohn machen? Wäre es die beste Lösung, wenn er selbst sich vollkommen zurückzog und sie das Feld der jüngeren Generation überließen? Giorgos und er hatten dafür gesorgt, dass ihre Kinder die besten Grundlagen erhielten, dabei waren sie sich tatsächlich einig gewesen. Es war an der Zeit, dass die Jugend all das, was sie beide – unterstützt von ihrer Mutter, die bis heute wie ein mahnender Geist mit stets erhobenem Zeigefinger die Entscheidungen ihrer Söhne beurteilte – aufgebaut hatten, fortführte. Sie war eine einfache Frau, doch sie hatte die schwierigsten Gegebenheiten gemeistert und zwei Söhne unter Bedingungen aufgezogen, die aus heutiger Sicht kaum glaubhaft schienen. Und sie hatte die beiden stets mit ihrer Strenge zu Höchstleistungen angetrieben. Sie zitierte häufig das alte Sprichwort »Ein kluger Junge kennt auch immer einen anderen Trittpfad« und machte damit deutlich, dass ihre Söhne clever genug waren, um für jede Situation gewappnet zu sein.
Noch heute, mit zweiundneunzig, schaute sie mit ihrem klaren Blick tief in seine Seele und traf dort stets auf den kleinen verängstigten Jungen, der zu früh hatte erwachsen werden müssen und dessen Augen Dinge gesehen hatten, die ein Kind nicht hätte sehen sollen.
Er wollte es besser machen. Olympia und er hatten einander aufrichtig geliebt, und sie hatte ihn bei allem unterstützt, hatte sich meist im Hintergrund gehalten, war, wenn nötig, strahlend schön daraus hervorgetreten und hatte Geldgeber oder Bauunternehmer bezirzt. Sie hatten ihre Kinder so erzogen, wie es Tradition und richtig war. Beide hatten eine hervorragende Schulbildung erhalten und sprachen je drei Sprachen. Katharina hatte in London Innenarchitektur studiert und die Einrichtung für die beiden Luxushotels in Agios Nikolàos entworfen sowie für das Restaurant Oneirodort im Hafen und das gleichnamige Restaurant mit kleinem Boutiquehotel in Rethymno. Sie hatte wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Olympia wäre stolz auf ihre Tochter gewesen.
Der Schmerz zwischen seinen Schläfen war nun auf ein Maximum angeschwollen, und an diesem Punkt war er immer versucht, sich die Augen mit den Fingerspitzen hinter geschlossenen Lidern zu reiben.
Er musste sich endlich hinlegen. Der Doktor hatte ihm geraten, jede Aufregung zu vermeiden und im abgedunkelten Zimmer liegend zu ruhen. Stattdessen hatte er diesen unsinnigen Streit mit seinem Jungen. Auch auf ihn wäre Olympia stolz, und er hörte ihre melodische Stimme, wie sie ihm sanft zuflüsterte: »Wir haben zwei großartige Kinder erzogen, ich freue mich darauf, mit dir das Leben zu feiern, wenn sie alt genug sind, um uns zu entlasten.« Er gab auf, erhob sich schwer vom Stuhl und ging gramgebeugt zu seinem Bett im Nachbarzimmer. Er hätte sterben sollen, nicht sie. Warum nur war er noch am Leben. Was dachte sich Gott dabei?
Kapitel 6
Giannis hatte ihn überschwänglich begrüßt und seine Freude war ansteckend, genau wie sein dröhnendes Lachen. Hyeronimos mochte den lauten Mann mit der gelbgrünen Aura. Da er oft das Gefühl hatte, direkt neben sich zu stehen und sich selbst zu beobachten, war er wie immer sehr verwundert darüber, dass er einen lauten Menschen mögen konnte. Laute Menschen störten ihn sonst eher und sorgten dafür, dass er sich zurückziehen wollte. Doch seine Entscheidung, in den Polizeidienst zu gehen, hatte tatsächlich so manches verändert. Er hatte sogar brüllende Vorgesetzte ertragen gelernt.
Rückblick 1982
»Mohoooo«, brüllte Achim laut und lachte sich dabei kaputt.
Hyeronimos ignorierte den Ruf, der nur dafür gedacht war, ihn zu verspotten. Er verabscheute den Spitznamen »Mo«, denn er hatte wahrlich nichts mit seinem Namen zu tun. Es war schon schwer genug zu akzeptieren, dass weder die Lehrer noch seine Klassenkameraden in der Lage waren, ihn richtig anzusprechen, denn wenn man ihn direkt ansprach, musste man das »S« am Ende seines Namens weglassen. Er hatte sich Mühe gegeben, es zu erklären, doch es war ihnen egal gewesen. Sie stempelten ihn als Sonderling ab und mit der Zeit war es auch ihm nicht wichtig gewesen, etwas mit den anderen zu tun zu haben.
»Mo, sag mal hast du Mathe schon gemacht?«, wurde er gern gefragt, und er wusste genau, dass hier kein echtes Interesse verborgen war, sondern die Person nur wissen wollte, ob sie »abpinnen« konnte. Er hatte begonnen, das Verhalten von Menschen zu studieren, und sie genau beobachtet. Wann gingen sie auf etwas oder jemanden zu, wann hielten sie Abstand oder mieden jemanden ganz. Wie sahen sie dann aus, welche Worte benutzten sie, und welchen Tonfall? Da er für die Mitschüler unsichtbar zu sein schien, außer sie brauchten etwas von ihm, wie zum Beispiel seine Matheaufgaben – die immer richtig waren –, war es umso leichter, diesen Posten einzunehmen, und er hatte begonnen, ganze Hefte mit Verhaltensmustern von Menschen zu füllen.
Er erinnerte sich noch an den ersten Tag, an dem er die Farben gesehen hatte. Sie umgaben seine Mutter ganz plötzlich, sie saß an ihrem Schreibtisch und korrigierte gerade Hausarbeiten ihrer Studenten. Er kannte ihr Gesicht genau, wenn sie mit solchen Aufgaben befasst war: Kritisch, ausdauernd und beharrlich sah sie aus, ihre Miene war dann immer leicht verkniffen und ihre Augenbrauen zusammengeschoben, sodass zwei tiefe Falten dazwischen entstanden. Und wäre sie nicht seine Mutter, so hätte er sie sicher gemieden und einen großen Bogen um diese strenge Frau gemacht. Sie war in eine hellrote Wolke gehüllt. Er kniff mehrfach die Augen zusammen und ging dann langsam auf sie zu, streckte die Hand aus und berührte den Rand der Farbe.
»Was machst du da«, fragte seine Mutter erschrocken, weil er ungefähr zehn Zentimeter von ihrem Bein entfernt etwas betastete, was sie ganz offensichtlich nicht sah.
»Da ist etwas Rotes«, murmelte er verwirrt, »es ist ein roter Schatten. Hast du vielleicht Rotwein getrunken, Mama?«
Sie schüttelte empört den Kopf. »Hyeronimo, es ist Mittag, ich trinke nicht am Tag, ich muss noch in die Uni.«
Er rieb sich verblüfft die Augen, und dann verblasste die Farbe und umwaberte die Mutter noch wie ein leicht schimmerndes bewegliches Licht. Seit diesem Zeitpunkt sah er Menschen mit Farben umgeben.
Anfangs hatte er noch geglaubt, seine Augen seien kaputt, doch der Augenarzt hatte nichts finden können. Er hatte begonnen, sich daran zu gewöhnen, und tatsächlich hatte er es irgendwann als normal empfunden.
Seine Welt war eben so: Er sah Menschen, umgeben von farbigen Lichtpartikeln. Jeder Mensch hatte seine eigene Farbschattierung, und diese gab ihm deutliche Auskunft über ihn: War sie eher rot, war die Person oft angriffslustig. War sie blau, war sie eher logisch orientiert. War sie grün, ging es meist um Zwischenmenschliches. War sie eher gelb, dann hatte er es mit der Spezies zu tun, die er am meisten fürchtete: die Spontanen, Kreativen.
Zurück im Heute
Was ihn überzeugte, den Gastwirt zu mögen, war dessen Liebe zu wirklich hervorragenden Speisen und sein Näschen für guten Wein. Seiner Familie gehörten einige große Gewächshäuser, und dort wuchsen die wunderbaren Dinge, die er dann in seiner Küche verarbeitete.
Hyeronimos reichte ihm die Hand, der stämmige Mann schüttelte sie heftig und führte ihn zu seinem angestammten Platz. Hyeronimos befürchtete, dass Giannis, sollte dort je ein anderer Gast sitzen, wenn er unangekündigt zum Essen kam, diesem den Stuhl unter dem Hintern wegziehen würde, um den Tisch für seinen Freund zu bereiten.
Hyeronimos saß kaum, da jonglierte der lächelnde Mann ein Tablett mit einer Flasche Wein und zwei Gläsern in seine Richtung. Er grinste verschwörerisch, zeigte ihm das Etikett und flüsterte, soweit seine von Natur aus dröhnende Stimme dies zuließ: »Das ist ein 2016er Evanthis, den hegen die Mönche da oben wie einen Schatz, und es ist kaum noch dranzukommen, aber ich habe extra ein paar Flaschen für dich organisiert.«
Er hob das Glas an die Nase, schnüffelte bedächtig und etwas, das Hyeronimos als Verzückung einsortierte, glitt über seine Gesichtszüge. Der Wirt forderte ihn mit einem Blick auf, sein Glas in die Hand zu nehmen, und auch er war begeistert von dem zarten Aroma von Kiwis und Grapefruits, das ihm in die Nase stieg.
Er nahm einen Schluck, nickte anerkennend, und Giannis sagte verzückt: »Ich wusste, dass er dir gefällt! Soll ich dir wie immer etwas Feines bringen?«
Hyeronimos schürzte bestätigend die Lippen. Es waren immer Köstlichkeiten, die der Freund für ihn auftischte. Er nahm noch einen Schluck Wein. Zufrieden ließ er sich in den bequemen Stuhl zurücksinken und begann die Menschen im Lokal und auf der Promenade zu beobachten.
Er überlegte kurz, ob er die Sonnenbrille beim Essen abnehmen sollte. Es kam ihm irgendwie sonderbar vor, mit diesem durch Verdunklung getrübten Blick auf die Speisen zu schauen. Doch die herbstliche Sonne stand tief und blendete ihn unter der Markise hindurch, als wolle sie ihm den Augenschmaus verwehren. Er zögerte einen Augenblick, denn er wollte seiner Hand den Impuls nehmen, es einfach zu tun, ohne auf seine bewusste Erlaubnis zu warten. Er hatte wirklich lange an diesen Mechanismen gearbeitet, und es war ihm nicht leicht gefallen die Dinge, die ihn störten, bewusst wahrzunehmen, einen Moment mit Abstand zu betrachten und dann gezielt zu reagieren. Es gab die einfachen Dinge, wie zum Beispiel den Tick, immer wieder das Haar mit der rechten Hand zu glätten – und er hatte genau beobachtet, welche Situationen dafür verantwortlich waren. Daher war er in der Lage, eine Strategie zu entwickeln, um dies zu unterbinden.
Bei den Dingen, die ihn weiter unter der Haut trafen, war er machtlos. Schweren Herzens hatte er dies anerkennen müssen, denn all seine Selbstversuche waren ins Leere gelaufen.
Er senkte seinen Blick auf die Teller und Schalen, die den gesamten Tisch bedeckten, Giannis hatte sogar noch einen kleinen Beistelltisch gebracht, um dort das dampfende Töpfchen mit dem Stifado abzustellen. Das traditionelle Schmorgericht war bei ihm mit Kaninchenfleisch gemacht und duftete nach süßen Zwiebeln und Zimt. Er warf einen Blick auf den Eintopf und nahm verstört wahr, dass er durch die getönten Gläser einem farblichen Einerlei glich. Das gab ihm die Erlaubnis, die Brille auf den Kopf zu schieben und lieber die Augen etwas zusammenzukneifen, um die Sonne auszublenden.
Dann stand plötzlich Giannis massiger Körper zwischen ihm und der flimmernden Helligkeit. »Hyeronimo«, sagte der Freund wohlwollend, »wenn du deinen Stuhl fünfzig Zentimeter nach links bewegst, hast du einen besseren Blick auf alle Köstlichkeiten, die ich dir gebracht habe.«
Kurz wägte Hyeronimos die Idee ab, Giannis kannte ihn gut und wusste in einer Art stillschweigendem Übereinkommen von seinen Sonderlichkeiten. Das Angebot, das er ihm machte, war genau richtig formuliert, um ihm den Vorteil der Bewegung zu verdeutlichen, ohne besorgt, belehrend oder gar übergriffig zu klingen.
Er richtete seine meerblauen Augen auf den Gastwirt, hob sein Glas, nahm einen genussvollen Schluck und sagte: »Da hast du vollkommen recht.« Dann schob er seinen Stuhl so zur Seite, dass die Sonne seine Augen nicht mehr erreichte und er nun entspannt jedes Gericht betrachten konnte. Giannis goss ihm noch einen kleinen Schluck Wein aus der Flasche nach, die in einem Kübel, randvoll mit Eis, steckte. Das Glas beschlug ein wenig und auf Hyeronimos’ Gesicht stahl sich ein Lächeln. Giannis nickte zufrieden und ließ ihn nun mit der Pracht allein.
Auf seinem Tisch stand eine flache Schale mit leuchtend gelber Fava, auf der sich das grünlich schimmernde Olivenöl absetzte und ein paar dunkelgrüne Petersilienspitzen das Farbenspiel abrundeten. Er liebte dieses klassische Gericht aus gelben Spalterbsen. Es war bezaubernd in seiner Einfachheit und hatte einen unvergleichlichen Geschmack. Manche Leute servierten es mit frischen Zwiebeln, doch das mochte er nicht, da für ihn die Zwiebel dann zu sehr vorschmeckte. Daneben erstreckte sich auf einem Teller ein frisch gebratenes Stück Oktopus. Er konnte sehen, dass es außen knusprig war, und wusste, dass es innen durch seine Zartheit bestach. Daneben thronten einige Scheiben frischer Zitrone. Das war für ihn eine der geschmacklich nachhaltigsten Erfahrungen gewesen, als seine Großmutter ihm das erste Mal eine Zitrone geschält und sie ihm wie einen Apfel oder ein anderes Stück Obst zum Verzehr gereicht hatte. Er kannte Zitronen aus Deutschland, so sauer, dass es einem alles zusammenzog. Hier auf der Insel waren die Zitrusfrüchte ganz anders. Man konnte in sie hineinbeißen, und es zog einem nicht alles zusammen. Sie waren sauer, aber mit so einer klaren und feinen Säure, dass es eine Freude war, sie zu verspeisen.
So nahm er nun eine dieser Scheiben, biss herzhaft das Fruchtfleisch heraus und genoss den köstlichen Geschmack. Neben dem Oktopus stand ein Teller mit frittierten Tintenfischringen. Wer jemals auf Kreta dieses Gericht genossen hatte, konnte nicht mehr nachvollziehen, was ihm in Deutschland als ähnlich lautende Speise serviert wurde. Die Gummiringe, auf denen man quietschend kaute und deren Masse sich im Mund zu vermehren schien, waren eine Art Frevel, den Menschen dieser Köstlichkeit antaten. Bei Giannis war die Panade dünn und kross und das Innere so zart, dass man dabei kaum an Kauen dachte. Vor diesem Teller stand eine kleine Platte mit Käsebällchen, und daneben präsentierten sich leicht gebräunt schimmernd die traditionellen in Olivenöl frittierten Zucchinischeiben. Wie seine Großmutter tauchte auch Giannis sie, nachdem sie mit grobem Meersalz entwässert und in Mehl gewälzt worden waren, noch einmal kurz in kaltes Wasser, bevor sie dann im heißen Öl landeten. Die hauchdünnen Scheiben waren ein Hochgenuss. Der letzte Teller wurde von herrlich gebratenen Lammkoteletts gekrönt. Entgegen der Unart vieler Landsleute, das Tier zweimal sterben zu lassen – einmal beim Schlachten und einmal beim Überbraten –, war es bei Giannis saftig rosa, und der äußere Fettrand lockte mit appetitlichen Röstaromen.
Hyeronimos entfaltete die Serviette und breitete sie auf seinem Schoß aus, nahm einen Schluck des kühlen Weins, aus dem er nun auch einen Anklang nach Avocado herauszuschmecken meinte, lud sich dann die Speisen auf seinen Teller und freute sich mit allen Sinnen auf jeden Happen. Er hatte die richtige Wahl getroffen, heute hierherzufahren, bevor morgen die gewohnte Dunkelheit über ihn kommen würde.