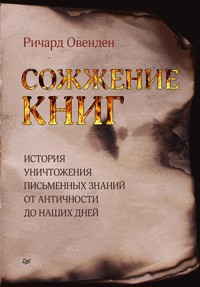14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fragile Tontafeln aus Mesopotamien, kostbare Bände mittelalterlicher Gelehrsamkeit, grandiose Bibliotheken in Alexandria und Sarajevo – seit Wissen schriftlich fixiert wird, haben Menschen versucht, es unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihre Heldinnen und Helden: Mönche und Hobbyarchäologen, Philanthropen und Freiheitskämpfer und vor allem Bibliothekare und Archivare, die sich dem Erhalt von Wissen verschrieben haben, nicht selten unter Einsatz ihres Lebens.
Richard Ovenden führt uns in fesselnd erzählten Schlüsselepisoden durch die dreitausendjährige Geschichte der Angriffe auf Bücher, Bibliotheken und Archive. Eine faszinierende Kulturgeschichte, die bis in unsere digitale Gegenwart und zu den neuartigen Gefahren, denen das Wissen der Welt heute ausgesetzt ist, reicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cover
Titel
Richard Ovenden
Bedrohte Bücher
Eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Titel der Originalausgabe:Burning the Books. A History of Knowledge under AttackFirst published in Great Britain in 2020 by John Murray (Publishers).Erstmals erschienen 2020 bei John Murray (Publishers).Copyright © Richard Ovenden 2020
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5339.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2021© Richard Ovenden 2020Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth, nach Entwürfen von John Murray (Publishers)
eISBN 978-3-518-76952-2
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Lyn
Motto
»Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.«
Heinrich Heine, Almansor, 1823
»Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.«
George Santayana, 1905
Bücherverbrennungen durch die Nazis, Berlin, 10. Mai 1933.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Einleitung
1 Rissiger Ton unter den Hügeln
2 Ein Scheiterhaufen aus Papyrus
3 Als Bücher spottbillig waren
4 Eine Arche zur Rettung der Gelehrsamkeit
5 Die Beute des Eroberers
6 Kafka nicht gehorchen
7 Die zweimal ausgebrannte Bibliothek
8 Die Papierbrigade
9 Ungelesen zu verbrennen
10 Sarajevo, mon amour
11 Flammen des Imperiums
12 Eine Obsession für Archive
13 Die digitale Flut
14 Das verlorene Paradies?
Schluss: Warum wir immer Bibliotheken und Archive brauchen werden
Danksagung
Bildnachweise
Anmerkungen
Einleitung
1. Rissiger Ton unter den Hügeln
2. Ein Scheiterhaufen aus Papyrus
3. Als Bücher spottbillig waren
4. Eine Arche zur Rettung der Gelehrsamkeit
5. Die Beute des Eroberers
6. Kafka nicht gehorchen
7. Die zweimal ausgebrannte Bibliothek
8. Die Papierbrigade
9. Ungelesen zu verbrennen
10. Sarajevo, mon Amour
11. Flammen des Imperiums
12. Eine Obsession für Archive
13. Die digitale Flut
14. Das verlorene Paradies?
Schluss: Warum wir immer Bibliotheken und Archive brauchen werden
Bibliografie
Register
Informationen zum Buch
Einleitung
Am 10. Mai 1933 wurde auf einem Platz in unmittelbarer Nähe der bedeutendsten Prachtstraße Berlins, Unter den Linden, ein großes Feuer entzündet. Der Ort besaß erhebliche Symbolkraft: Er lag gleich gegenüber der Universität und war umgeben von der St.-Hedwigs-Kathedrale, der Berliner Staatsoper, dem Alten Palais und der Neuen Wache, Karl Friedrich Schinkels Denkmal für die Befreiungskriege. Unter dem Jubel von annähernd vierzigtausend Schaulustigen marschierte eine Gruppe von Studenten des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes feierlich mit einer Büste des jüdischen Intellektuellen Magnus Hirschfeld (des Begründers des bahnbrechenden Instituts für Sexualwissenschaft) an das Feuer. Sogenannte »Feuersprüche« skandierend – wie: »Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat!« –, warfen sie die Büste zu den Tausenden brennenden Bänden aus der Institutsbibliothek und den aus Buchhandlungen und Leihbibliotheken geplünderten Büchern jüdischer und »undeutscher« (vor allem homosexueller und kommunistischer) Schriftsteller. Junge Männer in Nazi-Uniformen standen um das Feuer herum und hoben den Arm zum Hitlergruß. Die Studenten waren eifrig bemüht, sich bei der neuen Regierung einzuschmeicheln, und diese Bücherverbrennung war eine sorgfältig inszenierte Publicity-Aktion.1 Joseph Goebbels, Hitlers neuer Propagandaminister, hielt in Berlin eine mitreißende Rede, über die weltweit berichtet wurde:
[…] der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir Euch erziehen. […] Und deshalb tut Ihr gut daran, um diese mitternächtliche Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung […].2
Ähnliche Szenen spielten sich an diesem Abend an zahlreichen Orten im ganzen Land ab. Auch wenn viele Bibliotheken und Archive in Deutschland verschont blieben, waren die Bücherverbrennungen doch ein eindeutiges Warnsignal für den Angriff auf das Wissen, den das nationalsozialistische Regime damit eröffnete.
Noch immer ist Wissen Angriffen ausgesetzt. Auch heutzutage werden organisierte Wissensbestände attackiert, wie es in der Geschichte durchweg der Fall war. Im Laufe der Zeit haben Gesellschaften die Bewahrung des Wissens Bibliotheken und Archiven anvertraut, aber gegenwärtig sehen sich diese Institutionen vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt. Sie geraten ins Visier von Einzelpersonen, Gruppen und sogar Staaten, denen daran liegt, die Wahrheit zu leugnen und die Vergangenheit auszulöschen. Gleichzeitig erhalten Bibliotheken und Archive immer weniger finanzielle Förderung. Parallel zur fortwährenden Kürzung ihrer Ressourcen sind Technologieunternehmen herangewachsen, welche die Speicherung und Übermittlung von Wissen in digitaler Form effektiv privatisiert haben und einige Funktionen öffentlich finanzierter Bibliotheken und Archive damit in den kommerziellen Bereich verlagert haben. Diese Unternehmen haben völlig andere Motive als die Institutionen, die der Gesellschaft traditionell Wissen zugänglich gemacht haben. Wenn Unternehmen wie Google Milliarden Buchseiten digitalisieren und online verfügbar machen und wenn Firmen wie Flickr kostenlos Speicherkapazitäten im Internet bereitstellen, welchen Zweck erfüllen dann noch Bibliotheken?
Genau in einer Zeit, in der die öffentlichen Haushalte unter extremen Druck geraten sind, ist festzustellen, dass auch demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und die offene Gesellschaft bedroht sind. Die Wahrheit selbst ist in Gefahr. Das ist natürlich nichts Neues. George Orwell wies darauf schon in seinem Roman 1984 hin, und wenn wir an die Rolle denken, die Bibliotheken und Archive bei der Verteidigung der offenen Gesellschaft spielen müssen, klingen seine Äußerungen heutzutage beunruhigend zutreffend: »Es gab die Wahrheit, und es gab die Unwahrheit, und wenn man an der Wahrheit festhielt, sei es auch gegen die ganze Welt, so war man nicht verrückt.«3 Bibliotheken und Archive haben eine zentrale Bedeutung als Stützen der Demokratie, des Rechtsstaats und der offenen Gesellschaft erlangt, denn sie existieren genau zu dem Zweck, dass sie »an der Wahrheit festhalten«.
Die Vorstellung, dass es so etwas wie »alternative Fakten« geben könne, wurde im Januar 2017 von Kellyanne Conway, einer Beraterin des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, in einer berühmt-berüchtigten Äußerung nahegelegt. Damit reagierte sie auf Kritik an Trumps Behauptung, an seiner Amtseinführungszeremonie hätten mehr Zuschauer teilgenommen als vier Jahre zuvor an der Amtseinführung Barack Obamas, obwohl Bildaufnahmen und Datenmaterial das Gegenteil belegten.4 Diese Situation war eine zeitgemäße Erinnerung daran, dass die Bewahrung von Informationen auch weiterhin ein wichtiges Instrument zur Verteidigung offener Gesellschaften ist. Die Wahrheit gegen das Vordringen »alternativer Fakten« zu verteidigen bedeutet, diese Wahrheiten und die Äußerungen, die sie verleugnen, festzuhalten, damit wir Bezugspunkte haben, denen Gesellschaften vertrauen und auf die sie sich verlassen können.
Bibliotheken sind wichtig für das gesunde Funktionieren der Gesellschaft. Mittlerweile habe ich über fünfunddreißig Jahre in Bibliotheken gearbeitet, sie aber schon weitaus länger genutzt und ihren Wert erfahren. Die Motivation zu diesem Buch erwuchs aus meiner Entrüstung darüber, dass es in jüngster Zeit weltweit – bewusst wie auch versehentlich – nicht gelungen ist, sicherzustellen, dass die Gesellschaft sich auf die Bewahrung des Wissens durch Bibliotheken und Archive verlassen kann. Die wiederholten Angriffe, die diese Einrichtungen im Laufe der Jahrhunderte erfahren haben, müssen als beunruhigender Trend in der Menschheitsgeschichte untersucht werden, und es gilt die erstaunlichen Anstrengungen von Menschen zu würdigen, die das darin verwahrte Wissen zu schützen versuchen.
Die Enthüllung, dass das britische Innenministerium die sogenannten Landekarten, die das Eintreffen von Migrantinnen und Migranten der »Windrush-Generation« in Großbritannien dokumentierten, 2010 vernichtet hatte, belegt die Wichtigkeit von Archiven. Als die britische Regierung ihre Einwanderungspolitik der »feindseligen Umgebung« einleitete, verlangte sie von den Windrush-Migranten einen Beleg, dass sie durchgängig ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich hatten, und drohte andernfalls mit Ausweisung.5 Dabei hatte man ihnen die Staatsbürgerschaft nach dem British Nationality Act von 1948 zugesagt, und sie waren in gutem Glauben ins Vereinigte Königreich gekommen, das nach dem Zweiten Weltkrieg unter einem akuten Mangel an Arbeitskräften litt. Als das Innenministerium im Frühjahr 2018 zugab, dass es mindestens dreiundachtzig dieser Bürgerinnen und Bürger zu Unrecht ausgewiesen hatte, von denen elf mittlerweile verstorben waren, löste dies eine Welle öffentlicher Empörung aus.
Ich war fassungslos über diese absurde Politik, die von einem Ministerium (unter der Führung von Theresa May, die gerade Premierministerin war, als die Sache ans Licht kam) eingeleitet und aggressiv betrieben wurde, nachdem es die wichtigsten Unterlagen vernichtet hatte, die es vielen Betroffenen ermöglicht hätten, ihre Staatsbürgerschaft zu belegen.6 Obwohl die Entscheidung, die Unterlagen zu vernichten, vor der Umsetzung dieser Politik getroffen wurde und vermutlich nicht böswillig erfolgte, mag der Beschluss des Innenministeriums, an dieser feindseligen Behandlung festzuhalten, durchaus von niederen Beweggründen getragen gewesen sein. In einem Kommentar in der Financial Times wies ich darauf hin, dass die Bewahrung solchen Wissens für eine offene, gesunde Gesellschaft lebenswichtig ist, wie es seit Beginn unserer Zivilisation der Fall war.7
Seit Menschen sich zu organisierten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, die es notwendig machten, miteinander zu kommunizieren, wurde Wissen erzeugt und wurden Informationen festgehalten. In den frühesten Gesellschaften geschah dies, soweit wir wissen, in der Form mündlicher Überlieferung. Die einzigen erhalten gebliebenen Zeugnisse sind Bilder: Malereien an Höhlenwänden oder in Stein geritzte Symbole. Über die Motive hinter diesen Zeichen wissen wir nichts; darüber können Anthropologinnen und Archäologen lediglich wohlbegründete Mutmaßungen anstellen.
In der Bronzezeit verbesserten sich die Organisation und die Entwicklung der Gesellschaften. Als Nomadengruppen sesshaft wurden und anfingen, feste Gemeinschaften mit Ackerbau und frühem Handwerk zu etablieren, entwickelten sie auch Hierarchien mit herrschenden Familien, Stammesoberhäuptern und anderen, die ihre Gemeinschaft anführten.
Ab etwa 3000 v. Chr. begannen diese Gesellschaften mit schriftlichen Aufzeichnungen. Aus diesen ältesten Archiven und den darin entdeckten Dokumenten kennen wir eine erstaunliche Fülle von Details über die Funktionsweise dieser Gemeinschaften.8In anderen Schriftzeugnissen begannen Menschen, ihre Gedanken, Vorstellungen, Beobachtungen und Geschichten festzuhalten. Sie wurden in den ältesten Bibliotheken aufbewahrt. Schon bald erforderte diese Organisation des Wissens die Entwicklung spezieller Fertigkeiten, die unter anderem die Aufzeichnung dieses Wissens und Techniken des Kopierens umfassten. Im Laufe der Zeit erwuchsen aus diesen Aufgaben eigene Berufsstände, die grobe Ähnlichkeit mit denen heutiger Bibliothekarinnen und Archivare hatten. »Bibliothekar« leitet sich aus dem griechischen Wort für »Buch« ab, biblios, »Archivar« aus dem lateinischen Begriff archivum, der sowohl Schriftzeugnisse als auch ihren Aufbewahrungsort bezeichnet und wiederum von dem griechischen Wort archeion für »Amtsgebäude« abstammt. Bibliotheken und Archive wurden damals jedoch nicht aus den gleichen Gründen geführt wie heute, und es wäre gefährlich, einfache Parallelen zwischen diesen antiken Sammlungen und den heutigen zu ziehen. Dennoch schufen diese Gesellschaften einen Wissenskorpus und entwickelten für dessen Organisation Handwerkszeug, von dem wir vieles noch heute kennen, wie beispielsweise Kataloge und Metadaten.9
Die Rollen des Bibliothekars und des Archivars gingen häufig einher mit anderen Aufgaben wie denen eines Priesters oder Verwaltungsbeamten und wurden im antiken Griechenland und Rom klarer umrissen und augenfälliger, wo Bibliotheken eher öffentlich zugänglich waren und die Haltung, dass der Zugang zu Wissen ein wesentliches Element einer gesunden Gesellschaft ist, allmählich Fuß fasste.10 In einer erhalten gebliebenen Liste der Männer, die im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. die große Bibliothek von Alexandria leiteten, finden sich viele führende Gelehrte ihrer Zeit wie Appollonios von Rhodos (dessen epische Dichtung über Jason und das Goldene Vlies Vergil zur Aeneis inspirierte) und Aristophanes von Byzanz (der Erfinder einer der ältesten Formen der Interpunktion).11
Orte zur Aufbewahrung von Wissen standen von Anfang an im Zentrum der Entwicklung von Gesellschaften. Obwohl sich die Techniken der Erzeugung und Bewahrung von Wissen radikal gewandelt haben, haben sich die Kernfunktionen dieser Orte erstaunlich wenig verändert. In erster Linie sammeln, organisieren und bewahren Bibliotheken und Archive Wissen. Durch Schenkung, Übertragung und Ankauf tragen sie Schrifttafeln, Schriftrollen, Bücher, Zeitschriften, Manuskripte, Fotografien und viele andere Dokumentationsformen der Zivilisation zusammen. In jüngster Zeit sind zu diesen Formaten noch die digitalen Medien hinzugekommen, von Textdateien bis hin zu E-Mails, Internetseiten und Inhalten aus den sozialen Medien. In der Antike und im Mittelalter hatte die Organisation von Bibliotheken heilige Anklänge: Die Archive der Königreiche Mesopotamiens befanden sich häufig in Tempeln, und König Philipp II. August von Frankreich schuf den »Trésor de Chartes« (Dokumentenschatz), eine erste »mobile« Dokumentensammlung, die ab 1254 jedoch in eigens für diesen Zweck gebauten Räumen in der Palastkapelle Sainte-Chapelle in Paris untergebracht war.12
Bibliotheken und Archive erstellen und veröffentlichen ihre Kataloge, stellen Leseräume bereit, fördern Bildung, publizieren Bücher, veranstalten Ausstellungen, digitalisieren mittlerweile Texte und sind – und waren – damit Teil der umfassenderen Geschichte der Verbreitung von Ideen. Die Schaffung von Nationalbibliotheken ab dem 18. Jahrhundert und von öffentlichen Leihbibliotheken ab dem 19. Jahrhundert erweiterte die Rolle erheblich, die diese Einrichtungen im gesellschaftlichen Wandel spielten.
Im Zentrum steht das Bewahren. Wissen kann verletzlich, anfällig und instabil sein. Papyrus, Papier und Pergament sind leicht brennbar. Wasser kann sie ebenso beschädigen wie hohe Luftfeuchtigkeit, die sie verrotten lässt. Bücher und Dokumente können gestohlen, unleserlich gemacht und gefälscht werden. Digitale Dateien können sogar noch flüchtiger sein, da Technologien schnell veralten, magnetische Speichermedien nicht lange haltbar sind und im Internet bereitgestellte Inhalte besonders ungeschützt sind. Wie jeder weiß, der schon einmal auf einen toten Hyperlink gestoßen ist, kann es ohne Bewahrung keinen Zugang geben.
Archive unterscheiden sich von Bibliotheken. Letztere sind Sammlungen, die Buch für Buch und häufig mit großer strategischer Zielstrebigkeit aufgebaut werden. Archive hingegen dokumentieren die Vorgänge und Entscheidungsprozesse von Institutionen, Verwaltungen und Staaten. Ein Teil dieses Materials findet sich zwar oft auch in Bibliotheken – etwa die gedruckten Ausgaben des Journal of the House of Commons –, aber Archive sind ihrem Wesen nach voller oftmals profaner Unterlagen, die nicht dazu gedacht sind, dass ein Massenpublikum sie liest. Während Bibliotheken sich mit Vorstellungen, Ambitionen, Entdeckungen und Fantasien befassen, enthalten Archive Details über routinemäßige, aber wichtige Angelegenheiten des Alltagslebens: Grundbesitz, Importe und Exporte, Sitzungsprotokolle und Steuerunterlagen. Listen spielen häufig eine wesentliche Rolle, und ganz gleich ob es sich dabei um Listen der in einer Volkszählung erfassten Bürgerinnen oder der per Schiff eingetroffenen Einwanderer handelt: Archive stehen im Zentrum der Geschichte, da sie die Umsetzung der in Büchern festgehaltenen Ideen und Gedanken dokumentieren.
Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass die Bedeutung von Büchern und Archivmaterial nicht nur von Menschen erkannt wird, die das Wissen bewahren wollen, sondern auch von denjenigen, die es vernichten möchten. Bibliotheken und Archive waren im Laufe der Geschichte immer Angriffen ausgesetzt. Und zuweilen haben die Menschen, unter deren Obhut sie standen, für die Bewahrung von Wissen ihr Leben riskiert und auch verloren.
Ich möchte eine Reihe von historischen Schlüsselepisoden untersuchen, um verschiedene Motive für die Zerstörung von Wissensspeichern sowie die Schutzmaßnahmen aufzuzeigen, die einschlägige Berufsgruppen dagegen entwickelt haben. Die Einzelfälle, auf die ich mich konzentriere (ich hätte noch Dutzende andere auswählen können), sagen uns etwas über die Zeit, in der sie stattgefunden haben, und sind jeder für sich faszinierend.
Die Motive von Staaten, die nach wie vor Geschichte auslöschen, betrachte ich im Kontext der Archive. Da Wissen zunehmend in digitaler Form erzeugt wird, beleuchte ich die Herausforderungen, die dieser Umstand für die Wissensbewahrung und die Gesundheit offener Gesellschaften mit sich bringt. Am Ende dieses Buches stehen einige Vorschläge, wie Bibliotheken und Archive sich in ihrem heutigen politischen und finanziellen Kontext besser unterstützen ließen, und zum Abschluss zeige ich fünf gesellschaftliche Funktionen dieser Institutionen auf, um Menschen in Machtpositionen ihren Wert zu verdeutlichen.
Bibliotheken und Archive selbst vernichten täglich Wissen. Regelmäßig mustern sie doppelt vorhandene Bücher aus, wenn nur ein Exemplar gebraucht wird. Kleinere Bibliotheken werden häufig in größere eingegliedert, ein Vorgang, der gewöhnlich dazu führt, dass die größere Bibliothek das Wissen bewahrt, aber gelegentlich geht dabei versehentlich oder auch absichtlich einmaliges Material verloren. Ein für Archive zentraler Vorgang ist die Entscheidung darüber, welche Unterlagen weggeworfen und welche aufbewahrt werden. Nicht alles kann und sollte aufbewahrt werden. Auch wenn das Historikern zuweilen empörend und unbegreiflich erscheinen mag, ist die Vorstellung, dass man jedes Dokument verwahren sollte, aus wirtschaftlichen Gründen unhaltbar. Viele der Informationen, die im Laufe dieses Prozesses vernichtet werden, werden bereits andernorts aufbewahrt.
Auswahl, Erwerb und Katalogisierung wie auch das Wegwerfen und Bewahren sind niemals neutrale Akte. Sie erfolgen durch Menschen, die in ihrem jeweiligen sozialen und zeitlichen Kontext arbeiten. Die Bücher und Zeitschriften, die heute auf Bibliotheksregalen stehen oder in unseren digitalen Bibliotheken zugänglich gemacht werden, und die Dokumente und Akten in unseren Archiven befinden sich dort aufgrund menschlichen Handelns. Das Vorgehen der Menschen, die am Aufbau von Sammlungen beteiligt waren, war also von deren Vorlieben, Vorurteilen und Persönlichkeit beeinflusst. In den Beständen der meisten Bibliotheken und Archive gibt es große Leerstellen, ein »Schweigen«, das die Repräsentation beispielsweise nichtweißer Menschen oder Frauen in der historischen Überlieferung beeinträchtigt hat. Alle, die heutzutage diese Sammlungen nutzen, müssen sich dieser Zusammenhänge bewusst sein. Auch die Leserinnen und Leser dieses Buches sollten diese historischen Kontexte berücksichtigen und daran denken, dass Menschen früherer Zeiten anders mit Dingen umgingen.
Wenn wir die Geschichte von Bibliotheken und die Entwicklung ihrer Bestände im Laufe der Zeit untersuchen, erzählen wir in gewisser Weise vom Überleben des Wissens. Jedes einzelne Buch, das sich heutzutage in diesen Einrichtungen findet, sämtliche Sammlungen, die zusammen einen umfassenderen Wissenskorpus ergeben – sie alle sind Überlebende.
Bis zum Aufkommen digitaler Datenspeicherung verfügten Bibliotheken und Archive über hoch entwickelte Strategien, ihre Sammlung zu bewahren, und zwar auf Papier. Ihre Verantwortung teilten die Institutionen mit ihren Leserinnen. So müssen noch heute alle neuen Nutzer der Bodleian Library sich wie seit über vierhundert Jahren explizit verpflichten, »keinerlei Feuer oder offene Flamme in die Bibliothek zu bringen oder darin anzuzünden«. Im Zentrum der Erhaltungsstrategien stehen gleichbleibende Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeit, Vorkehrungen gegen Überschwemmungen und Brände sowie eine gut organisierte Magazinierung. Digitale Datenspeicherung ist ihrem Wesen nach weniger stabil und erfordert eine weitaus proaktivere Herangehensweise nicht nur an die Technologie (wie Dateiformate, Betriebssysteme und Software). Diese Herausforderungen wurden noch verstärkt durch die breite Nutzung von Internetdiensten großer Technologieunternehmen, vor allem solcher im Social-Media-Bereich, die Wissensbewahrung nach rein kommerziellen Erwägungen betreiben.
Da das Gedächtnis der Welt zunehmend online gestellt wird, wird es effektiv an die großen Technologieunternehmen outgesourct, die gegenwärtig das Internet beherrschen. Früher bedeutete der Ausdruck »etwas nachschlagen«, einen Begriff im Register eines gedruckten Buches oder unter dem passenden alphabetischen Eintrag in einer Enzyklopädie oder einem Wörterbuch zu suchen. Heutzutage bedeutet es, ein Wort, einen Begriff oder eine Frage in das Suchfeld einer Suchmaschine zu tippen und den Computer den Rest erledigen zu lassen. Früher legte die Gesellschaft großen Wert darauf, das Gedächtnis des Einzelnen zu trainieren, und entwickelte sogar ausgeklügelte Übungen, die das Auswendiglernen verbesserten. Diese Zeiten sind vorbei. Aber die Bequemlichkeit des Internets birgt auch Gefahren, da die großen Technologiekonzerne eine beträchtliche Kontrolle über unser digitales Gedächtnis ausüben. Manche Organisationen, auch Bibliotheken und Archive, bemühen sich mittlerweile intensiv darum, die Kontrolle wiederzuerlangen, indem sie Webseiten, Blog-Posts, Social-Media-Einträge und sogar E-Mails und andere persönliche digitale Sammlungen selbst speichern und aufbewahren.
»Wir ertrinken in Informationen, aber hungern nach Wissen«, schrieb John Naisbitt bereits 1982 in seinem Buch Megatrends.13 Seitdem wurde der Begriff der »digitalen Überfülle« geprägt, der einen wichtigen Aspekt der digitalen Welt zu begreifen hilft, über den ich in meinem Alltag als Bibliothekar häufig nachdenke.14 Die Menge an digitalen Informationen, zu denen jeder Nutzer, der über einen Computer und einen Internetanschluss verfügt, Zugang hat, ist überwältigend groß – zu groß, um sie zu erfassen. Bibliothekarinnen und Archivare treibt mittlerweile die Frage um, wie man die Suche in der Masse des verfügbaren Wissens effektiv gestalten kann.15
Die digitale Welt ist voller Gegensätze. Einerseits waren die Erzeugung von Wissen sowie das Kopieren von Texten, Bildern und anderen Informationsträgern niemals einfacher. Mittlerweile ist das Speichern digitaler Informationen in großem Stil nicht nur möglich, sondern auch erstaunlich kostengünstig. Aber Speichern ist nicht dasselbe wie Bewahren. Das auf Internetplattformen gespeicherte Wissen läuft Gefahr, verlorenzugehen, da digitale Informationen erstaunlich anfällig sowohl für Vernachlässigung als auch für mutwillige Vernichtung sind. Zudem besteht das Problem, dass das Wissen, das wir durch unsere tagtäglichen Interaktionen schaffen, für die meisten von uns unsichtbar ist, sich aber für kommerzielle und politische Zwecke manipulieren und gegen die Gesellschaft verwenden lässt. Es mag für diejenigen, die sich um den Schutz von Persönlichkeitsrechten sorgen, kurzfristig wünschenswert scheinen, dass dieses Wissen vernichtet wird, aber letztlich könnte dies der Gesellschaft ebenfalls schaden.
Ich habe das Glück, in einer der größten Bibliotheken der Welt zu arbeiten. Die Bodleian Library in Oxford wurde 1598 gegründet, öffnete ihre Pforten 1602 erstmals für Leser und besteht seitdem ununterbrochen. Durch die Arbeit in einer solchen Einrichtung bin ich mir der Leistungen früherer Bibliothekare ständig bewusst. Im Bestand der Bodleian Library befinden sich gegenwärtig weit über 13 Millionen Bücher sowie zahlreiche Regalkilometer an Manuskripten und Archivmaterial. Sie hat eine breit gestreute Sammlung aufgebaut, die unter anderem Millionen Landkarten, Partituren, Fotografien, Grafiken und unzählige andere Dinge umfasst. Dazu gehören Petabyte an digitalen Informationen wie Zeitschriften, Datensätze, Bilder, Texte und E-Mails. Diese Sammlungen sind in vierzig Gebäuden untergebracht, die aus dem 15. bis 21. Jahrhundert stammen und jeweils eine eigene faszinierende Geschichte haben.
Im Bestand der Bodleian Library finden sich nicht nur die erste Folio-Ausgabe der Werke Shakespeares (1623) und eine Gutenberg-Bibel (um 1450), sondern auch Manuskripte und Dokumente aus der ganzen Welt – zum Beispiel die Selden-Karte von China aus der späten Ming-Periode oder eine meisterhafte Bilderhandschrift des Alexanderromans aus dem 14. Jahrhundert. Die faszinierende Geschichte dieser Objekte erzählt davon, wie sie die Zeitläufte überstanden und den Weg in den Bestand der Bodleian Library gefunden haben. Eigentlich ist die Bodleian Library ein Konglomerat verschiedener Sammlungen, und die Geschichten, wie sie dorthin gekommen sind, haben zu dem Ruhm beigetragen, den sie in den vergangenen vierhundert Jahren erlangt hat.16
Bis zu meinem 19. Lebensjahr formte die Möglichkeit, die öffentliche Bibliothek in meiner Heimatstadt Deal zu nutzen, meinen Bildungsweg. In diesem Gebäude entdeckte ich die Freude am Lesen. Anfangs war es eine Alltagsflucht mithilfe von Science-Fiction-Romanen (besonders von Isaac Asimov, Brian Aldiss und Ursula K. Le Guin), später las ich Autoren wie Thomas Hardy und D. H. Lawrence, aber auch ausländische Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Hermann Hesse, Nikolai Gogol, Colette und viele weitere. Als ich feststellte, dass ich dort auch Schallplatten ausleihen konnte, entdeckte ich, dass die klassische Musik mehr zu bieten hatte als Tschaikowskys Ouvertüre 1812: Beethoven, Vaughan Williams, Mozart. Ich konnte die »ernsthaften« Zeitungen und The Times Literary Supplement lesen. Alles kostenlos – was entscheidend war, da meine Familie nicht wohlhabend war und kaum Geld hatte, um Bücher zu kaufen.
Die Bibliothek wurde (und wird) von der Kommune betrieben, die Nutzung der meisten ihrer Dienstleistungen ist kostenlos und sie wird nach dem 1850 verabschiedeten Public Libraries Act aus örtlichen Steuereinnahmen finanziert. Damals gab es politischen Widerstand gegen diese Idee. Als das Gesetz seinen Weg durch das Parlament nahm, äußerte sich der konservative Abgeordnete Colonel Sibthorp skeptisch zur Bedeutung des Lesens für die Arbeiterklasse. Seine Begründung: »Ich selbst habe nie gerne gelesen und es während meiner Studienzeit in Oxford gehasst.«17
Das durch dieses Gesetz geschaffene System öffentlicher Bibliotheken ersetzte den Flickenteppich aus Leihbüchereien, die von Stiftungen und Pfarrgemeinden betrieben wurden, aus Büchersammlungen in Cafés und Leseräumen für Fischer, aus Lesegesellschaften und Buchclubs, die aus dem age of improvement, dem »Zeitalter der Verbesserung«, und dem Konzept »nützlichen Wissens« hervorgegangen waren. Dieser Begriff erwuchs aus den Ideen des 18. Jahrhunderts. So gründete eine Gruppe Prominenter, zu denen Benjamin Franklin gehörte, 1767 die American Philosophical Society, um »nützliches Wissen zu fördern«. Die Royal Institution entstand 1799 in Großbritannien zu dem Zweck, »die Verbreitung von Wissen zu fördern und die allgemeine Einführung nützlicher mechanischer Erfindungen und Verbesserungen zu erleichtern«. Beide Organisationen verfügten über Bibliotheken, die ihre Arbeit unterstützten.
Bibliotheken waren wesentlicher Bestandteil einer breiteren Bewegung, die zum Wohle des Einzelnen wie auch der gesamten Gesellschaft die Allgemeinbildung fördern wollte. Gut hundert Jahre später schrieb Sylvia Pankhurst, die inspirierende Verfechterin der Frauenrechte, an den Leiter des British Museum und bat um die Erlaubnis, den Lesesaal der Bibliothek zu benutzen, »da ich verschiedene staatliche Publikationen und andere Werke konsultieren möchte, zu denen ich auf keinem anderen Wege Zugang erlangen kann«. Am Ende ihres Antragsschreibens führte sie das Thema ihrer Studien an: »Informationen über die Erwerbsarbeit von Frauen zu erlangen«.18
Der Public Libraries Act ermöglichte es Kommunen, öffentliche Bibliotheken einzurichten und diese über Kommunalsteuern zu finanzieren, allerdings zunächst auf freiwilliger Basis. Erst 1964 verpflichtete der Public Libraries and Museums Act Städte und Gemeinden, Bibliotheken zu unterhalten – ein System, das bis heute im öffentlichen Bewusstsein einen hohen Stellenwert als geschätzte Dienstleistung und Teil der nationalen Infrastruktur für die öffentliche Bildung besitzt.19
Trotz alledem haben öffentliche Bibliotheken im Vereinigten Königreich einen Großteil des Drucks abbekommen, dem die kommunalen Haushalte durch die Politik in Westminster ausgesetzt waren.20 Die Kommunalverwaltungen mussten mit knappen Mitteln zurechtkommen, was schwierige Entscheidungen bedeutete, und viele nahmen Kürzungen bei Bibliotheken und lokalen Archiven vor. Nach dem Stand von 2018/2019 gibt es im Vereinigten Königreich 3583 öffentliche Bibliotheken gegenüber 4356 in 2009/2010. Anders gesagt: 773 Einrichtungen wurden geschlossen. In vielen Gemeinden sind Bibliotheken inzwischen in ihrem Betrieb zunehmend auf ehrenamtliche Kräfte angewiesen, da die Zahl der in diesem Sektor fest angestellten Personen auf unter 16 000 gesunken ist.21
Weltweit ist die Bewahrung von Wissen ein heikler Kampf. Nach dem Zusammenbruch des Apartheidsystems ging es in Südafrika darum, die von Gewalt und Unterdrückung zerrissene Gesellschaft zu heilen. Um diesen Prozess zu unterstützen, verfolgte man den Ansatz, »das Leid der Vergangenheit wahrheitsgetreu zu dokumentieren, damit eine geeinte Nation in den gewaltigen Aufgaben des Wiederaufbaus auf diese Vergangenheit als Kraft zurückgreifen kann, die sie zusammenschweißt«.22 Als ein Mittel, »ihre schwierige Vergangenheit zu bewältigen«, wurde eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung eingerichtet.23 Sie sollte den friedlichen Wandel des Landes unterstützen und ihm zugleich helfen, sich seiner jüngsten Geschichte und ihren Auswirkungen auf Individuuen und die Gesellschaft als ganze zu stellen und sie zu verarbeiten. Ihre Arbeit hatte politische und rechtliche Aspekte, verfolgte aber auch geschichtswissenschaftliche, moralische und psychologische Ziele, und eine der im Promotion of National Unity and Reconciliation Act genannten Zielsetzungen war, »ein möglichst vollständiges Bild von Art, Ursachen und Ausmaß grober Menschenrechtsverletzungen« zu erstellen. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Nationalarchiv Südafrikas, dessen Belegschaft eng in die Aufgabe einbezogen war, sicherzustellen, dass die Vergangenheit akkurat dokumentiert und die Ergebnisse den Menschen zugänglich gemacht wurden. Der Schwerpunkt lag in Südafrika jedoch nicht auf der Öffnung der Staatsarchive, um »Art, Ursachen und Ausmaß« dessen, was schiefgelaufen war, herauszufinden, wie es nach dem Zusammenbruch des Sozialismus 1989 in Ostdeutschland der Fall war, sondern auf den Anhörungen selbst, und die Zeugenaussagen schufen eine tiefgreifende Oral History, aus der ein neues Archiv entstand.
In Südafrikas Apartheidsystem hatten Beamte in großem Maßstab Dokumente vernichtet. Das behinderte die Arbeit der Truth and Reconciliation Commission erheblich; in ihrem Abschlussbericht widmete sie der Vernichtung von Unterlagen ein ganzes Kapitel und stellte unumwunden fest: »Die Geschichte der Apartheid ist unter anderem die Geschichte der systematischen Auslöschung Tausender Stimmen, die Teil des Gedächtnisses der Nation hätten sein sollen.« Der Bericht gab die Schuld dem Staat: »Das Tragische ist, dass die frühere Regierung gezielt und systematisch einen Großteil staatlicher Unterlagen und Dokumente in dem Bestreben vernichtete, belastendes Material zu beseitigen und dadurch die Geschichte der unterdrückerischen Herrschaft zu beschönigen.« Die Beseitigung dieser Unterlagen rückte ins Licht, wie wichtig sie waren: »[…] die massenhafte Vernichtung von Dokumenten […] hatte schwerwiegende Auswirkungen auf das gesellschaftliche Gedächtnis Südafrikas. Eine Fülle offizieller Dokumente vor allem zur inneren Arbeitsweise des Sicherheitsapparats des Apartheidstaates wurden aus der Erinnerung getilgt.«24 Im Irak hat man viele wichtige Unterlagen nicht vernichtet, sondern in die Vereinigten Staaten gebracht, wo sich einige bis heute befinden (siehe Kapitel 12). Ihre Rückkehr könnte Teil eines Prozesses nationaler »Wahrheit und Versöhnung« in diesem vom Bürgerkrieg so zerrissenen Land sein.
Bibliotheken und Archive sind mitverantwortlich dafür, Wissen für die Gesellschaft zu bewahren. Dieses Buch ist nicht nur entstanden, um die Zerstörung dieser Institutionen in der Vergangenheit ins Licht zu rücken, sondern auch um zu würdigen, wie Bibliothekare und Archivare sich dagegen gewehrt haben. Durch ihre Arbeit wurde Wissen von einer Generation an die nächste weitergegeben und bewahrt, damit die Menschen und die Gesellschaft sich weiterentwickeln und sich von diesem Wissen inspirieren lassen können.
In einem berühmten Brief verglich Thomas Jefferson 1813 die Verbreitung von Wissen mit dem Anzünden einer Kerze an einer anderen Kerzenflamme: »Derjenige, welcher eine Idee von mir erhält, bekommt von mir Erkenntnis, ohne die meine zu verringern; ebenso wie derjenige, der seine Wachskerze an meiner anzündet, Licht erhält, ohne meines zu verdunkeln.«25 Bibliotheken und Archive sind Institutionen, die Jeffersons Versprechen der Kerze erfüllen – ein wesentlicher Bezugspunkt für Ideen, Fakten und Wahrheit. Wie sie die Herausforderungen gemeistert haben, die Flamme des Wissens zu bewahren und die Erleuchtung anderer zu ermöglichen, ist eine komplexe Geschichte.
Einzelne Anekdoten in diesem Buch geben Aufschluss über die vielfältigen Angriffe, die Wissen im Laufe der Geschichte erfahren hat. Jeffersons Kerze brennt bis heute weiter, dank der außerordentlichen Bemühungen der Bewahrerinnen und Bewahrer des Wissens: der Sammler, Gelehrten, Schriftsteller und vor allem der Bibliothekare und Archivare, die die andere Hälfte dieser Geschichte bilden.
1
Rissiger Ton unter den Hügeln
Der antike griechische General und Geschichtsschreiber Xenophon schildert in seinem berühmtesten Werk, der Anabasis, die dramatische Geschichte, wie er eine gestrandete Armee von zehntausend griechischen Söldnern aus Mesopotamien zurück nach Griechenland führte. Nach seiner Beschreibung zog das Heer mitten durch das Gebiet des heutigen Irak und machte am Tigrisufer Rast an einem Ort, den er Larisa nannte.1 Als er die Umgebung betrachtete, bemerkte er eine riesige verlassene Stadt mit hoch aufragender Stadtmauer. Von dort marschierten sie weiter zu einer anderen Stadt namens Mespila, von der Xenophon behauptet: »Meder hatten sie einst bewohnt.« Dort habe Medea, die Frau des Königs, Zuflucht gesucht, als die Perser das Reich belagerten. Der Perserkönig hatte die Stadt laut Xenophon nicht einnehmen können, aber »Zeus erschreckte die Einwohner mit Donner, und so kam sie zu Fall«.2
Austen Henry Layard zeichnet Skizzen in Nimrud.
Was Xenophon in dieser antiken Landschaft sah, waren die Überreste der Städte Nimrud (Larisa) und Ninive (Mespila), die Zentren des großen Assyrerreiches, die unter der Herrschaft des berühmt-berüchtigten und imposanten Königs Assurbanipal florierten. Nach Assurbanipals Tod wurde Ninive 612 v. Chr. von einer Allianz aus Babyloniern, Medern und Skythen zerstört. Xenophon verwechselt die Assyrer (die diese Stadt bewohnt hatten) mit den Medern (die sie erobert hatten) und die Meder mit den Persern, der östlichen Großmacht seiner Zeit.3
Ich finde die Vorstellung erstaunlich, dass Xenophon diese großartigen Erdhügel vor über zweitausend Jahren betrachtete, dass die Ruinen bereits viele Jahrhunderte alt waren, als er sie sah, und dass die Ereignisse, durch die diese Städte zerstört wurden, selbst für diesen großen Historiker bereits im Dunkeln lagen. Die Griechen verstanden sich als die Pioniere der Bibliotheken, und zu der Zeit, als Xenophon schrieb, besaß die griechische Welt eine lebendige Buchkultur, in der Bibliotheken eine wesentliche Rolle spielten. Xenophon hätte sicher begeistert reagiert, wenn er von der wunderbaren Bibliothek erfahren hätte, die tief unter der Erdoberfläche erhalten geblieben ist und eines Tages die Geschichte ihres antiken Gründers Assurbanipal erzählen sollte.
Allerdings dauerte es noch weitere zweitausendzweihundert Jahre, bis Assurbanipals große Bibliothek entdeckt wurde und die umfassende Geschichte dieses Reiches (und seiner Vorgänger und Nachbarn) anhand archäologischer Funde an vielen seither erkundeten assyrischen Grabungsstätten, vor allem aber anhand der dort gefundenen Dokumente entschlüsselt werden konnte.
In der langen Menschheitsgeschichte erscheint die Schrift als eine derart junge Technik, dass die Mutmaßung verlockend erscheint, die ältesten Zivilisationen hätten Wissen in erster Linie mündlich weitergegeben. Diese Kulturen aus der Region um die heutigen Staaten Türkei, Syrien, Irak und Iran hinterließen große, imposante Überreste – Bauwerke und Gegenstände, die oberirdisch und bei archäologischen Grabungen gefunden wurden –, aber sie hinterließen auch Dokumente, die eindeutig belegen, dass bereits in den Jahrhunderten vor der ägyptischen, mykenischen, persischen und schließlich griechischen und römischen Kultur neben mündlichen Überlieferungen auch Schriftzeugnisse existierten. Sie offenbaren sehr viel über diese Kulturen. Die Assyrer und ihre benachbarten Völker besaßen eine hoch entwickelte Dokumentationskultur und haben uns ein reiches geistiges Erbe hinterlassen.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten rivalisierende europäische Großmächte erhebliches Interesse an den Gebieten, die Xenophon um die Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert v. Chr. beschrieben hatte. Dieses Interesse trug dazu bei, die Wissenskultur wiederzuentdecken, die diese Zivilisationen entwickelt hatten, und dabei nicht nur einige der ältesten Bibliotheken und Archive der Erde, sondern auch Belege für uralte Angriffe auf das Wissen zu finden.
Die britische Präsenz in dieser Region war ursprünglich den Aktivitäten der East India Company zu verdanken, jener Triebkraft imperialer Expansion, die Handel mit dem Einsatz militärischer und diplomatischer Macht verknüpfte. Einer ihrer hochrangigen Angestellten in der Region war Claudius James Rich, ein talentierter Kenner orientalischer Sprachen und Antiquitäten, den seine Zeitgenossen für den mächtigsten Mann in Bagdad neben dem örtlichen osmanischen Herrscher, dem Pascha, hielten, »und es war sogar die Frage, ob der Pascha selbst nicht bisweilen sein Betragen mehr nach den Vorschlägen und dem Rathe von jenem, als nach den Wünschen seines eigenen Divans einrichtete«.4 Um seinen »unersättlichen Hunger, neue Länder zu sehen«,5 zu stillen, hatte Rich es sogar geschafft, verkleidet in die Große Moschee in Damaskus vorzudringen, was für einen westlichen Besucher damals schwierig gewesen sein dürfte.6 Rich unternahm ausgedehnte Reisen in dieser Region, studierte eingehend deren Geschichte und Altertümer und sammelte Manuskripte, die das British Museum nach seinem Tod erwarb. Erstmals besuchte Rich 1820/1821 Ninive und den großen Hügel Kujundschik (wie er im osmanischen Türkisch hieß), der sich im Zentrum der assyrischen Stadt befand. Während dieses Besuchs grub Rich eine Tafel mit Keilschrift aus, die aus Assurbanipals Palast erhalten geblieben war. Es war die erste von Zigtausenden solcher Tafeln, die man an dieser Stätte finden sollte.
Rich verkaufte seine Sammlung amateurhaft ausgegrabener Artefakte an das British Museum. Als die ersten Keilschrifttafeln in London eintrafen, lösten sie eine Welle fieberhaften Interesses an dieser Region und Spekulationen über etwaige Schätze aus, die dort im Boden verborgen liegen mochten. In London sah Julius Mohl, der Sekretär der französischen Société Asiatique, diese Sammlung und las Richs veröffentlichte Reiseberichte. Umgehend ermutigte er die französische Regierung, eine eigene Expedition nach Mesopotamien zu schicken, damit sie zum Ruhm der französischen Forschung mit den Briten mithalten könne. So wurde Paul-Émile Botta, ein französischer Gelehrter, als Konsul nach Mosul geschickt und mit ausreichenden Mitteln für eigene Grabungen ausgestattet, die 1842 begannen. Es waren die ersten ernstzunehmenden Ausgrabungen in der Region, und ihre Veröffentlichung in dem von Eugène Flandin prachtvoll illustrierten Buch Monument de Ninive, das 1849 in Paris erschien, machte sie in der europäischen Elite berühmt. Es ist nicht bekannt, wann und wo, aber irgendwann blätterte ein abenteuerlustiger junger Brite namens Austen Henry Layard dieses Werk mit wachsendem Staunen durch.
Layard wuchs in einer wohlhabenden Familie auf dem Kontinent auf und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Italien, wo er eifrig las und sich besonders von den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht beeindrucken ließ.7 Er entwickelte eine Vorliebe für Altertümer, Kunst und Reisen, und sobald er alt genug war, bereiste er den Mittelmeerraum und das Osmanische Reich und besuchte schließlich das Land, das wir heute Irak nennen, zunächst in Begleitung eines älteren Engländers namens Edward Mitford, später allein. In Mosul traf er Botta, der ihm von seinen Entdeckungen im Hügel Kujundschik erzählte – möglicherweise sah Layard dort auch ein Exemplar von Monument de Ninive.8 Begeistert begann Layard mit Grabungen und setzte dazu in der Hochphase bis zu hundertdreißig einheimische Arbeitskräfte ein. Obwohl die wissenschaftliche Archäologie damals noch in den Kinderschuhen steckte, war seine Arbeit erstaunlich professionell und produktiv. Anfangs wurde sie privat von Stratford Canning, dem britischen Botschafter in Konstantinopel finanziert, da die Ausgrabungen im Rahmen der Rivalitäten zwischen Frankreich und Großbritannien stattfanden. Knapp sechs Jahre lang beaufsichtigte und unterstützte Hormuzd Rassam, ein chaldäischer Christ aus Mosul und Bruder des britischen Vizekonsuls, die Arbeiter aus den örtlichen Stämmen. Layard und er wurden gute Freunde und Kollegen. Ab 1846 diente Rassam Layard als Sekretär und Zahlmeister, brachte sich aber auch intellektuell in das Unternehmen ein. Sein Anteil an diesen sensationellen Ausgrabungen hat weniger Beachtung gefunden, als er verdient, teils weil ihm das Geschick fehlte, mit prompten Veröffentlichungen seiner Funde auf sich aufmerksam zu machen, teils weil manche seiner Erfolge durch rassistische Verleumdungen unterminiert wurden, und so waren seine letzten Jahre von Rechtsstreitigkeiten und Desillusionierung geprägt. Dank seines Organisationstalents machte Rassam die Ausgrabungen zu einem großen Erfolg, er trug jedoch außerdem zur Interpretation der Keilschrift bei, und nachdem Layard nach Großbritannien zurückgekehrt war, um eine politische Karriere anzustreben, leitete Rassam weiter bedeutende archäologische Ausgrabungen im Irak, die vom British Museum finanziert wurden.9
Im Laufe der Grabungen stießen sie auf riesige Kammern voller Tontafeln. Layard und sein Team hatten nicht nur Wissensfragmente aus dem Assyrerreich entdeckt, sondern dessen zentrale Institution: die große Bibliothek Assurbanipals. Gut 28 000 Tontafeln wurden ins British Museum gebracht, Tausende weitere befinden sich gegenwärtig in anderen Einrichtungen.10
In den Kammern stapelten sich Tontafeln bis zu einem Fuß hoch, manche zerbrochen, andere wie durch ein Wunder über Jahrtausende unversehrt. Hinter einer Tür, »welche von Fischgöttern gehütet wird«, wie Layard schrieb, waren »die Decrete der assyrischen Könige und die Archive des Reiches niedergelegt«.11 Manche enthielten »historische Daten über Kriege«, wie er vermutete, »andere scheinen königliche Decrete zu sein und diese sind mit dem Namen eines Königs, des Sohnes Asarhaddons bezeichnet; noch andere, in parallele Columnen durch Horizontallinien getheilt, enthalten Verzeichnisse der Götter und vermutlich auch der Opfer, die in den Tempeln derselben dargebracht wurden«.12 Besonders bemerkenswert waren zwei Fragmente von Tonsiegeln mit den königlichen Signeten eines ägyptischen Königs, Shabaka oder Sabaco, und eines assyrischen Monarchen (vermutlich Sennacherib). Layard vermutete, dass sie einen Friedensvertrag besiegelten. Solche Funde sollten einen Prozess in Gang bringen, der legendäre Ereignisse auf eine durch Dokumente belegte Grundlage stellte. Die Erforschung der Sprache, Literatur, Überzeugungen und Organisation dieser alten Zivilisationen setzt sich bis heute fort.
Ich hatte das Glück, einige mesopotamische Tontafeln selbst in die Hand nehmen und sehen zu dürfen, auf welche bahnbrechende Art und Weise antike Gemeinschaften Wissen dokumentierten. Ich habe verschiedene Tontafeln im Ashmolean Museum in Oxford untersucht, die das hohe Niveau belegen, das diese Kulturen entwickelten. Als Erstes tauchten aus den Schubladen des Museumsmagazins kleine ovale Tafeln aus einer Fundstätte in Dschemdet-Nasr im Südirak auf. Sie waren äußerst praktisch, da ihre Form der Handfläche angepasst war. Die Zeichen wurden in den noch feuchten Ton geritzt. Vermutlich wurden diese Tafeln, die administrative Informationen enthielten – meist über die Menge gehandelter Waren (eine Tafel zeigt ein Bild von Eseln, dem zum Beispiel die Zahl sieben vorangestellt ist, was »sieben Esel« bedeutet) –, nach Gebrauch weggeworfen, denn man fand ihre Fragmente in der Ecke eines Raumes aufgehäuft. Andere Tafeln entdeckte man im Bauschutt, der zum Ausbessern einer Mauer oder anderer reparaturbedürftiger Gebäudeteile verwendet wurde. Im Laufe der Geschichte sind solche Zeugnisse häufig nur per Zufall erhalten geblieben. Darin bildet das alte Mesopotamien keine Ausnahme.
Weitaus spannender waren die Tontafeln, die nicht weggeworfen, sondern aufbewahrt und wiederverwendet wurden. Ich bestaunte etwas größere Tafeln, die dichter mit Inschriften versehen waren. Diese eckigen Tafeln, als »Bibliotheksdokumente« bezeichnet, da sie literarische oder kulturelle Texte zu Themen enthalten, die von Religion bis zu Astrologie reichen, waren dazu gedacht, sie über lange Zeit aufzubewahren und zu lesen. Eine dieser literarischen Tafeln hatte sogar ein Kolophon, in dem der Schreiber Einzelheiten zu dem eigentlichen Dokument verzeichnet hatte – um welchen Text es sich handelte, wer der Schreiber war und wann und wo er gearbeitet hatte (das Kopieren wurde fast ausnahmslos von Männern erledigt). Diese Details, die mit der Titelei moderner Bücher vergleichbar sind, belegen, dass die Tafeln zusammen mit anderen aufbewahrt werden sollten, da das Kolophon half, den Inhalt einer Tafel von dem anderer zu unterscheiden. Es handelt sich also um die älteste Form von Metadaten.
Aus den erhalten gebliebenen Tafeln geht hervor, dass es auch noch andere Arten von Archivdokumenten gab, Unterlagen zu administrativen und bürokratischen Vorgängen. Eine Gruppe sehr kleiner Tafeln, die aussahen wie diese »Shredded-Wheat«-Getreidekissen, die heute zum Frühstück verzehrt werden, waren Ausweise, mit denen ein Bote seine Identität belegen konnte, wenn er Waren abholte oder lieferte. Sie waren klein, weil sie tragbar sein mussten, da der Bote sie in einer Tasche oder einem Beutel bei sich trug und bei seiner Ankunft übergab. Es ist nicht geklärt, warum sie aufbewahrt und nicht für Gebäudereparaturen verwendet wurden, aber es mag durchaus sein, dass man sie als Referenz aufhob.
Dank nahezu zweihundert Jahren archäologischer Forschung wissen wir, dass diese alten Völker eine hoch entwickelte Kultur besaßen, die Bibliotheken, Archive und Skribenten hervorbrachte. Als die ältesten Zivilisationen entstanden und vom Nomadenleben zur Sesshaftigkeit übergingen, entwickelte sich auch die Einstellung, dass eine dauerhafte Aufzeichnung der Kommunikation und die Aufbewahrung von Wissen nötig waren. Als Assurbanipal seine Bibliothek betrieb, brauchte man Kammern, wie die von Layard entdeckten, um darin die damals verwendeten – schweren, unhandlichen – Schrifttafeln aufzubewahren, Kopien anzufertigen und Zugang zu Informationen zu bekommen. Im Laufe der Zeit hat man in den Tafeln Belege gefunden, die auf eine Katalogisierung und bewusste Anordnung hindeuten.
Als Layard 1846 begann, Fundstücke nach Großbritannien zu schicken, und sie in London gezeigt wurden, galten sie umgehend als Sensation. Öffentlicher Druck, befeuert von Zeitungsberichten, trug dazu bei, dass die Leitung des British Museum ihre Einstellung änderte und sich bereiterklärte, weitere Expeditionen zu finanzieren, teils angespornt von Politikern, die den Erfolg der Ausgrabungen als Sieg über ihre französischen Rivalen werteten. Layard wurde zum internationalen Helden – mit dem Spitznamen »Löwe von Ninive« – und konnte dank seiner neu gewonnenen Berühmtheit als Schriftsteller und Politiker Karriere machen. Die Entdeckung der Bibliothek Assurbanipals war sein wohl bedeutendster Fund. Die Skulpturen, Keramiken, Juwelen und Statuen (die heute in den großen Museen in London, Berlin, New York und Paris ausgestellt werden) waren ästhetisch beeindruckend, aber erst die Entschlüsselung des in den Sammlungen enthaltenen Wissens sollte unser Verständnis der Antike grundlegend verändern.
Aus der Untersuchung dieser Tafelfunde wissen wir nun, dass die königliche Bibliothek Assurbanipals möglicherweise der erste Versuch war, den gesamten Korpus des zur damaligen Zeit verfügbaren Wissens unter einem Dach zu versammeln. Sie umfasste drei Hauptgruppen: literarische und wissenschaftliche Texte, Orakelbefragungen und Prophezeiungen sowie Briefe, Berichte, Volkszählungen, Verträge und sonstige Verwaltungsdokumente. Das Gros des Materials betraf (wie in vielen anderen Bibliotheken, die in Mesopotamien gefunden wurden) Vorhersagen für die Zukunft. Das in seiner Bibliothek vorhandene Wissen sollte Assurbanipal bei der Entscheidung helfen, wann die günstigste Zeit war, in den Krieg zu ziehen, zu heiraten, ein Kind zu bekommen, die Saat auszubringen oder andere wichtige Dinge des Lebens anzugehen. Bibliotheken waren für die Zukunft notwendig, um den Entscheidungsträgern das aus der Vergangenheit gesammelte Wissen an die Hand zu geben, und der wichtigste Entscheidungsträger in Ninive war Assurbanipal.13
Die literarischen Texte umfassten ein großes Themenspektrum von Religion, Medizin und Magie bis hin zu Geschichte und Mythologie und waren bestens organisiert, nämlich in einer Themenfolge angeordnet und mit Anhängern versehen, die wir heute als Katalogschild oder sogar als Metadaten bezeichnen könnten. Solche Texttafeln wurden als permanente Bezugsquellen aufbewahrt, während die Archivmaterialien nur begrenzte Zeit als Grundlage zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten über Grund- und Immobilienbesitz verwahrt wurden.14 Zu den wichtigsten Entdeckungen, die Layard und Rassam in Ninive machten, gehört eine Reihe von Schrifttafeln mit dem Text eines der ältesten erhalten gebliebenen literarischen Werke der Welt, des Gilgamesch-Epos. Man fand dort verschiedene Tafelserien, die belegen, dass dieser Schlüsseltext über mehrere Generationen hinweg vorhanden war, dass die Tafeln alle zusammen aufbewahrt und von einer Königsgeneration an die nächste weitergegeben wurden; laut einem Kolophon hatte Assurbanipal den Text sogar selbst geschrieben.
Anhand der archäologischen Funde aus mesopotamischen Archiven und Bibliotheken und der Untersuchung der Texte auf den ausgegrabenen Tafeln lässt sich eine klare Tradition ausmachen, Wissen zu organisieren, und wir kennen sogar die Identität der für diese Sammlungen zuständigen Fachleute. Anders als heute, da die Berufe des Archivars und Bibliothekars recht klar umrissen sind, waren diese Aufgaben in Gesellschaften des Altertums weniger deutlich abgegrenzt. Bibliotheken wie die Assurbanipals zeugen von einem Bestreben, Informationen zu verwalten, und vermitteln uns einen Eindruck, wie wertvoll Wissen für die Herrschenden war und wie entschlossen sie waren, es mit allen Mitteln zu erwerben.
Die Forschungen der letzten vierzig Jahre zur königlichen Bibliothek Assurbanipals haben ergeben, dass sie nicht nur durch Abschriften aufgebaut wurde, sondern auch durch Wissen, das aus Nachbarländern erbeutet wurde. Unsere Erkenntnisse hierzu stammen aus diversen Quellen, die in den letzten Jahrzehnten ausgegraben wurden und Layard oder den Pionieren der Keilschrift nicht zugänglich waren. Die Schrifttafeln, die von solchen requirierten Sammlungen zeugen, sind vielleicht die ältesten Vorläufer dessen, was wir heute als verschleppte oder migrierte Archive bezeichnen (mehr dazu in Kapitel 11), eine Praxis, die seit Jahrtausenden stattfindet. Viele der erhalten gebliebenen Tafeln in Assurbanipals Bibliothek gelangten auf diesem Weg dorthin.15
Durch Schrifttafeln, die an vielen anderen Stätten dieser Region wie Borsippa im heutigen Südirak ausgegraben wurden, hat sich unser Verständnis dieser Praxis vertieft. Im ersten Jahrtausend v. Chr. gehörte Borsippa zum Babylonischen Reich, das von den Assyrern unterworfen wurde. Unter den dort ausgegrabenen Schrifttafeln fanden sich spätere Kopien eines Briefes, der ursprünglich aus Ninive an einen Agenten namens Shadunu geschickt wurde und ihn beauftragte, einige Gelehrte in ihren Häusern aufzusuchen und »alle Tafeln einzusammeln, die im Ezida-Tempel lagern« (der Tempel des Nabu in Borsippa war ausdrücklich der Gelehrsamkeit geweiht).16 Die gewünschten Dinge sind recht genau benannt, was darauf hindeutet, dass Assurbanipal wusste, was sich in den Sammlungen der Privatgelehrten befand.17 Assurbanipals Anweisungen waren klar und deutlich:
[…] was immer für den Palast benötigt wird, was immer da ist, und seltene Tontafeln, die euch bekannt sind und die in Assyrien nicht existieren, sucht sie und bringt sie mir! […] Und solltet ihr eine Tafel oder rituelle Anweisung finden, über die ich nichts geschrieben habe, die aber gut für den Palast ist, so nehmt sie ebenfalls und schickt sie mir […].18
Dieser Brief untermauert Hinweise aus anderen Tontafeln im British Museum, aus denen hervorgeht, dass Assurbanipal Schrifttafeln beschlagnahmte oder Gelehrte bezahlte, damit sie ihm diese überließen oder Tafeln aus ihrem Besitz sowie weitere aus der berühmten Sammlung in Borsippa kopierten, das für seine herausragende Schreibertradition berühmt war.
Einige erhalten gebliebene Unterlagen über Neuzugänge vermitteln uns einen Eindruck davon, wie diese Beutestücke Assurbanipal halfen, seine große Bibliothek in Ninive aufzubauen (und bestätigen zudem, dass diese Bibliothek sehr sorgfältig organisiert und verwaltet wurde). Der Umfang dieser Zugänge ist auf den ersten Blick erstaunlich. Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass von den 30 000 Schrifttafeln, die von Assurbanipals Bibliothek erhalten geblieben sind, etwa 2000 Tontafeln und 300 Elfenbein- oder Holztafeln auf einmal hinzukamen. Das war eine enorm große Einzelanschaffung. Die Themen rangierten über dreißig Genres von astrologischen Omen bis hin zu Arzneirezepten. Nicht in jedem Fall ist die Herkunft des Materials verzeichnet, aber es ist klar, dass die Tafeln aus Privatbibliotheken in Babylonien stammten. Bei einigen handelte es sich offenbar um »Schenkungen« der Gelehrten, denen sie gehörten und die sich vielleicht bei der Obrigkeit in Ninive einschmeicheln wollten oder einen Teil ihres Bestandes abgaben, um den Rest ihrer Bibliothek behalten zu können. Die einzigen identifizierbaren Daten weisen auf 647 v. Chr. hin, nur Monate nach dem Fall Babyloniens während des Bürgerkriegs zwischen Assurbanipal und seinem Bruder Schamasch-schuma-ukin. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Er nutzte den militärischen Sieg als Gelegenheit, seine eigene Bibliothek durch die Zwangsrequirierung von Wissen zu erweitern.19
Schon bald sollte Assurbanipals Bibliothek jedoch ein ähnliches Schicksal erleiden. Sein Sieg über Babylonien weckte einen brennenden Rachedurst, der an Assurbanipals Sohn Sin-schar-ischkun gestillt wurde, als er 631 v. Chr. die Nachfolge seines Vaters antrat. Die Babylonier verbündeten sich mit den benachbarten Medern, deren Truppen Ninive 612 v. Chr. belagerten, die Stadt schließlich einnahmen und einen Sturm der Zerstörung entfesselten, der auch die Wissenssammlungen einschließlich der von Assurbanipal aufgebauten Bibliothek erfasste. Layards Arbeit förderte bemerkenswerte Leistungen in Bezug auf Bewahrung und Erwerb von Wissen zutage, aber überall, wo er grub, fanden sich auch Spuren von Bränden und dem Einwirken von Gewalt. Die Grabungen legten Ascheschichten frei und Gegenstände, die mutwillig in Innenräumen zerschmettert worden waren, und im nahe gelegenen Nimrud entdeckten spätere Archäologen besonders grauenvolle menschliche Überreste, Leichen mit gefesselten Gliedmaßen, die man in einen Brunnenschacht geworfen hatte.20
Die Zerstörung von Assurbanipals Bibliothek nach dem Fall Ninives war ein verheerender Akt, allerdings ist nicht klar, was damals im Einzelnen geschah. Es mag sein, dass der Großteil der Bibliotheks- und Archivsammlung schlicht in die allgemeine Zerstörung des Palastkomplexes geriet. Auf dem gesamten Areal kam es weithin zu Bränden und Plünderungen, und es lässt sich nicht feststellen, ob die Bibliothek gezielten Angriffen ausgesetzt war, obwohl nachweisbar ist, dass bestimmte Tafeln (wie solche mit diplomatischen Verträgen) zertrümmert wurden.21 So fand man im Nabu-Tempel in Nimrud gesiegelte Schrifttafeln mit Vasallenverträgen von Assurbanipals Vater Asarhaddon zerschmettert am Boden. Dort sind sie liegen geblieben, bis sie zweitausendfünfhundert Jahre nach der Schlacht um die große Stadt entdeckt wurden.22
Die königliche Bibliothek in Ninive ist die berühmteste Sammlung ihrer Art aus den Zivilisationen Mesopotamiens, war aber keineswegs die älteste. In Uruk im Südirak fand man über 5000 Schrifttafeln aus dem 4. Jahrtausend v. Chr., die sich vornehmlich mit Wirtschaft, aber auch mit der Benennung von Dingen befassen. In der archaischen Stätte Ebla (südlich der heutigen Stadt Aleppo) in Syrien finden sich Belege, dass es dort tausend Jahre später Skriptorien und Bibliotheks- und Archivräume mit gemauerten Bänken gab, auf denen man Schrifttafeln durchsehen konnte. Obwohl Bibliotheken keine spezielle architektonische Ausprägung als separate Gebäude fanden, weisen Funde zunehmend darauf hin, dass in jener Zeit offizielle Verfahren der Informationsverwaltung aufkamen, darunter auch verschiedene Arten der Lagerung. Dazu gehören Mittel wie Holzregale oder Steinfächer, wie man sie im Archivraum des Nabutempels in Chorsabad (der ehemaligen Hauptstadt Assyriens, bevor sie nach Ninive verlegt wurde) entdeckt hat, und Regale im Schamaschtempel in der babylonischen Stadt Sippar, die dazu dienten, Tontafelsammlungen zu sortieren – was darauf schließen lässt, dass der Umfang des Bestandes besondere Verfahren notwendig machte, um die Sammlung zu ordnen und zu verwalten.23 Die Verwendung von Metadaten (in Form von Etiketten und anderen Arten, den Inhalt der Tafeln zu beschreiben), die nicht nur die Lagerung von Texten, sondern auch den Zugang zu Informationen und das Kopieren erleichterten, war ebenfalls ein innovatives Merkmal der Zivilisationen Mesopotamiens. Die Notwendigkeit, Wissen sicher aufzubewahren und durch Kopien seine Weitergabe zu ermöglichen, hat uralte Wurzeln, die mit dem Zivilisationsprozess an sich einhergehen.
Unmittelbare Belege für die Bibliotheken und Archive des Altertums sind selten, und da die Gesellschaften, die diese Sammlungen entwickelten, von den unseren so verschieden waren, ist es riskant, allzu viele enge Parallelen zu ziehen. Trotz dieser Vorbehalte lassen sich meiner Ansicht nach einige grobe Muster ausmachen.
Die Bibliotheken und Archive Mesopotamiens, vor allem die Bibliothek Assurbanipals, zeigen, dass die antike Welt verstand, wie wichtig es war, Wissen anzusammeln und zu bewahren. Diese Zivilisationen entwickelten ausgeklügelte Methoden: Sie ordneten Tontafeln und fügten Metadaten hinzu, die Lagerung und Zugang erleichterten, als die Sammlungen größer wurden. Zudem förderten sie die Vervielfältigung von Texten, um sie innerhalb der kleinen elitären Zirkel an den Königshöfen, denen der Zugang zu ihnen gestattet war, zu verbreiten.
Häufig wurden diese Sammlungen von den Herrschern angelegt, die meinten, durch den Erwerb von Wissen ihre Macht zu steigern. Die Beschlagnahme von Tontafeln benachbarter oder feindlicher Staaten brachte diese Gegner um Erkenntnisse und schwächte sie damit. Da es in vielen dieser Texte um Weissagungen ging, half das Erbeuten der Tafeln nicht nur dabei, bessere Vorhersagen zu machen, sondern stellte auch sicher, dass die Feinde in Sachen Zukunftsprognosen im Nachteil waren.
Assurbanipals Bibliothek vermittelt uns einen Eindruck, was sie zum Wohle nachfolgender Generationen aufbewahrte, da Schrifttafeln vom Vater an den Sohn weitergegeben wurden, unter anderem auch die des Gilgamesch-Epos. Schon damals herrschte also die Einsicht, dass die Bewahrung des Wissens einen Wert nicht nur für die Gegenwart, sondern für die Zukunft hatte. Dass diese Sammlungen überlebt haben, ist Zufall. Die Zivilisationen sind untergegangen. Ihre Bibliotheken und Archive, selbst solche, die für die Dauer ausgelegt waren, wurden erst in jüngerer Zeit entdeckt, und zwar von Gelehrten, die am Beginn der Archäologie standen.
Der Dichter Vergil, eine Schriftrolle haltend und zwischen einem Stehpult und einer »Capsa« (oder Bücherkiste) zur Aufbewarhung von Schriftrollen sitzend (Illustration aus einer Handschrift aus dem 5.Jahrhundert).
2
Ein Scheiterhaufen aus Papyrus
Wenn wir über das Vermächtnis alter Bibliotheken im öffentlichen Bewusstsein nachdenken, so hat der Ruhm einer legendären Bibliothek den aller anderen überdauert: Alexandria. Obwohl sie wesentlich später existierte als die in Mesopotamien und obwohl von ihr keinerlei greifbare Zeugnisse erhalten geblieben sind, ist Alexandria in der westlichen Vorstellung die archetypische Bibliothek und vielen gilt sie nach wie vor als die größte und großartigste, die von den Hochkulturen der antiken Welt je zusammengetragen wurde.
Unser Wissen über die Bibliothek ist zwar, gelinde gesagt, lückenhaft – die wenigen einschlägigen Quellen, die es diesbezüglich gibt, stützen sich meist auf andere Quellen, die mittlerweile verloren gegangen oder zu weit entfernt sind, um eine Verifikation zuzulassen –, aber die Vorstellung einer echten Universalbibliothek, die das gesamte Wissen der Welt an einem Ort versammelt, hat Schriftsteller und Bibliothekare seit jeher inspiriert. Es ist bekannt, dass es im antiken Alexandria tatsächlich zwei Bibliotheken gab, das Museion und das Serapeion, die Innere und die Äußere Bibliothek. Das Museion war ein Tempel für die Musen – neun griechische Schwestergöttinnen, die über Kreativität und Wissen der Menschen über Geschichte bis hin zu epischer Dichtung und Astronomie wachten. Von diesem Begriff leitet sich unser Wort Museum her. Das Museion war jedoch alles andere als ein Museum: Es war eine lebendige Bibliothek, voller Bücher (in Form von Schriftrollen) und Gelehrter.
Es war ein großes Wissenslager, das Gelehrte besuchen konnten, um dort zu studieren. Das Gebäude lag im Königsviertel, dem Brucheion, in der Nähe des Palastes, was ein deutlicher Hinweis auf seine Bedeutung ist.1 Der griechische Historiker und Geograf Strabo, der in den ersten Jahren nach Christus schrieb, betonte, wie wichtig die königliche Förderung für die Bibliothek war, und schilderte, dass sie einen gemeinsamen Speisesaal besaß, in dem sich der König gelegentlich zu den Gelehrten gesellte.2 Die Liste dieser Gelehrten liest sich wie ein Namensappell der großen Denker der Antike und umfasst nicht nur Euklid (den Vater der Geometrie) und Archimedes (den Vater des Ingenieurwesens), sondern auch Eratosthenes, der als Erster den Erdumfang erstaunlich genau berechnete. Viele der intellektuellen Durchbrüche, auf denen die moderne Zivilisation basiert, lassen sich auf ihr Schaffen zurückführen.
Die Bibliothek hatte eine Zweigstelle im Serapeion, einem Tempel für den »erfundenen« Gott Serapis. Antike Schriftsteller stritten darüber, ob Ptolemaios I. oder der II. den Serapiskult in Ägypten eingeführt hatte, aber archäologische Funde belegen, dass der Tempel von Ptolemaios III. Euergetes I. (246-221 v. Chr.) errichtet wurde.3 Und diese Bibliothek verlieh diesem Kult zusätzliche Legitimation. Wie das Museion war auch dieses Bauwerk darauf angelegt, zu beeindrucken. Laut der Schilderung des römischen Historikers Ammianus Marcellinus war es »durch die ausgedehntesten Säulenvorhöfe, fast lebende Bildsäulen und eine Menge anderer Kunstwerke also ausgeschmückt […], daß nach dem Capitolium [dem Haupttempel Roms], in dem sich das ehrwürdige Rom in die Ewigkeit erhebt, der Erdkreis nichts Prachtvolleres auszuweisen hat«.4
Nach ihrer Gründung wuchs die Bibliothek von Alexandria stetig, wie aus einem merkwürdigen Dokument hervorgeht, das als Aristeasbrief bekannt ist und um 100 v. Chr. entstand. Demnach besaß die Bibliothek bereits kurz nach ihrer Gründung 500 000 Schriftrollen und erhielt durch das Serapeion noch größere Kapazitäten. Der römische Historiker Aulus Gellius gab in seinem Kompendium Die attischen Nächte den Bestand mit 700 000 Rollen, verteilt auf zwei Bibliotheken, an. Johannes Tzetzes machte etwas genauere Angaben – Bibliothekare bevorzugen in der Regel eher eine präzise Zählung ihrer Sammlungen – und behauptete, das Museion habe über 490 000 Rollen und das Serapeion über 42 800 Rollen verfügt. Allerdings müssen wir diese antiken Schätzungen zur Größe der Bestände mit äußerster Vorsicht behandeln. In Anbetracht des Umfangs der aus der antiken Welt erhalten gebliebenen Literatur können die Mengenangaben für die Bibliothek nicht realistisch sein. Während man diesen Schätzungen also skeptisch gegenüberstehen sollte, machen sie doch deutlich, dass die Bibliothek eine enorme Größe hatte und um vieles umfangreicher war als jede andere damals bekannte Sammlung.5
Was lässt sich über die Rolle der Bibliothek von Alexandria für das antike Königreich sagen? War sie mehr als nur ein Wissensspeicher? Obwohl wir über den Bibliotheksbetrieb praktisch nichts wissen, scheint doch klar zu sein, dass sie neben dem offenkundigen Bestreben, Wissen zu erwerben und zu bewahren, auch dem Wunsch diente, Bildung zu fördern. Aphthonios, der im 4. Jahrhundert n. Chr. schrieb, spricht von »Lagerhäusern […], die den Wissbegierigen offenstehen, eine Ermunterung für die ganze Stadt, Weisheit zu erlangen«.6 Möglicherweise hat die »Legende« der Bibliothek von Alexandria ebenso viel mit der Zugänglichkeit des dort gelagerten Wissens zu tun wie mit der Größe der Sammlung. Durch den römischen Historiker Sueton wissen wir, dass Kaiser Domitian im ausgehenden 1. Jahrhundert n. Chr. Schreiber nach Alexandria schickte, damit sie dort Texte kopierten, die durch Brände in verschiedenen römischen Bibliotheken verloren gegangen waren.7 Die Größe der beiden Bibliotheken, die im Museion wohnenden Gelehrten und der freie Zugang umgaben die Bibliothek mit einer Aura, die sie zum Zentrum der Gelehrsamkeit und Bildung machte.
Wenn von der Bibliothek von Alexandria die Rede ist, geht es meist um die mahnende Legende ihrer Zerstörung – als diese überragende Bibliothek, die ein wahres Meer von Wissen enthielt, in einer Feuersbrunst dem Erdboden gleichgemacht wurde. In gewisser Weise hat die Zerstörung der Bibliothek für ihr Vermächtnis ebenso große, wenn nicht gar größere Bedeutung erlangt als ihre Existenz. Das wird deutlich, wenn wir uns klar machen, dass die klassische Darstellung, Alexandria sei durch ein verheerendes Inferno zerstört worden, ein Mythos ist. Tatsächlich handelt es sich um eine Ansammlung von (häufig widersprüchlichen) Mythen und Legenden, an denen die populäre Vorstellung weiterhin festhält.
Der vielleicht bekannteste Bericht stammt von Ammianus Marcellinus, der in seinem (um 380 bis 390 n. Chr. verfassten) Werk Römische Geschichte erklärte: »[…] die übereinstimmende Aussage alter Geschichtsbücher lautet dahin, daß siebenmal hunderttausend Bücherrollen, die von den Ptolemäern mit angestrengtem Fleiße zusammengebracht worden, im Alexandrinischen Kriege, da die Stadt unter dem Diktator Caesar geplündert wurde, im Feuer aufgegangen seyen.«8 Ein anderer antiker Schriftsteller, Plutarch, schildert den Brand eingehender. Nachdem sich in Alexandria ein Mob gegen die Römer erhoben hatte, war Cäsar gezwungen, sich im Palastviertel in der Nähe des Hafens zu verbarrikadieren. Und »als man ihm seine Flotte wegnehmen wollte«, musste er »die Gefahr mit Hilfe des Feuers von sich abwenden, welches aber von dem Seearsenale weiter um sich griff, und die große Bibliothek verzehrte«. Eine etwas andere Sicht vermittelt Dio Cassius in seinem (um 230 n. Chr. verfassten) Werk Römische Geschichte, in dem er schildert, »mehr als ein Gebäude ward ein Raub der Flammen«, aber außer dem Seearsenal ging nach seiner Darstellung nicht etwa das Museion, sondern »das Fruchtmagazin und die eben so reiche als vortreffliche Büchersammlung im Rauch auf«.9
Der Mythos, Cäsar sei auf irgendeine Weise für die Zerstörung der Bibliothek verantwortlich gewesen, musste im Laufe der Geschichte mit anderen konkurrieren. Nachdem Alexandria zu einer christlichen Stadt geworden war, verlor der Patriarch Theophilus 391 n. Chr. die Geduld mit den heidnischen Besetzern des Serapeion und zerstörte den Tempel. Während der muslimischen Eroberung Ägyptens 642 erlebte Alexandria erstmals eine Besatzung, und laut einer Schilderung wurde die Bibliothek auf Befehl des Kalifen Omar mutwillig von Amr (dem arabischen Heerführer, der die Stadt eroberte) zerstört. Diese Darstellung schreibt dem Kalifen eine verdrehte Logik zu: »Stimmen diese Schriften mit dem Buche Gottes überein, so sind sie unnütz, und brauchen nicht aufbehalten zu werden; stimmen sie nicht überein, so sind sie schädlich, und müssen vernichtet werden«, heißt es dort. Nach dieser Legende wurden die Befehle des Kalifen »mit blindem Gehorsam vollzogen«, die Schriftrollen wurden an die viertausend Bäder Alexandrias verteilt, um damit das Wasser zu erhitzen, und es dauerte sechs Monate, bis sie verheizt waren.10
Einig sind sich alle Althistoriker darüber, dass die Bibliothek zerstört wurde. Das Gewicht ihrer Meinungen trug dazu bei, den Mythos zu verbreiten – ein Vorgang, der erheblichen Auftrieb erhielt, als Edward Gibbon im ausgehenden 18. Jahrhundert den dritten Band seiner monumentalen