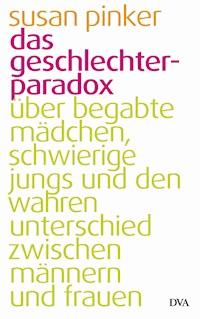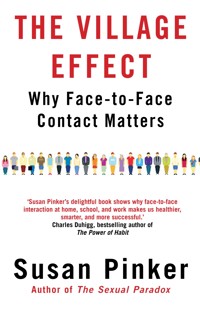Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Einleitung
Kapitel 1 – Sind Männer das fragilere Geschlecht?
Schuljungen
Sich ins Zeug legen: Die Kluft bei der Selbstdisziplin
Das männliche Kontinuum
Kapitel 2 – Jungen mit Legasthenie auf Erfolgskurs
Die biologischen Leerstellen füllen
Männliche Enklaven
Tom, Dick, Harry … und Wendy – Was sind ihre Erfolgsrezepte?
Die paradoxe Gabe
Mädchen mit Legasthenie
Legasthenie und Geld
Kapitel 3 – Verlasst das Schiff!
Flüchtlinge
Die Mentoren-Falle
Die Macht intrinsischer Ziele
Seltsam, aber wahr
Menschen, Worte und Ideen, nicht die Dezimalstellen von Pi
Der Druck des akademischen Lebens
Antriebs- und Abstoßungsfaktoren
Den Ausstieg in die Wege leiten
Woher willst du wissen, dass es dir nicht gefällt, wenn du es nie ausprobiert hast?
Kapitel 4 – Der Empathie-Vorteil
Keine Frau ist eine Insel
Das utopische Experiment
Der Empathie-Rheostat
Die Biologie der Empathie – Henne oder Ei?
Auf Trost eingestellt, nicht auf Tempo
Empathie bei Tieren
Das Innere von außen betrachtet: Empathie in der Neurowissenschaft
Der Effekt des letzten Tropfens
Ist Empathie gefährlich?
Politisierte Empathie: Eine Emotion in Ungnade
Kapitel 5 – Die Rache der Nerds
Die Wunderkinder
Die populäre Krankheit
Die Wissenschaft von den Gegensätzen
Wachsen, wuchern und zurechtstutzen
Der T-Faktor
Kapitel 6 – Niemand hat mich je gefragt, ob ich den Papa spielen will
Anpassungsfähige Frauen
Das passiert, wenn du keinen Plan hast
Von Rattenmüttern und weiblichem Kampfgeist
Die sogenannte gläserne Decke
Das Geschlechter-Paradox
Kapitel 7 – Die Hochstaplerin im Innern verbergen
Würde die echte Frau bitte mal aufstehen?
Cosi Fan Tutti
Fehlerhafter Optimismus und Externalisierer
Erkennst du dich selbst?
Pessimismus mit Pep
Die Internalisierer
Das andere Problem ohne Namen
Kapitel 8 – Konkurrenz: Ein Männerding?
Kleine Fische oder Geschäfte en gros
Aggressionen
Rache und Bestrafung
Was dich nicht umbringt …
Warum gehenMänner Risiken ein?
Konkurrenz beim Dating-Spiel
Der Zaubertrank
Knastraudis und Prozessanwälte: Testosteron und berufliche Laufbahnen
Weibliche Aggressionen ans Licht bringen
Verbrecher und Genies
Mit den großen Jungen spielen
Hohe Risikobereitschaft
Wetteifern um Spaß und Profit
Kapitel 9 – Turbodynamisch: Erfolgreiche Männer mit ADHS
Das Paradox von ADHS
Ist es überhaupt eine Störung?
Die biologischen Nachweise
Der Vorteil
Der bewegliche, sprunghafte Stil
Die Debatte über Frauen und Mädchen mit ADHS
Kapitel 10 – Der Schein trügt
Sollte eine Frau nicht so sein wie ein Mann?
Die wirklichen Probleme
Lebewohl Jugend, hallo Reife
Danksagung
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Quellennachweis Tabellen und Abbildungen
Register
Copyright
Für Martin
I am two with nature.
WOODY ALLEN
Einleitung
Weibliche Puppen und Eunuchen
Warum kann eine Frau nicht sein wie ein Mann? 1964 schien diese Frage recht harmlos. Wie Henry Higgins, der liebeskranke viktorianische Professor aus My Fair Lady, in seinem Gesangsvortrag darlegte, war es zwar möglich, die Klassenzugehörigkeit zu wechseln – man musste einfach nur Akzent und Kleidung ein wenig ändern -, aber die Kluft zwischen den Geschlechtern war absolut unüberwindlich. Vier Jahrzehnte später wird die Frage immer noch gestellt, zielt aber inzwischen in eine etwas andere Richtung. Heute bedeutet sie normalerweise: »Sollte eine Frau nicht sein wie ein Mann?« Die Frustration ist geblieben, jedoch wird sie mittlerweile durch unerfüllte Erwartungen verstärkt.
Wie Higgins erkennen die meisten von uns nicht, dass wir den Mann für die Norm halten und die Frau für eine Variation dieses Grundmodells – wahlweise mit einigen Zusatzmerkmalen. Wir haben die Erwartung entwickelt, dass es in psychologischer und sozialer Hinsicht eigentlich keine echten Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben sollte. Doch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse widersprechen der Vorstellung, dass Mann und Frau etwas Austauschbares, Symmetrisches oder Gleiches seien. Einfach ausgedrückt, lautet die Frage, der ich in diesem Buch nachgehen möchte: Wie realistisch ist die Erwartung, dass eine Frau »so ist wie ein Mann«, wenn wir berücksichtigen, was uns Forschungsbereiche wie Psychologie, Neurobiologie und Wirtschaftswissenschaft, in denen man allein im letzten Jahrzehnt zu einer Fülle von erstaunlichen neuen Erkenntnissen gelangt ist, über menschliche Entscheidungsprozesse und Verhaltensweisen sagen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mann so ist wie eine Frau? Diesmal geht es eher um eine Beschreibung des Ist-Zustandes als um die Frage des »Könnte« oder »Sollte«, da die Erwartung, dass der Mann der Ausgangspunkt sei, uns offenbar in die Irre geführt hat.
Die Annahme, dass das Weibliche nur eine etwas andere Schattierung des Männlichen sei, zeigte sich sehr deutlich an der misslichen Lage, in der das Team der amerikanischen Sesamstraße steckte, als es versuchte, ein Figuren-Ensemble für die beliebte Vorschulserie zu erfinden. Wie die New York Times im Jahr 2006 berichtete, wurden die Produzenten der Sesamstraße bei der Entwicklung einer weiblichen Hauptfigur lange Zeit von der Angst gelähmt, dass alle mädchenhaften Züge ins Klischeehafte hineinspielen würden. »Wenn das Krümelmonster eine weibliche Figur wäre, würde man ihr vorwerfen, unter Magersucht oder Bulimie zu leiden«, erklärte die leitende Produzentin. Andere Teammitglieder waren sich einig, dass Elmo, wenn er eine weibliche Figur wäre, als dumme Gans gelten würde. Vor allem nach der empörten Reaktion auf die Figur der Miss Piggy in der Muppet Show schien es das Sicherste, einfach die verbreitete Annahme widerzuspiegeln, dass das Männliche die Standardeinstellung für beide Geschlechter sei. Männliche Puppen – ob flugunfähige Vögel, zottelige Monster oder ernste kleine Jungen – waren nicht wirklich männlich, sondern auf exemplarische Weise menschlich. Dagegen würde jede weibliche Puppe als Abweichung von der Norm betrachtet werden oder als ausgestattet mit spezifisch weiblichen Eigenschaften. Die Folge war, dass die Produzenten der Sesamstraße erst siebenunddreißig Jahre nach der Erfindung von Bibo, Krümelmonster und Elmo die Gestalt der Abby Cadabby erschufen, eine temperamentvolle Figur mit Zauberkräften und weiblicher Ästhetik. Ihre eindeutig weibliche Persona war ein Zeichen, dass man anfing, entspannter mit Geschlechterfragen umzugehen, aber es war immer noch eine Nachricht wert.1
Ich hatte nur eine vage Vorstellung davon, wie heikel das Thema war, als ich den Plan fasste, zwei Bereiche persönlichen und beruflichen Interesses – extreme oder eindeutig männliche Eigenschaften und die Berufswahl von Frauen – in einem Buch über Männer, Frauen und Arbeit zu verbinden. Ich wollte mehrere ungewöhnliche Männer porträtieren, die in der Kindheit unter Problemen gelitten hatten, und aufzeigen, wie es ihnen zwanzig Jahre später erging. Ihre Geschichten wollte ich jenen von begabten Frauen gegenüberstellen, die in ihrer Kindheit für eine erfolgreiche Laufbahn prädestiniert schienen. Mich faszinierten die Geschichten dieser Menschen, aber auch die Erkenntnisse, mit denen die Wissenschaft ihre Erfahrungen erklärte. Der Versuch, diese Lebensgeschichten zu deuten, führte mich in die politisch explosive Welt der Geschlechterunterschiede, in der, wie sich herausstellen sollte, fast jeder, den ich traf, bereits Partei ergriffen hatte. Auf dem Weg entdeckte ich, dass Geschlechterunterschiede nicht nur meine aktuelle Arbeit berührten, sondern wahrscheinlich auch meine eigenen beruflichen Entscheidungen beeinflusst hatten. Wie in Higgins’ Song fing ich an, mir Fragen über mich selbst, meine Kolleginnen und andere Frauen aus meinem Bekanntenkreis zu stellen: »Muß das Vorbild ausgerechnet Mutti sein? Warum schlägt keine je dem Väterchen nach?«
Mir selbst hatten alle Möglichkeiten offengestanden. Im Jahr 1973, im Alter von sechzehn Jahren, arbeitete ich für meinen Vater. Er war damals als Handelsvertreter für einen Textilhersteller tätig, und zwei Sommermonate lang kurvten wir gemeinsam in seinem holzvertäfelten Kombi durchs ländliche Quebec. Die Ladefläche des Wagens war vollgepackt mit einem Dutzend marineblauer Mustersäcke, angefüllt mit Schwesterntrachten, Kitteln und Nachthemden, jeder Sack so groß wie ein Kühlschrank und ungefähr 35 Kilo schwer. Mit neu gewonnenem Respekt stellte ich fest, wie anstrengend die Arbeit war, die unser mittelständisches Vorstadtleben finanzierte. Die Vertretertätigkeit meines Vaters brachte letztendlich drei Kinder durchs College, meine Mutter durchs Studium und sicherte auch seinen eigenen Wechsel zu einer erfolgreichen Laufbahn als Anwalt ab. Es war ein Job, bei dem man häufig einsam war, die Arbeit war körperlich anstrengend und wie die meisten Berufslandschaften jener Zeit zu 99 Prozent von Männern bevölkert.
Zu jenem Zeitpunkt war ich überzeugt, dass Frauen genau dieselben Berufe ausüben konnten und wollten wie Männer. Simone de Beauvoir hatte es in Das Andere Geschlecht genau erklärt: Biologie war kein Schicksal. »Man wird nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht.« So etwas wie Mutterinstinkt existierte nicht – Menschen waren keine Tiere, sie hatten keine erkennbaren, festen Angewohnheiten wie brünstige Hirsche oder wie Paviane, die ihr rosa Hinterteil feilboten. Über derartige Instinkte waren wir erhaben. Als Menschen befanden wir uns »in einem Zustand immerwährenden Wandels, immerwährenden Entstehens« – ein existenzialistischer Ansatz, der hervorragend in die Weltanschauung meiner sechzehn Jahre passte. Frauen konnten also über ihre gegenwärtige Situation und ihre Möglichkeiten definiert werden, aber das war auch schon alles. Wenn es eine stabile Nachfrage nach Krankenschwesterntrachten und Negligés gab, lag es daran, dass die Gesellschaft Frauen als fürsorgliche Geschöpfe und Sexualobjekte definierte. Aber ich war mir sicher, dass diese Welt sich schon bald ändern würde. Natürlich wusste ich nichts über die Kluft zwischen diesem feministischen Klassiker und dem eigenen Leben der Autorin, von der Art, wie sie sich von Sartre behandeln ließ – nicht als gleichberechtigte Partnerin, sondern eher als Beschafferin von Möglichkeiten und von schönen jungen Frauen, von denen einige nicht älter waren als ich damals.2 Doch das hätte auch nichts geändert. Was in den Vierzigern und Fünfzigern geschehen war, war Geschichte. Ich lebte in der Gegenwart, und die war alles, was zählte.
Ich wuchs heran, als die zweite Welle der Frauenbewegung ihren Scheitelpunkt erreichte, und meine Erwartungen unterschieden sich deutlich von denen früherer Generationen. Anders als die Frauen, die zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren erwachsen wurden, ging ich davon aus, dass ich studieren und nicht nur einen Job, sondern einen Beruf ausüben würde. Wie meine Freundinnen hielt ich nicht viel von einem Zukunftsplan, der sich in Ehe und Kindern erschöpfte. Durch genau diesen Plan waren unsere Mütter in die Falle getappt. Im Jahr 1963 hatte Betty Friedan ihr Buch Der Weiblichkeitswahn veröffentlicht: Darin hatte sie die häusliche Idylle der Nachkriegszeit auseinandergenommen und Vorstadthausfrauen porträtiert, die unter der Last endloser Hausarbeit, quengelnder Kinder und einer namenlosen, alles umhüllenden Anomie litten. Das waren die ursprünglichen »Desperate Housewives« und Friedans scharfe Kritik und Forderung, dass Frauen sich diesem Szenario verweigern sollten, schien mehr als berechtigt. »Wir haben diesen Mythos vollkommen verinnerlicht«, erinnerte sich meine Mutter, die mit neunzehn geheiratet und die nächsten achtzehn Jahre damit verbrachte hatte, »immer wieder dieselbe Arbeitsfläche in der Küche abzuwischen«. (Laut der Soziologin Juliet Schor leistete im Jahr 1973 eine zur Mittelschicht gehörende Mutter von drei Kindern durchschnittlich 53 Stunden Hausarbeit in der Woche.)3 Angespornt durch Betty Friedan, Gloria Steinem und andere begann meine Mutter in jenem Sommer 1973 ein weiterführendes Studium an der Universität. Alle ihre Freundinnen taten das Gleiche, nahmen berufliche Tätigkeiten wieder auf, die sie vor der Ehe ausgeübt hatten, oder bemühten sich um eine Berufsausbildung, um sich für eine bezahlte Arbeit zu qualifizieren.
Es gab weitere Anzeichen für ein tiefgreifendes gesellschaftliches Umdenken.4 Seit 1969 war »die Pille« in Kanada gesetzlich zugelassen und einige meiner Freundinnen an der Highschool nahmen sie bereits.5 Eine stabile Nachkriegswirtschaft hatte uns das Gefühl unbegrenzter Möglichkeiten vermittelt, doch die Pille in Verbindung mit dem Idealismus und dem Individualismus der Vietnam-Ära ließ dieses Gefühl ins Unermessliche wachsen. Für uns stand fest, dass Schwangerschaft oder Ehe uns nicht von unseren Zielen abbringen würden und das niemand uns vorschreiben konnte, zu welcher Art von Arbeit wir geeignet oder fähig wären. Gerade war Der weibliche Eunuch erschienen und ich wurde sofort eine begeisterte Anhängerin von Germaine Greers kraftvoller Prosa. Sie vertrat die Ansicht, dass Frauen darauf konditioniert würden, die Eigenschaften eines Kastraten anzunehmen: Passivität, Rundlichkeit, Ängstlichkeit, Schwäche, Trägheit, Empfindlichkeit und Affektiertheit seien die von den Männern gelobten weiblichen Tugenden, denen die Frauen gehorsam nacheiferten. »Die neue Voraussetzung zur Diskussion des Körpers heißt: Alles, was wir beobachten, könnte auch anders sein«, schrieb sie. Die Kursivschrift spiegelte die Selbstsicherheit – und den Optimismus – jener Zeit wider: Alles war veränderbar. Wenn Frauen nur ihre konditionierten Rollen ablehnten, wenn sie sich weigerten, weiterhin die Handlangerinnen der Männer zu spielen, keine »niederen« Tätigkeiten wie Lehrerin oder Krankenschwester mehr ausübten und auch auf die Kleidung, Kosmetik und die Haushaltsgeräte, die sie versklavten, verzichteten, würde die Welt anders aussehen. Dahinter stand die Annahme, dass die Männer es geschafft hatten, sie waren der Standard, diejenigen, die es nachzuahmen galt. Nur wenn Frauen sich von weiblichen Rollenzwängen befreiten und männliche Rollen übernahmen, würden sie wahrhaft gleichberechtigt sein. Es stimmte, dass viele Frauen in meiner Familie und deren Umfeld rundlich waren, aber ich kannte keine, die auch nur im Entferntesten passiv, schwach, ängstlich oder träge war. Dennoch übte die Vorstellung einer Generalüberholung großen Reiz aus.
Der Feminismus, zusammen mit dem Zeitgeist der Sechziger, hatte uns die feste Überzeugung eingeflößt, die Freiheit der Wahl zu haben. Hinter der kulturellen Fassade waren wir den Männern ebenbürtig, wenn nicht ganz genauso wie sie. Und viele Frauen gingen davon aus, dass wir auch das gleiche Leben führen würden wie sie, wenn die künstlichen Schranken erst einmal gefallen wären. Tatsächlich sind in meiner Generation mehr Fortschritte gemacht worden als in den 150 Jahren zuvor, in denen US-amerikanische Frauen -vergeblich – darum kämpften, die selben verfassungsmäßigen Rechte zu erhalten wie ehemalige Sklaven. Ich profitierte von den harterkämpften Errungenschaften der zweiten Welle der Frauenbewegung. Ich hatte das Glück, mich mit Anfang zwanzig nicht unter dem enormen Druck zu fühlen, ein Leben als Hausfrau und Mutter aufnehmen zu müssen. Ich hielt es für ganz selbstverständlich, dass meine Meinung genauso viel zählte wie die jedes Mannes, dass ich dieselben Ansprüche auf Bildung und Berufstätigkeit hatte, dass ich wählen, Eigentum besitzen und selbst entscheiden konnte, wann und ob ich Kinder haben wollte oder nicht. Dass ich diese Rechte für selbstverständlich hielt, bewies, wie weit die Frauen und die Gesellschaft in kurzer Zeit gekommen waren.
Dennoch kam es mir nie in den Sinn, dass Frauen die Art von Arbeit wählen könnten, die mein Vater jahrelang ausübte. Gewiss, sein Verdienst reichte aus, um eine fünf köpfige Familie zu ernähren. Aber schwere Säcke schultern, mutterseelenallein durch die Gegend kutschieren und nur alle Jubeljahre Familie und Freunde sehen – ich meine, wie viele Frauen hätten dazu wirklich Lust?6
Was Frauen wollen und warum sie es wollen, ist die Frage, mit der sich die eine Hälfte dieses Buches befasst. Die andere Hälfte handelt von Männern und ob es sinnvoll ist, den Mann als Grundmodell zu betrachten, wenn wir über Frauen und Berufstätigkeit nachdenken. Gut dreißig Jahre nach meinem ersten Ferienjob fragte ich mich, ob Biologie vielleicht nicht gerade Schicksal, aber doch ein wichtiger und bedeutender Ausgangspunkt für eine Erörterung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern sein könnte. Die meisten Frauen der westlichen Welt sind heute erwerbstätig. Doch hochbegabte, qualifizierte Frauen mit den besten Chancen und Wahlmöglichkeiten schlagen offenbar nicht in gleicher Zahl die gleichen Wege ein wie die Männer in ihrem Umfeld. Auch nachdem die Barrieren gefallen sind, verhalten sie sich nicht wie Klone der Männer.
Also fing ich an, mich zu fragen, was geschehen würde, wenn man die ganzen »Sollte«-Grundsätze und politischen Programme einen Moment beiseite schieben und nach wissenschaftlichen Erklärungen suchen würde. Würde die Frau auch aus dieser Perspektive als alternative Version des Mannes erscheinen? Als Entwicklungspsychologin war mir klar, dass Männer alles andere als eine neutrale, homogene Gruppe sind. Anstatt wie Simone de Beauvoir es formulierte, »das absolut Vertikale« zu sein, »an der das Schräge als solches festgestellt« wird, zeigen Jungen und Männer ein breites Spektrum an biologisch begründeten Schwächen, die dazu führen, dass viele Männer unberechenbar, andere fragil und wieder andere verwegen oder sogar extrem wirken. Wenn irgendjemand »schräg« ist, dann die Männer.
Mein Interesse an der Frage, ob Männer tatsächlich unserer Erwartung vom neutralen Standardgeschlecht entsprechen (was ich als soziales Normgeschlecht oder »Vanilla-Gender« bezeichne), wurde im Wartezimmer meiner Kinderpraxis geweckt. In über zwanzig Jahren klinischer Arbeit und Lehrtätigkeit als Kinderpsychologin hatte ich größtenteils Jungen behandelt. In meiner Praxis – und in der jedes anderen mir bekannten Entwicklungspsychologen – dominierten Jungen und männliche Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, mit aggressiven und antisozialen Tendenzen, Jungen, die nicht schlafen oder keine Freunde finden oder nicht stillsitzen konnten. Wissenschaftliche Studien bestätigten den geschlechtsspezifischen Andrang in meinem Wartezimmer. Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefizite und autistische Störungen treten bei Jungen vier bis zehn Mal so häufig auf wie bei Mädchen, während Angst und Depressionen bei Mädchen doppelt so häufig vorkommen wie bei Jungen. In punkto Lernen und Selbstbeherrschung sind Jungen einfach anfälliger.
Die erste Hälfte meines Berufslebens habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, ihre Stärken und Schwächen zu bestimmen und anderen die gewonnenen Erkenntnisse zu vermitteln. Das machte ich schon so lange, dass meine ersten Patienten inzwischen erwachsen waren, und zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass über einige von ihnen Erfolgsgeschichten in den Medien auftauchten. Einer war ein international renommierter Designer geworden. Ein Weiterer hatte ein Vermögen als Finanzexperte verdient und erfolgreich bei mehreren Investmentbanken gearbeitet. Ein Dritter hatte als Elektroingenieur eine bahnbrechende Erfindung gemacht, und ein Vierter war ein aufstrebender Starkoch. Und das waren nicht die einzigen Fälle. Diese zerbrechlich wirkenden Jungen hatten ihre früheren Schwierigkeiten durch die Unterstützung von Eltern und Lehrern überwunden, die immerhin aufmerksam und fürsorglich genug waren, um eine Psychologin aufzusuchen, was vermutlich nur eine von vielen Maßnahmen gewesen war, die sie zum Wohle der Kinder ergriffen hatten. Doch mich ließ der Gedanke nicht los, dass es möglicherweise auch eine biologische Gemeinsamkeit gab. Bei einigen schien es eine Kehrseite der frühen männlichen Vulnerabilität zu geben. Viele dieser anfangs zerbrechlichen Jungen hatten weiterhin obsessive Interessen verfolgt oder eine ausgeprägte Risikobereitschaft bewahrt, die sich als Voraussetzungen für ihre Karriere erwiesen. Dagegen hatten viele gleichaltrige Mädchen, die diesen Jungen im Schulunterricht, in sprachlichen und sozialen Fähigkeiten und in puncto Selbstbeherrschung um Lichtjahre voraus gewesen waren, Wege eingeschlagen, die nicht notwendigerweise zu hohem Status oder hochbezahlten Tätigkeiten führen würden. Sie verfolgten andere Ziele. Auch wenn die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht den Jungen also einen steinigeren Weg durch die Kindheit beschert hatte, war die Situation bei den Erwachsenen im Berufsleben umgekehrt.
Im vorliegenden Buch gehe ich der Frage der Geschlechterunterschiede am Beispiel dieser beiden extremen Gruppen nach – ich untersuche die Werdegänge von fragilen Jungen, die später erfolgreich sind, und von begabten, höchst disziplinierten Mädchen, die ihre männlichen Gegenstücke in der dritten Klasse weit in den Schatten stellten. Diese scheinbaren Gegensätze stellen unsere Annahmen in Frage. Wir erwarten, dass die zerbrechlichen Jungen auch in ihrem späteren Leben zu kämpfen haben. Wir erwarten, dass die leistungsstarken Mädchen mühelos ihren Weg an die Spitze machen. Dass so viele in diesen Gruppen unseren Erwartungen widersprechen, sagt uns etwas Wichtiges über Geschlechterunterschiede. Wenn sich Jungen und Mädchen im Durchschnitt von Geburt an in biologischer und entwicklungspsychologischer Hinsicht voneinander unterscheiden (und ich werde einige faszinierende Beweise mit Ihnen durchgehen), müssten diese Unterschiede dann nicht auch ihre späteren Berufsentscheidungen beeinflussen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den voneinander abweichenden Entwicklungswegen von Männern und Frauen und ihren unterschiedlichen beruflichen Prioritäten?
Die Geschichte
Die Vorstellung, dass es angeborene Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben könnte, ist ein heikles Thema, weil sie so lange Zeit als Vorwand für die Unterdrückung der Frau missbraucht wurde. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine große Kluft zwischen den Geschlechtern, die durch Gesetze und Traditionen zementiert wurde. Abgesehen von einer kleinen Elite hatten nur wenige Frauen irgendwelche Wahlmöglichkeiten. Und ohne Wahlmöglichkeiten blieben ihre Wünsche und Ziele reine Theorie. Verheiratete Frauen konnten Pensionsgäste, schmutzige Wäsche oder Akkordarbeiten annehmen, aber bis zum Zweiten Weltkrieg war es in den meisten Bundesstaaten der USA, in Kanada und Großbritannien verboten, verheiratete Frauen einzustellen (in Australien waren sie bis 1966 vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen). Alleinstehende Frauen, die in den Hafen der Ehe einliefen, wurden prompt ausgebootet; sie erhielten in den meisten Schulen und Büros keine Anstellung mehr, also genau an jenen Orten, an denen Frauen am ehesten Arbeit fanden. Fabriken hatten zwar stets Frauen eingestellt, bezahlten ihnen aber für gewöhnlich weniger als den Männern, deshalb betrachteten die Gewerkschaften sie als eine Art Schwarzarbeiterinnen, die die Existenzgrundlagen der Männer gefährdeten. Sogar nach den Entbehrungen der Weltwirtschaftskrise und den Kriegsjahren, als man Frauen offensiv für die Fabrikarbeit und Munitionsherstellung rekrutiert hatte, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, galt es als Privileg der Frau, »nicht arbeiten zu müssen«, und als Pflicht des Mannes, »allein für den Familienunterhalt zu sorgen«.7 Daran änderte auch »Rosie the Riveter« nichts, die Werbeikone der amerikanischen Heimatfront, die ihren Bizeps auf Anwerbungspostern spielen ließ und von ihrem Ausguck auf dem Flugzeugrumpf nach Saboteuren Ausschau hielt (wie es in einem beliebten Song hieß). Bei Kriegsende hatten einige Frauen gewisse Fortschritte erzielt, insbesondere schwarze Frauen, aber für die Mehrheit bedeutete es eine Rückkehr zum Status quo. Frauen wurden allgemein diskriminiert, und da sie keine Möglichkeiten der Geburtenkontrolle, kaum Arbeitsplätze und wenig Zugang zu Geld oder Besitz hatten, blieben sie häufig Gefangene ihrer gesellschaftlichen Situation.
Das änderte sich durch die zweite Welle der Frauenbewegung, die auch unsere Erwartungen über die weitere Entwicklung prägte. Frauen hielten unaufhaltsam Einzug in die Arbeitswelt, und die Zahl der erwerbstätigen Frauen stieg im Laufe einer einzigen Generation – meiner eigenen – rapide an.8 Im Jahr 1930 betrug der Frauenanteil an der erwerbstätigen Bevölkerung Kanadas 25 Prozent. 1950 war er auf 29 Prozent gestiegen, aber bis 1975 war er zu einer Welle von mehr als 40 Prozent angewachsen und lag 2005 bei 47 Prozent.9 Im Jahr 1918 erhielten Frauen das Wahlrecht in Kanada, 1920 in den USA und 1928 in Großbritannien. Aber erst in den Siebzigern fingen die Frauen an, in großer Zahl in Ausbildungsgänge zu strömen, die sie zu Ärztinnen, Rechtsanwältinnen oder Architektinnen machten, um nur einige der Berufe zu nennen, die zuvor als rein männliche Domänen galten.10 Dieser Einstellungswandel bei der neuen Frauengeneration spiegelte sich auch in der Politik wider. Während der Sechziger und Siebziger wurden in Großbritannien, den USA, Kanada und der Europäischen Gemeinschaft Gleichstellungsgesetze eingeführt, die es untersagten, Frauen zu diskriminieren oder ihnen weniger Lohn zu zahlen als Männern. Ironischerweise waren die USA trotz ihrer Rolle als Speerspitze des sozialen Protests in den Sechzigern das einzige westliche Land, das nicht genügend Schwung aufnahm, um die Gleichstellung von Mann und Frau als allgemeinen Grundsatz in die Verfassung aufzunehmen – und das obwohl die Idee fünfunddreißig Jahre lang diskutiert wurde und breite Zustimmung fand. Stattdessen verabschiedete man gezielte Gesetze, die sich gegen eine Diskriminierung am Arbeitsplatz und sexuelle Belästigung richteten (im Equal Pay Act von 1963 und im Title VII des Civil Rights Act von 1964) und staatlichen Schulen untersagten, geschlechtsspezifische Unterrichtsfächer anzubieten (Title IX, 1972). Diese Gesetze lösten noch lange Zeit erbitterte Kontroversen aus. Die Statuten beseitigten zwar offenkundige Ungerechtigkeiten wie unterschiedliche Lohn- und Gehaltstarife für Mann und Frau und solche Misslichkeiten wie »Boom-boom«-Räume, in denen männliche Mitarbeiter sich mit Stripperinnen amüsierten, aber sie übertünchten auch alle elementaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wodurch absurde Situationen entstanden, in denen Schwangerschaftsvergünstigungen oder rein männliche Fußballmannschaften plötzlich als Diskriminierungen eingestuft wurden. Dennoch stand außer Frage, dass im Westen eine überwältigende soziale Bewegung im Gange war, die darauf zielte, die Ungleichheiten der Vergangenheit durch eine schützende Gesetzgebung zu beseitigen ebenso wie durch Affirmative-Action-Programme, die die Anzahl der Mädchen und Frauen in Schulen, Universitäten und der Arbeitswelt erhöhen sollten.
Die Gleichstellungsgesetze und das Denken, das hinter der zweiten Welle der Frauenbewegung stand und das die Generation der Babyboomer entscheidend prägte, hatten unbeabsichtigte Auswirkungen. Beide trugen zu der Erwartung bei, dass alle Unterschiede zwischen Männern und Frauen durch ungerechte Praktiken hervorgerufen würden und die Abschaffung dieser Praktiken von daher auch die Unterschiede aus der Welt schaffen würde. Als die neuen Gesetze und Richtlinien in Kraft waren und Frauen beinahe die Hälfte der Erwerbstätigen stellten, vertraute man darauf, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bevor alle Berufe im Verhältnis 50 zu 50 zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wären. Es schien eine logische Erweiterung des Gleichheitsideals der Sechziger zu sein, dass Männer und Frauen, Seite an Seite, in gleicher Zahl arbeiten und die gleichen Tätigkeiten in der gleichen Stundenzahl und für die gleiche Bezahlung ausüben würden. Als dann im Jahr 2000 das Fifty-fifty-Verhältnis nicht in allen Berufssparten erreicht war, machte sich allgemeine Enttäuschung breit. »Volle Gleichberechtigung liegt immer noch in weiter Ferne«, kommentierte die britische Journalistin Natasha Walters im Jahr 2005 die Tatsache, dass Frauen dort noch immer 15 Prozent weniger verdienten als Männer, wenn man das Durchschnittseinkommen berechnete.11 »What’s Wrong With This Picture?«, also »Was ist hier falsch?«, lautete die Schlagzeile eines im Jahr 2007 veröffentlichten Artikels, in dem das Feminist Research Center berichtete, dass es »unter Zugrundelegung der derzeitigen Zuwachsrate noch 475 Jahre dauern wird oder mindestens bis zum Jahr 2466, bis es genauso viele Frauen wie Männer in den Vorstandsetagen gibt.«12 (Bei 16,4 Prozent aller Führungskräfte in Fortune-500-Unternehmen im Jahr 2005 ist diese Schätzung für Frauen nicht ganz korrekt. Bei der derzeitigen Zuwachsrate würde es laut den Prognosen von Catalyst, einer anderen Frauenforschungsgruppe, weitere 40, nicht 400 Jahre dauern, bis wir genauso viele weibliche wie männliche CEOs hätten.) Auf alle Fälle war die Grundannahme offenbar, dass Frauen, wenn die Gesellschaftsordnung sich wirklich verändert hätte, jetzt auf genau dem gleichen Stand wären wie die Männer. Sie würden genauso häufig die gleichen Berufsentscheidungen treffen und genauso häufig wie Männer ihren Weg in die Unternehmensführung, in die theoretische Physik oder in politische Ämter finden. Sogar bei Frauen, die solche Berufsfelder nicht selbst gewählt haben, ist die Enttäuschung umso größer, je weiter der Frauenanteil von 50 Prozent entfernt ist. Das ist so, weil es größtenteils für selbstverständlich gehalten wird, dass sich hinter diesen Zahlen eine Form von Frauendiskriminierung verbirgt. Doch trotz immer noch bestehender Diskriminierung (sowohl die Wall Street als auch Wal Mart sahen sich jüngst mit Gruppenklagen konfrontiert und mussten sich wegen diskriminierender Praktiken verantworten, weil weibliche Mitarbeiter am Aufstieg gehindert wurden) ist mir bei meinen Gesprächen mit erfolgreichen Frauen und bei meiner Auswertung der Daten klar geworden, dass auch die Interessen und Präferenzen von Männern und Frauen zu dieser Schieflage beitragen.13 Die gleichen Chancen führen nicht notwendigerweise zu gleichen Ergebnissen. Genaugenommen lässt gerade die Tatsache, dass Frauen Wahlmöglichkeiten haben, ihre Präferenzen besonders deutlich hervortreten. Betrachtet man genauer, was sich in den letzten dreißig Jahren dramatisch verändert hat und was sich nur wenig verändert hat, bekommt man einen Eindruck davon, welche Richtungen Frauen einschlagen, wenn ihnen die Türen erst einmal offen stehen.
Eine der bemerkenswertesten Veränderungen in diesem Zeitraum hat sich an den Universitäten vollzogen. 1960 waren in den USA 39 Prozent der Studierenden weiblich. Heute sind es 58 Prozent. Tatsächlich gilt für die Universitäten der gesamten westlichen Welt, dass die Frauen den Männern zahlenmäßig überlegen sind.14 Ihre herausragenden akademischen Leistungen und ihre breiten Interessen, die über das Studium hinausgehen – von Debattierclubs bis hin zum tätigen Engagement für Habitat for Humanity -, hatten zur Folge, dass sich leistungsstarke Frauen ihre Universitäten und Fachbereiche aussuchen können. Studienfächer wie Jura, Medizin, Pharmazie und Biologie, lauter einst von Männern beherrschte Domänen, werden heute gleichmäßig von Frauen und Männern belegt oder mehrheitlich von Frauen. In zwei höchst wettbewerbsorientierten Disziplinen – klinische Psychologie und Veterinärmedizin – finden sich heute zwischen 70 und 80 Prozent Frauen.15 Mädchen und Frauen schlagen sich eindeutig hervorragend im Klassenzimmer und machen auch außerhalb davon bedeutende Fortschritte – die Bemühungen, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu verringern, waren in der westlichen Welt also eindeutig erfolgreich. 56 Prozent aller hochbezahlten, hochqualifizierten Arbeitsplätze werden heute von Frauen eingenommen, und in Kanada und Großbritannien besetzen Frauen mehr als die Hälfte aller hochqualifizierten und leitenden Positionen.16 Sogar in den höchsten Rängen der Geschäftswelt, wo man weibliche Führungskräfte in der Vergangenheit mit der Lupe suchen musste, hat eine Studie über 10 000 Fortune-Unternehmen ein interessantes Phänomen aufgedeckt: Obwohl fast die Hälfte der Unternehmen keine Frau am Ruder hat, befördert die andere Hälfte mehr Frauen in leitende Positionen und lässt sie zudem schneller aufsteigen – in jüngerem Alter und mit weniger Berufserfahrung als Männer in vergleichbaren Positionen (die Frauen werden im Durchschnitt nach 2,6 Jahren am Arbeitsplatz befördert, wenn sie in den Vierzigern sind, die Männer nach 3,5 Jahren, in ihren Fünfzigern.)17 Zurzeit sind alle geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Bezahlung geringer als je zuvor. Im Gegensatz dazu gibt es viele Teile der Welt, wo Mädchen noch immer nicht zur Schule gehen dürfen, wo sie im Teenageralter zu Schwangerschaften, zur Prostitution oder zur Ehe gezwungen werden und als Erwachsene nicht außerhalb des Hauses arbeiten dürfen und kein Wahlrecht haben. Doch was die westlichen Demokratien betrifft – wo ist das Problem? Warum feiern wir nicht unsere Erfolge?
Ein Grund für das anhaltende Händeringen ist, dass Frauen zwar bestimmte Disziplinen überschwemmt haben, in denen sie noch vor einigen Jahrzehnten rar gesät waren, dass es in anderen Bereichen aber immer noch auffällige Diskrepanzen gibt. Mehr Frauen als je zuvor studieren Ingenieurwesen, Physik und Informatik, dennoch kann man nicht unbedingt sagen, dass sie sich um diese Fächer genauso reißen wie etwa um Medizin oder Rechtswissenschaft. Trotz zahlreicher Projektgruppen und der Millionenbeträge, die in die Frauenförderung fließen, sind an den meisten Universitäten im Fachbereich Ingenieurwissenschaft nicht mehr als 20 Prozent Frauen eingeschrieben. Männer ergreifen verstärkt Berufe wie Lehrer, Krankenpfleger und Sozialarbeiter – aber auch diese Bereiche sind überwiegend weibliche Enklaven geblieben. Trotz größerer Wahlmöglichkeiten scharen Frauen sich immer noch in bestimmten Berufsfeldern zusammen, genauso wie Männer es in anderen tun.
Damals und heute
Tabelle 1: AusbildungDer Prozentsatz von Frauen mit Studienabschlüssenin »männertypischen« Bereichen.
Quellen auf Seite 429.
Tabelle 2: BerufDer Prozentsatz von Frauen, die in früheren»Männerdomänen« arbeiten.
Quellen auf Seite 429 f.
Der zweite Anlass zur Besorgnis ist, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, wenn man das geschlechtsspezifische Durchschnittseinkommen berechnet. Diese globalen Statistiken verschmelzen für gewöhnlich grundverschiedene Berufe, unterschiedliche Untergruppen beruflicher Spezialisierung und unterschiedliche Arbeitszeiten zu einem undifferenzierten Gemisch. Auf den folgenden Seiten möchte ich darlegen, wie biologisch begründete Neigungen und Vorlieben aufschlussreiche Details bei beiden Geschlechtern beeinflussen können. Die entwicklungsbezogenen Unterschiede bei Jungen bringen vielleicht etwas Licht in die Frage, warum sie in ihren schulischen Leistungen und ihrer Universitätspräsenz den Mädchen hinterherhinken. Andererseits beeinflussen die – breitgefächerten und häufig menschenorientierten – Prioritäten von Frauen deren Berufswahl. Trotz größerer Möglichkeiten und trotz der Affirmative-Action-Programme rümpfen viele Frauen beharrlich die Nase über zahlreiche Bereiche, die ihnen heute offen stehen, ob es sich um Computerprogrammierung, die holzverarbeitende Industrie oder die Politik handelt. Betrachtet man ihre Ausbildungsprofile ist klar, dass die Berufswahl keine Frage des »Kann nicht« ist. Es ist auch keine Frage des »Sollte nicht«, da die meisten ehemals von Männern beherrschten Domänen beträchtliche Anstrengungen unternommen haben, um Frauen anzuwerben. Dennoch spielt die Frage, was sie sollten oder nicht sollten, eine große Rolle in den Geschichten der hier beschriebenen Frauen. Ein starker Druck, unter dem viele begabte, leistungsorientierte Frauen stehen, ist, sich für dieselben Berufe zu entscheiden wie die Männer. Das bringt uns zurück zu den Männern und ob es sinnvoll für Frauen ist, sie sich zum Vorbild zu nehmen.
Die Extreme
»Es gibt keinen weiblichen Mozart, weil es keinen weiblichen Jack the Ripper gibt«, schrieb die Gesellschaftskritikerin Camille Paglia und ihr Bonmot verweist auf eine biologische Tatsache. Verglichen mit Frauen gibt es mehr Männer, die zu Extremen neigen. Obwohl die Geschlechter sich in den meisten Bereichen, einschließlich der Intelligenz, ebenbürtig sind, gibt es weniger Frauen als Männer an den extremen Enden der normalen Verteilung. Die Variabilität bei den Männern ist einfach größer. Ihr »Mittel« oder ihre Durchschnittswerte als Gruppe entsprechen in etwa denen der Frauen, aber ihre individuellen Werte sind breiter gestreut. Von daher gibt es eine größere Zahl sehr dummer und sehr kluger Männer, mehr extrem faule Männer und mehr Männer, die bereit sind, sich zu Tode zu arbeiten. Es gibt mehr Männer mit physiologischen Schwächen und mehr mit einzelnen Extrembegabungen; dazu gehören auch Männer mit herausragendem Talent, die gleichzeitig unter Defiziten in anderen Bereichen leiden, zum Beispiel unter solchen Problemen wie die Jungen in meinem Wartezimmer. Die Glockenkurve sieht bei Männern einfach anders aus als bei Frauen, mit mehr Männern an den Ausläufern der Verteilung, wo ihre gemessenen Fertigkeiten entweder kläglich, grandios oder eine Mischung aus beidem sind. Obwohl also der Durchschnitt bei Männern und Frauen gleich ist, gibt es mehr männliche »Ausreißer« – und insgesamt mehr »normale« Frauen.18 Vergleicht man Männer und Frauen in den Mittelbereichen, findet man weniger Unterschiede zwischen den Geschlechtern, aber an den Extremen sieht das Bild, nun ja, extrem aus.
Geschlechterunterschiede in den Extrembereichen gehörten zu den Themen, die den früheren Rektor der Harvard-Universität, Larry Summers, um sein Amt brachten. Ich arbeitete bereits an diesem Buch, als ich im Januar 2005 eine E-Mail von Jackie Joiner, einer meiner Literaturagentinnen erhielt. »Hast du das gesehen?«, schrieb sie und schickte mir im Anhang einen elektronischen Artikel, der am selben Morgen in der New York Times erschienen war. Summers hatte auf einer Tagung zum Thema Vielfalt in Wissenschaft und Technik eine Rede über die Ursachen von Geschlechterunterschieden in naturwissenschaftlichen Spitzenbereichen gehalten. Seine Äußerungen lösten mehr als tausend Artikel in der Presse aus, führten ein Jahr lang zu erbitterten Auseinandersetzungen in Harvard, veranlassten Summers zu mehreren öffentlichen Entschuldigungen und schließlich zu dem Versprechen, 50 Millionen Dollar zu investieren, um Frauen und Angehörige von Minderheiten an der Universität zu fördern. Dennoch wurde er 2006 aus dem Amt gedrängt. Worum ging es bei diesem ganzen Wirbel? Summers hatte die Vermutung angestellt, dass es drei Gründe dafür gebe, warum so wenige Frauen hochrangige Fakultätspositionen in Naturwissenschaft und Technik bekleideten. Der erste lautete, dass diese Positionen so »gierig« und kräftezehrend seien, dass viele Frauen sie vermieden. »Wie viele junge Frauen entscheiden sich mit Mitte Zwanzig für einen Job, der sie achtzig Stunden die Woche in Anspruch nimmt? Wie viele junge Männer entscheiden sich gegen einen Job, der sie achtzig Stunden die Woche in Anspruch nimmt?«, fragte er, und fügte hinzu, dass es eine andere Frage sei, ob eine Gesellschaft das Recht hätte, ein solches Engagement zu fordern. Sein zweiter Punkt war die männliche Variabilität. »Wenn die Variabilität bei den Männern größer ist als bei den Frauen, dann gibt es mehr Männer am untersten und am obersten Ende der Verteilung. Deshalb findet man in der naturwissenschaftlichen und technischen Forschung, die um einen winzigen Bruchteil menschlicher Begabung an der obersten Spitze konkurriert – wo es nicht nur sehr wenige Frauen, sondern auch sehr wenige Männer gibt – vielleicht extremere Geschlechterunterschiede«, sagte er.19
Das war keine neue Idee, mindestens ein Dutzend Wissenschaftler hatte sie bereits dargelegt. Ein Edinburgher Psychologe, Ian Deary, hatte das Phänomen sogar dokumentiert, nachdem er die Daten von mehr als 80 000 Kindern ausgewertet hatte – von fast jedem Kind, das 1921 in Schottland geboren wurde. Im Alter von elf Jahren gab es im Durchschnitt keinen Unterschied zwischen dem IQ der Jungen und Mädchen, stellte Dearys Team fest. Doch der Unterschied in der Variabilität war eindeutig: es gab signifikant mehr Jungen als Mädchen an den niedrigen und hohen Fähigkeitsextremen.20
Ein Vergleich der IQ-Werte von 80 000 schottischen Kindern, die 1921 geboren wurden
Abb1: Der DurchschnittIQ-Verteilung bei schottischen Kindern
Quelle auf Seite 430.
Seit über einem Jahrzehnt hatten andere Wissenschaftler – Amy Nowell, Larry Hedges, Alan Feingold, Diane Halpern, Camilla Benbow und Julian Stanley, Yu Xie, Kimberlee Shauman, der Scholastic Aptitude Testing Service (der die Hochschulreife amerikanischer Schüler testet) ebenso wie mein Bruder Steven – dasselbe Phänomen erkannt und darüber geschrieben, doch in Summers’ Fall löste es einen anhaltenden Sturm der Entrüstung aus. »Mir wurde ganz schlecht«, sagte Nancy Hopkins, Biologieprofessorin am MIT, die berichtete, dass Summers’ Kommentare sie fürchterlich aufgeregt hätten: »Mein Herz pochte wie wild und ich bekam kaum noch Luft.« Summers nannte im weiteren Verlauf seiner Rede einen dritten Faktor – die Sozialisation und anhaltende Diskriminierung -, doch es hörte kaum noch jemand zu. Seine Botschaft über Extreme, über Standardabweichungen und Jobs, die einen auffressen, war zu einer einzigen Aussage komprimiert worden: »Frauen sind in Mathematik und Naturwissenschaften nicht so gut wie Männer.« Die spannungsgeladene Atmosphäre, die das Thema Geschlechterunterschiede umgibt, lud sich nur noch stärker auf.
Ein Vergleich der IQ-Werte von 80 000 schottischen Kindern, die 1921 geboren wurden
Abb2: Die StandardabweichungenSignifikanz des Unterschieds zwischen den Geschlechternin jedem IQ-Bereich
Quelle auf Seite 430.
Das Thema physiologisch begründeter Geschlechterunterschiede stand also bereits im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als ich mich in die Diskussion einmischte. Doch die Bereitschaft vieler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, über ihre Arbeit zu sprechen, hatte merklich abgenommen. Mehrere Wissenschaftlerinnen, die sich auf das Thema spezialisiert hatten, lehnten ein Interview ab; sie wollten die Aufmerksamkeit nicht auf irgendetwas lenken, das man als politisch inkorrekt deuten könnte, und hatten auch keine Lust, zur Zielscheibe der Kritik zu werden. Als ich eine Sozialwissenschaftlerin fragte, was ihrer Ansicht nach die Gründe dafür sein könnten, dass hochintelligente, erfolgreiche Frauen andere Berufe wählten als Männer, platzte sie wütend heraus: »Nicht das schon wieder!« Naiv fragte ich nach: »Nicht was schon wieder?« »Nicht schon wieder dieses Zeug mit der Wahlfreiheit!« Ich hatte ungewollt einen wunden Punkt berührt. Nach dem »Wahlfreiheits-Feminismus« können Frauen sich in beruflicher Hinsicht offenbar so entscheiden, wie es ihnen gefällt (sie können Teilzeit, Vollzeit oder überhaupt nicht arbeiten) und sich dennoch als Feministinnen bezeichnen. Doch dieser Zweig des Feminismus hatte letztendlich die Vorstellung in Frage gestellt, dass jede Abweichung vom männlichen Standard einen Rückschritt für die Frauen bedeutete, weil viele kluge und fähige Frauen sich nicht für »Männerberufe« entschieden. Ungeachtet individueller Unterschiede und Bedürfnisse passte das einfach nicht zu der Erwartung, dass Chancengleichheit für Frauen (ein Prinzip, das mir lieb und teuer ist) zu einem mathematisch gleichen Ergebnis führen sollte. Dass dies nicht geschehen ist, hat sich in der Debatte um die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere für Frauen als Zündstoff erwiesen und bei WissenschaftlerInnen das Gefühl hinterlassen, dass dieses Thema tabu ist.
Doch WissenschaftlerInnen sind nicht die einzigen, die in diesem Buch zu Wort kommen werden. Auch »ganz normale Leute« schildern ihren beruflichen Werdegang und warum sie diese oder jene Entscheidungen getroffen haben. Ihre Geschichten sind nicht aus den Erfahrungen verschiedener Personen zusammengesetzt oder fiktionalisiert, auch wenn ich Details, die Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen, gelegentlich verändert habe. Die Interviews erwiesen sich schon als solche, ganz abgesehen vom Inhalt, als aufschlussreich, weil alle beteiligten Frauen mich baten, ihnen Pseudonyme zu geben, während die Mehrheit der sogenannten fragilen Männer darauf bestand, dass ich ihre echten Namen benutzte. Deshalb treten die beschriebenen Frauen mit einem fiktiven Vornamen – unter einem Pseudonym – auf. Wenn Vor- und Nachname genannt werden, wie bei den meisten beschriebenen Männern, handelt es sich um den echten Namen der Person. Es war meine Entscheidung, einigen jungen Männern, die Anfang zwanzig sind, ein Pseudonym zu geben, für den Fall, dass sie es in ein paar Jahren bereuen, in diesem Buch erkannt zu werden. Obwohl alle Männer heikle Krankengeschichten hatten, schienen sie sich weniger Sorgen darüber zu machen, verletzlich zu erscheinen, als die Frauen, die befürchteten, dass man ihr berufliches oder wissenschaftliches Engagement in Frage stellen könnte. Obwohl alle Frauen mit großer Offenheit und Weitsicht über ihre beruflichen Erfahrungen sprachen, bekamen drei erfolgreiche Frauen im Anschluss an die Interviews trotz der Pseudonyme und der veränderten Detailinformationen Bedenken, was ihre Teilnahme betraf. Keiner der Männer hatte derartige Bedenken. Vielleicht hatten die Männer so hart um ihre Erfolge gerungen, dass sie sich als Sieger betrachteten. Vielleicht ist die Wahlfreiheit immer noch eine so junge und empfindliche Errungenschaft, dass die Frauen sich nicht unbesiegbar fühlen.
»Selbstvertrauen ist etwas sehr Zerbrechliches«, hat einmal der NFL-Football-Spieler Joe Montana gesagt. Auch wenn man sich einen Quarterback nur schwer als Experte zum Thema Zerbrechlichkeit vorstellen kann, zeigen die in diesem Buch vorgestellten ungewöhnlichen Männer und die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Daten, dass Männer weder das Standard- noch das Gattungsmodell für den Menschen sind. Auch sind sie nicht immer die richtigen Vorbilder für weibliche Karriere-Ambitionen. Immerhin lassen viele Männer ein breites Spektrum an Stärken und Schwächen erkennen, die zu erheblichen Krümmungen ihres Entwicklungs- und Lebensweges führen. Männer sind anfälliger für Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Unfälle. Sie neigen eher dazu, andere Menschen zu verletzen oder zu töten. Bei ihnen besteht auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie extrem lange Arbeitszeiten in extremen Jobs ableisten und jünger sterben. Das vorliegende Buch zeigt, dass diese Merkmale zumindest teilweise mit der Biologie zusammenhängen. Wenn man Männer als Variationen ihres eigenen Themas betrachtet, gewinnt man ein differenzierteres Verständnis davon, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und Frauen werden nicht einfach als frustrierte Versionen dieses männlichen Modells betrachtet. Stattdessen erklären hochbegabte Frauen, die dieses Modell ausprobiert haben, warum sie zu dem Schluss kamen, dass es für sie nicht geeignet ist.
In der Realität ist kein Geschlecht eine umfrisierte oder fehlerhafte Version des anderen. In diesem Buch werden Männer nicht kurzerhand als gefühlsarme, unkomplizierte Tölpel abgefertigt. Und Frauen werden nicht als unglückliche Opfer dargestellt, die am Erreichen ihrer Ziele gehindert werden. Die Erfahrungsberichte dieser beiden Gruppen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich dahinter verbergen, sind die Chiffren, über die ich grundlegende Unterschiede zwischen den Geschlechtern untersuche. Diese scheinbaren Gegensätze – fragile Männer und hochbegabte Frauen – eröffnen einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf die Geschlechterdebatte. Wenn diese beiden Gruppen Extreme auf einem Kontinuum sind, ist, was immer sie antreiben mag, für uns alle gültig.
Kapitel 1
Sind Männer das fragilere Geschlecht?
Als lebhafter, aufgeweckter Vierjähriger wurde Cutler Dozier in der New York Times als einer der ersten Vertreter einer neuen Generation von winzig kleinen, frühgeborenen Babys porträtiert, die dank des medizinischen Fortschritts überlebt hatten. »Wir wissen nicht, was geschieht, wenn er zur Schule kommt«, erklärte seine Mutter gegenüber der Reporterin. Ihre Vorsicht war begründet. Cutler hatte sein Leben außerhalb des Mutterleibs in der 26. Schwangerschaftswoche begonnen. Mit einem Gewicht von weniger als 2½ Pfund hing sein Leben in den ersten Monaten an einem seidenen Faden. Wie die meisten Frühchen konnte er in den ersten Wochen nicht eigenständig atmen oder auch nur saugen. Er wurde durch eine Magensonde ernährt und hatte ein Loch im Herzen, das sofort operiert werden musste. All das verhieß nichts Gutes für seine Zukunft.
Als er fünfzehn Jahre später noch einmal von der Reporterin Jane Brody porträtiert wurde, hatte er allen Widrigkeiten getrotzt. Der Neunzehnjährige hatte sich zu einem gesunden jungen Mann entwickelt, der an der University of Minnesota die Fächer Film und Orientalistik studierte, eine Kampfsportart ausübte und gerade mit einem Preis für seine Gedichte ausgezeichnet worden war.1 Dank der Betreuung durch hochspezialisierte Fachkräfte und mithilfe modernster intensivmedizinischer Technik auf der Neugeborenenstationen hatte er nicht nur überlebt, sondern sich prächtig entwickelt, lange bevor die Experten wussten, welches Schicksal ihn erwartete.
Die Geschichte von Cutler Dozier verdiente nicht nur Aufmerksamkeit, weil er ein Frühchen war, das es geschafft hatte. Die Tatsache, dass er ein Junge war, machte ihn zu einer ganz besonderen Ausnahme.
Die Frühchen mit der größten Überlebenschance sind Mädchen.2 Weibliche Frühchen haben eine 1,7 Mal höhere Überlebenschance als männliche; afroamerikanische Mädchen, die zu früh geboren werden, überleben sogar doppelt so häufig wie weiße Jungen. Zu diesen Ergebnissen kam eine Studie von amerikanischen Ärzten, die den Entwicklungsweg von 5076 Babys mit niedrigem Geburtsgewicht verfolgten.3
Wie Cutler entwickeln sich viele dieser Kinder schließlich sehr gut. Doch mehr als die Hälfte der Frühchen leidet später unter einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung, unter Lernproblemen oder Verhaltensstörungen. Bei der überwältigenden Mehrheit der Kinder, die von diesen Problemen betroffen sind, handelt es sich um Jungen, was bestätigt, dass sie bereits vor der Geburt anfälliger sind als Mädchen. 4 Wie die Jungen in meinem Wartezimmer haben sie im weiteren Entwicklungsverlauf häufig Probleme mit dem Sprech- und Sprachvermögen, mit dem Lernen und mit sozialen Fähigkeiten. Bei den frühgeborenen Jungen bleiben die Hirnregionen, die für Lesen, Sprache und die Emotionskontrolle zuständig sind, wie eingefroren auf einem früheren Entwicklungsstand stehen und sind kleiner als bei frühgeborenen Mädchen; diese Größenunterschiede sind auf Hirnscans selbst bei Achtjährigen noch erkennbar.
»Als wir die Frühchengruppe nach Geschlecht unterteilten, landeten wir einen Treffer! Bei den Mädchen stellten wir ein normales oder gleichbleibendes Volumen der weißen Substanz fest, während das Volumen bei den frühgeborenen Jungen verglichen mit gleichaltrigen Jungen reduziert war«, erklärte Allan Reis, der federführende Leiter dieser Studie, als er einem Kollegen vom Stanford Hospital die Ergebnisse seines Forschungsteams erläuterte. Seine Entdeckung war lediglich die jüngste aus einer langen Reihe von Studien, die zeigen, dass bei frühgeborenen Mädchen eine größere Wahrscheinlichkeit besteht als bei ihren männlichen Gegenstücken, dass sie den Rückstand gegenüber voll ausgetragenen Babys auf holen – von der Körpergröße bis hin zur Lesefähigkeit. Die Mädchen, die genauso früh und mit genauso niedrigem Gewicht geboren werden, sind einfach von Anfang an stärker und widerstandsfähiger.5
Männliche Embryos sind vom ersten Tag an anfälliger für die Auswirkungen von Stress bei der Mutter. Wenn es hart auf hart kommt, haben die weiblichen Embryos bessere Chancen durchzukommen. Sie sind besser dafür gerüstet, die kritischen ersten Stunden nach der Empfängnis zu überstehen, und sie sind weniger anfällig für Komplikationen bei der Geburt, für alle Arten von Behinderungen und einen frühen Tod. Sogar die Umweltverschmutzung wirkt sich stärker auf den männlichen Nachwuchs aus. Demographen haben festgestellt, dass es an Orten, die stromabwärts von Industriegebieten liegen, weniger männliche Neugeborene gibt. (In einem Gebiet im nördlichen Ontario, das als »Chemical Valley« bekannt ist, bringen die Frauen der Aamjiwnaang doppelt so viele Mädchen wie Jungen zur Welt.) Das klingt nach einer apokalyptisch anmutenden geschlechtsspezifischen Auslese, doch nach allgemeiner Expertenmeinung haben die weniger robusten männlichen Embryos bei schlechteren Umwelt- oder sozialen Bedingungen tatsächlich geringere Überlebenschancen.
Die amerikanischen Psychologinnen Emmy Werner und Ruth Smith führten eine bemerkenswerte Studie durch, in der sie über zwanzig Jahre hinweg die Entwicklung von 700 hawaiianischen Kindern verfolgten, die 1955 in armen Verhältnissen auf der »Garteninsel« Kauai geboren wurden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass von den Wochen vor der Geburt bis zum Alter von achtzehn Jahren die Jungen eine signifikant höhere Anfälligkeit zeigten. In dieser eng verbundenen, ethnisch bunt gemischten Gemeinschaft waren mehr Jungen als Mädchen geburtsbezogenen Traumata ausgesetzt und mehr als die Hälfte dieser Jungen starb im Säuglingsalter, im Gegensatz zu weniger als einem Fünftel der Mädchen. Von der Geburt bis zum Alter von zwei Jahren hatten mehr Jungen als Mädchen schwere Unfälle oder Krankheiten, und doppelt so viele Jungen wie Mädchen hatten IQ-Werte unter 80 oder Schwierigkeiten mit der sprachlichen, sozialen oder motorischen Entwicklung. Die beiden Kinder, die durch einen Unfall und durch Ertrinken ums Leben kamen, waren beide Jungen. Mehr als 50 Prozent aller Jungen hatten schulische Probleme. Die Jungen wurden durch negative Bedingungen – Armut, instabile Familienverhältnisse oder fehlende Anregungen – stärker beeinträchtigt als die Mädchen.6
Aus einer biologischen Perspektive bietet die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht einfach eine Art Schutzschirm von der Wiege bis zur Bahre. Niemand weiß genau, warum das so ist, aber es gibt mehrere Hypothesen. Mädchen könnten durch den Besitz zweier X-Chromosomen in dem Sinne abgesichert sein, dass sie ein Chromosom in Reserve haben, falls das andere zerstört wird oder Fehler kodiert. Da viele Gene, die mit dem Gehirn zusammenhängen, auf dem X-Chromosom liegen, sind neurologische Merkmale besonders betroffen. Bei nur einem einzigen X-Chromosom besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass extreme Variationen auftreten, die möglicherweise abgemildert oder sogar beseitigt würden, wenn ein zweites X-Chromosom vorhanden wäre, um die Auswirkungen der Mutation aufzufangen.7
Mädchen sind zudem vor den männlichen Hormonen geschützt, die zu einer verlangsamten und abweichenden Entwicklung des fötalen männlichen Gehirns führen – was eines der Themen dieses Buches und möglicherweise eine der Ursachen ist, weshalb männliche Frühchen bereits vor der Geburt verwundbarer sind als Mädchen. Das Testosteron als machtvoller chemischer Antriebsstoff vermännlicht das Gehirn vor der Geburt und gestaltet es auch danach weiterhin um, häufig mit widersprüchlichen Auswirkungen. Bei männlichen Tieren ist die Gefahr, dass sie krank werden und sterben, besonders groß, wenn sie sich in der Fortpflanzungsphase befinden, das heißt, wenn ihr Hormonspiegel am höchsten ist. Testosteron übt eine ähnlich paradoxe Wirkung auf Menschen aus. Es erhöht die Aggressivität, Risikofreudigkeit und Energie. Doch man vermutet, dass es auch mit der höheren Anfälligkeit der Männer für praktisch jede bestehende chronische Krankheit zusammenhängt, wie etwa Krebs, Diabetes, Lebererkrankungen, Herzerkrankungen und AIDS.8 Testosteronschübe steigern bei Männern die Kraft, das Durchhaltevermögen und bis zu einem gewissen Grad sogar das räumliche Vorstellungsvermögen. Doch sie schwächen gleichzeitig die Immunabwehr des Körpers. Das zeigt sich eindrucksvoll an den Überlebensraten in Krankenhäusern. Je höher der Testosteronspiegel, desto weniger widerstandsfähig sind die Männer gegenüber postoperativen Infektionen. 70 Prozent der Männer, die an diesen Infektionen erkranken, sterben auch daran, verglichen mit nur 26 Prozent bei den Frauen.9
Und wie erklärt sich nun diese biologische Vulnerabilität? Möglicherweise liegt der Ursprung der stärkeren weiblichen Konstitution in der Evolutionsgeschichte. Robuste Frauen, die über genügend Zähigkeit verfügten, um Kinder zu gebären, sie zu füttern und auf dem langen Weg ins Erwachsenenalter zu betreuen, hatten bessere Chancen auf überlebenden Nachwuchs. Die Frauen mit der besseren Konstitution hatten also Nachfahren, die ihre Erbinformationen weitertrugen. Im Gegensatz dazu konnten Männer sich ungestraft fortpflanzen. Ob sie lange genug überlebten, um ihren Nachwuchs bis zur Reife großzuziehen, spielte letztendlich eine weniger bedeutsame Rolle als ihre Fähigkeit, überhaupt Nachwuchs zu zeugen. Bei jeder Spezies, bei der eine gewisse Anzahl Männchen sich mit mehr als einem einzigen Weibchen paart, während andere Männchen sich überhaupt nicht paaren, ist diese Leistung alles andere als selbstverständlich. Bei diesem harten Wettbewerb konnten größere Stärke, Schnelligkeit oder Risikobereitschaft darüber entscheiden, ob man sich erfolgreich fortpflanzte oder ewiger Vergessenheit anheimfiel. Und wenn dies auf lange Sicht Abstriche an der männlichen Lebenserwartung oder Gesundheit erforderte, so war das ein Preis, den die Evolution in Kauf nahm. Dieser Macho-Vorteil an Schnelligkeit, Kraft und Durchsetzungsfähigkeit kann durch weibliche Präferenzen verstärkt werden. Da das Fortpflanzungsschicksal der Frau zur Hälfte in ihrem männlichen Nachwuchs angelegt ist, hat sie im Laufe der Evolution vielleicht eine Präferenz für männliche Bewerber entwickelt, die stärker, schneller und risikobereiter sind, weil sie mit diesen Eigenschaften bessere Chancen haben, Söhne mit den gleichen Vorzügen zu zeugen.
Männliche Jugendliche auf der ganzen Welt, von helmlosen Skateboard-Fahrern in den Vorstädten bis hin zu messerschwingenden Gangs in den Innenstädten, wissen sehr wohl um den Sexappeal der Risikobereitschaft. Jedes Mal, wenn wir junge Draufgänger im Park sehen oder die Todesanzeigen in der Zeitung lesen, haben wir den Beweis direkt vor unserer Nase. Noch stärker ausgeprägt ist die Fragilität der Männer in Entwicklungsländern, wo die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht der größte Risikofaktor für einen vorzeitigen Tod ist.10
Nehmen wir zum Beispiel die männlichen Jugendlichen in Soweto, die als Train-Surfer bezeichnet werden, und den Tod herausfordern, indem sie tollkühne Stunts auf den Dächern fahrender Züge vollführen, unter Brücken Limbo tanzen, von Waggon zu Waggon springen oder »den Schotter machen« – die Hacken über den Boden ziehen, während sie sich von einem fahrenden Zug hängen lassen. Auf der Beerdigung einer seiner Freunde, der starb, als er gegen einen Stromleitungsmast prallte, beschrieb das Mitglied einer Train-Surfer-Bande, die sich »Die Vandalen« nennt, warum sie diese Risiken eingehen: »Wir haben das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein, wenn wir das tun – wie im Himmel oder so. Es ist, als würde man schweben und nichts fürchten. Die Mädchen finden das toll und schwärmen für uns.« Der neunzehnjährige Südafrikaner wurde interviewt, als die Gruppe beim Train-Surfen war und damit auf makabere Weise einem weiteren Gang-Mitglied, das einige Tage zuvor von einem Zug gefallen war, Tribut zollen wollte. »Jananda hat vergessen, sich schnell genug zu bücken. Er starb vor meinen Augen. Es schien uns ein angemessener Abschied, das zu tun, was wir immer mit ihm zusammen getan haben, bevor er starb«, fügte ein weiter Junge, Julius, hinzu.11 In dem harten Wettbewerb der sexuellen Auslese fühlt es sich wie ein Riesenkick an, tödliche Risiken im Hier und Jetzt einzugehen.
Darauf programmiert, später zu reifen, erbittert zu konkurrieren und jünger zu sterben, leben Männer weiterhin ein gefährdeteres, kürzeres Leben, wie Demographen sowohl in archäologischen Funden als auch in modernen Gesellschaften der letzten 250 Jahre und in über zwanzig verschiedenen Kulturen nachgewiesen haben.12 Die Natur zieht die Fortpflanzungskraft des Testosterons noch immer dem Nachteil einer geringeren Lebenserwartung vor, ein Grund, weshalb der Biologe und Anthropologe Richard Bribiescas die Lebensphasen des Mannes kurz und knapp als »Stud, Dud, Thud« zusammenfasst (etwa: rammeln, versagen, tot umfallen).13 Sogar heute, wo die Fortschritte in Medizin und Technik die menschliche Lebenserwartung beträchtlich erhöhen, besteht ein großer Unterschied in der Sterblichkeit von Männern und Frauen.14
Männer gehen weiterhin höhere Risiken ein, haben mehr Unfälle, werden häufiger krank und neigen auch eher dazu, ihre Krankheiten zu ignorieren, und sterben daher früher (Frauen haben heute eine Lebenserwartung von 83 Jahren, Männer von 78 Jahren). Männer trinken und rauchen auch mehr als Frauen und greifen eher zu tödlichen Waffen, während sie Sicherheitsgurte, Sonnenschutzmittel und ärztliche Ratschläge seltener nutzen als Frauen. Die Realität der männlichen Anfälligkeit traf mich mit voller Wucht, als ich eine E-Mail mit dem Betreff: »Traurige Nachricht« erhielt. Sie setzte mich davon in Kenntnis, dass mein bevorstehendes Klassentreffen von der Highschool einen Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen Mitschüler umfassen würde. Ob noch jemand Fotos oder andere Erinnerungsstücke mitbringen könnte. Dreizehn der siebzehn Mitschüler, die vor ihrem fünfzigsten Lebensjahr gestorben waren (einige noch während unserer Schulzeit), waren Männer – das heißt 76 Prozent. Es kamen also mehr als drei männliche Todesfälle auf einen weiblichen. Dieses Verhältnis entspricht der Sterblichkeit bei Fünfzigjährigen in der Durchschnittsbevölkerung Nordamerikas, wo die meisten Männer im Gegensatz zu den Frauen ihren achtzigsten Geburtstag nicht mehr erleben.15
Wer also ist das stärkere Geschlecht? Das Wartezimmer des Kinderpsychologen und die Notaufnahme des Krankenhauses erzählen die Geschichte einer größeren Fragilität von männlichen Kindern und Jugendlichen. Ein Besuch im Pflegeheim zeigt, wie die Geschichte ausgeht – die Frauen halten einfach länger durch als die Männer.
Schuljungen
Dieses Bild männlicher Zerbrechlichkeit zeigt sich auch beim schulischen Werdegang von Jungen. Es ist schwer, die Vorstellung von der größeren Anfälligkeit der Männer mit der verbreiteten Annahme in Einklang zu bringen, dass sie nicht nur der Standard, sondern auch das stärkere Geschlecht mit der größeren Macht sind. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Die Geschichte mag Männer bevorzugt behandelt haben, aber die Biologie hat ihnen nichts geschenkt, und nirgends zeigt sich dies deutlicher als im Klassenzimmer. In den USA besteht bei Jungen eine drei Mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie in Förderschulen kommen, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Klasse wiederholen müssen, und eine drei Mal so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie die Highschool ohne Abschluss verlassen. In Kanada brechen Jungen die Schule doppelt so häufig ab wie Mädchen und neigen eher dazu, Unterricht als reine Zeitverschwendung zu betrachten. Sie geben weniger Hausaufgaben ab, kommen weniger gut mit den Lehrern aus und interessieren sich weniger für den Unterrichtsstoff.16 In Großbritannien übertreffen Mädchen die Jungen in allen Schulfächern außer den Naturwissenschaften; in den letzten sieben Jahren haben Mädchen bei allen A-Levels oder vor-universitären Prüfungen die Nase vorn. »Von Schulbeginn an nehmen Mädchen eine andere Haltung gegenüber dem Lernen ein«, erklärt Diane Reay, eine britische Erziehungssoziologin, auf die Frage nach den mäßigen Leistungen der Jungen. »Die Mädchen sind bereit, sich an die Regeln des Bildungsspiels zu halten und engagiert zu lernen. Auch wenn sie sich langweilen, machen sie weiter, anstatt auszusteigen.«17
Mädchen neigen weniger dazu, den Unterricht zu kritisieren und seine Mängel zu beklagen – ganz im Gegensatz zu dem »verhaltensauffälligen« amerikanischen Zehntklässler, der das x-te Mal nachsitzen musste und dabei von seinem Highschool-Lehrer beschrieben wurde: »Brandons derzeitige Probleme begannen, weil Mrs Waverly, seine Lehrerin in Sozialkunde, sich weigerte, eine kritische Frage zu beantworten, nämlich wozu der von ihr präsentierte Unterrichtsstoff gut sein solle. Eine der ersten Beobachtungen, die ich als Lehrer machte, war, dass Jungen unweigerlich diese Frage stellen, während Mädchen das selten tun. Wenn ein Lehrer den Schülern eine Aufgabe stellt, schlagen die Mädchen gehorsam ihre Hefte auf und notieren das Datum. Mädchen sind ruhig und angenehm. Sie erzielen ihre Erfolge durch Kooperation. Jungen nageln dich wie eine Motte an die Wand. Sie verlangen eine rationale Erklärung für alles. Wenn deine Gründe sie nicht überzeugen – oder wenn du keine Lust hast, welche anzugeben – lümmeln sie sich verächtlich auf ihren Stühlen, trommeln mit ihren Stiften oder beobachten die Eichhörnchen durchs Fenster.«18
Eine etwas bedrohlichere Schilderung der Frustration männlicher Jugendlicher liefert Bill Bryson in seinen Erinnerungen Mein Amerika. Das Kapitel über seine Schulzeit beginnt mit der folgenden Pressemeldung: »Der Schüler Edward Mulrooney wurde im kalifornischen Passadena verhaftet, nachdem er eine Bombe auf das Haus seines Psychologielehrers geworfen und einen Zettel hinterlassen hatte, auf dem stand: ›Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Haus in die Luft fliegt oder Ihre Fenster rausgeschossen werden, vergeben Sie gerechte Noten und schreiben Sie die Aufgaben an die Tafel – oder ist das zu viel verlangt?‹«19
Das entspricht nicht jedermanns Vorstellung von männlicher Zerbrechlichkeit. Doch die Zahlen verweisen auf eine weitreichende Geschichte der Entfremdung und des Schulversagens. Mädchen haben im Klassenzimmer schon immer bessere Leistungen erbracht – ein Punkt, auf den ich in Kürze noch ausführlicher eingehen werde. Seit 1992 schlagen sie die Jungen weltweit mit besseren Ergebnissen bei Highschool-Leistungstests.20 Tests aus einer riesigen Stichprobe von Fünfzehnjährigen aus dreißig OECD-Staaten zeigen, dass Mädchen in all diesen Ländern im Lesen und Schreiben erheblich besser abschneiden als die Jungen und sich auch in Mathematik ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihnen liefern.21 Dieser Gleichstand in Mathematik ist relativ neu. Anfang der achtziger Jahre wurde eine starke männliche Überlegenheit im schlussfolgernden mathematischen Denken bei standardisierten Tests von zwei Wissenschaftlern der Johns Hopkins Universität nachgewiesen. Camilla Persson Benbow und Julian Stanley hatten die Testergebnisse von 40 000 jungen Highschool-Schülern – die Hälfte Jungen, die Hälfte Mädchen – beim Scholastic Aptitude Test ausgewertet, an dem die Jugendlichen im Rahmen einer Talentsuche der Johns Hopkins University teilgenommen hatten. Beim mathematischen Denken ergaben die Testergebnisse einen Vorsprung von 30 Punkten für die Jungen; besonders ausgeprägt war die Überlegenheit im obersten Punktebereich, wo das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen 13 zu 1 betrug, obwohl sie genau die gleichen Mathematikkurse an der Schule besucht hatten.22 Dass Jungen den obersten, ein Prozent umfassenden Anteil mathematischer Spitzenbegabung stellen, ist das Eine. Wie wir gesehen haben, sind männlichen Testergebnisse breiter gestreut und spiegeln extreme Hochs und Tiefs wider. Und da Jungen diejenigen sind, die wahrscheinlich die allerbesten und die allerschlechtesten Leistungen zeigen (»mehr männliche Genies und mehr männliche Idioten«, wie der Politikwissenschaftler James Wilson es ziemlich direkt ausdrückte), werden alle Tests, die auf Hochbegabungen ausgerichtet sind, Geschlechterunterschiede besonders deutlich hervortreten lassen.
Doch was die schulischen Leistungen und Testergebnisse bei der allgemeinen Population betrifft, liegen die Mädchen vorn. In sechsundzwanzig der dreißig OECD-Staaten ist jeder männliche Vorsprung in Mathematik und Naturwissenschaften so hauchdünn geworden, dass er praktisch ohne Bedeutung ist.23 Das gilt auch für Asien. Unter Achtklässlern in Japan gibt es einen kleinen geschlechtsspezifischen Unterschied zugunsten der Jungen (der Durchschnittswert der Mädchen war 569, während der der Jungen bei 571 lag); in Singapur dagegen schnitten die Mädchen besser ab als die Jungen, mit durchschnittlichen Mathematik-Scores von jeweils 611 und 601. (In beiden asiatischen Ländern erzielten die Beteiligten erheblich bessere Ergebnisse als amerikanische Highschool-Schüler.)24 Sogar in den USA, wo Jungen bei standardisierten Mathematiktests den Mädchen leicht überlegen sind, wird diese Überlegenheit durch das wesentlich höhere Leistungsniveau der Mädchen im Lesen und Schreiben mehr als aufgewogen.
Judith Kleinfeld, eine Psychologieprofessorin aus Anchorage, Alaska, beschreibt Jungen als »Flatliner« und berichtet von einer Studie mit 1195 zufällig ausgewählten Highschool-Schülern, bei der ein Drittel der Mädchen im letzten Zeugnis überwiegend Bestnoten erhalten hatte, verglichen mit weniger als einem Fünftel der Jungen. Die Schüler und Schülerinnen wurden in drei Gruppen unterteilt – die Erfolgreichen, die strebend Bemühten (fleißig) und die Entfremdeten (verbittert und desillusioniert). Die Gruppe der Erfolgreichen bestand zu zwei Dritteln und die Gruppe der strebend Bemühten zu 55 Prozent aus Mädchen, während sich die Gruppe der Entfremdeten zu 70 Prozent aus Jungen zusammensetzte.25
Ganz offensichtlich ist eine wie auch immer geartete männliche Führungsrolle bei schulischen Leistungen eindeutig in Auflösung begriffen. Während Mädchen und Frauen im Laufe der letzten dreißig Jahren enorme Bildungsfortschritte erzielt haben, sind die Jungen auf der Stelle getreten oder haben an Boden verloren. Tatsächlich ist diese schulische Überlegenheit der Mädchen möglicherweise nichts Neues. Historische Daten zeigen, dass es im Hinblick auf die Schreib-und Lesefähigkeiten, das schulische Lernen und die Schulabschlüsse schon immer einen geschlechtsspezifischen Unterschied zugunsten der Mädchen gegeben hat. Laut Claudia Goldin, Lawrence Katz und Ilyana Kuziemko, drei Wirtschaftswissenschaftlern aus Harvard, verfügten die Mädchen sogar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Jungen weit stärkeren Zugang zu Bildungsmöglichkeiten hatten, über bessere Lesefähigkeiten. Sobald man den Frauen in den 1920er Jahren den gleichen Zugang zu Bildungseinrichtungen gewährte, war es bei Jungen weniger wahrscheinlich als bei Mädchen, dass sie die Highschool besuchten, und um 24 Prozent weniger wahrscheinlich, dass sie ihren Abschluss machten, wie die Forscher feststellten, als sie Unmengen von statistischen Daten auswerteten. Im Jahr 1950 lagen die Werte der Mädchen im 60. Perzentil (Prozentrang) ihrer Highschoolklassen – die Mehrheit stellte die Jungen in den Schatten. 1957 lag das mediane oder durchschnittliche Mädchen 21 Perzentilpunkte über dem durchschnittlichen Jungen, 1972 lag es 17 Perzentilpunkte darüber und 1992 16 Perzentilpunkte.26