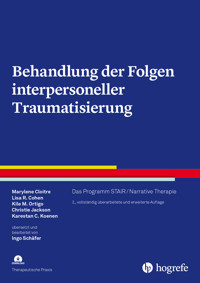
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Menschen, die interpersonelle Traumatisierungen erlebt haben, wie z.B. sexuellen Missbrauch in der Kindheit, häusliche oder strukturelle Gewalt, haben häufig mit den Symptomen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zu kämpfen. Zudem behindern die traumatischen Erlebnisse den Aufbau von wichtigen Ressourcen, was den Umgang mit Emotionen und den Aufbau von Beziehungen erschwert. Hier setzt das evidenzbasierte Skillstraining zur affektiven und interpersonellen Regulation/Narrative Therapie (STAIR/Narrative Therapie) an. Die 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage des Buches beschreibt ein klar strukturiertes Vorgehen, das traumatisierten Personen hilft, ihre Bewältigungsfähigkeiten zu verbessern, soziale und emotionale Ressourcen aufzubauen und die traumatischen Erfahrungen zu bearbeiten. Das Therapieprogramm setzt sich aus zwei Behandlungsschwerpunkten zusammen: Im ersten Modul (STAIR) werden Fähigkeiten vermittelt, die die Emotionsregulation verbessern, den Aufbau von Beziehungen fördern und das Selbstmitgefühl stärken. Das zweite Modul (Narrative Therapie) fokussiert die Bearbeitung der traumatischen Ereignisse mithilfe narrativer Verfahren. Die Neuauflage von STAIR/Narrative Therapie berücksichtigt die Diagnosekriterien nach DSM-5 und ICD-11, kann bei einem breiten Spektrum interpersoneller Traumatisierungen zum Einsatz kommen und enthält zusätzliche Sitzungen zur Emotionsregulation, zu Selbstmitgefühl und zu Nähe und Intimität in Beziehungen. Ausführliche Anleitungen zum Vorgehen in den Sitzungen und Fallbeispiele erleichtern die Umsetzung in der klinischen Praxis. Zahlreiche Arbeitsblätter können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Webseite heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marylene Cloitre
Lisa R. Cohen
Kile M. Ortigo
Christie Jackson
Karestan C. Koenen
Behandlung der Folgen interpersoneller Traumatisierung
Das Programm STAIR / Narrative Therapie
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
übersetzt und bearbeitet von Ingo Schäfer
unter Mitarbeit von Anna-Sophia Hanke, Victoria Scheuber und Anna Simbürger
Die Originalausgabe des Buches ist unter folgendem Titel erschienen:
Treating Survivors of Childhood Abuse and Interpersonal Trauma. STAIR Narrative Therapy
Copyright © 2020 The Guilford Press
A Division of Guilford Publication, Inc.
Published by arrangement with The Guilford Press
Hinweis: Die erste deutschsprachige Auflage des Buches ist 2014 unter der Autorenschaft von Marylene Cloitre, Lisa R. Cohen und Karestan C. Koenen mit dem Titel „Sexueller Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit. Ein Therapieprogramm zur Behandlung komplexer Traumafolgen“ erschienen (Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von Ingo Schäfer, Stephan Schubert-Heukeshoven und Maria Teichert. Die Übersetzung der ersten Auflage erfolgte unter Mitarbeit von Mailin Kluth, Lisa Wegener und Stephanie Vietheer)
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
© 2014 und 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3220-5; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3220-6)
ISBN 978-3-8017-3220-2
https://doi.org/10.1026/03220-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Für unsere Patient:innen, die uns mit ihrem Mut inspiriert haben, sich in Behandlung zu begeben, sich ihren Traumatisierungen zu stellen, und die wagten zu hoffen, ein anderes Leben führen zu können als das, das sie bisher kannten.
Eine Person, die von Missbrauch oder Misshandlung betroffen war, hat letztlich zwei psychische Möglichkeiten: Sich zu verschließen oder sich zu öffnen. Normalerweise tut sie beides … Das sich stetig wandelnde Selbst trifft die Wahl, sich zu öffnen … dazu gehört die grundlegende Zufriedenheit, sogar Freude darüber, am Leben und nicht gestorben zu sein, zusammen mit der Einsicht, eine Erfahrung gemacht zu haben, die in ihrer Schmerzhaftigkeit den Horizont erweitert. Überleben heißt auch Weitermachen, Durchhalten, seine Existenz bewahren … eine körperliche und mentale Stärke. Das Bewusstsein, das Zerstörende besiegt zu haben, ist spürbar, wenn mehrere Betroffene zusammenkommen, … auch wenn es eigentlich unausgesprochen bleibt, ist es deutlich zu vernehmen: „Wir sind hier! Wir sind am Leben! Wir haben gewonnen!“
Robert Jay Lifton (1993, S. 81, 82; Übers.: I. Schäfer)
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Zitat/e
Inhaltsverzeichnis
Vorwort – Was ist mit dem „unterbrochenen Leben“ gemeint?
Inhalt
7Inhaltsverzeichnis
Behandlung der Folgen interpersoneller Traumatisierung
Vorwort – Was ist mit dem „unterbrochenen Leben“ gemeint?
I
Theoretische Rahmenbedingungen
Kapitel 1: Verlust von Ressourcen – ein Modell
1.1
Trauma und eine neue Diagnose: Komplexe PTBS
1.2
Traumatisierungen führen immer zum Verlust von Ressourcen
1.3
Psychische Traumatisierung als Verlust von Ressourcen
1.4
Missbrauch in der Kindheit als Verlust von Ressourcen
1.5
Spezifische Ressourcenverluste durch Misshandlung in der Kindheit
1.5.1
Verlust von gesunder Bindungsfähigkeit und einem gesunden Gefühl für sich selbst
1.5.2
Verlust an Möglichkeiten in Bezug auf die soziale und emotionale Entwicklung
1.5.3
Verlust des Gefühls, Rückhalt im weiteren sozialen Umfeld zu haben
1.6
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 2: Bindung – Wenn Beschützer:in und Täter:in dieselbe Person sind
2.1
Die Kraft der Bindungsbeziehung
2.2
Beziehungsmodelle, die durch Missbrauch entstehen
2.3
Aspekte der Bindungstheorie
2.4
Wie Beziehungsmodelle sich selbst bestätigen
2.5
Dimensionen missbrauchsbedingter Beziehungsmodelle
2.6
Wenn Schutzpersonen nicht beschützen
2.7
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 3: Entwicklung im Kontext emotionaler Deprivation
3.1
Traumatisierung in der Kindheit führt zu Störungen der Entwicklung
3.1.1
Emotionale und sensorische Entwicklung
3.1.2
Kognitive Entwicklung: Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit
3.1.3
Die interpersonelle Entwicklung
3.2
Einfluss geringer Fürsorge auf Missbrauch durch Personen außerhalb des eigenen Haushalts
3.3
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
II
Fundamente der Behandlung
Kapitel 4: Grundlagen der Behandlung
4.1
Was wollen Patient:innen wirklich?
4.2.
Warum ist es für Patient:innen so schwierig, im Alltag zurechtzukommen?
4.3
Die zentrale Rolle der Emotionsregulation für ein gesundes Leben
4.4
Unterschiede zwischen Traumatisierungen in der Kindheit und solchen im Erwachsenenalter
4.5
Interventionen auf die Zielproblematik abstimmen
4.6
Warum eine Behandlung mit unterschiedlichen Modulen?
4.6.1
Patient:innen Zeit zum Lernen geben
4.6.2
Patient:innen auf die narrative Arbeit vorbereiten
4.6.3
Die Kraft der therapeutischen Beziehung würdigen
4.7
Vorteile des modulbasierten Ansatzes
4.7.1
Behandlungsergebnis
4.7.2
Verbesserung der Abschlussquote und Verringerung der Herausforderungen der Traumaverarbeitung
4.8
Weitere Erfahrungen mit STAIR/Narrative Therapie
4.9
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 5: Emotionale und soziale Ressourcen aufbauen – Ein Überblick über STAIR
5.1
Emotionale Kompetenzen
5.1.1
Emotionale Achtsamkeit
5.1.2
Emotionsregulation
5.1.3
Leben im Einklang mit Emotionen: Persönliche Ziele verfolgen
5.2
Soziale Kompetenzen
5.2.1
Beziehungsmodelle identifizieren, die auf Traumatisierungen zurückgehen
5.2.2
Beziehungsmodelle verändern
5.2.3
Aktuelle Beziehungsmodelle und frühere Traumatisierungen in der narrativen Arbeit miteinander verbinden
5.2.4
Probleme mit Machtverhältnissen: Das Thema Selbstsicherheit
5.2.5
Flexibilität im Umgang mit Machtverhältnissen und die Rolle von Respekt für sich selbst und andere
5.2.6
Probleme mit Intimität und Nähe
5.2.7
Übergang zur Narrativen Therapie
5.3
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 6: Mit traumatischen Erinnerungen arbeiten – Überblick über die Narrative Therapie
6.1
Warum die traumatische Vergangenheit erneut aufsuchen?
6.2
Eine kurze Geschichte der Expositionstherapie bei PTBS
6.2.1
Die Entwicklung der Expositionstherapie für Erinnerungen
6.2.2
Die Stärke von Furcht-Erinnerungen
6.2.3
Aktualisierung von Furcht-Erinnerungen
6.3
Das Trauma-Narrativ
6.4
Die Ziele im Verlauf der Narrativen Therapie
6.4.1
Die Geschichte erzählen
6.4.2
Themen identifizieren
6.5
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 7: Das Narrativ erweitern – Die Bearbeitung von Scham und Verlust
7.1
Scham
7.1.1
Das minderwertige Selbst
7.1.2
Das schlechte Selbst
7.1.3
Das verleugnete Selbst
7.1.4
Das mit den Täter:innen identifizierte Selbst
7.1.5
Scham, soziale Kompetenz und interpersonelle Beziehungen
7.2
Verlust und Trauer
7.2.1
Der Verlust der beschützenden Elternfigur
7.2.2
Der Verlust der Unschuld und der Freuden der Kindheit
7.2.3
Der Verlust interpersoneller Beziehungen
7.2.4
Der Verlust von Zeit
7.3
Traumatischer Verlust
7.4
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 8: Anleitung zum Einstieg in die Behandlung
8.1
Die Arbeit mit einem Therapiemanual
8.1.1
STAIR/Narrative Therapie: Eine Handlungsempfehlung, kein technisches Manual
8.1.2
Flexible Entscheidung über das Behandlungsmodul
8.1.3
Flexible Entscheidung über die STAIR-Sitzungen
8.1.4
Flexible Entscheidung über die Sitzungen der Narrativen Therapie
8.1.5
Flexible Anzahl an Sitzungen
8.2
Systematische Aus- und Weiterbildung
8.3
Die therapeutische Allianz
8.4
Die Entscheidung darüber, wer von der Behandlung profitieren kann
8.4.1
Patient:innen mit körperlichen Misshandlungserfahrungen
8.4.2
Patient:innen mit signifikanten Traumatisierungen im Erwachsenen-, aber nicht im Kindesalter
8.4.3
Patient:innen des gesamten Gender-Spektrums
8.4.4
Patient:innen mit partieller PTBS
8.4.5
Patient:innen mit emotional instabiler und anderen Persönlichkeitsstörungen
8.4.6
Patient:innen, die motiviert sind, an Skills zu arbeiten
8.5
Die Bereitschaft zur Behandlung einschätzen
8.5.1
Die Behandlungsvorgeschichte erheben
8.5.2
Behandlungsmotivation während der ersten Sitzungen
8.6
Die therapeutische Allianz
8.6.1
Was ist die therapeutische Allianz?
8.6.2
Die Bedeutung der therapeutischen Allianz
8.6.3
Bedrohungen der therapeutischen Allianz
8.7
Besondere Herausforderungen bei der Behandlung von Personen mit Misshandlungserfahrungen
8.7.1
Der Wunsch, den Wahrheitsgehalt von traumatischen Erinnerungen zu belegen
8.7.2
Selbstverletzendes Verhalten bei Patient:innen
8.7.3
Andere in die Misshandlungsgeschichte und die Behandlung einweihen
8.7.4
Partnerschaftsfragen
8.7.5
Zusätzliche Behandlungen
8.8
Selbstfürsorge für Therapeut:innen
8.9
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
Kapitel 9: Diagnostische Einschätzung und Indikationsstellung
9.1
Grundprinzipien der Traumadiagnostik
9.1.1
Aktiv unterstützen
9.1.2
Versuchen, zu beschreiben und nicht zu werten
9.1.3
„Containment“ – Die Erzählung der Patient:innen begrenzen
9.1.4
Ein Vorbild darin sein, keine Vermeidung zu zeigen
9.1.5
Erwarten, dass die Patient:innen mehr erzählen werden
9.2
Erster Kontakt
9.3
Einstieg in die diagnostische Sitzung
9.4
Die Trauma-Anamnese
9.4.1
Sexueller Missbrauch
9.4.2
Körperliche Misshandlung
9.4.3
Emotionale Misshandlung
9.4.4
Körperliche Vernachlässigung
9.4.5
Emotionale Vernachlässigung
9.4.6
Reviktimisierungserfahrungen und andere traumatische Erlebnisse
9.4.7
Herausforderungen bei der Bewertung der Traumavorgeschichte im Rahmen der Diagnostik
9.5
Die Diagnosen PTBS und kPTBS nach ICD-11
9.5.1
Symptomprofile
9.5.2
Instrumente
9.6
Die PTBS-Diagnose nach DSM-5
9.6.1
Symptomprofil
9.6.2
Instrumente
9.7
Spezifische Symptombereiche
9.7.1
Klassische oder Kern-Symptome der PTBS
9.7.2
Probleme mit der Emotionsregulation
9.7.3
Negatives Selbstkonzept
9.7.4
Interpersonelle Schwierigkeiten
9.7.5
Selbstverletzendes Verhalten, Risikoverhalten und Komorbidität
9.7.6
Resilienz und Bewältigungsstrategien
9.8
Rückmeldungen zur Diagnostik und Behandlungsempfehlungen
9.8.1
Eignung für die Behandlung
9.8.2
Bereitschaft zur Behandlung
9.8.3
Rückmeldung an die Patient:innen
9.9
Fallbeispiel
9.9.1
Die Ergebnisse der Diagnostik interpretieren
9.9.2
Rückmeldung durch die Therapeutin
9.10
Zusammenfassung und Implikationen für die Behandlung
III
STAIR/Narrative Therapie – Durchführung der Sitzungen
Modul I: Skillstraining zur Affektiven und Interpersonellen Regulation (STAIR) – Ressourcen aufbauen
Kapitel 10/Sitzung 1: Die Ressource Hoffnung – Patient:innen in die Behandlung einführen
10.1
Die Patient:innen in der Behandlung willkommen heißen und den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
10.2
Die Erfahrungen der Patient:innen aus dem diagnostischen Gespräch, die Trauma-Anamnese und Symptomatik besprechen
10.3
Den Therapievertrag formulieren
10.3.1
Die Beschreibung der Behandlung vor Beginn
10.3.2
Anmerkungen zum therapeutischen Bündnis
10.4
Einen Überblick über den Behandlungsplan geben
10.5
Die Ziele von Modul 1 (STAIR) erklären
10.5.1
Skills zur Emotionsregulation entwickeln
10.5.2
Entwicklung interpersoneller Skills
10.5.3
Auswahl spezifischer Skills als Bewältigungsstrategien
10.6
Falls relevant, die Ziele von Modul 2 (Narrative Therapie) erklären
10.6.1
Die Ergebnisse der PTBS-Diagnostik besprechen
10.6.2
Narrative Arbeit zur Reduktion von Angst und PTBS-Symptomen
10.6.3
Narrative Arbeit, um traumatische Erinnerungen einzusortieren
10.6.4
Narrative Arbeit, um die eigene Lebensgeschichte zu entwickeln
10.7
Falls relevant, die Prinzipien und Vorteile einer Zwei-Phasen-Behandlung besprechen
10.8
Einen Skill anbieten: Bewusstes Atmen
10.8.1
Überblick und Grundidee des Bewussten Atmens
10.8.2
Hinweise für Therapeut:innen zur Einführung in das Bewusste Atmen
10.9
Gründe für das Üben von Skills zwischen den Sitzungen vermitteln
10.10
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
10.11
Den Einsatz von Skills planen
10.12
Arbeitsblätter
Kapitel 11/Sitzung 2: Gefühle als Ressource – Emotionen bewusst wahrnehmen
11.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
11.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
11.3
Das Konzept der Emotionsregulation einführen
11.4
Probleme der Patient:innen mit der Emotionsregulation identifizieren
11.4.1
Besprechen, wie mit Gefühlen umgegangen wurde, als die Patient:innen aufwuchsen
11.4.2
Besprechen, wie Traumatisierungen sich auf die Gefühle der Patient:innen ausgewirkt haben
11.4.3
Die Patient:innen und ihre Erfahrungen respektieren
11.5
Das Gefühlstagebuch einführen
11.5.1
Nutzen der Selbstbeobachtung für die Patient:innen
11.5.2
Therapeutischer Prozess und Haltung der Therapeut:innen
11.6
Den Grundgedanken der Selbstbeobachtung und des Verstehens von Gefühlen vermitteln
11.6.1
Erholung des Erregungs-/Furchtsystems
11.6.2
Das Vertrauen darin stärken, Gefühle für Entscheidungen und Handlungen zu nutzen
11.6.3
Mehr Beteiligung am Leben und die Chance auf Freude und Glück
11.7
Die verschiedenen Ebenen von Gefühlen nutzen, um Erfahrungen zu organisieren
11.8
Die Funktionen von Gefühlen beschreiben
11.9
Problematische Emotionen der Patient:innen identifizieren und diskutieren
11.9.1
Angst
11.9.2
Wut
11.9.3
Trauer
11.9.4
Dissoziation
11.10
Diskutieren, wie verschiedene Arten von Gefühlen unterschieden werden können
11.11
Mit dem Gefühlstagebuch üben
11.12
Fallbeispiel: Konkret werden
11.12.1
Gefühle in einer bestimmten Situation erkennen
11.12.2
Intensität und Dauer der Gefühle bestimmen
11.12.3
Gedanken identifizieren
11.12.4
Reaktionen und Bewältigungsstrategien identifizieren
11.12.5
Bewusstsein für sich selbst entwickeln
11.13
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
11.14
Den Einsatz von Skills planen
11.15
Arbeitsblätter
Kapitel 12/Sitzung 3: Emotionsregulation – Fokus auf den Körper
12.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
12.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
12.3
Das Konzept der Emotionsregulation vertiefen
12.3.1
Besprechen, wie die Emotionsregulation sich in der Kindheit entwickelt
12.3.2
Falls relevant, die Auswirkungen von Problemen mit der Emotionsregulation auf elterliche Kompetenzen besprechen
12.4
Skills der Patient:innen zum Umgang mit Emotionen identifizieren und besprechen
12.4.1
Die Diagnostik zur Emotionsregulation nochmals durchgehen
12.4.2
Das Gefühlstagebuch besprechen
12.4.3
Beispiele für Strategien zur Emotionsregulation herausarbeiten
12.4.4
Identifizieren, wann die Strategien eingesetzt werden
12.5
Skills auf Körperebene der Gefühle einführen
12.5.1
Grundlegende Selbstfürsorge
12.5.2
Beruhigung über die Sinne
12.5.3
Progressive Muskelentspannung
12.5.4
Andere achtsamkeitsbasierte Skills auf Körperebene
12.6
Missverständnisse bezüglich der Arbeit an Emotionen klären (falls notwendig)
12.6.1
Belastung zu reduzieren, erfordert das Verdrängen oder Verleugnen von Gefühlen
12.6.2
Belastung zu reduzieren, verharmlost Gefühle
12.6.3
Belastung zu reduzieren, verharmlost die traumatischen Erfahrungen
12.7
Fallbeispiel: Auf dem Weg zu einer gesunden Emotionsregulation auf Körperebene
12.8
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
12.9
Den Einsatz von Skills planen
12.10
Arbeitsblätter
Kapitel 13/Sitzung 4: Emotionsregulation – Fokus auf Gedanken und Verhalten
13.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
13.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
13.3
Traumabezogene Denkmuster besprechen
13.4
Skills auf Gedankenebene auswählen und besprechen
13.4.1
Emotionssurfen
13.4.2
Gedankentesten
13.4.3
Gedankenwechsel
13.4.4
Sich Erinnern/Umdeuten
13.4.5
Positive Selbstaussagen
13.4.6
Positive Bilder
13.4.7
Das Gefühlstagebuch in Verbindung mit Skills auf Gedankenebene verwenden
13.5
Traumabezogene Verhaltensmuster besprechen
13.6
Skills auf Verhaltensebene auswählen und besprechen
13.6.1
Eine Auszeit nehmen
13.6.2
Entgegengesetztes Handeln
13.6.3
Um Hilfe bitten/Unterstützung suchen
13.6.4
Das Gefühlstagebuch in Verbindung mit Skills auf Verhaltensebene verwenden
13.7
Sich positiven Emotionen zuwenden und Positive Aktivitäten planen
13.7.1
Gründe dafür wiederholen, sich positiven Emotionen zuzuwenden
13.7.2
Positive Aktivitäten identifizieren und planen
13.7.3
Falsche Vorstellungen über positive Emotionen und Positive Aktivitäten überprüfen (falls zutreffend)
13.8
Zusammenfassung der Skills auf den drei Ebenen von Gefühlen ausfüllen
13.9
Das Gefühlstagebuch in Verbindung mit den neuen Skills nutzen
13.10
Fallbeispiel
13.11
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
13.12
Den Einsatz von Skills planen
13.13
Arbeitsblätter
Kapitel 14/Sitzung 5: Leben im Kontakt mit den eigenen Emotionen – Belastungstoleranz
14.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
14.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
14.3
Das Konzept der Belastungstoleranz vorstellen
14.4
Skills zur Belastungstoleranz der Patient:innen identifizieren
14.4.1
Erfolge identifizieren
14.4.2
Maladaptive Strategien identifizieren
14.5
Die Belastungstoleranz mit den Zielen der Patient:innen verknüpfen
14.5.1
Spezifische Ziele identifizieren
14.6
Den Skill „Vor- und Nachteile abwägen“ vorstellen und üben
14.6.1
Den Skill und dessen Zweck vorstellen
14.6.2
Das Ziel identifizieren
14.6.3
Die Notwendigkeit der Belastungstoleranz evaluieren
14.6.4
Vor- und Nachteile herausarbeiten
14.7
Fallbeispiel: Ziele identifizieren und Vor- und Nachteile erarbeiten
14.8
Skills zur Stressreduktion mit den Zielen verknüpfen
14.9
Fallbeispiel: Skills festigen, um das Ziel der Vollendung der Therapie zu unterstützen
14.9.1
Flexible Anwendung von Skills
14.10
Das Üben von Belastungstoleranz in „zufälligen Momenten” vorstellen
14.10.1
Die Gründe für die Akzeptanz negativer Gefühle beschreiben
14.10.2
Beispiele für die Akzeptanz negativer Gefühle im Alltag aufzeigen
14.10.3
Beispiele für das Akzeptieren intensiver Gefühle und Stimmungen aufzeigen
14.10.4
Langfristige Vorteile einer gesunden Belastungstoleranz erkennen: Gesteigertes Wohlbefinden
14.11
Die Rolle von positiven Emotionen beim Verfolgen von Zielen besprechen
14.12
Die Patient:innen darauf vorbereiten, an interpersonellen Problemen zu arbeiten
14.13
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
14.14
Den Einsatz von Skills planen
14.15
Arbeitsblätter
Kapitel 15/Sitzung 6: Die Ressource Bindung – Beziehungsmuster verstehen
15.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
15.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
15.3
Konzept der Beziehungsmodelle und -muster vorstellen
15.4
Beziehungsmuster der Patient:innen erfassen und identifizieren
15.5
Häufige Annahmen über Beziehungen bei traumatisierten Personen prüfen
15.6
Arbeitsblatt „Beziehungsmuster 1“ vorstellen
15.7
Üben, das Arbeitsblatt „Beziehungsmuster 1“ einzusetzen
15.8
Fallbeispiel: Ein Beziehungsmodell identifizieren
15.9
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
15.10
Den Einsatz von Skills planen
15.11
Arbeitsblätter
Kapitel 16/Sitzung 7: Beziehungsmuster verändern – Fokus auf selbstsicheres Verhalten
16.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
16.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
16.3
Psychoedukation zu selbstsicherem Verhalten und grundlegenden persönlichen Rechten
16.3.1
Das Konzept der Selbstsicherheit besprechen
16.3.2
Grundlegende persönliche Rechte besprechen
16.4
Falls relevant, grundlegende Annahmen der Patient:innen zu selbstsicherem Verhalten klären
16.5
Eine „Ich-Botschaft“ durchgehen und üben (das erste Rollenspiel)
16.5.1
„Ich-Botschaften“ beschreiben
16.5.2
Die Grundidee der Rollenspiele vermitteln
16.5.3
Rollenspiele mit einer „Ich-Botschaft“
16.5.4
Anleitung für die Durchführung von effektiven Rollenspielen
16.6
Arbeitsblatt „Beziehungsmuster 2“ ausfüllen
16.7
Fallbeispiel: Ein „Ich-Botschaften“-Rollenspiel
16.8
Zusätzliche Skills zu selbstsicherem Verhalten vorstellen
16.8.1
Bitten formulieren
16.8.2
Nein sagen
16.9
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
16.10
Den Einsatz von Skills planen
16.11
Arbeitsblätter
Kapitel 17/Sitzung 8: Beziehungsmuster verändern – Umgang mit Macht
17.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
17.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
17.3
Die drei Formen von Machtverhältnissen durchgehen und besprechen
17.3.1
Barrieren im Umgang mit den unterschiedlichen Formen von Machtverhältnissen besprechen, die durch die Traumatisierung entstanden sind
17.4
Über Respekt und Macht sprechen: Respekt ist die Konstante
17.5
Den Skill „Respektvolle Grenzen“ einführen
17.6
Fallbeispiel: Ein Machtproblem bewältigen
17.6.1
Das Arbeitsblatt 16.4 „Beziehungsmuster 2“ nutzen
17.6.2
Im Rollenspiel die respektvollen Grenzen nutzen
17.6.3
Andere Skills nutzen
17.7
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
17.8
Den Einsatz von Skills planen
17.9
Arbeitsblätter
Kapitel 18/Sitzung 9: Beziehungsmuster verändern – Nähe fördern
18.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
18.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
18.3
Das Konzept der Grenzsetzung und emotionalen Distanz vorstellen
18.4
Beziehungsmuster in Zusammenhang mit Nähe identifizieren
18.5
Schritte zum Aufbau von neuen Beziehungen prüfen und auswählen oder bestehende Beziehungen vertiefen
18.5.1
Neue Beziehungen aufbauen
18.5.2
Bestehende Beziehungen vertiefen
18.6
Das Arbeitsblatt 16.4 „Beziehungsmuster 2“ ausfüllen
18.7
Ein Rollenspiel zu einem ausgewählten Skill durchführen
18.7.1
Rollenspiele zum Aufbau von neuen Beziehungen durchführen
18.7.2
Rollenspiele zur Vertiefung bestehender Beziehungen
18.7.3
Rollenspiele zur Versöhnung nach Konflikten
18.8
Zusätzliche Skills erkunden (optional)
18.9
Fallbeispiel: Ein gesundes Ausmaß von Nähe entwickeln
18.10
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
18.11
Den Einsatz von Skills planen
18.12
Arbeitsblätter
Kapitel 19/Sitzung 10: Selbstmitgefühl und Zusammenfassung des Skillstrainings
19.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
19.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
19.3
Das Konzept des Mitgefühls einführen
19.3.1
Begründung für Mitgefühl
19.3.2
Hindernisse für Mitgefühl besprechen
19.4
Meditation zum Selbstmitgefühl üben
19.5
Fallbeispiel: Förderung des Mitgefühls in einer rauen Welt
19.6
Zusammenfassung der Erfolge des Skillstrainings
19.6.1
Sich vor der Sitzung vorbereiten
19.6.2
Die bisherige Arbeit reflektieren
19.6.3
Die Patient:innen zu ihren Fortschritten beglückwünschen
19.7
Die Patient:innen auf den nächsten Schritt vorbereiten: Wählen Sie Option 1 oder 2
19.8
Option 1: Übergang zur Narrativen Therapie
19.8.1
Vorbereitung der Patient:innen auf den Übergang zur Narrativen Therapie
19.8.2
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
19.8.3
Den Einsatz von Skills planen
19.9
Option 2: Beendigung der Behandlung – die letzte Sitzung
19.9.1
Die Behandlung als Ganzes zusammenfassen
19.9.2
Patient:innen auf den eigenständigen Einsatz von Skills vorbereiten
19.9.3
Den eigenständigen Einsatz von Skills planen
19.9.4
Das Abschlusszertifikat überreichen
19.10
Arbeitsblätter
Modul II: Narrative Therapie – Sich der Vergangenheit stellen und sich die Zukunft vorstellen
Kapitel 20: Vom Skillstraining zur Narrativen Therapie – Woran erkennen Sie, dass Patient:innen dafür bereit sind?
20.1
Vorschläge, wie die Bereitschaft zur Narrativen Therapie geprüft werden kann
20.1.1
Lassen sich die Patient:innen ausreichend auf die Behandlung ein?
20.1.2
Sind die Patient:innen derzeit verhältnismäßig stabil?
20.1.3
Sind die Patient:innen zu einem gewissen Grad in der Lage, eine therapeutische Allianz einzugehen?
20.1.4
Waren die Patient:innen in der Lage, die Skills aus dem STAIR-Modul zu erlernen und anzuwenden?
20.1.5
Könnten die Patient:innen daran interessiert sein, an einer „gemeinsamen Behandlung“ teilzunehmen?
Kapitel 21/Sitzung 11: Einführung in die Narrative Therapie
21.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
21.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
21.3
Einen Überblick über die Narrative Therapie vermitteln
21.3.1
Erstes Ziel der Narrativen Therapie: Angst und PTBS-Symptome reduzieren
21.3.2
Zweites Ziel der Narrativen Therapie: Traumatische Erinnerungen in einen schlüssigen und bedeutsamen Kontext einordnen
21.3.3
Drittes Ziel der Narrativen Therapie: Eine kohärente Lebensgeschichte entwickeln
21.4
Einsatz von Skills zur Emotionsregulation besprechen
21.5
Die Bereitschaft der Patient:innen zur Mitarbeit in der Narrativen Therapie bestätigen
21.5.1
Grundgedanken der Patient:innen zur Narrativen Therapie besprechen
21.5.2
Anzahl der Sitzungen und zeitliche Begrenzung planen
21.6
Eine Hierarchie der Erinnerungen erstellen
21.6.1
Eine Liste der traumatischen Erinnerungen erstellen
21.6.2
Mit Herausforderungen beim Erstellen der Erinnerungshierarchie umgehen
21.6.3
Die SUD-Bewertungsskala erklären
21.6.4
Die Erinnerungshierarchie vervollständigen
21.6.5
Die Verwendung von SUD-Werten während der Arbeit mit Narrativen beschreiben
21.7
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
21.8
Den Einsatz von Skills planen
21.9
Arbeitsblätter
Kapitel 22/Sitzung 12: Das Narrativ zur ersten Erinnerung
22.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
22.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
22.3
Mit einer neutralen Erinnerung üben
22.4
Erstes Narrativ von einem traumatischen Erlebnis
22.4.1
Eine Erinnerung auswählen
22.4.2
Anzahl der Wiederholungen und Dauer der Narrative
22.4.3
Abschluss der Narrative
22.5
Patient:innen ins Hier und Jetzt zurückholen
22.6
Die Aufzeichnung vom ersten Narrativ gemeinsam anhören
22.7
Überzeugungen über sich selbst und/oder andere im Narrativ identifizieren
22.8
Fallbeispiel: Von der Traumatisierung berichten – damals und heute
22.9
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
22.10
Den Einsatz von Skills planen
22.11
Arbeitsblätter
Kapitel 23/Sitzungen 13 bis 17: Narrative zum Thema Angst
23.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
23.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
23.3
Ein Narrativ zum Thema Angst erstellen
23.3.1
Eine Erinnerung auswählen
23.3.2
Das Narrativ durchführen
23.3.3
Gefühle, die durch das Narrativ ausgelöst wurden, identifizieren
23.4
Vermeidungsverhalten bearbeiten
23.5
Fallbeispiel 1: Einen Moment hoher Belastung im Narrativ erkennen
23.6
Mit dissoziativen Reaktionen umgehen
23.6.1
Dissoziation bei den Trauma-Narrativen
23.6.2
Strategien für den Umgang mit Dissoziation
23.6.3
Zusätzliche Techniken, um Patient:innen in die Gegenwart zu reorientieren
23.7
Analyse des Narrativs durchführen
23.8
Fallbeispiel 2: Beziehungsmuster modifizieren
23.8.1
Identifikation von angstbezogenen Beziehungsmodellen im Narrativ
23.8.2
Alternative Beziehungsmodelle während der Narrativen Therapie entwickeln
23.8.3
Rollenspiele durchführen
23.8.4
Das neue Beziehungsmodell auf das aktuelle Leben beziehen
23.9
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
23.10
Den Einsatz von Skills planen
Kapitel 24/Sitzungen 13 bis 17: Narrative zum Thema Scham
24.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
24.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
24.3
Besprechen, warum es wertvoll ist, sich mitzuteilen
24.3.1
Gefühle von Entfremdung reduzieren
24.3.2
Die Bindung an die Täter:innen reduzieren
24.3.3
Das Selbstmitgefühl der Patient:innen stärken
24.3.4
Sich besser kennenlernen und sich wertschätzen
24.3.5
Interpersonelle Beziehungen verbessern
24.3.6
Wachstum fördern und sich als handlungsfähig erleben
24.4
Ein Narrativ zum Thema Scham erstellen
24.5
Fallbeispiel 1: Aktive Beteiligung einer Patientin an ihrem Missbrauch
24.6
Analyse des Narrativs durchführen
24.7
Fallbeispiel 2: Hilflos oder Täter?
24.7.1
Schambezogene Beziehungsmodelle im Narrativ identifizieren
24.7.2
Alternative Beziehungsmodelle entwickeln
24.7.3
Ressourcen identifizieren
24.7.4
Rollenspiele durchführen
24.8
Durch positive Wertschätzung unterstützen
24.8.1
Eine Herausforderung: Wenn Patient:innen sich nicht mitteilen
24.8.2
Die Bedeutung der therapeutischen Beziehung bei der Bearbeitung von Scham
24.9
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
24.10
Den Einsatz von Skills planen
Kapitel 25/Sitzungen 13 bis 17: Narrative zum Thema Verlust
25.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
25.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
25.3
Besprechen, warum es sinnvoll ist, sich mit Verlust und Trauer zu beschäftigen
25.3.1
Emotionale und körperliche Energie freisetzen
25.3.2
Verbindungen zwischen Verlust/Trauer und PTBS-Symptomen lösen
25.3.3
Das Mitgefühl für sich selbst steigern
25.3.4
Die Fähigkeit verbessern, interpersonelle Beziehungen einzugehen
25.3.5
Die Gegenwart würdigen
25.4
Ein Narrativ zum Thema Verlust erstellen
25.5
Analyse des Narrativs durchführen
25.6
Fallbeispiel: Ebenen von Verlusterfahrungen
25.6.1
Verlustbezogene Beziehungsmodelle im Narrativ identifizieren
25.6.2
Alternative Beziehungsmodelle entwickeln
25.6.3
Rollenspiel durchführen
25.7
Die Patient:innen unterstützen: Die Last der Trauer teilen
25.8
Die Ziele der Sitzung zusammenfassen
25.9
Den Einsatz von Skills planen
Kapitel 26/Sitzung 18: Die letzte Sitzung
26.1
Aktuelle Befindlichkeit erfragen und Einsatz von Skills besprechen
26.2
Den Schwerpunkt der Sitzung herausarbeiten
26.3
Die Veränderungen und Fortschritte der Patient:innen reflektieren
26.3.1
Gehen Sie auf die Reduktion von PTBS-/kPTBS-Symptomen ein
26.3.2
Reflektieren Sie die verbesserten Skills zur Emotionsregulation
26.3.3
Betrachten Sie Veränderungen in Bezug auf interpersonelle Skills
26.3.4
Reflektieren Sie die neue Selbstwahrnehmung der Patient:innen
26.3.5
Beglückwünschen Sie die Patient:innen zu ihrem Fortschritt
26.4
Eigenständige Aufrechterhaltung der Skills vorbereiten und planen
26.5
Die nächsten Schritte planen
26.6
Rückfallrisiko und geeignete Strategien, damit umzugehen, besprechen
26.7
Respekt für das Tempo des Veränderungsprozesses zum Ausdruck bringen und auf die weitere Bedeutung von Selbstmitgefühl eingehen
26.8
Über Hilfsangebote für den Übergang und für künftige Probleme informieren
26.9
Das Abschlusszertifikat überreichen
26.10
Abschied nehmen
26.11
Arbeitsblätter
Kapitel 27: Neue Entwicklungen von STAIR/Narrative Therapie
27.1
Anpassungen der klinischen Behandlung
27.1.1
STAIR für Gruppen
27.1.2
STAIR für Jugendliche
27.1.3
STAIR für die medizinische Grundversorgung
27.1.4
STAIR für Menschen mit Fluchterfahrung
27.1.5
STAIR für Eltern
27.2
Technologische Anpassungen
27.2.1
Telemedizinische Versorgung
27.2.2
STAIR Emotion Coach
27.2.3
Webbasiertes STAIR
27.3
Ausblick
Literatur
Anhang
Die Autor:innen sowie der Übersetzer des Bandes
Hinweise zu den Online-Materialien
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Beitrag von PTBS-Symptomen, Emotionsregulations- und interpersonellen Problemen zur Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit im Alltag (nach Cloitre, Miranda, Stovall-McClough & Han, 2005).
Abbildung 2: Unterschiedliche Auswirkungen auf die Emotionsregulation in Abhängigkeit vom Alter bei Traumatisierung (TAS = Toronto Alexithymie Skala; DES = Dissociative Experience Scale; CSA = Child Sexual Abuse/Gruppe mit Missbrauch in der Kindheit; ASA = Adult Sexual Abuse/Gruppe mit Missbrauch im Erwachsenenalter (Vergewaltigung); NC = Never-Abused Control Group/Vergleichsgruppe ohne Missbrauchserfahrungen; nach Cloitre, Scarvalone & Difede, 1997).
Abbildung 3: Unterschiedliche Auswirkungen von Traumatisierungen auf die interpersonelle Funktionsfähigkeit in Abhängigkeit von der Altersstufe (CSA, ASA und NC siehe Abbildung 2; nach Cloitre et al., 1997).
Abbildung 4: Reduktion der PTBS-Symptome (erhoben mit der „PTSD Symptom Scale Self-Report Version“[PSS-SR]) (STAIR/NT = STAIR/Narrative Therapie; STAIR/SC = STAIR mit supportiver Behandlung (SC); SC/NT = supportive Behandlung mit Narrativer Therapie; nach Cloitre et al., 2010).
Abbildung 5: Verbesserungen der Emotionsregulation (erhoben mit der Generalized Expectancy for Negative Mood Regulation Scale) (Abkürzungen siehe Abbildung 4; nach Cloitre et al., 2010).
Abbildung 6: Reduktion interpersoneller Probleme (erhoben mit dem „Inventar Interpersoneller Probleme“) (Abkürzungen siehe Abbildung 4; nach Cloitre et al., 2010).
Abbildung 7: Selbstberichtete PTBS-Symptome nach Sitzungen (gemessen mit der PSS-SR) (Abkürzungen siehe Abbildung 4; nach Cloitre et al., 2010).
Abbildung 8: Dissoziative Symptome nach Sitzungen (gemessen mit der „Trauma Symptom Inventory’s Dissociation Scale“) (Abkürzungen siehe Abbildung 4; nach Cloitre et al., 2010).
Abbildung 9: Beispiel für die Einführung in die drei Ebenen von Gefühlen
Abbildung 10: Beispiel des ausgefüllten Gefühlstagebuches von Petra
Abbildung 11: Lisas Liste der Vor- und Nachteile
Abbildung 13: Davids ausgefülltes Arbeitsblatt 14.2
Abbildung 12: Davids Liste der Vor- und Nachteile
Abbildung 14: Marias ausgefülltes Arbeitsblatt 15.3
Abbildung 15: Carolines ausgefülltes Arbeitsblatt 16.4
Abbildung 16: Julias ausgefülltes Arbeitsblatt 16.4
Abbildung 17: Simones ausgefülltes Arbeitsblatt 16.4
Abbildung 18: Rosalies ausgefülltes Arbeitsblatt 16.4
Abbildung 19: Julians ausgefülltes Arbeitsblatt 16.4
Abbildung 20: Juttas ausgefülltes Arbeitsblatt 16.4
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gründe für die Inanspruchnahme der Behandlung
Tabelle 2: Prädiktoren aus STAIR, die den Erfolg der Narrativen Therapie vorhersagten, gemessen anhand der Reduktion der PTBS-Symptome
Tabelle 3: Hindernisse für Mitgefühl ansprechen
Tabelle 4: Anpassungen und Erweiterungen von STAIR
7
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
305
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
397
399
400
401
15Vorwort – Was ist mit dem „unterbrochenen Leben“ gemeint?
Als die erste Ausgabe dieses Buches 2006 veröffentlicht wurde, konzentrierten wir uns auf das „unterbrochene Leben“ derjenigen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch oder körperliche Misshandlung erlebt hatten. Wir stellten fest, dass Missbrauch die Entwicklung der emotionalen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen und damit seine Entwicklung hin zu einer kompetenten und selbstbewussten Person unterbricht. Wir haben das Skillstraining zur Affektiven und Interpersonellen Regulation (STAIR)/Narrative Therapie deshalb in weiten Teilen als ein „Ressourcen-Rehabilitationsprogramm“ entwickelt, das Betroffene mit einem positiven Lernumfeld in Kontakt bringen sollte, das sie in ihrer Kindheit nicht erlebt haben.
In den 20 Jahren, in denen wir die Behandlung durchführen und andere Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich darin schulen, haben wir festgestellt, dass es viele andere Umstände gibt, unter denen die Entwicklung wichtiger Lebensressourcen gestört werden kann. Zu diesen Umständen gehören auch emotionaler Missbrauch oder Vernachlässigung in all ihren Formen, wie z. B. unzureichende Ernährung, inkonsistentes Verhalten oder fehlende Beaufsichtigung durch die Eltern. Noch bemerkenswerter ist die Beobachtung, dass Menschen, deren prägendstes Trauma später in ihrem Leben stattgefunden hat, z. B. durch häusliche Gewalt oder dadurch, dass sie Genozide, Terrorismus, Kampfhandlungen oder Bürgerkriege erleben mussten, ebenfalls von einer „Rehabilitation ihrer Ressourcen“ im emotionalen und interpersonellen Bereich profitieren. Wenn man Traumatisierungen über längere Zeiträume ausgesetzt war, wird dies in der Regel ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Kompetenzen in diesen Bereichen führen. Darüber hinaus erleben viele Personengruppen, die mit systematischer Diskriminierung und sozialen Vorurteilen konfrontiert sind (z. B. ethnische Minderheiten oder queere Personen), eine Art chronischen Stress, der in Verbindung mit anderen Formen von Trauma zu einer ähnlichen Erschöpfung interner und externer Ressourcen führt.
Aus all diesen Gründen empfehlen wir die in diesem Buch beschriebene Behandlung für Betroffene aller Arten von schweren und/oder chronischen zwischenmenschlichen Traumatisierungen, wie sexuellem Missbrauch in der Kindheit, häuslicher Gewalt und Gewalt durch die Gesellschaft. Der konzeptionelle Rahmen des Buches konzentriert sich weiterhin auf die Auswirkungen chronischer interpersoneller Traumatisierungen, aber er tut dies nun durch ein zunächst weit gefasstes und dann spezifischeres Modell des Ressourcenverlusts, wenn Traumatisierungen während der frühen Entwicklung einwirken (Kapitel 2 bis 3). Das Rational für die Behandlung (Kapitel 4 bis 7), die diagnostischen Strategien und Empfehlungen zur Umsetzung des Programms (Kapitel 8 bis 9) sowie die tatsächliche Durchführung der Behandlung (Kapitel 10 bis 26) sind für Betroffene eines breiten Spektrums von Traumatisierungen geeignet.
Das in diesem Buch vorgestellte Programm, STAIR/Narrative Therapie, besteht aus zwei Modulen. Das erste Modul, STAIR, wurde speziell dafür entwickelt, soziale und emotionale Ressourcen für ein kompetentes Leben in der Gegenwart aufzubauen und zu stärken (Kapitel 10 bis 19). Eine Traumabehandlung wäre jedoch unvollständig, wenn sie sich nicht in irgendeiner Weise mit dem ebenso wichtigen und häufig anzutreffenden Problem der traumatischen Erinnerungen befassen würde. Da die mit traumatischen Erinnerungen verbundenen Emotionen – überwältigende Angst, Demütigung und Verrat – extrem schmerzhaft sind, werden diese Erinnerungen oft vermieden. Infolgedessen erhalten traumatische Erinnerungen keinen bewussten Raum oder werden auf sinnvolle oder kohärente Weise in das eigene Selbst- oder Weltverständnis integriert. Die emotionale Kraft der Erinnerungen bleibt jedoch bestehen und führt dazu, dass sie durch intrusives Wiedererleben und 16Reinszenierung des Traumas zum Ausdruck kommen, was die Fähigkeit beeinträchtigt, ein sinnerfülltes und vollständiges Leben in der Gegenwart zu führen. Diese Unfähigkeit, sich selbst als kohärent und über die Zeit beständig zu erleben, ist eine weitere Art, wie das Leben für Betroffene von Traumatisierungen „unterbrochen“ ist. Das zweite Modul der Behandlung, die Narrative Therapie (Kapitel 20 bis 26), konzentriert sich daher auf die Aufarbeitung einer Reihe von traumatischen Erinnerungen, um diesen Erfahrungen einen Sinn zu geben, sie in den Kontext der Lebensgeschichte der Person zu integrieren und eine kohärente Selbstwahrnehmung zu fördern.
Die Narrative Therapie bietet Rahmen und Vorgehensweise dafür, traumatische Erfahrungen, die nicht verarbeitet wurden und immer noch sehr lebendig sind, emotional zu integrieren. Die Narrative Therapie beginnt mit der emotionalen Verarbeitung von Angsterinnerungen durch klassische In-sensu-Expositionstechniken (siehe Kapitel 22 und 23). Wir haben diese Arbeit jedoch in zweierlei Hinsicht erweitert. Erstens haben wir auf der Grundlage neuerer Modelle des autobiografischen Gedächtnisses Strategien zur „Kontextualisierung“ entwickelt und systematisch integriert, um ein „Narrativ des Selbst“ zu organisieren und zu konstruieren. Zweitens können sich Patient:in und Therapeut:in mithilfe dieser Strategien auf sichere Weise mit zwei zentralen emotionalen Themen befassen, die Betroffene von chronischen interpersonellen Traumatisierungen oft belasten und effektiv eine kohärente Selbstwahrnehmung fördern: Scham und Verrat (Kapitel 24) sowie Verlust und Trauer (Kapitel 25).
Wir haben zwei Arten beschrieben, wie chronische Traumatisierungen das Leben unterbrechen. Sie stören die Entwicklung wichtiger emotionaler und interpersoneller Fähigkeiten, die ein effektives Leben unterstützen oder führen zu erheblichen Beeinträchtigungen in diesen Bereichen. Sie unterbricht auch das Gefühl von Kohärenz und Kontinuität der persönlichen Identität. Angesichts dieser schädlichen Auswirkungen nutzen wir den Begriff „STAIR/Narrative Therapie für das unterbrochene Leben“, um unseren Behandlungsansatz zu beschreiben, weil er eine Botschaft der Hoffnung vermittelt. Er erkennt an, dass es möglich und wichtig ist, das beschädigte Selbst zu heilen. Wir weisen auch auf die Möglichkeit hin, dass die Behandlung manche Fähigkeiten einer Person sogar über das hinaus erweitern kann, was ohne das Trauma hätte entwickelt oder aufrechterhalten werden können. Wir hoffen, dass die Patient:innen dadurch, dass sie wichtige Lebenskompetenzen wiedererlangen und sich selbst kohärent und gestärkt wahrnehmen, ihre verborgenen Potenziale im Wesentlichen wieder entfalten können.
Wer kann von diesem Buch profitieren?
Dieses Buch bietet eine evidenzbasierte Behandlung für Fachkräfte im psychosozialen Bereich, die mit Betroffenen von interpersonellen Traumatisierungen arbeiten. Die Behandlung wurde ursprünglich für Betroffene von Misshandlung in der Kindheit entwickelt (d. h. für alle Menschen, die als Kind sexuellen Missbrauch, körperliche Misshandlung oder Vernachlässigung erlebt haben). Zudem wurde die Behandlung ursprünglich für Frauen entwickelt. Sie wurde jedoch auch erfolgreich mit Männern und geschlechterdiversen Personen sowie mit Patient:innen unterschiedlichen Alters (einschließlich Kindern und Jugendlichen) eingesetzt, die in ihrer Kindheit Misshandlung und/oder viele andere Formen interpersoneller Gewalt erlebt haben (siehe Kapitel 8). Aus diesem Grund haben wir die Sprache dieses Buches erweitert, um geschlechtsneutraler zu sein und die Person hinter dem Trauma und den klinischen Beschwerden hervorzuheben und nicht eine Störung oder ein negatives Merkmal (z. B. „eine Betroffene von Kindesmissbrauch“ und nicht „ein misshandeltes Kind“). Wir hoffen, dass diese Änderungen unser wachsendes Bewusstsein (und das der Gesellschaft und unseres Berufsstandes insgesamt) für die Vorteile von Inklusivität, Diversität und Empowerment widerspiegeln.
Die Behandlungsphilosophie
Die Behandlungsphilosophie besteht aus einer Mischung von Prinzipien aus den kognitiv-behavioralen und den interpersonellen bzw. bindungs- oder objektbezogenen Ansätzen, die sich aus der Arbeit von Bowlby (1988) entwickelt haben. Die Interventionstechniken stützen sich stark auf die Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Dazu gehören zum Beispiel Interventionen, die Betroffenen helfen, die Bedeutung ihrer traumatischen Erfahrungen zu erkennen und zu bewerten (Exposition und kognitive Neubewertung). Sie umfassen auch Strategien zur Identifizierung der impliziten zwischenmenschlichen Modelle, die Überzeugungen, Gefühle und Verhaltensweisen steuern, sowie Strategien dafür, sie durch neue Bewertungen und den Einsatz von Rollenspielen zu modifizieren und so Lernprozesse und Verhaltensänderungen zu fördern. Sie beruhen auch auf Grundannahmen, die in der KVT implizit enthalten sind, nämlich, dass durch aktives Üben neue Verhaltens-, Gefühls- und Denkweisen möglich werden. Aus dieser Perspektive ist die KVT eine bemerkenswert 17praktische und optimistische psychotherapeutische Tradition.
Der theoretische Rahmen der Behandlung ist der interpersonellen Tradition zuzuordnen, insbesondere derjenigen, die sich aus der Arbeit von Bowlby entwickelt hat. Die Anwendung dieses Rahmens unterstreicht die Bedeutung der frühen Bindungen im Leben und die langfristigen Folgen, die Störungen in den Bindungsbeziehungen für das Funktionsniveau im Erwachsenenalter haben. Die kognitiv-behavioralen Strategien sind die Mittel, mit denen die Patient:innen diese Probleme identifizieren und auf eine Veränderung hinarbeiten. So werden zum Beispiel Beziehungsprobleme, die auf frühen Missbrauch zurückzuführen sind, durch das Konzept aus der Bindungstheorie der „inneren Arbeitsmodelle zwischenmenschlicher Beziehung“ beschrieben. Dieses Konzept wird in der Praxis mithilfe der Arbeitsblätter zu Beziehungsmustern umgesetzt – Arbeitshilfen, die sich so in vielen kognitiven Therapien wiederfinden und zur Bewertung und Veränderung von Vorstellungen über sich selbst und andere genutzt werden.
Wie dieses Buch zu verwenden ist
Dieses Buch soll Therapeut:innen die Fähigkeiten, die Kompetenz und das Selbstvertrauen vermitteln, um Personen zu behandeln, die von chronischen interpersonellen Traumatisierungen betroffen waren. Wir haben einen Leitfaden für die einzelnen Sitzungen einer Behandlung erstellt, die theoretisch fundiert ist, sich in ihrer Wirkung bewährt hat und über 20 Jahre mithilfe des Feedbacks unserer Patient:innen weiter verfeinert wurde. Das Buch bietet praktische Anleitungen für alle technischen Aspekte der Behandlung. Außerdem ist das Buch so aufgebaut und geschrieben, dass es die Grundprinzipien der Behandlung und die primären Ziele hinter jeder Intervention hervorhebt, damit Therapeut:innen die Prinzipien der Behandlung mit STAIR/Narrative Therapie so anwenden können, wie sie zu einem:einer bestimmten Patient:in passen und sich nicht dazu verpflichtet fühlen müssen, die Module, Sitzungen und Interventionen in einer festgeschriebenen Abfolge zu bearbeiten.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Teil I beschreibt die Auswirkungen chronischer Traumatisierungen im Kontext eines Modells des Ressourcenverlusts und eines bindungs- und entwicklungsbezogenen Rahmens. Teil II beschreibt die theoretischen und empirischen Grundlagen für die Behandlungsprinzipien und empirische Ergebnisse, die den Nutzen der Therapie belegen. In Teil III schließlich erfolgt Sitzung für Sitzung eine Darstellung der Behandlung, der Richtlinien zu Diagnostik und Behandlung vorangestellt sind. Das Buch als Ganzes soll eine Haltung gegenüber Betroffenen von interpersonellen Traumatisierungen vermitteln, die eine effektive Therapie erleichtern kann. Theorie, Forschung und klinischer Versorgung liegt das gemeinsame Motiv zugrunde, dass die Genesung von solchen Traumatisierungen die Anerkennung und Heilung einer Lebensgeschichte erfordert, in der schreckliche Dinge geschehen sind – und, was ebenso wichtig ist, die Anerkennung und Heilung einer Lebensgeschichte, in der viele wichtige normative Ereignisse und Erfahrungen gefehlt haben oder beeinträchtigt wurden.
In Teil III bezieht sich das STAIR-Modul (Modul I) auf den Aufbau sozialer und emotionaler Ressourcen (ein Fokus auf die Gegenwart), während das Modul der Narrativen Therapie (Modul II) auf die Lösung von Symptomen im Zusammenhang mit traumatischen Erinnerungen abzielt (ein Fokus auf die Vergangenheit). Viele Betroffene werden beide Formen von Problemen haben und daher von beiden Behandlungskomponenten profitieren. Ein:e Therapeut:in kann jedoch in Erwägung ziehen, nur die eine oder die andere Komponente einzusetzen, je nachdem, was den Bedürfnissen eines:einer bestimmten Patient:in zu einem bestimmten Zeitpunkt entspricht. Solche Einschätzungen werden durch einen Überblick über die Empfehlungen zur Behandlung (Kapitel 8), Strategien zur Beurteilung des passenden Zeitpunkts für den Übergang vom Skillstraining zur narrativen Arbeit (Kapitel 20) und einen zusammenfassenden Überblick über die jeweiligen Sitzungen in Teil III (die Zusammenfassung ist der erste Kasten in jedem Kapitel von 10 bis 19 und von 21 bis 26) unterstützt. Diese Zusammenfassungen zeigen auf einen Blick, was in den Sitzungen am wichtigsten ist (z. B. die Entwicklung von emotionalem Bewusstsein) und warum es wichtig ist. Dies soll den:die Therapeut:in davon befreien, anzunehmen, dass eine Sitzung, um erfolgreich zu sein, wie beschrieben abgeschlossen werden muss. Vielmehr sollte das Thema einer bestimmten Sitzung den:die Therapeut:in dazu veranlassen, sich zu fragen: „Wie bedeutsam ist dieses Problem für meine:n Patient:in? Wie kompetent ist mein:e Patient:in in Bezug auf jede dieser Fertigkeiten? Welche dieser Strategien sprechen die aktuellen Probleme meines:meiner Patient:in an?“ Im Idealfall arbeiten Therapeut:in und Patient:in gemeinsam an der Beantwortung dieser Fragen. Die Auswahl der Interventionen und die Wahl der spezifischen Ziele, die angestrebt werden, sind das Ergebnis einer gemeinsamen Bemühung.
18Es ist gut bekannt, dass das therapeutische Bündnis die Effekte jeder Behandlung beeinflusst, und diese Tatsache gilt besonders für Betroffene von Missbrauch (siehe Cloitre, Stovall-McClough, Miranda & Chemtob, 2004). Aus diesem Grund werden das Wesen und die Rolle der therapeutischen Allianz in mehreren Kapiteln des Buches diskutiert. Kapitel 8 bietet einen Überblick über die Bedeutung der therapeutischen Beziehung und Strategien für den Aufbau einer guten Arbeitsbeziehung, insbesondere im Falle möglicher Irritationen, die in der Arbeit mit Traumabetroffenen häufig auftreten. In mehreren Sitzungen wird auf spezifische Haltungen und Verhaltensweisen von Therapeut:innen eingegangen, die eine wirksame Umsetzung der Interventionen in den betreffenden Sitzungen unterstützen und erleichtern – zum Beispiel jene, die sich auf die bewusste Wahrnehmung von Emotionen (Kapitel 11) und auf Narrative von Scham und Verlust (Kapitel 24 und 25) beziehen.
Schließlich sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, dass Therapeut:innen auf ihre eigene psychische und physische Gesundheit achten müssen und betonen deshalb die Bedeutung der Selbstfürsorge von Therapeut:innen (siehe Kapitel 8). Wir hoffen, dass die Behandlungsphilosophie und -empfehlungen, die wir dargelegt haben, das Mitgefühl und Verständnis für die Situation ihrer Patient:innen fördern und auch dadurch Therapeut:innen bei ihrer Arbeit schützen und befähigen.
Danksagung
Wir möchten Ashley Bauer, Lori Davis, Chetali Gupta, Shaili Jain, Annabel Prinz und Brandon Weiss danken, die als Studierende, Postdocs und Kolleg:innen zur Entwicklung, Anpassung und Bewertung dieser Behandlung beigetragen haben. Wir möchten uns auch bei denjenigen Personen bedanken, die für unsere berufliche Entwicklung und unser persönliches Wachstum besonders wichtig waren und die uns bei der Erstellung dieser überarbeiteten Ausgabe inspirierend, begeisternd und unterstützend zur Seite standen: Jerilyn Brownstein, Eugene Canotal, George und Susan Cohen, David und Joyce DeArman, Caleb Ferguson, Maximilian Greer, Denise Hien, Marc Horowitz, Alice Jackson, Nick Jollymore, Kathleen Koenen, Carol und Arvil Ortigo, Verna und Ted Ortigo, Lorcan Purcell, David Schroeder sowie Thea Stone.
19I Theoretische Rahmenbedingungen
21Kapitel 1: Verlust von Ressourcen – ein Modell
Misshandlung in der Kindheit ist keine Diagnose, sondern eine Erfahrung, die das Leben prägt.
Frank W. Putnam (2004; Übers.: I. Schäfer)
Die Behandlung, die in diesem Buch beschrieben wird, ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten, in denen wir Patient:innen, die sich aufgrund von Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und anderen interpersonellen Traumatisierungen an uns gewandt haben, zugehört und uns mit ihren Bedürfnissen auseinandergesetzt haben. Als die erste Ausgabe dieses Buches veröffentlicht wurde, war das Skillstraining zur Affektiven und Interpersonellen Regulation (STAIR)/Narrative Therapie die erste nachweislich wirksame Behandlung, die speziell für Betroffene von Missbrauch in der Kindheit entwickelt wurde. Sie wurde sorgfältig empirisch überprüft und hat sich als effektiv und – was am wichtigsten ist – für Betroffene als passend erwiesen. Die Motivation für die erste Ausgabe dieses Buches entstand aus der Beobachtung, dass von Institutionen im Bereich der psychischen Gesundheit keine Programme für Betroffene von Missbrauch in der Kindheit angeboten wurden. Glücklicherweise ist dies nicht mehr der Fall; viele Gesundheitssysteme bemühen sich inzwischen, traumainformierte Dienste anzubieten, einschließlich der Anwendung von STAIR/Narrative Therapie.
Diese neue Ausgabe spiegelt die Ergebnisse von mehr als einem Jahrzehnt Arbeit mit Betroffenen von Missbrauch in der Kindheit sowie mit anderen Betroffenen komplexer interpersoneller Traumatisierungen wider, darunter Geflüchtete und Kriegsveteran:innen. Es hat sich gezeigt, dass die Behandlung auch bei diesen Gruppen von Betroffenen anwendbar und hilfreich ist. Wir haben auch gelernt, dass Menschen mit interpersonellen Traumatisierungen im Erwachsenenalter, wie z. B. Ersthelfer:innen bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001, ein komplexes Symptomprofil entwickeln können, je nachdem, wie ausgeprägt die Belastung war und inwieweit sie über soziale und emotionale Ressourcen verfügten, die sie im Genesungsprozess unterstützten. Wir haben erkannt, dass STAIR/Narrative Therapie auch für diese Zielgruppen anwendbar war und mit geringen Anpassungen erfolgreich durchgeführt werden konnte (Levitt, Malta, Martin, Davis & Cloitre, 2007). Das vorliegende Kapitel beschreibt die Prinzipien von STAIR/Narrative Therapie im Rahmen eines Ressourcenverlust-Modells. Dieses Modell ist sowohl auf Personen anwendbar, die als Kind ein Trauma erlebt haben als auch auf Personen mit Traumatisierungen im Erwachsenenalter. Die Kapitel 2 und 3 konzentrieren sich speziell auf bindungsbezogene Ressourcenverluste, die in der Folge von Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit auftreten.
1.1 Trauma und eine neue Diagnose: Komplexe PTBS
Studien an der Allgemeinbevölkerung kommen zu dem Ergebnis, dass Traumatisierungen weit verbreitet sind: Über 70 % der Weltbevölkerung berichten, dass sie mindestens ein traumatisches Ereignis erlebt haben und 30 % berichten, dass sie vier oder mehr solcher Ereignisse erlebt haben (Benjet et al., 2016). Traumatische Erfahrungen umfassen interpersonelle Erlebnisse, die oft mit Gewalt von einer Person gegen eine andere einhergehen, wie körperliche Übergriffe, Vergewaltigungen und Kampfhandlungen; sie umfassen auch andere Arten von Erfahrungen, wie schwere Unfälle und natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen. Die meisten interpersonellen Traumatisierungen, zu denen auch sexuelle und körperliche Gewalt gehört, treten vor dem Alter von 18 Jahren auf (Kessler et al., 2017). Die verheerendsten traumatischen Erfahrungen betreffen also Personen, die von ihrem Entwicklungsstand her am wenigsten in der Lage sind, sie zu bewältigen. Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit oder andere 22Formen von Misshandlungen (die alle zu den interpersonellen Traumatisierungen gehören) sind besonders häufig; mehr als eine von vier Personen hat bis zum Alter von 17 Jahren Misshandlungen durch eine Betreuungsperson erlebt (Finkelhor, Turner, Shattuck & Hamby, 2013).
Seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe dieses Buches im Jahr 2006 sind Missbrauch in der Kindheit im Speziellen und Traumatisierungen im Allgemeinen als wichtige Probleme für die Gesundheit der Bevölkerung erkannt worden (Teicher & Samson, 2013). Insbesondere die American Heart Association weist auf Belege für die langfristigen negativen Auswirkungen von Kindheitstraumatisierungen auf die psychische und physische Gesundheit hin (Suglia et al., 2018). Personen mit einer Missbrauchsgeschichte in der Kindheit sind noch jünger beim Beginn psychischer Beschwerden, haben einen höheren Schweregrad der Symptome, weisen mehr komorbide Störungen auf, haben ein höheres Suizidrisiko und sprechen schlechter auf die Behandlung an als Personen ohne Missbrauchsgeschichte mit denselben Diagnosen (Teicher & Samson, 2013).
Die Beeinträchtigungen und das psychische Leid, das durch Missbrauch in der Kindheit verursacht wird, sind enorm. Im Jahr 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den besonders komplexen Auswirkungen von Missbrauch in der Kindheit und anderen chronischen und anhaltenden interpersonellen Traumatisierungen durch die Einführung einer neuen Diagnose, der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS), in die 11. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-11; WHO, 2018) Rechnung getragen. Die ICD-11 ist das weltweit anerkannte, offizielle Diagnosesystem, das (endlich) auch in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Die Diagnose umfasst nicht nur die klassischen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), sondern auch die Auswirkungen, die ein Trauma auf die Emotionsregulation, das Selbstkonzept und die Beziehungsfähigkeit haben kann. Als die erste Auflage dieses Buches veröffentlicht wurde, war die Diagnose der PTBS, wie sie in der vierten Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000) dargestellt wird, die vorherrschende Formulierung der psychischen Auswirkungen von Traumatisierungen. Damals sprachen wir zwar über Probleme, die wir bei Betroffenen von Missbrauch in der Kindheit beobachteten und die über die im DSM definierte PTBS hinausgingen, insbesondere in Bezug auf die Emotionsregulation, das zwischenmenschliche Funktionsniveau und das negative Selbstkonzept, sie waren aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell anerkannt. Im DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) werden solche Symptome nun aufgegriffen, indem der PTBS ein Symptomcluster „Negative Veränderungen von Kognitionen und Stimmung“ hinzugefügt wurde, das sich auf negative Überzeugungen über sich selbst und andere sowie auf Gefühle der Entfremdung von anderen bezieht. Außerdem wurde bei der PTBS der Subtyp „mit dissoziativen Symptomen“ hinzugefügt, der eine bestimmte Form von Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation (Hypoaktivierung) erfasst. Die Aufnahme der kPTBS-Diagnose in die ICD-11, die ein kohärentes und empirisch gestütztes Profil von Symptomen bietet, die typischerweise mit komplexen Traumatisierungen einhergehen, macht es nun einfacher, die Probleme zu erkennen, zu bewerten und zu behandeln, die typischerweise bei Betroffenen von Missbrauch in der Kindheit auftreten. Das spezifische Symptomprofil, das mit der kPTBS laut ICD-11 assoziiert ist, sowie seine Diagnostik werden in den Kapiteln 8 und 9 diskutiert.
Das Ziel dieses Buches ist es, einen Behandlungsleitfaden für Personen bereitzustellen, die in ihrer Kindheit Missbrauch und andere zwischenmenschliche Traumatisierungen erlebt haben, die zu einer breiten Palette von Symptomen führen, einschließlich derer, die in der kPTBS nach ICD-11 zu finden sind. Wir sind der Meinung, dass dieses Buch aufgrund der Aufnahme der kPTBS in die diagnostischen Kategorien heute mehr denn je benötigt wird. Wir sind uns jedoch bewusst, dass nicht alle Probleme, die Betroffene von Missbrauch in der Kindheit und anderen schweren interpersonellen Traumatisierungen erleben, von dieser Diagnose erfasst werden. Dementsprechend ist es unsere Absicht, einen konzeptionellen Rahmen sowie ein Behandlungsprogramm bereitzustellen, die sich mit der Erfahrung chronischer interpersoneller Traumatisierungen befassen und nicht nur mit einer Diagnose. Die Perspektive auf Traumatisierungen als Ressourcenverlust bietet einen Erklärungsrahmen für PTBS und kPTBS sowie für andere Störungen und psychologische Probleme, die sich aus verschiedenen Arten von interpersonellen Traumatisierungen ergeben können. Das in diesem Buch vorgestellte Behandlungsprogramm, STAIR/Narrative Therapie, befasst sich mit allen Problemen, die in der Diagnose der kPTBS enthalten sind. Es kann aber auch auf andere Probleme bezogen werden, wenn diese im Kontext des Verlustes und der Wiederherstellung von Ressourcen verstanden werden. Der Rest dieses Kapitels beschreibt Traumatisierungen als ein 23Phänomen des Ressourcenverlusts. Dies betrifft die Arten von Verlusten, die aus Traumatisierungen in der Kindheit resultieren, besonders durch nahe Bezugspersonen, die Art und Weise, wie diese Verluste in der kPTBS-Diagnose dargestellt werden und das Konzept von STAIR/Narrative Therapie als Programm zur Wiederherstellung von Ressourcen.
1.2 Traumatisierungen führen immer zum Verlust von Ressourcen
Der Verlust von Ressourcen ist ein wesentliches und allgegenwärtiges Merkmal aller Traumatisierungen. Das Leben wird durch sie eingeschränkter. Je nach Art der Traumatisierung kann es zum Verlust psychischer (etwa dem persönlichen Gefühl von Sicherheit, Optimismus und sozialer Unterstützung) oder materieller Ressourcen (etwa der Wohnung, der Familie, der Schule oder des Arbeitsplatzes und einer förderlichen Gemeinschaft) oder beidem kommen. Weiter betreffen bestimmte Arten von traumatischen Ereignissen und deren härteste Konsequenzen gerade jene, die bereits in Lebensumständen mit eingeschränkten Ressourcen leben. Häufig sind gerade Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln von Traumatisierungen betroffen. So laufen Menschen, die es sich nicht leisten können, in eine sichere Gegend umzuziehen, eher Gefahr, von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Überschwemmungen heimgesucht zu werden und stärker unter ihren Konsequenzen zu leiden. In ähnlicher Weise werden Personen, die nicht über die notwendigen physischen und psychischen Ressourcen verfügen, um sich vor Übergriffen zu schützen, eher Opfer von zwischenmenschlicher Gewalt. Dazu gehören zum Beispiel Kinder, Ältere oder in anderer Weise eingeschränkte Menschen. Die Häufigkeit von Vergewaltigungen etwa verteilt sich nicht gleichmäßig über die gesamte Lebensspanne, sondern diese ereignen sich vor allem während der verletzlichen Phasen von Kindheit und Jugend. Wie oben erwähnt, treten mehr als die Hälfte aller sexuellen und physischen Übergriffe bis zum Alter von 18 Jahren auf (Kessler et al., 2017).
Weiter haben es Menschen mit begrenzten Ressourcen, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, Traumatisierungen ausgesetzt zu sein, aus demselben Grund auch schwerer, sich von den Folgen zu erholen. Es liegt eine bittere Ironie darin, dass der Heilungsprozess nach einem Trauma oft mehr Ressourcen erfordern würde, als Betroffenen vor der traumatischen Erfahrung je zur Verfügung standen. Für den Wiederaufbau eines Hauses, das von einem Wirbelsturm zerstört wurde, braucht es mehr als Ziegel, Mörtel und Arbeitskraft. Es wird ein ganzes Team von Handwerker:innen benötigt: Dachdecker:innen, Maurer:innen, Klempner:innen und Maler:innen. So wie Hausbesitzer:innen den Wiederaufbau ihres Hauses ohne fremde Hilfe nicht leisten können, verfügen Betroffene von Traumatisierungen häufig nicht über notwendige Ressourcen und sind somit auf die Hilfe anderer angewiesen. Dies gilt vor allem für Personen, die in ihrer Kindheit traumatisiert wurden. Die Kindheit ist eine vulnerable Phase in Bezug auf Opfererfahrungen, und wenn es dazu kommt, haben Kinder in der Folge noch weniger psychische und soziale Ressourcen als zuvor, um einen Heilungsprozess zu ermöglichen.
Letztlich ist der Zustand nach einer Traumatisierung dabei nichts Statisches. Wird der Ressourcenverlust nicht kompensiert, kommt es nicht zu einem Stillstand, sondern eher zu einem weiteren Abbau und Verlust von Ressourcen (vgl. Hobfoll, Mancini, Hall, Canetti & Bonanno, 2011). Ein beschädigtes oder nur unzureichend repariertes Haus bleibt anfällig für Windböen, verwittert stetig weiter und droht beim nächsten Unwetter ganz zusammenzufallen. In gleicher Weise zeigen traumatisierte Menschen, deren Ressourcen sich nicht regenerieren konnten, eine starke Beeinträchtigung in ihrer weiteren psychischen und sozialen Entwicklung. Dies macht sie empfindlicher gegenüber Alltagsstress und weiteren traumatischen Erfahrungen. Menschen, die in ihrer Kindheit Missbrauch erfahren, sind besonders anfällig dafür, dass sich eine solche negative Entwicklung weiter fortsetzt. Kindheit heißt Wachstum: Es entwickeln sich körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten. Traumatische Erfahrungen beeinträchtigen die Ressourcen, die für die Entwicklungsaufgaben in der Kindheit essenziell sind. In der Folge werden wesentliche Entwicklungsschritte nicht vollzogen, was zu erheblichen Einschränkungen führen kann, mit Problemen, das eigene Leben zu meistern, die sich bis ins Erwachsenenalter weiter verstärken. Das Ressourcenverlust-Modell kann demnach auch einen Rahmen für das Verständnis von Heilungsprozessen nach Traumatisierungen bieten. Heilung von Traumatisierungen erfordert Wiederherstellung von Ressourcen (Hollifield et al., 2016). Dementsprechend beruht das vorliegende Behandlungsmodell auf dem Prinzip, den Verlust von Ressourcen zu kompensieren, insbesondere der psychischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten, deren Entwicklung durch erlittene Gewalterfahrungen nachhaltig gestört wurde.
241.3 Psychische Traumatisierung als Verlust von Ressourcen
Unter einem „Trauma“ versteht man in der Medizin ein Ereignis, das dazu führt, dass Teile des Körpers durch eine Einwirkung geschädigt werden, die so stark ist, dass die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers nicht in der Lage sind, eine Verletzung zu vermeiden und die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers nicht in der Lage sind, die Verletzung ohne medizinische Hilfe zu bewältigen (Stedman’s Medical Dictionary, 2000). Der Begriff „Trauma“ leitet sich vom griechischen Wort für „Verwundung“ ab. Nach Chris Brewin (2003) war Freud (1920/1955) der erste, der „seelische Verletzungen“ in Analogie zu „körperlichen Verletzungen“ definiert hat. In einem seelischen Trauma sah Freud ein Ereignis, das „eine Art psychischer Schutzhülle durchbrach, die dazu vorgesehen ist, die Person vor massiven äußeren Einflüssen zu bewahren. Ein Trauma war damit letztlich die Verletzung einer ansonsten effektiven Barriere“ (Brewin, 2003





























