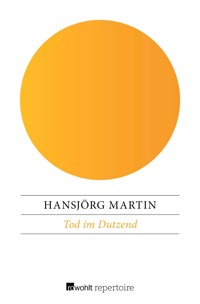9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter der alten Decke sah der Tote im Mondlicht aus wie ein zu groß geratener Maulwurfshügel. Auf die Polizei würden wir noch ein paar Stunden warten müssen. Das Boot vom Festland konnte erst mit der Flut kommen. Es war zum Verrücktwerden: Erst hatte jemand dem komischen kleinen Botaniker den Hut vom Kopf geschossen; dann hatte mein Kameramann einen Streifschuß abgekriegt, und jetzt war der Toningenieur tot. Und das auf der winzigen Vogelinsel, auf der man nur mit Sondergenehmigung landen darf. Auf der normalerweise nur zwei Menschen lebten – der Inselvogt und seine Tochter. Auf der sich gegenwärtig nur sechs Menschen aufhielten – nein, fünf; Harry war ja tot ... Fünf Menschen also und ein Toter: die beiden ständigen Bewohner, der kleine Botaniker, der die Inselflora studierte, und wir drei – nunmehr zwei – Fernsehleute. Nach keinem der drei Attentate war eine Spur von dem geheimnisvollen Schützen zu finden gewesen. Wer immer es war – es mußte ein Irrer sein. Ein Irrer allerdings, der fliegen konnte. Oder auf den Wellen schreiten. Oder sich unsichtbar machen. Oder alles miteinander ... Ich verfluchte den Tag, an dem ich auf die Idee gekommen war, diesen Möwenfilm zu drehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Bei Westwind hört man keinen Schuß
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Unter der alten Decke sah der Tote im Mondlicht aus wie ein zu groß geratener Maulwurfshügel.
Auf die Polizei würden wir noch ein paar Stunden warten müssen. Das Boot vom Festland konnte erst mit der Flut kommen.
Es war zum Verrücktwerden: Erst hatte jemand dem komischen kleinen Botaniker den Hut vom Kopf geschossen; dann hatte mein Kameramann einen Streifschuß abgekriegt, und jetzt war der Toningenieur tot. Und das auf der winzigen Vogelinsel, auf der man nur mit Sondergenehmigung landen darf. Auf der normalerweise nur zwei Menschen lebten – der Inselvogt und seine Tochter. Auf der sich gegenwärtig nur sechs Menschen aufhielten – nein, fünf; Harry war ja tot ... Fünf Menschen also und ein Toter: die beiden ständigen Bewohner, der kleine Botaniker, der die Inselflora studierte, und wir drei – nunmehr zwei – Fernsehleute.
Nach keinem der drei Attentate war eine Spur von dem geheimnisvollen Schützen zu finden gewesen. Wer immer es war – es mußte ein Irrer sein. Ein Irrer allerdings, der fliegen konnte. Oder auf den Wellen schreiten. Oder sich unsichtbar machen.
Oder alles miteinander ...
Ich verfluchte den Tag, an dem ich auf die Idee gekommen war, diesen Möwenfilm zu drehen.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Die Leute von der Insel:
Dirk Dirksen
kann Jungvögel zart und Menschen hart anfassen.
Swantje Dirksen
ist schon auf dem Festland gewesen – mehrmals, bitte sehr!
Der Gast:
Dr. Schlünz
sammelt seltene Pflanzen und lehnt es ab, Fisch zu essen.
Das Fernseh-Team:
Anselm Kiwitt
schlichtet Streit und findet einen Toten.
Harry Jungnickel
spielt auf der Gitarre und mit Mädchenherzen.
Jochen Kieselack
hat erst redliche Absichten und dann Handschellen an.
Die Polizisten:
Fokko Hallenga
kennt die Verhältnisse, aber das hilft nicht weiter.
Kommissar Lehmann
versucht, den Fall mit Filzstiften zu lösen, und greift daneben.
Alfred Cerwinkowialsky
wird der Einfachheit halber Alfred genannt.
Dies ist ein Roman; die auftretenden Personen sind ebenso frei erfunden wie die geschilderten Ereignisse, und jede Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig. – Nur die Insel existiert tatsächlich. Aber sie heißt anders.
Für meine Freunde
an der Küste:
Eili,
Frerich
und
Gerd
– und für die Möwen,
natürlich. HjM
… das ausgedehnte Tief, das sich von Schottland bis zur Biskaya erstreckt, wandert langsam südwärts und beeinflußt unser Wetter. An seiner Ostflanke dringt kalte Meeresluft vor allem in den norddeutschen Raum.
Die Aussichten für Montag, den 3. Juni: Bedeckt mit gelegentlichen Aufheiterungen. Niederschläge, besonders im Küstengebiet. Neigung zu Schauern. Auffrischende Winde aus nördlicher Richtung, später auf West drehend, in Böen bis Stärke acht …
1
Ich habe schon manches erlebt, was mir die Sprache verschlagen hat. Atemberaubende Sachen, dramatische Begebenheiten, seltsame Begegnungen, unerwartetes Glück, leidenschaftliche Liebesgeschichten, häßlichen Haß – alles mögliche.
Und doch gibt es für mich ein paar ganz simple Situationen, bei denen mir immer wieder die Luft wegbleibt, obschon ich vorher weiß, was auf mich zukommt. Und obschon ich das, was mich sprachlos macht, bereits hundertmal gesehen habe, bin ich dennoch jedesmal wieder für lange Sekunden atemlos …
Wir waren seit vier Stunden unterwegs an diesem Montagmorgen.
Zunächst 150 Kilometer Autobahn. Ziemlich mühsam, wegen der vielen Baustellen. Dann ein asphaltierter Anachronismus über 114 weitere Kilometer … Der gesamte Fernlastverkehr Nordeuropas schien sich ausgerechnet diese Straße, die schmal und glatt und schlängelig war wie ein sterbender Aal, ausgesucht zu haben, um Fleisch, Fisch, Futtermittel, Fässer und alles nur denkbare Frachtgut irgendwohin zu befördern.
Wir hatten nach anfänglichen selbstmörderischen Überholversuchen kapituliert und zuckelten nun, von dicken Dieseldünsten umwölkt, im Sechziger-Tempo durch die Landschaft, lutschten Bonbons, rauchten Zigaretten, tauschten Studio-Klatsch aus und erzählten wechselseitig Witze.
Jochen Kieselack fuhr den Kombi. Das war gut; er fährt so ruhig und sicher, wie er auch mit seiner Kamera umgeht. Ich fahre gern mit ihm, wie ich auch gern mit ihm arbeite. Es gibt kaum bessere Kameraleute als ihn. Vielleicht sind einige mit mehr Tricks vertraut oder mit größerer Genialität ausgerüstet – aber so zuverlässig ist keiner, den ich kenne.
Hinter uns, zwischen Kisten und Kabeln, saß Harry Jungnickel, der neue Assistent; ein frech-wacher, fixer Bursche, schnell und schnoddrig, vorwitzig und verwegen – kurz: genau das Richtige für einen Kamera-Assi.
Wenn alles andere klappte, wenn die Möwen mitspielten, wenn das Wetter mitmischte, konnte der Film in fünf Tagen im Kasten sein.
Nach vier Stunden Landschaft, Lastwagen und lahmarschiger Fahrerei erreichten wir endlich das flache Land hinter den Deichen, wo die Bäume sich auch dann vor dem Wind verbeugen, wenn er gar nicht weht.
Dann die Fünf-Sekunden-Steigung über den Damm, und – aahh! – Die See … und meine immer wiederkehrende Atemlosigkeit vor der unendlichen Wasserfläche; dieses unerklärliche, beklemmende Glücksgefühl, das ich nirgendwo anders habe – nicht in den Bergen, nicht im Flugzeug, nicht in den Armen einer Frau, nicht angesichts eines Bündels unverhoffter Geldscheine –, nirgends sonst, nur beim ersten Blick über den Deich auf die graublaue oder grüne, lehmgelbe oder schwarze oder silbrige See.
Das dauert immer nur ein paar Sekunden; ich überwinde es – leider und Gott sei Dank – schon mit dem ersten tiefen Atemzug … Ich weiß nicht, ob es vielen Menschen so geht wie mir.
Allen bestimmt nicht; Harry Jungnickel in meinem Rücken zündete sich ungerührt eine Zigarette an und meinte: «’ne Menge Wasser, wie?»
Jochen Kieselack schwieg, blinzelte unter seinen erstaunlich langen Wimpern, um die ihn sicher schon manches Mädchen beneidet hatte, und fuhr dann den Wagen langsam auf die breite Mole.
Es war ein kühler Montag Anfang Juni, zehn Tage vor Pfingsten, bedeckt und frisch, aber trocken. Außer einem Lieferwagen und einem Polizeiauto standen höchstens zehn, zwölf Kraftfahrzeuge dort, wo zur Saison viele hundert parken.
Wir fuhren an einem Verbotsschild vorbei, um den Kutter zu suchen, der uns erwartete, und setzten damit vollautomatisch das Obrigkeits- und Ordnungsvehikel in Bewegung.
In schneidigem Bogen preschte es heran; es fehlte nur noch Sirene und Blaulicht.
Ein rotgesichtiger Dickkopf mit weißer Mütze schwenkte den Arm aus dem Autofenster.
Wir hielten an.
Sie sprangen zu zweit heraus, einer links, einer rechts, als gelte es, eine Bande von Terroristen oder Chicago-Gangstern zu umzingeln, und kamen auf uns zu. Der Dickkopf brüllte schon fünf Schritt vor unserem Wagen: «Können Sie nicht lesen?»
Ich kurbelte gemächlich mein Fenster herunter, sagte: «Mahlzeit, Herr Hauptwachtmeister!» und gab mir Mühe, meine mir von den Ordnungshütern in jahrelanger Kleinarbeit anerzogene Antipathie zu unterdrücken. «Was gibt’s denn?» fragte ich also lächelnd.
«Was es gibt?» Der Mitmensch in Uniform stand nun vor dem offenen Autofenster; er stützte die Fäuste in die Hüften und redete immer noch so laut, als ob er’s mit Schwerhörigen oder Ausländern zu tun hätte: «Eine gebührenpflichtige Verwarnung gibt’s, werter Herr; Sie haben eben ein Verbotsschild überfahren!»
«Na, so was!» sagte ich.
«Ei, der Daus!» rief Harry von hinten.
«Potzblitz!» sagte Jochen am Lenkrad.
Aber wir blieben alle drei ganz ernst.
Der zweite Polizist hatte sich, da er ein Wesen niederen Dienstranges war, zwei Schritt hinter den Dickkopf gestellt und blickte uns, die Hände auf dem Rücken, in der Reihenfolge unserer Äußerungen an. Er trug einen dunklen Schnauzbart und sah eigentlich eher wie ein Jazzmusiker aus. Ich hatte den Eindruck, daß er unter dem Bart griente.
Der Dickköpfige, von unserer Reaktion zunächst irritiert, begann sich aufzupumpen – es hatte Ähnlichkeit mit den Flugvorbereitungen eines Maikäfers. Aber dann schweifte sein Steckbrief-Suchblick von unseren Gesichtern ab und fiel auf die Beschriftung an der Tür des Kombiwagens. Die mühsam gepumpte dienstliche Entrüstungsluft entwich durch seine Knubbelnasenlöcher. «Ach so», sagte er in Moll. «Sie sind die Leute vom Fernsehen!»
«Gewiß doch, Herr Hauptkommissar, wenn’s beliebt», pflichtete ich ihm bei.
«Ja, ja, ich weiß schon», sagte er, gewann allmählich seine Sicherheit zurück und wurde nun ganz der Freund und Helfer aus dem Werbeprospekt für den Polizeinachwuchs. «Die Wiebke wartet schon auf Sie – drüben, auf der anderen Seite der Mole … Wir fahren eben voraus.» Er machte mit einem Zwei-Finger-Tip an den Mützenschirm kehrt, stieg neben dem Bärtigen in den Streifenwagen und fuhr vor uns her die Mole entlang, um die Gebäude der Reederei herum, an zwei weißen Fährschiffen vorbei, und hielt schließlich neben einem Motorkutter, dessen Bug der Name Wiebke zierte.
Dort stieg der Herr Untergebene aus und rief einem Mann in Rollpullover und Overall, der an Bord des Kutters auf einer Kiste saß, zu: «Dien Feernsehlüd, Freerk!»
«Ward ook Tied; denn man to!» rief der Freerk genannte zurück und erhob sich. «Wie hebb no ’n knappen Stünd bis Hochwasser!»
Aus diesem Dialog entnahm ich, daß es eilig war, stieg aus, winkte dem Kutterkapitän zu und machte die Rückklappe des Kom- bis auf.
«Sollen wir helfen?» fragte der Schnauzbart-Polizist. «Der Schipper hat Sorge, daß er nicht mehr durchs Watt kommt, wenn Sie noch lange zum Umladen brauchen.»
«Ja, bitte!» sagte ich.
So kam es, daß wir zu siebt – wir drei, die zwei Polizeibeamten, der Kapitän und sein langer, schlaksiger Bootsmann oder Steuermann oder Vollmatrose oder was weiß ich – eine Kette bildeten und in schöner Harmonie innerhalb zehn Minuten unseren ganzen Kram an Bord hatten, wo alles auf dem Vorderdeck von Jochen verstaut und vom Vollmatrosen mit einer großen Plane zugedeckt wurde: Kisten, Kasten, Kabel, Kameras, Koffer, Lampen, Stative und so weiter.
«So ’n Haufen Zeug!» sagte der plötzlich so nett gewordene Dickkopf mit der weißen Mütze erstaunt. «Was wird das denn für ’n Film?»
«Ein Krimi!» grinste Harry.
Wenn er gewußt hätte, wie schrecklich recht er behalten sollte, hätte er sicher nicht gegrinst.
«Was wollen Sie denn nun wirklich für ’n Film auf Melloog drehen?» fragte mich der Schiffer eine Viertelstunde später in langsamem Hochdeutsch, das ihm offensichtlich Mühe machte, nachdem der Kutter abgelegt hatte und die Fahrrinne entlang hinaus ins Watt tuckerte.
«Einen Möwenfilm», sagte ich. «Den Titel wissen wir noch nicht. Erst mal sehen, was dabei rauskommt.»
Wir standen zu dritt auf der Brücke (oder heißt das bei Kuttern Ruderhaus?): der Käptn, Jochen und ich. Harry saß in einem Windschattenwinkel an Deck und rauchte; der schlaksige Matrose schoß die Leinen auf, mit denen das Boot an den Pollern festgemacht gewesen war.
«Die brüten jetzt», fuhr ich fort. «Und dabei sollen sie so interessante Gewohnheiten haben. Sind überhaupt dolle Vögel, wenn alles stimmt, was ich darüber gehört und gelesen habe.»
«Weiß ich nicht», sagte der Kapitän und ließ das große Holzrad mit den vielen gedrechselten Griffen durch seine roten, hornigen Hände laufen … Die Dinger haben bestimmt auch einen seemännischen Namen – ‹Pint› oder so; jedenfalls nicht ‹Griff› …
«Dann gehört der Doktor zu Ihnen?» fragte er nach einer Denkpause.
«Welcher Doktor?» Ich war überrascht.
«Der unten im Logis sitzt», sagte Kapitän Freerk. «Ich hab den Namen nicht behalten. Der will auch nach Melloog; auch wegen irgendwelchem Vogelviehzeug. Dirksen, der Vogt, hat mich angerufen gestern abend, daß ich ihn mitnehmen soll. Doktor … Doktor … Nee; komischer Name. Komm nicht drauf. Also der hat nix mit Ihrem Film zu tun?»
«Nein», sagte ich. «Doch ich werd ihm mal guten Tag sagen gehen. Ist ja vielleicht gut, so einen Fachmann in der Nähe zu haben … Der Inselvogt versteht ja wohl auch allerhand davon, nicht?»
«Dirk Dirksen? Ho – der kennt seine paar tausend Möwen jede mit Vornamen!» Der Kapitän lachte. Seine hellen Augen verschwanden dabei in tiefen Falten, die sich sternförmig von der Nasenwurzel über das Gesicht ausbreiteten.
Ich stieg das Treppchen aus dem Ruderhaus hinab, ging zwei Schritte rechts und wieder rechts und kletterte die Stufen hinunter, die in den Bauch des Kutters führten. Hinter einer Schiebetür befand sich das Logis, und dort, im spärlichen Licht von vier Bullaugen, saß auf einer wachstuchbezogenen Bank ein schmaler, älterer Mann – nein, Herr –, der mir über den Goldrand seiner Brille entgegensah, als ich eintrat.
«Guten Tag!» sagte ich. «Der Kapitän erzählt gerade, daß Sie mit nach Melloog fahren. Ich wollte mich eben nur vorstellen – mein Name ist Kiwitt.»
Der Fremde erhob sich. Er war klein und konnte in dem niedrigen Raum, in dem es nach Öl und nasser Wolle roch, aufrecht stehen, während ich den Kopf ein wenig einziehen mußte.
Er gab mir eine zerbrechlich wirkende Hand, die sich wie Wildleder anfühlte, und sagte: «Guten Tag! Ich heiße Schlünz.»
«Sehr angenehm.»
Es geht nichts über Floskeln.
«Ganz meinerseits.» Er deutete eine Verbeugung an. Er hatte eine dunkle, heisere Stimme, die zu seinem Körper paßte wie ein Cello-Strich auf der tiefen Saite in ein Kindergarten-Lied.
Eine Peinlichkeitspause begann sich auszubreiten und den dunklen, engen Raum zu füllen.
«Ja», sagte ich, «ich wollte, wie gesagt, eben nur … Lassen Sie sich nicht stören, bitte!»
«Aber nein … Das ist doch …» Er brach ab, schob die Goldrandbrille, die ihm auf die Mitte der Nase gerutscht war, wieder zurecht und probierte ein Lächeln, das ihm nicht gelang, und fuhr sich mit allen fünf Fingern durch das kurzgeschnittene bleigraue Haar, so daß es nach allen Seiten aufstand wie Igelborsten.
«Bis nachher also!» sagte ich, ging hinaus und wußte nicht recht, ob ich ihn für arrogant, scheu oder verklemmt halten sollte.
An Deck empfing mich Nieselregen. Dort, wo vorhin der Horizont gewesen war, quoll milchiger Nebel, vor dem die Buschpricken, die die Fahrrinne kennzeichneten, wie schwarze Ausrufungszeichen standen.
«Schlechtes Wetter», sagte ich, wieder im Ruderhaus, zu Käptn Freerk.
«Dat is man een Aferjagd; ’t geit boll vörafer», teilte er mir mit.
Da es tröstlich klang, fragte ich nicht, was es heißen sollte.
Jochen, der an der Rückwand des Ruderhauses lehnte und sich eine Pfeife angezündet hatte, lächelte mir zu. Der Tabak roch gut.
Vom Vorderdeck kam Harry zu uns herein. Es wurde nun ein bißchen eng in dem kleinen Raum, aber es ging, als ich mich an die linke – pardon – an die Backbordseite quetschte.
«Stören wir Sie auch nicht, Käptn?» fragte ich.
«Daß Sie bloß nicht vom Kurs abkommen!» flachste Harry.
«Hööö …», brummte der Kapitän.
Aus einer der tiefen Taschen seines Duffle-Coats zauberte Harry einen Flachmann Whisky, schraubte die Kappe ab und reichte ihn dem Schiffer. «Für die innere Feuchtigkeit, Admiral!»
Der Alte schnüffelte, schob genießerisch die Unterlippe vor, knurrte eine unverständliche Anerkennung und wippte, zu unserer Verblüffung, aus der flachen Flasche einen Spritzer Whisky durch die Ruderhaustür über Bord. «Für Neptun!» erklärte er todernst und mit ganz langem Uu. Darauf nahm er einen schönen tiefen Schluck, ohne danach im geringsten die Miene zu verziehen, und gab die Flasche an Harry zurück, der sie mir anbot. Ich bedankte mich, wagte nicht, den Flaschenhals abzuwischen, setzte an, schluckte den scharfen Stoff und bemühte mich, ebenfalls so zu tun, als sei es nur Apfelsaft. Das war nicht so einfach. Ich würgte an einem Huster und merkte, wie mir die Anstrengung das Wasser in die Augen trieb.
Jochen lachte.
«Hebt noch einen für Fokko auf», sagte der Kapitän über die Schulter.
«Is gebongt!» Harry trank nach Jochen als letzter und rief durch die offene Ruderhaustür: «Fokko! Komm her! Befehlsausgabe!»
Irgendwo vom Hinterdeck kam der schlaksige Junge. Er hatte einen richtigen Südwester auf, freute sich, sagte: «Prost!» – Das einzige Wort, das wir auf der ganzen Fahrt von ihm hörten – und genehmigte sich einen langen Zug. Dann verschwand er wieder.
Es war nur noch ein guter Daumenbreit Whisky in der Flasche, den wir ohne parlamentarische Diskussion dem Käptn zusprachen. Der zierte sich nicht, kippte den Rest runter und warf die leere Flasche in großem Bogen ins Wasser. Dann rülpste er gewaltig, fuhr sich mit dem breiten Handrücken über die zerklüfteten Lippen und sagte: «Wat helpt mi warm Beer, wenn ’k dood bin!»
Als hätte das Whisky-Opfer irgendeine für das Wetter zuständige Wassergottheit bestochen, lichtete sich kurz danach der Nebel; der Nieselregen hörte auf, und durch den Dunst quälten sich einzelne schwache Sonnenstrahlen wie Kammzinken durch dichtes Haar.
Ich kletterte vom Ruderhaus aufs Deck. Der Kutter lief an einer Sandbank entlang. Ein Silbermöwenpulk schwamm, lief, flatterte lärmend an der schaumigen Wasserkante entlang hinter dem Schiff her. Eine flog auf. Ein fingerlanger Fisch zappelte in ihrem gelben Schnabel. Sie flog, von zwei anderen verfolgt, auf mich zu.
«Heee!» schrie ich, als sie fast über mir war, und klatschte in die Hände.
Die Möwe erschrak und ließ den Fisch fallen.
Er fiel mir direkt vor die Füße, lag auf den Planken, blutig mit schnappendem Maul, schnellte noch mal hoch, bog sich, drehte sich, streckte sich und lag still.
Mir kroch was Kaltes über den Rücken. Ich bückte mich, mochte aber das tote Ding nicht anfassen. Mit dem Fuß stieß ich’s durch ein Speigatt ins Wasser, wo es wegwirbelte und versank.
Im Nordwesten war ein Streifen Land zu sehen.
«Ich glaube, das ist Melloog», sagte jemand hinter mir. Es war der kleine Doktor mit dem bleigrauen Igelborsten-Haar.
Ich hatte ihn nicht kommen hören. Er ging noch leiser, als er aussah.
2
«Die gesamte Bevölkerung versammelt sich zu Ihrer Begrüßung», sagte Kapitän Freerk.
Über den breiten weißen Sandstrand der Insel kamen zwei Menschen gelaufen. Hinter ihnen zockelte ein Pferd, das einen Leiterwagen zog. Die zwei waren barfuß, aber noch zu weit weg, als daß ich ihre Gesichter hätte erkennen können. Der eine war groß, breitschultrig und ging mit weitausholenden Schritten. Der andere war fast einen Kopf kleiner und schmal und lief wie ein Mädchen.
«Wieso?» fragte ich den Käptn. «Zwei Leute? Nur zwei?»
«Dirksen und seine Tochter», erklärte Freerk. «Mehr sind das nu mal nicht. Die Frau ist vor Jahren schon gestorben. Was haben Sie denn gedacht?»
«Nichts», gestand ich. «Darüber hab ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe zwar mit dem Inselvogt ’n paarmal telefoniert, und irgendwer hat gesagt, daß es einsam sei auf Melloog, aber daß er hier ganz allein lebt, nur mit dem Mädchen …»
Nun, im Näherkommen wurde es auch deutlicher, daß der kleine, schlanke Insulaner tatsächlich ein Mädchen war. Ein weißblondes, gegen den massigen Vogt zierlich wirkendes Mädchen, das sein Haar glatt nach hinten gebürstet und zu einem Knoten gebunden hatte.
Der Kutterkapitän drosselte den Motor und drehte das Schiff längsseits zum Strand.
«Fallen Anker!» schrie er Fokko zu.
Der ließ die Ankerkette rasseln. Es waren noch zwanzig Meter Wasser bis zur Flutkante.
«Und nu?» fragte Harry. «Den Rest? Sollen wir schwimmen?»
Er stand neben Jochen bei unserem Gepäckhaufen. Die Plane hatten sie schon weg. Fokko hantierte jetzt am Bug mit einem zweiten Anker. Aus dem Logis stieg Dr. Schlünz. Er trug ein langes Bündel; es sah aus wie ein Fotostativ oder irgendwelche Angelgeräte, um die ein Schlafsack gewickelt und mit dickem Bindfaden verschnürt war.
«Hallo!» rief ich.
Der Inselvogt wandte den bärtigen Kopf zu mir und hob stumm die Hand. Er nahm das zottige Pferd am Zügel und führte es ins Wasser, nachdem er sich die Leinenhose bis übers Knie hochgekrempelt hatte.
«Wenn Sie sich beeilen», sagte der Kapitän, «kann ich wohl mit der Flut noch zurück. Sonst müssen wir wenigstens zehn, zwölf Stunden warten.»
Der Vogt war auf den Leiterwagen geklettert und lenkte das Gefährt schnalzend zum Kutter. Das Wasser ging dem Pferd fast bis zum Bauch.
«Tag!» sagte er, als die Wagenseite direkt neben der Schiffswand war, und streckte mir die Hand entgegen. «Nu man los; runter mit Ihren Sachen!»
Harry sprang über Bord auf den Wagen, und Jochen, Fokko und ich reichten ihm den ganzen Kram zu. Das ging, trotz der Schlingerei des Kutters, schnell und gut und ohne Panne.
Die Sonne brach durch. Zwischen der Packerei und Schlepperei sah ich die Haare des Mädchens am Strand wie Weißgold glänzen.
Es war ein sehr hübsches Mädchen.
Wir hatten alles beisammen auf dem Wagen. Ich bedankte mich bei Käptn Freerk und schrieb mir schnell noch die Telefonnummer auf, unter der ich ihn erreichen konnte, wenn er uns wieder abholen sollte.
«Vielleicht Ende der Woche», sagte ich; «kommt aufs Wetter an. Spätestens aber Montag oder Dienstag in der nächsten Woche.»
«Geiht klor!» raunzte er.
Jochen war schon von Bord. Ich stieg ihm nach, nahm Dr. Schlünz seinen Koffer und das Schlafsackbündel ab und half ihm, über die Reling zu kommen.
«Hüh, Lotte!» Dirk Dirksen klatschte dem Pferd die Leine auf den Rücken. Wir standen alle breitbeinig auf den Brettern, um eventuelle Stöße aufzufangen; nur Dr. Schlünz hatte sich auf seinen Koffer gesetzt. Der Wagen schaukelte ruckelnd einen halben Meter vorwärts, dann saß er fest. Es war wohl eine ziemliche Quälerei für das Pferd; denn wir fünf Männer und der Berg Gepäck belasteten den Wagen sicher mit zwölf oder noch mehr Zentnern. Die breiten Räder rührten sich nicht. Sie sackten im weichen Sand ein. Es ging nicht voran.
Jochen und ich schalteten gleichzeitig. Wir zogen Schuhe, Strümpfe und Hosen aus, als Dirksen vom Wagen stieg, und sprangen ins Wasser. Es war aasig kalt, und mir blieb für einen Augenblick die Luft weg.
«Puh!» machte auch Jochen.