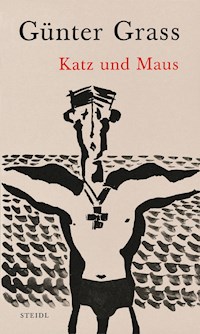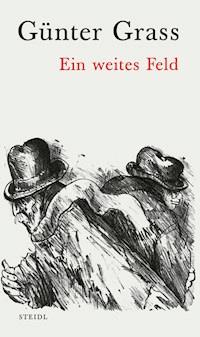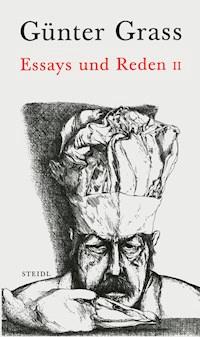Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Günter Grass erzählt von sich selbst. Vom Ende seiner Kindheit beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Vom Knaben in Uniform, der so gern zur U-Boot-Flotte möchte und sich hungernd in einem Kriegsgefangenenlager wiederfindet. Von dem jungen Mann, der sich den Künsten verschreibt, den Frauen hingibt und in Paris an der "Blechtrommel" arbeitet. Günter Grass erzählt von der spannendsten Zeit eines Menschen: den Jahren, in denen eine Persönlichkeit entsteht, geformt wird, ihre einzigartige Gestalt annimmt. Zwischen den vielen Schichten der "Zwiebel Erinnerung" sind zahllose Erlebnisse verborgen. Grass legt sie frei, schreibt über den Arbeitsdienst-Kameraden, der niemals eine Waffe in die Hand nahm, schildert genüsslich einen Lager-Kochkurs, der mangels Lebensmitteln abstrakt blieb, und berichtet, wie der Kunststudent sein Geld in einer Jazzband verdiente. Zudem zeichnet er liebevolle Porträts von seiner Familie, von Freunden, Lehrern, Weggefährten. Beim Häuten der Zwiebel ist ein mit komischen und traurigen, oft ergreifenden Geschichten prall gefülltes Erinnerungsbuch, das immer wieder Brücken in die Gegenwart schlägt. Günter Grass faßt den jungen Menschen von damals nicht mit Samthandschuhen an, enthüllt seine Schwächen, legt den Finger auf manches Versagen und noch heute schmerzende Wunden. Daß er die ein oder andere Erinnerungslücke mit Hilfe seiner reichen Phantasie ausgemalt haben könnte, gesteht er offen ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Die Häute unter der Haut
Ob heute oder vor Jahren, lockend bleibt die Versuchung, sich in dritter Person zu verkappen: Als er annähernd zwölf zählte, doch immer noch liebend gern auf Mutters Schoß saß, begann und endete etwas. Aber läßt sich, was anfing, was auslief, so genau auf den Punkt bringen? Was mich betrifft, schon.
Auf engem Raum wurde meine Kindheit beendet, als dort, wo ich aufwuchs, an verschiedenen Stellen zeitgleich der Krieg ausbrach. Er begann unüberhörbar mit den Breitseiten eines Linienschiffes und dem Anflug von Sturzkampfflugzeugen über dem Hafenvorort Neufahrwasser, dem als polnischer Militärstützpunkt die Westerplatte gegenüberlag, zudem entfernter mit den gezielten Schüssen zweier Panzerspähwagen beim Kampf um die Polnische Post in der Danziger Altstadt und nahbei verkündet aus unserem Radio, dem Volksempfänger, der im Wohnzimmer auf dem Büfett seinen Platz hatte: mit ehernen Worten wurde in einer Parterrewohnung, die Teil eines dreistöckigen Mietshauses im Langfuhrer Labesweg war, das Ende meiner Kinderjahre ausgerufen.
Sogar die Uhrzeit wollte unvergeßlich sein. Ab dann herrschte auf dem Flugplatz des Freistaates, nahe der Schokoladenfabrik Baltic, nicht nur ziviler Betrieb. Aus den Dachluken des Mietshauses gesehen, stieg überm Freihafen schwärzlich Rauch auf, der sich unter fortgesetzten Angriffen und bei leichtem Wind aus Nordwest erneuerte.
Aber sobald ich mich an den fernen Geschützdonner der Schleswig-Holstein, die eigentlich als Veteran der Skagerrakschlacht ausgedient hatte und nur noch als Schulschiff für Kadetten taugte, sowie an die abgestuften Geräusche von Flugzeugen erinnern will, die Stukas genannt wurden, weil sie hoch überm Kampfgebiet seitlich abkippten und im Sturzflug mit endlich ausgeklinkten Bomben ihr Ziel fanden, rundet sich die Frage: Warum überhaupt soll Kindheit und deren so unverrückbar datiertes Ende erinnert werden, wenn alles, was mir ab den ersten und seit den zweiten Zähnen widerfuhr, längst samt Schulbeginn, Murmelspiel und verschorften Knien, den frühesten Beichtgeheimnissen und der späteren Glaubenspein zu Zettelkram wurde, der seitdem einer Person anhängt, die, kaum zu Papier gebracht, nicht wachsen wollte, Glas in jeder Gebrauchsform zersang, zwei hölzerne Stöcke zur Hand hatte und sich dank ihrer Blechtrommel einen Namen machte, der fortan zitierbar zwischen Buchdeckeln existierte und in weißnichtwieviel Sprachen unsterblich sein will?
Weil dies und auch das nachgetragen werden muß. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen könnte. Weil wer wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes Wachstum, mein Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch dieser Grund sei genannt: weil ich das letzte Wort haben will.
Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie verkriecht sich. Zum Schönreden neigt sie und schmückt gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will.
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach Buchstab ablesbar steht: selten eindeutig, oft in Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt.
Unter der ersten, noch trocken knisternden Haut findet sich die nächste, die, kaum gelöst, feucht eine dritte freigibt, unter der die vierte, fünfte warten und flüstern. Und jede weitere schwitzt zu lang gemiedene Wörter aus, auch schnörkelige Zeichen, als habe sich ein Geheimniskrämer von jung an, als die Zwiebel noch keimte, verschlüsseln wollen.
Schon wird Ehrgeiz geweckt: dieses Gekrakel soll entziffert, jener Code geknackt werden. Schon ist widerlegt, was jeweils auf Wahrheit bestehen will, denn oft gibt die Lüge oder deren kleine Schwester, die Schummelei, den haltbarsten Teil der Erinnerung ab; niedergeschrieben klingt sie glaubhaft und prahlt mit Einzelheiten, die als fotogenau zu gelten haben: Das unter der Julihitze flimmernde Teerpappendach des Schuppens auf dem Hinterhof unseres Mietshauses roch bei Windstille nach Malzbonbon…
Der abwaschbare Kragen meiner Volksschullehrerin, des Fräulein Spollenhauer, war aus Celluloid und schloß so eng, daß ihr Hals Falten warf…
Die Propellerschleifen der Mädchen sonntags auf dem Zoppoter Seesteg, wenn die Kapelle der Schutzpolizei muntere Weisen spielte…
Mein erster Steinpilz…
Als wir Schüler hitzefrei hatten…
Als meine Mandeln schon wieder entzündet waren…
Als ich Fragen verschluckte…
Die Zwiebel hat viele Häute. Es gibt sie in Mehrzahl. Kaum gehäutet, erneuert sie sich. Gehackt treibt sie Tränen. Erst beim Häuten spricht sie wahr. Was vor und nach dem Ende meiner Kindheit geschah, klopft mit Tatsachen an und verlief schlimmer als gewollt, will mal so, mal so erzählt werden und verführt zu Lügengeschichten.
Als bei anhaltend schönem Spätsommerwetter in Danzig und Umgebung der Krieg ausbrach, sammelte ich – kaum hatten die polnischen Verteidiger der Westerplatte nach sieben Tagen Widerstand kapituliert – im Hafenvorort Neufahrwasser, der mit der Straßenbahn über Saspe, Brösen in kurzer Zeit erreicht werden konnte, eine Handvoll Bomben- und Granatsplitter, die jener Junge, der anscheinend ich war, während einer Zeitspanne, in deren Verlauf der Krieg nur aus Sondermeldungen im Radio zu bestehen schien, gegen Briefmarken, farbige Zigarettenbilder, zerlesene wie druckfrische Bücher, darunter Sven Hedins Reise durch die Wüste Gobi, weißnichtwasnoch eintauschte.
Wer sich ungenau erinnert, kommt manchmal dennoch der Wahrheit um Streichholzlänge näher, und sei es auf krummen Wegen.
Zumeist sind es Gegenstände, an denen sich meine Erinnerung reibt, das Knie wundstößt oder die mich Ekel nachschmecken lassen: Der Kachelofen… Die Teppichklopfstangen auf den Hinterhöfen… Das Klo in der Zwischenetage… Der Koffer auf dem Dachboden… Ein Stück Bernstein, taubeneigroß…
Wem sich ertastbar die Haarspange der Mutter oder Vaters unter der Sommerhitze an vier Zipfeln geknotetes Taschentuch oder der besondere Tauschwert verschieden gezackter Granat- und Bombensplitter erhalten hat, dem fallen – und sei es als unterhaltsame Ausrede – Geschichten ein, in denen es tatsächlicher als im Leben zugeht.
Die Bilder, die ich als Kind und dann als Jugendlicher zu sammeln nicht faul war, gab es gegen Gutscheine, die in Päckchen steckten, aus denen meine Mutter nach Geschäftsschluß ihre Zigaretten klopfte. »Stäbchen« nannte sie die Teilhaber ihres mäßigen Lasters, das sie allabendlich bei einem Glas Cointreau zelebrierte. Bei Laune gelang es ihr, Rauchringe schweben zu lassen.
Die mir begehrenswerten Bilder gaben farbig die Meisterwerke der europäischen Malerei wieder. So lernte ich früh die Namen der Künstler Giorgione, Mantegna, Botticelli, Ghirlandaio und Caravaggio falsch auszusprechen. Das nackte Rückenfleisch einer liegenden Frau, der ein geflügelter Knabe den Spiegel hält, war mir seit Kinderjahren mit dem Namen des Malers Velázquez verkuppelt. Unter Jan van Eycks »Singenden Engeln« prägte sich vor allen anderen das Profil des hintersten Engels ein; gern hätte ich Haare gelockt wie er oder Albrecht Dürer gehabt. Dessen Selbstbildnis, das in Madrid im Prado hängt, konnte befragt werden: Warum hat sich der Meister mit Handschuhen gemalt? Wieso sind seine seltsame Mütze und der rechte untere Pluderärmel so auffallend gestreift? Was macht ihn so selbstsicher? Und warum steht sein Alter – erst sechsundzwanzig zählt er – unterm gemalten Fensterbord geschrieben?
Heute weiß ich, daß ein Zigaretten-Bilderdienst in Hamburg-Bahrenfeld diese allerschönsten Reproduktionen gegen Gutscheine geliefert hat und – auf Bestellung – quadratische Alben. Seit mir alle drei dank meines Lübecker Galeristen, der in der Königstraße ein Antiquariat unterhält, wieder zur Hand sind, ist sicher, daß die im Jahr achtunddreißig erschienene Auflage des Renaissance-Bandes bis zum vierhundertfünfzigtausendsten Exemplar gedruckt worden ist.
Während ich Blatt nach Blatt wende, sehe ich mich beim Einkleben der Bilder am Wohnzimmertisch. Diesmal sind es spätgotische, unter ihnen die Versuchung des heiligen Antonius von Hieronymus Bosch: er zwischen vermenschtem Getier. Fast feierlich geht es dabei zu, sobald aus der gelben Uhu-Tube der Klebstoff quillt…
Damals mögen viele Sammler, weil heillos auf Kunst versessen, übermäßig geraucht haben. Ich jedoch wurde zum Nutznießer all jener Raucher, denen die Gutscheine nichts wert waren. Immer mehr Bilder machten gesammelt, getauscht und eingeklebt meinen Besitz aus, mit dem ich kindlich, später einfühlsam umging: so erlaubte Parmigianinos hoch aufgeschossene Madonna, deren auf langem Hals knospender Kopf die im Hintergrund himmelwärts strebende Säule überragt, dem Zwölfjährigen, sich als Engel innigst an ihrem rechten Knie zu reiben.
Ich lebte in Bildern. Und weil der Sohn so beharrlich auf Vollständigkeit aus war, hat die Mutter nicht nur den Ertrag ihres eher bemessenen Konsums – sie rauchte andächtig Orient-Zigaretten mit Goldmundstück –, sondern auch Gutscheine beigesteuert, die der eine oder andere Kunde, der ihr geneigt und dem die Kunst schnuppe war, über die Ladentheke geschoben hat. Manchmal brachte der Vater, wenn er als Kolonialwarenhändler, wie es hieß, geschäftlich unterwegs war, dem Sohn die begehrten Gutscheine mit. Auch rauchten die Gesellen meines Großvaters, des Tischlermeisters, fleißig zu meinen Gunsten. Die Alben voll leerer Felder zwischen gelehrt erklärenden Texten mögen Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke gewesen sein.
Schließlich waren es alle drei, die ich wie einen Schatz hütete: Das blaue Album, in dem die Malerei der Gotik und Frührenaissance klebte; das rote, das mir die Malerei der Renaissance vor Augen führte; das goldgelbe, in dem die Bilder des Barock nicht vollzählig versammelt waren. Zu meinem Kummer klebte nichts, wo Rubens und van Dyck Platz forderten. Es fehlte an Nachschub. Nach Kriegsbeginn verebbte der Gutscheinsegen. Aus zivilen Rauchern wurden Soldaten, die weit weg von zu Hause ihre Juno oder R6 pafften. Einer meiner zuverlässigsten Lieferanten, ein Kutscher der Aktien-Bierbrauerei, fiel beim Kampf um die Festung Modlin.
Auch kamen andere Serien in Umlauf: Tiere, Blumen, Glanzbilder deutscher Geschichte und die geschminkten Gesichter beliebter Filmschauspieler.
Zudem wurden seit Beginn des Krieges jedem Haushalt Lebensmittelkarten zugeteilt, und auf besonderen Abschnitten war der Genuß von Tabakwaren rationiert. Da ich mir aber meine kunsthistorische Bildung mit Hilfe der Zigarettenfirma Reemtsma bereits in Vorkriegszeiten angesammelt hatte, betraf mich der verordnete Mangel nicht allzu sehr. Etliche Lücken waren nachträglich zu schließen. So gelang es mir, Raffaels Dresdner Madonna, die ich doppelt besaß, gegen Caravaggios Amor zu tauschen; ein Handel, der sich erst nachwirkend auszahlte.
Schon als zehnjähriger Knabe konnte ich auf ersten Blick Hans Baldung, den man Grien nannte, von Matthias Grünewald, Frans Hals von Rembrandt und Filippo Lippi von Cimabue unterscheiden.
Wer malte die Madonna im Rosenhag? Und wer jene mit blauem Tuch, Apfel und Kind?
Auf Wunsch abgefragt von der Mutter, die die Bildtitel und Namen der Künstler mit zwei Fingern verdeckte, kamen des Sohnes Antworten treffsicher.
Bei diesem häuslichen Ratespiel, aber auch in der Schule war ich in Kunst eine Eins, hing aber von der Sexta an hoffnungslos durch, sobald Mathematik, Chemie, Physik auf dem Stundenplan standen. Fix im Kopfrechnen, gingen auf dem Papier meine Gleichungen mit zwei Unbekannten nur selten auf. Bis in die Quinta stützten mich Einser- und Zweiernoten in den Fächern Deutsch, Englisch, Geschichte und Erdkunde. Zwar konnten wiederholt belobigtes Zeichnen und Tuschen aus bloßer Einbildung oder nach der Natur dem Schüler behilflich werden, als aber ab der Quarta in den Zeugnissen Latein benotet wurde, blieb ich kleben und mußte ein Jahr lang mit anderen Sitzenbleibern alles noch einmal durchkauen. Das bekümmerte die Eltern, weniger mich, standen mir doch von früh an ins Blaue führende Fluchtwege offen.
Heute sind die Enkelkinder mit dem Eingeständnis des Großvaters, er sei ein teils fauler, teils ehrgeiziger, doch unterm Strich schlechter Schüler gewesen, nur halbwegs zu trösten, wenn sie unter miesen Zeugnissen oder hilflos hampelnden Lehrern leiden. Sie stöhnen, als müßten sie pädagogisch gewichtete Wackersteine schleppen, als verliefe ihre Schulzeit in einer Strafkolonie, als schikaniere Lernzwang ihren süßesten Schlummer; doch meinen Schlaf haben Pausenhofängste nie als Albträume beschweren können.
Als ich ein Kind war, noch keine rote Gymnasiastenmütze trug und noch keine Zigarettenbildchen sammelte, kleckerte ich, sobald wieder einmal der Sommer versprach, endlos zu sein, an einem der Strände entlang der Danziger Bucht aus nassem Seesand verschieden hohe Türme und Mauern zu einer Burg, bewohnt von Figuren, die phantastischer Natur waren. Immer wieder untergrub die See den gekleckerten Bau. Was hoch getürmt stand, stürzte lautlos in sich zusammen. Und aufs neue lief mir nasser Sand durch die Finger.
»Kleckerburg« heißt ein langes Gedicht, das ich Mitte der sechziger Jahre, also zu einer Zeit schrieb, in der der vierzigjährige Vater dreier Söhne und einer Tochter bereits bürgerlich gefestigt zu sein schien; wie der Held seines ersten Romans hatte sich dessen Autor einen Namen gemacht, indem er sein gedoppeltes Ich in Bücher sperrte und derart gebändigt zu Markte trug.
Das Gedicht handelt von meinem Herkommen und vom Geräusch der Ostsee: »In Kleckerburg gebürtig, westlich von«, und stellt Fragen: »Geboren wann und wo, warum?« Eine den Verlust und das Gedächtnis als Fundbüro beschwörende Suada in Halbsätzen: »Die Möwen sind nicht Möwen, sondern«.
Am Ende des Gedichtes, das mit dem Heiligen Geist und Hitlers Bild mein Umfeld absteckt und mit Bombensplittern und Mündungsfeuer den Kriegsbeginn in Erinnerung ruft, versanden die Jahre der Kindheit. Nur die Ostsee sagt weiterhin auf Deutsch, auf Polnisch: »Blubb, pifff, pschsch…«
Der Krieg zählte wenige Tage, als ein Cousin meiner Mutter, Onkel Franz, der als Briefträger zu den Verteidigern der Polnischen Post am Heveliusplatz gehörte, bald nach Ende des kurzen Kampfes wie fast alle Überlebenden auf deutschen Befehl standrechtlich erschossen wurde. Der Feldrichter, der die Todesurteile begründete, aussprach und unterschrieb, durfte noch lange nach Kriegsende unbeschadet in Schleswig-Holstein als Richter urteilen und Urteile unterschreiben. Das war so üblich zu Kanzler Adenauers nicht enden wollender Zeit.
Später habe ich den Kampf um die Polnische Post mit verwandeltem Personal einer erzählenden Schreibweise angepaßt und dabei ein Kartenhaus wortreich einstürzen lassen; meiner Familie jedoch fehlten die Worte, denn vom plötzlich abwesenden Onkel, der jenseits oder trotz aller Politik beliebt war und oft mit seinen Kindern Irmgard, Gregor, Magda und dem kleinen Kasimir auf Sonntagsbesuch zu Kaffee und Kuchen oder zum Nachmittagsskat mit den Eltern kam, war nicht mehr die Rede. Sein Name blieb ausgespart, als hätte es ihn nie gegeben, als sei alles, was ihn und seine Familie betraf, unaussprechlich.
Der von Mutters Seite her kaschubische Teil der Verwandtschaft und deren stubenwarmes Gebrabbel schien – von wem? – verschluckt zu sein.
Und auch ich habe, wenngleich mit Beginn des Krieges meine Kindheit beendet war, keine sich wiederholenden Fragen gestellt.
Oder wagte ich nicht zu fragen, weil kein Kind mehr?
Stellen, wie im Märchen, nur Kinder die richtigen Fragen?
Kann es sein, daß mich Angst vor einer alles auf den Kopf stellenden Antwort stumm gemacht hat?
Das ist die winzigtuende Schande, zu finden auf der sechsten oder siebten Haut jener ordinären, stets griffbereit liegenden Zwiebel, die der Erinnerung auf die Sprünge hilft. Also schreibe ich über die Schande und die ihr nachhinkende Scham. Selten genutzte Wörter, gesetzt im Nachholverfahren, derweil mein mal nachsichtiger, dann wieder strenger Blick auf einen Jungen gerichtet bleibt, der kniefreie Hosen trägt, allem, was sich verborgen hält, hinterdreinschnüffelt und dennoch versäumt hat, »warum« zu sagen.
Und während der Zwölfjährige noch peinlich befragt und dabei gewiß von mir überfordert wird, wäge ich in immer schneller schwindender Gegenwart jeden Treppenschritt, atme hörbar, höre mich husten und lebe so heiter es geht auf den Tod hin.
Der erschossene Onkel, Franz Krause, hinterließ Frau und vier Kinder, die etwas älter, gleichen Alters, zwei oder drei Jahre jünger als ich waren. Mit ihnen durfte nicht mehr gespielt werden. Sie mußten die altstädtische Dienstwohnung auf dem Brabank räumen und aufs Land ziehen, wo die Mutter zwischen Zuckau und Ramkau eine Instkate und einen Acker besaß. Dort, in der gehügelten Kaschubei, hausen des Briefträgers Kinder noch heute, geplagt von üblichen Altersgebrechen. Sie erinnern sich ganz anders. Ihnen fehlte der Vater, während mir meiner in enger Wohnung zu nahgerückt stand.
Der Angestellte der Polnischen Post war ein ängstlich besorgter Familienmensch, nicht geschaffen, als Held zu sterben, dessen Name späterhin als Franciszek Krauze auf einer Gedenktafel aus Bronze zu lesen steht und so verewigt sein soll.
Als mir im März achtundfünfzig nach einiger Mühe ein Visum für Polen ausgestellt wurde und ich von Paris über Warschau anreiste, um in der aus Trümmern wachsenden Stadt Gdańsk nach Spuren der vormaligen Stadt Danzig zu suchen, fuhr ich, nachdem hinter restlichen Ruinenfassaden und entlang dem Brösener Strand, später am Lesetisch der Stadtbibliothek wie im Umfeld der heilgebliebenen Pestalozzi-Schule und zuletzt in den Wohnküchen zweier überlebender Postangestellter genügend viel Erzählstoff zu finden und zu hören gewesen war, aufs Land zu den übriggebliebenen Verwandten. Dort wurde ich in der Tür einer Bauernkate von der Mutter des erschossenen Briefträgers, meiner Großtante Anna, mit dem unumstößlichen Satz begrüßt: »Na, Ginterchen, bist aber groß jeworden.«
Vorher hatte ich ihr Mißtrauen besänftigen müssen und auf Verlangen meinen Paß vorgezeigt, so ausländisch fremd standen wir uns gegenüber. Doch dann führte sie mich auf ihren Kartoffelacker, den heute die betonierten Start- und Landepisten des Flughafens von Gdańsk verdecken.
Im Sommer des nächsten Jahres, als sich der Krieg schon zum Weltkrieg ausgewachsen hatte, weshalb wir Oberschüler während der Ferien am Ostseestrand nicht nur lokale Kleinstereignisse wiederkäuten, sondern auch großräumig über Grenzen hinweg schwadronierten, ging es zwischen uns immer und nur um die Besetzung Norwegens durch unsere Wehrmacht, obgleich bis in den Juni hinein lauthals Sondermeldungen den Verlauf des nachfolgenden Frankreichfeldzuges als Blitzkrieg bis zur Kapitulation des Erbfeindes gefeiert hatten: Rotterdam, Antwerpen, Dünkirchen, Paris, die Atlantikküste… So verlief unser durch Landnahme erweiterter Geografieunterricht: Schlag auf Schlag, Sieg nach Sieg.
Doch uns waren vor oder nach dem Baden weiterhin nur die »Helden von Narvik« bewundernswert. Wir lagen im Sand, sonnten uns im Familienbad, wären aber sehnlichst gerne in dem umkämpften Fjord »hoch oben im Norden« dabeigewesen. Dort hätten wir uns mit Ruhm bekleckern mögen, so feriensatt wir nach Niveacreme rochen.
Im Verlauf der immerwährenden Heldenanbetung ging es um unsere Kriegsmarine und um die Schlappe der Engländer, dann wieder um uns, von denen einige, so auch ich, hofften, in drei vier Jahren, wenn nur der Krieg lange genug dauere, zur Marine zu kommen, nach Wunsch als U-Bootmatrosen. In Badehosen wetteiferten wir beim Aufzählen militärischer Großtaten, begannen mit Weddigens U9-Erfolgen im Ersten Weltkrieg, kamen auf Kapitänleutnant Prien, der die Royal Oak versenkt hatte, und schmückten uns bald wieder mit dem bei Narvik »heiß erkämpften« Sieg.
Da sagte einer der Jungs, der Wolfgang Heinrichs hieß, gern und anerkannt gut Balladen und auf Verlangen sogar Opernarien sang, dessen linke Hand aber verkrüppelt war, so daß er als »marineuntauglich« unseres Mitleids sicher sein konnte, unüberhörbar plötzlich: »Ihr spinnt ja alle!«
Dann zählte mein Schulfreund – denn das war er – mit Hilfe der Finger seiner heilen Hand jeden unserer Zerstörer auf, die im Kampf um Narvik versenkt oder schwer beschädigt worden waren. Er ging nahezu fachmännisch ins Detail, sagte, eines der Tausendachthunderttonnenschiffe – er nannte dessen Namen – hätte auf Grund gesetzt werden müssen. Die Finger der einen Hand reichten nicht aus.
Jede Einzelheit, selbst die Bewaffnung und Geschwindigkeit des englischen Schlachtschiffes Warspite in Knoten, war ihm geläufig; wie ja auch wir als Kinder einer Hafenstadt alle Merkmale unserer sowie der feindlichen Kriegsschiffe herunterbeten konnten: die Tonnage, Kopfzahl der Besatzung, die Anzahl und das Kaliber der Schiffsgeschütze, die Zahl der Torpedorohre, das Jahr des Stapellaufs. Dennoch wunderten wir uns über seine Kenntnisse des Kampfgeschehens um Narvik, die weit über das hinausgingen, was uns von den tagtäglichen, im Radio verkündeten Wehrmachtsberichten hängengeblieben war.
»Ihr habt ja keinen Schimmer von dem, was wirklich da oben im Norden los war. Schwere Verluste! Verdammt schwere Verluste!«
Das wurde, bei aller Verblüffung, hingenommen, denn Fragen, woher er, Wolfgang Heinrichs, sein fabelhaftes Wissen habe, stellten wir nicht, stellte ich nicht.
Fünfzig Jahre später, als das, was sich gegenwärtig und notdürftig als »Deutsche Einheit« zu behaupten hat, Spuren zu hinterlassen begann, besuchten wir Hiddensee, meiner Ute autofreie Heimatinsel. Der Küste des angeschlossenen Ostens vorgelagert, liegt sie lieblich hingestreckt zwischen See und Bodden und ist weniger durch Sturmfluten, doch zunehmend vom flächendeckenden Tourismus gefährdet.
Nach längerer Wanderung über Heidewege suchten wir in Neuendorf Martin Gruhn, einen Jugendfreund meiner Frau, auf, der sich nach seiner mit dem Ruderboot in Richtung Schweden gewagten Flucht aus der Deutschen Demokratischen Republik und der nach Jahren beschlossenen Rückkehr in den Arbeiter- und Bauernstaat dort zur Ruhe gesetzt hatte. Man sah ihm seine Abenteuer nicht an, so häuslich wirkte er, so seßhaft.
Bei Kaffee und Kuchen plauderten wir über dieses und jenes: seine Karriere als Manager im Westen, die vielen Reisen für Krupp nach Indien, Australien, sonstwohin. Er erzählte vom gescheiterten Versuch, über Joint Ventures ins ostwestliche Geschäft zu kommen, und von seinem letztlich gebliebenen Vergnügen bei der Reusenfischerei in den heimischen Gewässern.
Dann kam der offenkundig zufriedene Rückkehrer plötzlich auf einen Bekannten zu sprechen: der wohne in Vitte – einem der drei Dörfer der Insel – und behaupte »steif und fest«, mit mir in Danzig die Schulbank gedrückt zu haben. Heinrichs heiße der, ja, Wolfgang mit Vornamen.
Als ich weitere Fragen stellte, wurde mir die verkrüppelte Hand, auch daß er gut singen könne – »Immer noch, aber selten inzwischen« – bestätigt.
Danach ging es zwischen Ute und ihm nur noch um einheimische Inselgeschichten, in denen sich Lebende und Tote auf Plattdeutsch verplauderten. Martin Gruhn, der, wie als Junge gewünscht, die Welt gesehen hatte, wies mit kleinem Stolz auf Masken, bunte Teppiche, geschnitzte Fetische an den Wänden. Wir tranken einen letzten Schnaps.
Nach dem Rückweg durch die Heide suchten Ute und ich in Vitte das Haus hinter der Düne, in dem Heinrichs mit seiner Frau wohnte. Es öffnete ein hochgewachsen massiger, schwer atmender Mann, kenntlich für mich nur durch die verkrüppelte Hand. Nach kurzem Zögern umarmten sich die Schulfreunde und waren ein wenig gerührt.
Dann saßen wir in der Veranda, gaben uns willentlich munter und aßen später zu viert Fisch in einem der Gasthöfe: kroß gebratene Flundern. Singen wie früher, etwa den Erlkönig, wollte er nicht. Doch dauerte es nicht lange, bis wir auf das über Jahrzehnte hinweg fragwürdig gebliebene Strandgerede des Sommers vierzig kamen.
Verspätet wollte ich hören: »Woher wußtest du mehr als wir, die, wie du gesagt hast, keinen blassen Schimmer hatten? Wie bist du auf die genaue Zahl der bei Narvik versenkten und schwer beschädigten Zerstörer gekommen? Und auf all das andere, was du sonst noch gewußt hast? Zum Beispiel, daß eine veraltete Küstenbatterie der Norweger den Schweren Kreuzer Blücher nach ein paar Volltreffern und – gleichfalls von Land aus – mit zwei Torpedos im Oslo-Fjord versenkt hatte?«
In Heinrichs’ verhängtem Gesicht hielt sich, während er sprach, die Andeutung eines Lächelns. Prügel habe er von seinem Vater bezogen, als er zu Hause unsere ahnungslose Blödheit verspottet habe. Naja, seine Angeberei hätte Folgen haben können. Denunzianten habe es ja genug gegeben, auch unter Schülern. Der Vater sei als allabendlicher Hörer des britischen Feindsenders zu Kenntnissen gekommen, die er dem Sohn, bei gestrengem Gebot zur Verschwiegenheit, anvertraut habe.
»Stimmt!« sagte er, sein Vater sei ein richtiger, kein nachträglich selbsternannter Antifaschist gewesen. Er sagte das, als müßte der Sohn sich als nachträglich Selbsternannter abwerten.
Und dann hörte ich eine Leidensgeschichte, die an mir, dem Schulfreund, wie mit abgewürgtem Klageton vorbeigegangen war, weil ich nicht gefragt, wieder einmal keine Fragen gestellt hatte, auch nicht, als Wolfgang Heinrichs verschwand, plötzlich von der Schule, dem altehrwürdigen Conradinum, weg war.
Bald nach den Sommerferien oder während uns noch restlicher Seesand aus den Haaren rieselte, fehlte der Freund oder fehlte nicht, weil niemand willens war, den beiseitegesprochenen Befund »spurlos verschwunden« zu widerlegen, und weil ich abermals das Wort »warum« verschluckt, nicht ausgesprochen hatte.
Jetzt erst hörte ich: Heinrichs’ Vater, der während der Freistaatzeit Mitglied der USPD, dann sozialdemokratischer Abgeordneter gewesen war und im Senat der Stadt gegen die damaligen Parteigrößen Rauschning und Greiser, die Kumpanei und das spätere Regierungsbündnis zwischen Deutschnationalen und Nazis opponiert hatte, stand unter Beobachtung und wurde im Frühherbst vierzig von der Gestapo verhaftet. Er kam in ein Konzentrationslager, das bald nach dem Anschluß Danzigs an das Großdeutsche Reich nahe dem Frischen Haff errichtet und nach einem benachbarten Fischerdorf benannt wurde: vom Werderbahnhof der Stadt war Stutthof mit der Kleinbahn und ab Schiewenhorst mit der Fähre über die Weichsel in zwei drei Stunden zu erreichen.
Bald nach der Verhaftung des Vaters entschloß sich die Mutter zum Selbstmord. Worauf Wolfgang und seine Schwester zur Großmutter aufs Land geschickt wurden, weit genug entfernt, um von ihren Mitschülern vergessen zu werden. Der Vater jedoch kam nach der KZ-Haft in ein Strafbataillon, das während des Rußlandfeldzuges im Frontbereich Minen zu räumen hatte. »Himmelfahrtskommando« hieß dieser Einsatz mit hoher Verlustquote, der ihm jedoch Gelegenheit bot, zu den Russen überzulaufen.
Als im März fünfundvierzig die Zweite sowjetische Armee den ausgebrannten Trümmerhaufen Danzig besetzte, kam mit den Siegern der Vater meines Schulfreundes zurück. Er suchte und fand seine Kinder, worauf er mit ihnen bald nach Kriegsende in einem gesicherten, weil mit deutschen Antifaschisten belegten Transport Polen verließ und die Hafenstadt Stralsund in der sowjetisch besetzten Zone als zukünftigen Sitz der restlichen Familie wählte.
Man setzte ihn als Landtagsdirektor ein. Und da seine politische Überzeugung trotz doktrinärer Lagerschulung keinen Schaden genommen hatte, gründete er sogleich einen sozialdemokratischen Ortsverein, der Zulauf fand, geriet aber nach der Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei in Schwierigkeiten. Er wehrte sich gegen die von oben verordnete Gleichschaltung. Man schikanierte ihn, drohte mit Haft, wobei der Name des abermals mit Häftlingen belegten Konzentrationslagers Buchenwald angedeutet wurde.
Wenige Jahre später starb Vater Heinrichs verbittert, weil von seinen Genossen ins Abseits gedrängt. Der Sohn jedoch studierte nach Beendigung seiner Schulzeit in Rostock gemeinsam mit seinem Schulfreund Martin Gruhn und zeichnete sich bald als Wissenschaftler im ökonomischen Bereich aus. Während Gruhn nach der Flucht mit dem Ruderboot zuerst in Lund und später bei Karl Schiller in Hamburg sein Ökonomiestudium fortsetzte, machte Heinrichs im Dienst der alleinherrschenden Partei Karriere und überstand dabei jeden Kurswechsel, selbst den von Ulbricht zu Honecker. Alternd kam er sogar zu Ehren und befand sich als Direktor des Instituts für Wirtschaftswissenschaft bei der Akademie der Wissenschaften in so ranghoher Position, daß – kaum fiel die Mauer und gab es die Diktatur des Arbeiter- und Bauernstaates nicht mehr – die westdeutschen Sieger der Geschichte meinten, ihn sofort, wie es hieß, »evaluieren«, das bedeutete, zu einem Nichts machen zu müssen.
So erging es vielen, denen man eine falsche Biografie nachsagte; die mit der richtigen wußten schon immer, was falsch zu sein hatte.
Als wir den Freund in Vitte besuchten, war er bereits schwer krank. Seine Frau deutete an, daß es Grund gebe, sich Sorgen zu machen, ihr Mann klage über Enge in der Brust und Atemnot. Dennoch versuche er sich gelegentlich in Stralsund als Steuerberater und lerne dabei, Lücken im System zu finden.
Wolfgang Heinrichs, ein an den deutschen Verhältnissen Gescheiterter, der wenige Monate nach unserem Besuch an einer Lungenembolie starb, ist mir als Schulfreund im Umfeld meiner jungen Jahre – er sang während einer Abiturfeier »Die Uhr« von Carl Loewe und wußte in Sachen Kriegsmarine mehr als seine Mitschüler – verhaftet geblieben, weil ich mich begnügt hatte, nichts oder nur Falsches zu wissen, weil ich mich kindlich dummgestellt, sein Verschwinden stumm hingenommen und so abermals das Wort »warum« vermieden hatte, so daß mir mein Schweigen nun, beim Häuten der Zwiebel, in den Ohren dröhnt.
Zugegeben: ein Schmerz von nur minderer Pein. Doch Klagen wie, ach hätte ich doch einen standhaften Vater wie Wolfgang Heinrichs gehabt und nicht einen, der bereits sechsunddreißig, als im Freistaat Danzig der Zwang noch mäßig war, in die Partei eintrat, sind billig und haben als Echo allenfalls jenes Gelächter zur Folge, das der Spötter in mir freigibt, sobald vergleichbare Ausreden laut werden: Hätten wir damals… Wären wir damals…
Aber ich habe nicht, bin nicht. Der Onkel war weg, der Schulfreund blieb weg. Doch überdeutlich ist jener Junge, dem ich auf der Spur zu bleiben habe, dort aufzufinden, wo Ungeheuerliches geschah: knapp ein Jahr vor Kriegsbeginn. Gewalt, hell ausgeleuchtet bei Tageslicht.
Als bald nach meinem elften Geburtstag in Danzig und anderswo die Synagogen brannten und Schaufenster in Scherben fielen, war ich zwar untätig, doch als neugieriger Zuschauer dabei, als am Michaelisweg, nicht weit von meiner Schule, dem Conradinum, entfernt, die kleine Langfuhrer Synagoge von einer Horde SA-Männer geplündert, verwüstet, angekokelt wurde. Doch der Zeuge des übermäßig lautstarken Handlungsablaufs, dem die städtische Polizei, vielleicht weil das Feuer keinen Zunder fand, nur zusah, mag allenfalls erstaunt gewesen sein.
Mehr nicht. So beflissen ich im Laub meiner Erinnerungen stochere, nichts findet sich, das mir günstig wäre. Offenbar haben keine Zweifel meine Kinderjahre getrübt. Vielmehr machte ich, leicht zu gewinnen, bei allem mit, was der Alltag, der sich aufgeregt aufregend als »Neue Zeit« ausgab, zu bieten hatte.
Das war viel und verlockend: Im Radio und im Kino siegte Max Schmeling. Vor dem Kaufhaus Sternfeld wurde in Büchsen Kleingeld fürs Winterhilfswerk gesammelt – »Keiner soll hungern, keiner soll frieren!« Deutsche Rennfahrer – Bernd Rosemeyer – waren in ihren Silberpfeilen die schnellsten. Die Luftschiffe Graf Zeppelin und Hindenburg konnten bestaunt werden, wie sie hochglänzend über der Stadt zum Postkartenmotiv wurden. In der Wochenschau half unsere »Legion Condor« mit allerneuesten Waffen, Spanien von der Roten Gefahr zu befreien. Auf dem Pausenhof spielten wir »Alcázar«. Und wenige Monate zuvor begeisterten uns die Olympischen Spiele mit ihrem Medaillensegen. Später hieß unser Wunderläufer Rudolf Harbig. Und in der Wochenschau strahlte das Deutsche Reich im gebündelten Scheinwerferlicht.
Noch während der letzten Jahre der Freistaatzeit – ich zählte zehn – wurde der Junge meines Namens durchaus freiwillig Mitglied des Jungvolks, einer Aufbauorganisation der Hitlerjugend. »Pimpfe« nannte man uns oder auch »Wölflinge«. Auf den Weihnachtstisch wünschte ich mir die Uniform samt Käppi, Halstuch, Koppel und Schulterriemen.
Zwar kann ich mich nicht erinnern, besonders begeistert gewesen zu sein, mich als Wimpelträger auf Tribünen gedrängt, jemals den Rang eines schnürengeschmückten Jungzugführers angestrebt zu haben, aber mitgemacht habe ich fraglos selbst dann, wenn mich die ewige Singerei und das dumpfe Getrommel anödeten.
Nicht nur die Uniform lockte. Der wunschgemäßen Devise »Jugend muß von Jugend geführt werden!« entsprach das Angebot: Zeltlager und Geländespiele in Strandwäldern, Lagerfeuer zwischen zur Thingstätte gewuchteten Findlingen im Hügelland südlich der Stadt, Sonnenwend- und Morgenfeiern unterm Sternenhimmel und auf Waldlichtungen, die sich gen Osten öffneten. Wir sangen, als hätte Gesang das Reich größer und größer machen können.
Mein Fähnleinführer, ein Arbeiterjunge aus der Siedlung Neuschottland, war keine zwei Jahre älter als ich: ein Pfundskerl, der Witz hatte und auf den Händen laufen konnte. Ich bewunderte ihn, lachte, wenn er lachte, lief ihm hinterdrein, folgsam.
All das lockte mich aus dem kleinbürgerlichen Mief familiärer Zwänge, weg vom Vater, dem Kundengeschwätz vor der Ladentheke, der Enge der Zweizimmerwohnung, in der mir nur die flache Nische unterm Bord des rechten Wohnzimmerfensters zustand und genug sein mußte.
Auf ihren Zwischenbrettern stapelten sich Bücher und meine Klebealben für Zigarettenbilder. Dort hatten Plastilin-Knetmasse für erste Figuren, der Pelikan-Zeichenblock, der Malkasten mit zwölf Deckfarben, die eher nebensächlich gesammelten Briefmarken, ein Haufen Krimskrams und meine geheimen Schreibhefte ihren Platz.
Nur wenig Gegenständliches sehe ich im Rückblick so deutlich wie die Nische unterm Fensterbord, die für Jahre meine Zuflucht sein sollte; der Schwester Waltraut, drei Jahre jünger als ich, stand die linke Nische zu.
Denn so viel kann einschränkend gesagt werden: Ich war nicht nur Pimpf des Jungvolks in Uniform, der sich bemühte, im Gleichschritt zu marschieren und dabei »Unsere Fahne flattert uns voran« zu singen, sondern auch ein Stubenhocker, der mit den Schätzen seiner Nische haushielt. Selbst in Reih und Glied blieb ich Einzelgänger, der aber nicht sonderlich auffiel; ein Mitläufer, dessen Gedanken immer woanders streunten.
Zudem hatte mich der Wechsel von der Volksschule zur Oberschule zum Conradiner gemacht. Ich durfte, wie es hieß, aufs Gymnasium gehen, trug die traditionell rote Gymnasiastenmütze, geschmückt mit dem goldenen C, und meinte Grund zu haben, hochnäsig stolz zu sein, weil Schüler einer namhaften Lehranstalt, der die Eltern mühsam abgespartes Schulgeld in Raten zahlen mußten, weißnichtwieviel; eine monatliche Belastung, die dem Sohn nur angedeutet wurde.
Der Kolonialwarenladen, der sich dem schlauchengen Flur zur Wohnungstür hin seitlich anschloß und den allein meine Mutter unter dem Namen Helene Graß geschäftstüchtig führte – der Vater Wilhelm, Willy gerufen, dekorierte das Schaufenster, kümmerte sich um Einkäufe bei Grossisten und beschriftete Preisschilder –, ging mäßig bis schlecht. Zur Guldenzeit verunsicherten Zollbeschränkungen den Handel. An jeder Straßenecke Konkurrenz. Um den zusätzlichen Verkauf von Milch, Sahne, Butter und Frischkäse genehmigt zu bekommen, mußte die Hälfte der Küche zur Straßenseite hin geopfert werden, so daß nur eine fensterlose Kammer für den Gasherd und den Eisschrank übrigblieb. Immer mehr Kunden zog die Ladenkette »Kaisers Kaffee-Geschäft« ab. Nur wenn alle Rechnungen pünktlich bezahlt waren, lieferten die Handelsvertreter. Zuviel Pumpkundschaft. Besonders die Frauen der Zoll-, Post-, Polizeibeamten liebten es, ihre Einkäufe anschreiben zu lassen. Sie jammerten, knapsten, verlangten Rabatt. Die Eltern bestätigten sich jeweils am Sonnabend nach Ladenschluß: »Wir sind schon wieder mal knapp bei Kasse.«
Deshalb hätte einsehbar sein müssen, daß mir die Mutter kein wöchentliches Taschengeld abzweigen konnte. Als aber mein Klagen kein Ende nahm – in meiner Klasse klimperten alle Mitschüler mit mehr oder weniger reichlich Kleingeld –, schob sie mir ein vom Gebrauch abgegriffenes Oktavheft zu, in dem die Schulden aller Kunden gereiht standen, die, wie sie sagte, »auf Pump« lebten. Ich sehe das Heft vor mir, schlage es auf.
In säuberlicher Schrift stehen Namen, Adressen sowie kürzlich geminderte, immer wieder gesteigerte Summen von Guldenbeträgen, auf den Pfennig genau. Die Bilanz einer Geschäftsfrau, die Grund hat, sich Sorgen um ihren Laden zu machen; wohl auch der Spiegel der allgemeinen Wirtschaftslage bei zunehmender Arbeitslosigkeit.
»Am Montag kommen die Firmenvertreter und wollen Bares sehen«, hieß ihre stehende Rede. Nie aber hat die Mutter das monatlich fällige Schulgeld dem Sohn und später der Tochter als etwas vorgehalten, dem sich die Kinder pflichtschuldig hätten fügen müssen. Nie hieß es: Ich opfer mich für euch auf. Tut was dafür!
Sie, die für behutsame und allerlei Spätfolgen bedenkende Pädagogik zu wenig Zeit hatte – kam es zum Gezänk zwischen der Schwester und mir, das sich allzu kreischig zutrug, rief sie den Kunden zu, »Momentchen mal«, eilte aus dem Laden herbei, fragte nie »wer hat mit wem Streit angefangen«, sondern ohrfeigte wortlos beide Kinder, um alsbald wieder freundlich die Kundschaft zu bedienen –, sie, die liebevoll zärtliche, warmherzige, leicht zu Tränen gerührte, sie, die sich gerne, wenn sie nur Zeit fand, in Träumereien verlor und alles, was sie als schön ansah, »echt romantisch« nannte, sie, die besorgteste aller Mütter, schob ihrem Sohn eines Tages das Oktavheft zu und bot an, mir fünf Prozent der eingetriebenen Schulden in Gulden und Pfennigen auszuzahlen, wenn ich bereit sei, bewaffnet nur mit fixem Mundwerk – das hatte ich! – und der Kladde voller gereihter Zahlen jeweils am Nachmittag oder wann immer ich jenseits meines, aus ihrer Sicht, albernen Jungvolkdienstes Zeit fände, die säumigen Kunden aufzusuchen, auf daß sie sich dringlich gefordert sähen, ihre Schulden, wenn nicht zu begleichen, dann doch in Raten abzustottern.
Dann riet sie mir noch, den Abend eines bestimmten Wochentages besonders eifrig zu nutzen: »Freitags wird gelöhnt, da mußte hin und abkassieren.«
So wurde ich mit zehn oder elf, als Sextaner oder Quintaner, zum gewieften und unterm Strich erfolgreichen Schuldeneintreiber. Mit einem Apfel oder billigen Bonbons war ich nicht abzuspeisen. Worte fielen mir ein, das Herz der Schuldner zu erweichen. Selbst fromme, mit Öl gesalbte Ausreden verfehlten mein Ohr. Drohungen hielt ich stand. Wer die Wohnungstür zuschlagen wollte, dem stand mein Fuß dazwischen. Am Freitag trat ich mit Hinweis auf ausgezahlten Wochenlohn besonders fordernd auf. Sogar der Sonntag war mir nicht heilig. Und während der kleinen und großen Ferien war ich ganztags tätig.
Bald rechnete ich Summen ab, die die Mutter dazu bewogen, aus nunmehr pädagogischen Gründen des Sohnes übermäßigen Zugewinn von fünf auf drei Prozent zu schmälern. Das nahm ich maulend hin. Sie aber sagte: »Damit du mir ja nicht übermütig wirst.«
Am Ende war ich dennoch besser bei Kasse als viele meiner Mitschüler, die im Uphagen- oder Steffensweg in Doppeldachvillen mit Säulenportal, Balkonterrasse und Dienstboteneingang wohnten und deren Väter Rechtsanwälte, Ärzte, Getreidehändler, sogar Fabrikanten und Schiffseigner waren. Mein Reingewinn häufte sich in einer leeren Tabakdose, verborgen in der Fensternische. Ich kaufte mir Zeichenblöcke auf Vorrat und Bücher, mehrere Bände »Brehms Tierleben«. Dem süchtigen Kinogänger war fortan der Besuch selbst der entlegensten Filmpaläste in der Altstadt, sogar das »Roxi« am Olivaer Schloßgarten erschwinglich, samt Straßenbahnfahrten hin und zurück. Kein Programmwechsel entging ihm.
Damals, zur Freistaatzeit, lief noch »Fox Tönende Wochenschau« vor dem Kultur- und dem Spielfilm. Mich fesselte Harry Piel. Ich lachte über Dick und Doof. Charlie Chaplin sah ich als Goldsucher einen Schuh samt Senkel essen. Den amerikanischen Kinderstar Shirley Temple fand ich blöd und nur mäßig niedlich. Mein Geld reichte, um einen Stummfilm mit Buster Keaton, dessen Komik traurig und dessen Trauer mich lachen machte, mehrmals zu sehen.
War es im Februar zu ihrem Geburtstag oder zum Muttertag? Jedenfalls glaubte ich noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges in der Lage zu sein, meiner Mutter etwas besonderes, einen Importartikel schenken zu können. Lange stand ich abwägend vor Schaufenstern, genoß die Qual der Wahl, schwankte zwischen der ovalen Kristallschale im Kaufhaus Sternfeld und einem elektrischen Bügeleisen.
Schließlich war es das formschöne Siemens-Produkt, dessen enormen Preis die Mutter streng erfragt, der Verwandtschaft jedoch wie eine der sieben Todsünden verschwiegen hat; und auch der Vater, der sich sicher war, auf den tüchtigen Sohn stolz sein zu müssen, durfte die Quelle meines plötzlichen Reichtums nicht preisgeben. Nach Gebrauch verschwand das Bügeleisen sogleich im Büfett.
Die Praxis des Schuldeneintreibens brachte mir noch anderen Zugewinn, der sich allerdings erst nach Jahrzehnten in dinglicher Prosa ausgezahlt hat.
Ich kam treppauf, treppab in Mietshäuser, in denen es von Stockwerk zu Stockwerk anders roch. Der Geruch, den garender Weißkohl freigibt, wurde vom Gestank kochender Wäsche übertönt. Ein Stockwerk höher roch es vordringlich nach Katzen oder Kinderwindeln. Hinter jeder Wohnungstür miefte es besonders. Säuerlich oder brenzlig, weil die Hausfrau gerade ihre Locken mit Brennscheren gedreht hatte. Der Duft älterer Damen: Mottenkugeln und Uralt Lavendel. Der Schnapsatem des verwitweten Rentners.
Ich lernte, indem ich roch, hörte, sah und zu spüren bekam: die Armut und Kümmernis vielköpfiger Arbeiterfamilien, den Hochmut und die Wut gestelzt hochdeutsch schimpfender Verwaltungsbeamter, die aus Prinzip zahlungsunfähig waren, das Bedürfnis vereinsamter Frauen nach ein wenig Geplauder am Küchentisch, bedrohliches Schweigen und den zählebigen Streit zwischen Nachbarn.
Das alles sammelte sich inwendig als Sparguthaben an: nüchtern und im Suff prügelnde Väter, in höchster Tonlage keifende Mütter, verstummte oder stotternde Kinder, Keuch- und Dauerhusten, Seufzer und Flüche, Tränen verschiedener Größe, der Haß auf Menschen und die Liebe zu Hunden und Kanarienvögeln, die Endlosgeschichte vom verlorenen Sohn, Proletarier- und Kleinbürgergeschichten, jene auf Plattdeutsch mit polnischen Flüchen durchsetzt, diese in amtlicher Sprache, abgehackt und auf Klafterlänge verkürzt, solche, deren Triebwerk die Treulosigkeit war, und andere, die ich erst später als Geschichten begriff, die vom starken Willen des Geistes und vom hinfällig schwachen Fleisch handelten.
Das und noch viel mehr – nicht nur die Prügel, die mir beim Schuldeneintreiben ausgezahlt wurden – hat sich bei mir angereichert, vorrätig für Zeiten, in denen dem professionellen Erzähler der Stoff knapp wurde, ihm Wörter fehlten. Ich mußte nur die Zeit rückläufig werden lassen, Gerüche schnuppern, Gestank sortieren, wieder treppauf, treppab steigen, die Klingel drücken oder anklopfen, besonders häufig am Freitagabend.
Es mag sogar sein, daß mich der frühe Umgang mit der freistaatlichen Guldenwährung bis hin zu Pfennigbeträgen, dann, ab neununddreißig und Kriegsbeginn, das Abkassieren der Reichsmark – die begehrten silbernen Fünfmarkstücke – so nachhaltig in harter Praxis gefirmt hat, daß es mir skrupellos leicht fiel, während der Nachkriegszeit als Schwarzhändler mit Mangelware wie Feuersteinen und Rasierklingen, dann späterhin als Autor beim Aushandeln von Verträgen mit schwerhörigen Verlegern fordernd hartnäckig zu bleiben.
Mithin weiß ich Gründe genug, meiner Mutter dankbar zu sein, weil sie mich früh gelehrt hat, sachlich mit Geld umzugehen, und sei es beim Eintreiben von Schulden. Wenn also in der Reihung eines wortwörtlichen Selbstporträts, das mir die Söhne Franz und Raoul abnötigten, als ich zu Beginn der siebziger Jahre das »Tagebuch einer Schnecke« schrieb, lapidar gesagt wird: »Ich bin ganz gut schlecht erzogen worden«, ist damit auch meine Praxis als Schuldeneintreiber gemeint.
Ich vergaß, beiläufig die häufigen Mandelentzündungen zu erwähnen, die mich vor und nach dem Ende der Kindheit zwar für Tage von der Schule befreit, aber auch meinen aufs Geld versessenen Kundendienst behindert haben. Dem halbwegs Genesenen brachte die Mutter Eigelb in einem Glas, verrührt mit Zucker, ans Bett.
Was sich verkapselt hat
Ein Wort ruft das andere. Schulden und Schuld. Zwei Wörter, so nah beieinander, so fest im Nährboden der deutschen Sprache verwurzelt, doch ist dem erstgenannten mit Abzahlung – und sei es in Raten, wie es die Pumpkundschaft meiner Mutter tat – abmildernd beizukommen; die nachweisbare wie die verdeckte oder nur zu vermutende Schuld jedoch bleibt. Immerfort tickt sie und ist selbst auf Reisen ins Nirgendwo als Platzhalter schon da. Sie sagt ihr Sprüchlein auf, fürchtet keine Wiederholungen, läßt sich gnädig auf Zeit vergessen und überwintert in Träumen. Sie bleibt als Bodensatz, ist als Fleck nicht zu tilgen, als Pfütze nicht aufzulecken. Sie hat von früh auf gelernt, gebeichtet in einer Ohrmuschel Zuflucht zu suchen, sich als verjährt oder längst vergeben kleiner als klein, zu einem Nichts zu machen, und steht dann doch, sobald die Zwiebel Pelle nach Pelle geschrumpft ist, dauerhaft den jüngsten Häuten eingeschrieben: mal in Großbuchstaben, mal als Nebensatz oder Fußnote, mal deutlich lesbar, dann wieder in Hieroglyphen, die, wenn überhaupt, nur mühsam zu entziffern sind. Mir gilt leserlich die knappe Inschrift: Ich schwieg.
Weil aber so viele geschwiegen haben, bleibt die Versuchung groß, ganz und gar vom eigenen Versagen abzusehen, ersatzweise die allgemeine Schuld einzuklagen oder nur uneigentlich in dritter Person von sich zu sprechen: Er war, sah, hat, sagte, er schwieg… Und zwar in sich hinein, wo viel Platz ist für Versteckspiele.
Sobald ich mir den Jungen von einst, der ich als Dreizehnjähriger gewesen bin, herbeizitiere, ihn streng ins Verhör nehme und die Verlockung spüre, ihn zu richten, womöglich wie einen Fremden, dessen Nöte mich kaltlassen, abzuurteilen, sehe ich einen mittelgroßen Bengel in kurzen Hosen und Kniestrümpfen, der ständig grimassiert. Er weicht mir aus, will nicht beurteilt, verurteilt werden. Er flüchtet auf Mutters Schoß. Er ruft: »Ich war doch ein Kind nur, nur ein Kind…«
Ich versuche, ihn zu beruhigen, und bitte ihn, mir beim Häuten der Zwiebel zu helfen, aber er verweigert Auskünfte, will sich nicht als mein frühes Selbstbild ausbeuten lassen. Er spricht mir das Recht ab, ihn, wie er sagt, »fertigzumachen«, und zwar »von oben herab«.
Jetzt verkneift er die Augen zu Sehschlitzen, preßt und verzieht die Lippen, bringt den Mund in unruhige Schieflage und arbeitet an seiner Grimasse, während er zugleich über Büchern hockt, weg ist, nicht einzuholen.
Ich sehe ihn lesen. Das, nur das tut er mit Ausdauer. Dabei stöpselt er beide Ohren mit den Zeigefingern, um in enger Wohnung gegen den fröhlichen Lärm der Schwester abgeschirmt zu sein. Jetzt trällert sie, kommt näher. Er muß aufpassen, denn gern schlägt sie ihm das Buch zu, will mit ihm spielen, immer nur spielen, ist ein Wirbelwind. Nur auf Distanz ist ihm seine Schwester lieb.
Bücher waren ihm von früh an die fehlende Latte im Zaun, seine Schlupflöcher in andere Welten. Doch sehe ich ihn auch Grimassen schneiden, wenn er nichts tut, nur zwischen den Möbeln des Wohnzimmers rumsteht und dabei so abwesend zu sein scheint, daß die Mutter ihn anrufen muß: »Wo biste nu schon wieder? Was denkste dir jetzt wieder aus?«
Aber wo war ich, wenn ich Anwesenheit nur vortäuschte? Welch entlegene Räume bezog der grimassierende Junge, ohne das Wohn- oder Klassenzimmer zu verlassen? In welche Richtung spulte er seinen Faden?
In der Regel war ich zeitabwärts unterwegs, unstillbar hungrig nach den bluttriefenden Innereien der Geschichte und vernarrt ins stockfinstre Mittelalter oder in die barocke Zeitweil eines dreißig Jahre währenden Krieges.
So vergingen dem Jungen, der unter meinem Namen anzurufen ist, die Tage wunschgemäß als Folge von Auftritten in wechselnden Kostümen. Schon immer wollte ich weranders und woanders, jener »Baldanders« sein, der mir wenige Jahre später, als ich mich in der Volksausgabe des »Simplicissimus« verlor, gegen Schluß des Buches begegnete: eine unheimliche und doch anziehende Gestalt, die erlaubte, aus den Pluderhosen des Musketiers in die zottelige Kutte eines Eremiten zu schlüpfen.
Zwar war mir die Gegenwart mit ihren Führerreden, Blitzkriegen, U-Boothelden und hochdekorierten Fliegerassen samt militärischen Einzelheiten abfragbar deutlich – meine Geografiekenntnisse wurden bis in die Berge Montenegros, bis hin zu griechischen Inselgruppen und ab Sommer einundvierzig durch den vorrückenden Frontverlauf bis Smolensk, Kiew, zum Ladogasee hin erweitert –, aber zugleich bewegte ich mich im Heerwurm der Kreuzfahrer in Richtung Jerusalem, war Knappe des Kaisers Barbarossa, schlug auf Pruzzenjagd als Ordensritter um mich, wurde vom Papst exkommuniziert, gehörte Konradins Gefolge an und ging klaglos mit dem letzten Staufer unter.
Blind für alltäglich werdendes Unrecht im nahen Umfeld der Stadt – zwischen Weichsel und Haff, nur zwei Dörfer vom Nickelswalder Landschulheim des Conradinums entfernt, wuchs und wuchs das Konzentrationslager Stutthof –, empörten mich einzig die Verbrechen pfäffischer Herrschaft und die Folterpraxis der Inquisition. Wenn mir einerseits Zangen, glühende Eisen und Daumenschrauben handlich waren, sah ich mich andererseits als Rächer verbrannter Hexen und Ketzer. Mein Haß galt Gregor dem Neunten und weiteren Päpsten. Im westpreußischen Hinterland wurden polnische Bauern mit Frau und Kindern von ihren Höfen vertrieben; ich blieb Vasall des zweiten Friedrich, der in Apulien ihm getreue Sarazenen ansiedelte und mit seinen Falken arabisch sprach.
Im Rückblick sieht es so aus, als sei es dem grimassierenden Gymnasiasten gelungen, seinen aus Büchern gefütterten Sinn für Gerechtigkeit in mittelalterliche Rückzugsgebiete zu verlagern. Wohl deshalb konnte sich mein erster, vom Umfang her weitläufig geplanter Schreibversuch fern der Deportation restlicher Danziger Juden aus dem Ghetto Mausegasse in das Konzentrationslager Theresienstadt und abseits aller Kesselschlachten des Sommers einundvierzig abspielen; mitten im dreizehnten Jahrhundert sollte ein Handlungsgespinst geknüpft werden, das kaum entlegener hätte ausgedacht werden können.
Es ist die Zeitung für Schüler »Hilf mit!« gewesen, in der ein Wettbewerb angezeigt stand. Preise für erzählende Prosa, geschrieben von jugendlicher Hand, wurden versprochen.
Also begann der grimassierende Junge oder mein behauptetes, doch immer wieder im fiktionalen Gestrüpp verschwindendes Ich, in ein bis dahin unbeflecktes Diarium nicht etwa eine knappe Geschichte, nein, auf Anhieb und ungehemmt flüssig einen Roman zu schreiben, der – das ist sicher – unter dem Titel »Die Kaschuben« stand. Die waren mir immerhin verwandt.
Während meiner Kindheit fuhren wir oft über die Freistaatgrenze in Richtung Kokoschken, Zuckau und besuchten meine Großtante Anna, die samt vielköpfiger Familie auf engem Raum unter niedriger Decke hauste. Käsekuchen, Sülze, Senfgurken und Pilze, Honig, Backpflaumen und Hühnerklein – Magen, Herz, Leber –, Süßes und Saures, aber auch Schnaps, gebrannt aus Kartoffeln, kamen dort gleichzeitig auf den Tisch; und zugleich wurde gelacht und geweint.
Im Winter holte uns Onkel Joseph, der älteste Sohn der Großtante, mit Pferd und Schlitten ab. Das war lustig. Bei Goldkrug gings über die Freistaatgrenze. Onkel Joseph begrüßte die Zollbeamten auf deutsch, auf polnisch und wurde von den jeweils anders Uniformierten dennoch beschimpft. Das war weniger lustig. Kurz vorm Kriegsbeginn soll er die polnische Fahne und die mit dem Hakenkreuz aus dem Schrank geholt und gerufen haben: »Wenn Krieg jeht los, staig ich auf Baum und guck, wer kommt zuerst. Und denn hiß ich Fahne, die da oder die…«
Und selbst später noch, als genug Zeit vergangen war, sahen wir die Mutter und die Geschwister des erschossenen Onkel Franz, wenn auch nur heimlich nach Ladenschluß. Dabei erwies sich der in Zeiten der Kriegswirtschaft nützliche Naturalienhandel als hilfreich: Suppenhühner und Landeier wurden gegen Rosinen, Backpulver, Nähgarn und Petroleum getauscht. In unserem Laden stand neben dem Faß voller Salzheringe ein mannshoher Petroleumtank mit Zapfhahn, dessen Geruch die Zeit überdauert hat. Und als Bild sind mir die Auftritte der Großtante Anna geblieben, wenn sie ihre Tauschware, eine gerupfte Gans, die sie unter den Röcken verborgen hatte, mit einem Griff vorzog und auf die Ladentheke warf: »Mecht ne Zehnpfundje sain…«
So waren mir auch die Sprachgewohnheiten der Kaschuben vertraut. Wann immer sie ihr altslawisches Gemaule verschluckten und ihre Kümmernisse und Wünsche auf Plattdeutsch ausbreiteten, ließen sie die Artikel weg und sagten, um sicherzugehen, lieber zwei- als einmal nein. Ihr verlangsamtes Reden glich abgestandener Dickmilch, auf die sie geriebenes Schwarzbrot, gemischt mit Zucker, streuten.
Das Restvolk der Kaschuben siedelte seßhaft seit Urgedenken im hügeligen Hinterland der Stadt Danzig und galt unter wechselnder Herrschaft als nie polnisch, nie deutsch genug. Als mit dem letzten Krieg wieder einmal die Deutschen über sie kamen, wurden viele Kaschuben laut Erlaß als »Volksgruppe drei« eingestuft. Das geschah unter Druck der Behörden und mit Aussicht auf Bewährung, damit aus ihnen vollwertige Reichsdeutsche wurden; die jungen Frauen abrufbar für den Arbeitsdienst, die jungen Männer wie Onkel Jan, der nun Hannes hieß, für den Kriegsdienst.
Von diesen Nöten Bericht zu geben, wäre naheliegend gewesen. Weshalb ich aber die Handlung meines Erstlings, der von Mord und Totschlag bestimmt war, in die Zeit des Interregnums, »die kaiserlose, die schreckliche Zeit« des dreizehnten Jahrhunderts, verlegt habe, ist nur mit meiner Neigung zur Flucht in möglichst unwegsames Geschichtsgelände zu erklären. So kam denn auch nicht der Versuch einer altslawischen Sittengeschichte zu Papier, vielmehr handelte mein Erstling von Femegerichten und Rechtlosigkeit, die nach dem Untergang des Stauferreiches einen Erzählstoff hergaben, in dem es sattsam gewalttätig zuging.
Davon ist kein Wort geblieben. Nicht die Ahnung von blutrünstigen, weil der Blutrache dienlichen Szenen will dämmern. Kein Ritter-, Bauern-, Bettlername hat sich mir überliefert. Nichts, keines Pfaffen Schuldspruch, keiner Hexe Schrei haftet. Und doch müssen Ströme Blut geflossen, ein Dutzend und mehr Scheiterhaufen geschichtet und mit der Pechfackel in Brand gesteckt worden sein, denn gegen Ende des ersten Kapitels waren alle Helden tot: geköpft, erdrosselt, gepfählt, verkohlt oder gevierteilt. Mehr noch: niemand war da, die toten Helden zu rächen.
Auf solch schriftlich beackertem Leichenfeld fand meine Erprobung in erzählender Prosa ihr vorzeitiges Ende. Gäbe es das Diarium noch, wäre es allenfalls für Fragment-Fetischisten von Interesse.
Die Erwürgten, Geköpften, Verbrannten und Gevierteilten, alle den Krähen zum Fraß im Eichengeäst baumelnden Leichen fortan als Geister auftreten, in weiteren Kapiteln agieren und restliches Fußvolk erschrecken zu lassen, ist mir nicht in den Sinn gekommen – noch nie mochte ich Gespenstergeschichten. Doch kann es sein, daß mich der unökonomische Umgang mit fiktivem Personal als frühe Erfahrung einer Schreibhemmung dazu gebracht hat, späterhin, als nunmehr sorgfältig kalkulierender Autor, schonender mit den Helden meiner Romane umzugehen.
Oskar Matzerath überlebte als Medienmogul. Mit ihm seine Babka, die hundertsieben Jahre alt wurde und für die er, um ihren Geburtstag zu feiern, im zeitverschränkten Verlauf des Romans »Die Rättin« sogar – und trotz der Drangsal heftiger Prostatabeschwerden – die Strapazen einer Reise in die Kaschubei auf sich nahm.
Und weil der frühe Tod Tulla Pokriefkes nur vermutet werden konnte – tatsächlich wurde die Siebzehnjährige hochschwanger von Bord des sinkenden Flüchtlingsschiffes Wilhelm Gustloff gerettet –, stand sie, als endlich die Novelle »Im Krebsgang« reif zur Niederschrift war, als siebzigjährige Überlebende auf Abruf bereit. Sie ist die Großmutter eines rechtsradikalen Jungen, der im Internet seinen »Blutzeugen« feiert.
Gleiches gilt für meinen Liebling Jenny Brunies, die, wenngleich arg beschädigt und für immer erkältet, die »Hundejahre« überstehen durfte; wie ja auch ich geschont wurde, um mich auf anderem Feld mal um mal neu zu erfinden.
Jedenfalls konnte sich der maßlose Junge, der als Entwurf meiner selbst weiterhin zu entdecken ist, nicht am Wettbewerb der Zeitung für Schüler »Hilf mit!« beteiligen. Oder günstiger gesehen: so wurde mir die womöglich erfolgreiche Teilnahme an einem NS-Wettbewerb für Großdeutschlands schreibende Jugend erspart. Denn ausgezeichnet mit dem zweiten oder dritten Preis – vom ersten nicht zu reden –, wäre der verfrühte Beginn meiner Schriftstellerkarriere als angebräunt zu bewerten gewesen: mit Quellenangabe dem allzeit hungrigen Feuilleton ein gefundenes Fressen. Man hätte mich als Jungnazi einstufen, so vorbelastet zum Mitläufer erklären, mich unwiderruflich abstempeln können. An Richtern hätte es nicht gefehlt.
Aber das Belasten, Einstufen und Abstempeln kann ich selber besorgen. Ich war ja als Hitlerjunge ein Jungnazi. Gläubig bis zum Schluß. Nicht gerade fanatisch vorneweg, aber mit reflexhaft unverrücktem Blick auf die Fahne, von der es hieß, sie sei »mehr als der Tod«, blieb ich in Reih und Glied, geübt im Gleichschritt. Kein Zweifel kränkte den Glauben, nichts Subversives, etwa die heimliche Weitergabe von Flugblättern, kann mich entlasten. Kein Göringwitz machte mich verdächtig. Vielmehr sah ich das Vaterland bedroht, weil von Feinden umringt.
Seitdem mich Greuelberichte über den »Bromberger Blutsonntag« entsetzt hatten, die gleich nach Kriegsbeginn Seiten im »Danziger Vorposten« füllten und alle Polen zu Meuchelmördern machten, schien mir jede deutsche Tat als Vergeltung rechtens zu sein. Meine Kritik richtete sich allenfalls gegen lokale Parteibonzen, sogenannte Goldfasane, die sich feige vorm Dienst an der Front drückten, uns nach Aufmärschen vor Tribünen mit öden Reden langweilten und dabei ständig den heiligen Namen des Führers mißbrauchten, an den wir glaubten, nein, an den ich aus ungetrübter Fraglosigkeit so lange glaubte, bis alles, wie es das Lied vorausgewußt hatte, in Scherben fiel.
So sehe ich mich im Rückspiegel. Das läßt sich nicht wegwischen, steht nicht auf einer Schiefertafel, neben der griffbereit der Schwamm liegt. Das bleibt. Noch immer, wenn auch lückenhaft mittlerweile, sitzen die Lieder fest: »Vorwärts, vorwärts schmettern die hellen Fanfaren, vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren…«
Um den Jungen und also mich zu entlasten, kann nicht einmal gesagt werden: Man hat uns verführt! Nein, wir haben uns, ich habe mich verführen lassen.
Aber, könnte die Zwiebel lispeln, indem sie auf achter Haut Blindstellen nachweist, du bist doch fein raus, warst nur ein dummer Junge, hast nichts Schlimmes getan, hast niemanden, keinen Nachbarn denunziert, der zynische Witze über Göring, den dicken Reichsmarschall, riskiert hat, und hast keinen Fronturlauber verpfiffen, der sich rühmte, Gelegenheiten für ritterkreuzreife Heldentaten schlau gemieden zu haben. Nein, nicht du hast jenen Studienrat angezeigt, der im Geschichtsunterricht in Nebensätzen den Endsieg zu bezweifeln gewagt, das deutsche Volk »eine Hammelherde« genannt hatte und zudem ein übler Pauker war, von allen Schülern gehaßt.
Das wird stimmen: Jemanden zu verpfeifen, beim Blockwart, bei der NS-Kreisleitung, beim Hausmeister dieser oder jener Schule anzuschwärzen, war nicht meine Sache. Als aber ein Lateinlehrer, der, weil nebenbei Priester, als Monsignore angesprochen werden wollte, nicht mehr Vokabeln streng abfragte, weg, plötzlich verschwunden war, habe ich wieder einmal keine Fragen gestellt, wenngleich, kaum war er weg, der Ortsname Stutthof abschreckend in aller Munde war.
Bald vierzehn zählte ich, als Sondermeldungen aus unserem Volksempfänger, angekündigt durch Blech und Pauken, von siegreichen Kesselschlachten auf Rußlands Steppe Bericht gaben. Während Tag nach Tag Liszts »Les Préludes« mißbraucht wurde, geschah etwas, das meine Geografiekenntnisse erweiterte, doch in Latein blieb ich mangelhaft.
Nach abermaligem Schulwechsel sehe ich mich als Schüler in Sankt Johann, einem altstädtischen Gymnasium in der Fleischergasse, nahe dem Stadtmuseum und der Trinitatiskirche. Diese Lehranstalt erwies sich als gotisch unterkellert, lockte mit Kriechgängen bis in die »Hundejahre« hinein. Deshalb fiel es mir später leicht, mein Romanpersonal, die befreundeten und zugleich verfeindeten Schüler Eddie Amsel und Walter Matern, dort einzuschulen, auf daß sie vom Umkleideraum der Turnhalle aus in die franziskanischen Kriechgänge fanden…
Und als mein Lateinlehrer Monsignore Stachnik nach einigen Monaten zurückkam und weiterhin auf Sankt Johann unterrichtete, habe ich wiederum keine dringlichen Fragen gestellt, obgleich mir der Ruf anhing, nicht nur ein aufsässiger, sondern auch ein vorlauter Schüler zu sein.
Naja, er hätte ohnehin nicht antworten dürfen. War überall so nach der Entlassung aus KZ-Haft. Fragen hätten Stachnik, der äußerlich unverändert schien, nur zusätzlich in Schwierigkeiten gebracht.
Dennoch muß mich mein Schweigen ausreichend belastet haben, sonst wäre ich kaum genötigt gewesen, jenem Lateinlehrer und einstigen Vorsitzenden der freistaatlichen Zentrumspartei, dem unermüdlichen Fürsprecher der seligen Dorothea von Montau, in meinem aus Prinzip rückbezüglichen Roman »Der Butt« ein unüberlesbares Denkmal zu setzen.
Er und die gotische Einsiedlerin. Sein Bemühen um ihre Seligsprechung. Ins Schwärmen geriet Monsignore, sobald ihre Magerkur zum von uns angestoßenen Thema wurde. Leicht fiel es, ihn aus dem Zuchtgehege lateinischer Satzkonstruktionen zu locken; man mußte nur nach ihr, der ihm heiligen Dorothea fragen.
Was ihr die Ehe mit dem Schwertfeger versalzen habe.
Welche Wunder ihr zuzusprechen seien.
Warum sie sich im Dom zu Marienwerder lebendig habe einmauern lassen.
Ob sie, bald abgemagert, dennoch schön von Gestalt geblieben sei.
All das und seinen stets geschlossenen Halskragen rief ich in Erinnerung, um eines Lateinlehrers zu gedenken.
Allerdings konnte das späte Loblied Monsignore Stachnik nur teilweise gefallen. Aus allzu gegensätzlicher Perspektive werteten wir das Leben und den Hungertod der bußfertigen Dorothea von Montau. Und als ich um die Mitte der siebziger Jahre mit meiner Frau im Münsterland unterwegs war, um für die Erzählung »Das Treffen in Telgte« lokale Einzelheiten aus barocker Zeitweil zu recherchieren, besuchten wir ihn, der in einem Nonnenkloster seinen Alterssitz gefunden hatte: in geräumiger und komfortabel möblierter Zelle, die zum Gespräch einlud. In dessen Verlauf vermied ich jeden Konflikt auf katholisch bestelltem Acker. Ein wenig erstaunt, weil protestantischer Herkunft, war Ute über des alten Herrn geruhsamen Alltag inmitten klösterlich lebender Frauen, die uns in ihrer alles verhängenden Tracht nur beim Empfang zu Gesicht kamen.
Kokett, wie er sich als Lateinlehrer nie gegeben hatte, nannte sich Monsignore »Hahn im Korb«. Rundlicher, als ihn meine Erinnerung aufbewahrte, saß er mir gegenüber: die Klosterküche bekam ihm.
Wir plauderten nur wenig über die endlich Seliggesprochene. Auf politischem Feld vertrat er noch immer die Position der Zentrumspartei, die er allerdings bei den gegenwärtigen Christdemokraten nur unzureichend aufgehoben sah. Er lobte Pfarrer Wiehnke, meinen Beichtvater in der Herz-Jesu-Kirche, weil sich dieser Priester »überaus wagemutig« um die katholischen Arbeiter seiner Gemeinde gekümmert habe. Er erinnerte sich an diesen und jenen Lehrer auf Sankt Johann, so an den Schuldirektor, dessen zwei Söhne beim Untergang des Schlachtschiffes Bismarck den Tod, wie er sagte, »gefunden« hatten.
Doch hielt er nur widerstrebend Rückschau: »Schwierige Zeit, damals…« – »Neinnein, niemand hat mich denunziert…«
Daß ich ein schlechter Lateinschüler gewesen war, schien ihm gnädig entfallen zu sein.
Wir sprachen über Danzig, als die Stadt noch mit allen Türmen und Giebeln wie auf Postkarten aussah. Meinen Kurzbericht von wiederholten Reisen nach Gdańsk hörte er mit Gefallen – »Sankt Trinitatis soll ja so schön wie einst wiederaufgebaut sein…« –, doch als ich mein Schweigen in Schülerzeiten, die unverjährte Schuld anklingen ließ, winkte Monsignore Stachnik lächelnd ab. Ich glaubte ein »Ego te absolvo« zu hören.
Von einer mäßig frommen Mutter nur selten zum Kirchgang ermahnt, wuchs ich dennoch frühgeprägt katholisch auf: kreuzschlagend zwischen Beichtstuhl, Haupt- und Marienaltar. Monstranz und Tabernakel waren Wörter, die ich mir ihres Wohlklangs wegen gern aufsagte. Aber an was glaubte ich, bevor ich nur noch an den Führer glaubte?
Der Heilige Geist schien mir faßlicher zu sein als Gottvater nebst Sohn. Figurenreiche Altäre, dunkelnde Bilder und der weihrauchgeschwängerte Spuk der Langfuhrer Herz-Jesu-Kirche nährten meinen Glauben, der weniger christlich, eher heidnischer Natur war. Fleischlich nah kam mir die Jungfrau Maria: als Baldanders war ich der Erzengel, der sie erkannte.
Außerdem machten mich jene Wahrheiten satt, die in Büchern ihr vieldeutiges Eigenleben führten und in deren Treibbeeten meine Lügengeschichten keimten. Was aber las der Vierzehnjährige?
Gewiß keine frommen Traktate, auch keine Propagandaschriften, die Blut und Boden in Stabreime zwängten. Weder Tom-Mix-Hefte, noch waren mir Band nach Band Karl Mays Romane spannend: Lesefutter, das meinen Mitschülern nie ausging. Vorerst las ich alles, was – welch Glück! – im Bücherschrank meiner Mutter greifbar war.
Als mir vor gut einem Jahr in Ungarns Hauptstadt ein Preis in Gestalt einer monströsen, weil bleigrau eingefaßten Kaminuhr überreicht wurde, die aussah, als solle mir zukünftig nur noch »bleierne Zeit« angesagt werden, fragte ich Imre Barna, den Lektor meines ungarischen Verlages, nach dem Namen eines Autors, dessen Roman mich in jungen Jahren verwirrt hatte: »Versuchung in Budapest«.
Wenig später wurde mir der umfängliche Schmöker aus antiquarischen Beständen geliefert. Verfaßt hat ihn Franz Körmendi, ein mittlerweile vergessener Schriftsteller. Im Jahr dreiunddreißig beim Propyläen Verlag in Berlin verlegt, handelt sein Buch fünfhundert Seiten lang von halt- und glücksuchenden Männern, die sich nach Ende des Ersten Weltkrieges in Kaffeehäusern langweilen, unterschwellig von proletarischer Revolution und Gegenrevolte und nebenbei von anarchistischen Bombenlegern. Doch hauptsächlich geht es um einen Entwurzelten, der arm, aber strebsam die Stadt beiderseits der Donau verläßt, die Welt sieht und mit reicher Frau heimkehrt, um dort, in Budapest, einer trügerisch diffusen Liebe zu verfallen.
Dieser Roman liest sich immer noch druckfrisch und gehörte zum Bücherbestand meiner Mutter, einer Ansammlung kunterbunt gemischter Literatur, die der Sohn bald ausgelesen hatte und deren Titel vorerst noch ungenannt bleiben sollen, weil ich mich nun, hungrig nach weiterem Lesestoff, nahe der Oberschule Sankt Petri an einem Lesetisch der Stadtbibliothek sehe.
Die Petrischule ist meine Zwischenstation, in die ich durch Beschluß einer Lehrerkonferenz versetzt wurde, nachdem ich das Langfuhrer Conradinum hatte verlassen müssen: einem prügelnden Turnlehrer gegenüber, der uns Schüler an Reck und Barren quälte, war ich – so lasen es die vom Sohn enttäuschten Eltern –, »aufsässig und unverschämt frech« geworden.