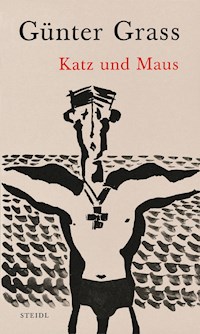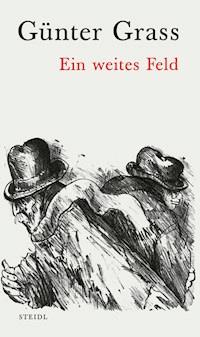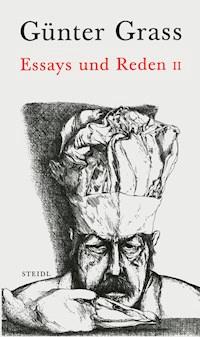
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von den poetologischen Texten des jungen Autors bis zu den Wahlkampfreden 2007 spannt sich der Bogen dieser Essays und Reden. Damit zeichnet er zugleich die Entwicklung nach, die Grass seit 1955 genommen hat: Begriff der Bildhauerschüler und Nachwuchsdramatiker Freiheit zunächst allein als eine der Kunst, wurde ihm mehr und mehr die Unmöglichkeit einer Existenz im Elfenbeinturm bewusst. Wachsendes gesellschaftliches Engagement führte ihn deshalb mitten hinein in das politische Alltagsgeschäft. Die Absage an jegliche Heilslehre, komme sie von rechts oder von links, ließ ihn jene Position zwischen allen Stühlen einnehmen, die ihm bis heute zu eigen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1047
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Essays und Reden II
1980
Februar 1980
Orwells Jahrzehnt I
Rede im Landtagswahlkampf Baden-Württemberg
Mein Referat steht unter der Überschrift »Orwells Jahrzehnt«. Der Name des englischen Schriftstellers, dem hier, als sei er ein Schutzpatron, die achtziger Jahre überantwortet werden, ist weitbekannt. Desgleichen sein Romantitel »1984«, wenngleich die Zahl der Leser dieser hoffnungslos düsteren Zukunftsvision beschränkt sein mag.
Wie Markenzeichen geistern der Name des Autors und der Titel seines Buches durch unser schreckenbereites Bewußtsein. Abhöraffären werden mit dem Orwell-Zitat »Big Brother is watching you« kommentiert. Orwell verbreitet Furcht. Auf das von ihm fixierte Jahr starren wir mit vorweggenommenem Schrecken.
Dabei hatte George Orwell vor mehr als dreißig Jahren Aufklärung, wenn auch - nach Schriftstellerart - schockierende Aufklärung im Sinn, als er seinen Romanhelden Winston Smith der Zukunft auslieferte. Er wollte warnen. Doch die Politiker und Wissenschaftler, die auf ihn hätten hören sollen, haben ihn als Literaten belächelt und abgetan: Was der sich da ausgedacht hat, dieser Schriftsteller! Die seine Schreckensvisionen heute als gegenwärtig erleben, haben ihn nie gelesen.
Sein Buch »1984«, das in den fünfziger Jahren zwar als literarische Leistung diskutiert, doch, die Zukunft betreffend, als gruselige Unglaublichkeit abgetan wurde, geriet in Vergessenheit. Erst jetzt, seitdem wir uns dem fatalen Datum des Buchtitels nähern, gewinnt es neues Interesse. Nicht etwa, daß Orwells Roman als literarische Wiederentdeckung gefeiert wird; es ist die düstere Hellsichtigkeit des Autors, die uns immer noch oder mehr als vor drei Jahrzehnten betrifft.
Gewiß wäre es einfach, Orwells Zukunftsroman am Detail zu messen und billig zu widerlegen. Weder entspricht das von ihm beschriebene London der gegenwärtigen Wirklichkeit, noch finden fortwährend interkontinentale Kriege zwischen drei gleichartigen und gleichgewichtigen Weltmächten statt. Die wissenschaftliche Voraussicht des Schriftstellers liest sich geradezu harmlos, wollten wir sie mit dem Stand der gegenwärtigen Technik vergleichen. Und doch stockt der Leser immer wieder, weil viele von Orwell erkannte Tendenzen sich bestätigt haben und - wie wir befürchten müssen - ihrer Zukunft sicher sind.
Besonders augenfällig ist der Prozeß der Angleichung zwischen den herrschenden Ideologien unseres Jahrhunderts. Zu den Erfahrungen des Schriftstellers George Orwell gehörten: der englische Kolonialismus, er war einige Jahre lang englischer Kolonialoffizier; der Spanische Bürgerkrieg, an dem er auf seiten der Republikaner teilgenommen hat; die Brutalität des westlichen Kapitalismus, von der seine Sozialreportagen zeugen; der Hitler-Stalin-Pakt, den er als linker Schriftsteller verurteilte, weshalb er fortan eine isolierte Position einnehmen mußte; der vielfältige, vom Faschismus, Stalinismus und Kapitalismus ausgehende Terror und die Befangenheit der europäischen Linken und Liberalen angesichts dieser zukunftsträchtigen Allianz.
Heute erkennen wir, daß sich die östliche und westliche Welt, trotz der bestehenden ideologischen Gegensätze, immer mehr angleichen, daß sich die westliche und östliche Welt dem wechselseitigen Machtwillen der Sowjetunion und der USA ausgeliefert sehen. Erschreckt und zu spät begreifen wir, daß die übliche Heuchelei das nackte Interesse des einen wie anderen Machtgebildes nicht mehr verdecken kann.
Und auch die dritte, von Orwell »Ostasien« genannte Weltmacht zeichnet sich ab: China und Japan werden ihr bald Gewicht geben.
Schon finden, nach dieser Dreiteilung, sogenannte Stellvertreterkriege statt. Ob Vietnam, Kambodscha oder Afghanistan, alle drei Kriegsschauplätze waren und sind wie nach George Orwells Vorausschau lokalisiert, selbst wenn sich in seinem Roman die drei Weltmächte ihre Verschleißkriege an der indischen Malabar-Front oder in Zentralafrika liefern.
Und wenn sich im Roman »1984« urplötzlich zwei soeben noch mörderisch miteinander verfeindete Weltmächte gegen die dritte verbünden, um hundert Seiten später abermals und urplötzlich, weil das Interesse es fordert, den Bündnispartner zu tauschen, sollte uns heute die noch junge Allianz der USA mit der Volksrepublik China als Drohung gegen die Sowjetunion nicht überraschen, wie auch das übermorgen schon mögliche Bündnis zwischen dem sowjetischen Staatskapitalismus und dem amerikanischen Monopolkapitalismus seine Begründung in der Sicherung von Rohstoffen fände: Diese unheilige Allianz ginge dann auf Kosten der Dritten Welt. Doch diese Dritte Welt wird sich als künftige dritte Weltmacht - siehe das Vorspiel Teheran - zu wehren wissen.
Drei Riesen, die einander nichts schenken. Drei Riesen, die geliebt sein wollen. Drei Riesen, die sich die Liebe ihrer Trabanten, notfalls unter Androhung von Strafe, erzwingen. Also beginnt die Welt, wie bei Orwell beschrieben, ihre neue, die zukünftige Ordnung zu finden.
Ein erschreckender Triumph der Literatur wäre zu feiern: Zu Beginn dieses Jahres - kaum hatten die Sowjets Kabul besetzt, kaum hatten die USA den Persischen Golf zu ihrem Interessengebiet erklärt - begann Orwells Jahrzehnt. Wir werden, sobald wir bereit sind, unseren Zustand zu erkennen und uns gegen diese Entwicklung zu stellen, unserem Autor noch oft begegnen.
Sie werden sich fragen: Was hat Orwell mit dem gegenwärtigen Wahlkampf zu tun? Soll hier Angst verbreitet werden, wo es doch in der bundesdeutschen Politik professionelle Angstmacher genug gibt?
Ich könnte mir einen Zwischenruf etwa dieser Art denken: Wir haben hier in Ludwigsburg oder Waiblingen andere Sorgen! Und diese Sorgen, stelle ich mir vor, haben alle mit dem Wort Sicherheit zu tun. Die Sicherheit der Arbeitsplätze, die Sicherung der Altersrente, die Versicherung gegen alles und nichts bestimmen notwendigerweise die Alltagspolitik. Doch da die Sicherheit der Arbeitsplätze sich nicht von der Sicherung des Energiebedarfs trennen läßt, ist schon im zweiten Satz die Sicherung der Ölquellen mitbetroffen.
So grotesk es klingt: Alles, selbst der Bau einer Freizeitanlage mit Schwimmbad und allem Drum und Dran - er mag noch so provinziell verhandelt werden -, hat gegenwärtig und zukünftig mit Weltpolitik zu tun. Unsere Idylle ist nicht mehr zu sichern. Wir befinden uns in Orwells Jahrzehnt.
Als Heinrich Böll, Carola Stern und ich vor einigen Jahren die Zeitschrift »L’76« gründeten, wollten wir mit dieser Publikation ein Forum für übergreifende Probleme schaffen. Gerade weil wir uns als eine Zeitschrift für den demokratischen Sozialismus definierten, griffen wir die Probleme der Staaten der Dritten Welt auf, zeigten wir uns als Gegner des sowjetischen Panzerkommunismus, waren uns Themen wie Menschenrechte und Datenschutz wichtig und sollten die herrschenden ideologischen Positionen einer ständigen Revision unterworfen werden. Plötzlich verkaufte der Deutsche Gewerkschaftsbund die Europäische Verlagsanstalt. Wir standen ohne Verleger da. Doch aufgeben wollten wir nicht. Also gründeten wir mit eigenen Mitteln den Verlag » L’80«, um unter neuem Titel unsere Arbeit fortzusetzen, nun auf das vor uns liegende Jahrzehnt bedacht.
Deshalb beteiligen wir uns auch als »L’80« am Wahlkampf. Wir wollen der modischen Wehleidigkeit widersprechen, den demagogischen Angstmachern die Wirkung schmälern, aber auch die tatsächlichen Gefahren unserer Zeit beim Namen nennen.
Wenn ich zu Orwells Roman »1984« ein Buch als Gegengewicht auf die Waage legen will, weiß ich nur den Bericht der Nord-Süd-Kommission. Als Vorsitzender dieser Kommission hat Willy Brandt unter dem Titel »Das Überleben sichern« die Ergebnisse seiner mehrjährigen politischen Bestandsaufnahme vorgelegt. Dieser Bericht liest sich düster und wäre noch eher als Orwells Roman geeignet, Furcht und Schrecken zu verbreiten, wenn ihm nicht Empfehlungen beigegeben wären, die uns helfen könnten, die bereits absehbare Weltkrise zu bewältigen.
Willy Brandts Nord-Süd-Kommission fordert eine neue Weltwirtschaftsordnung, die die Ungerechtigkeiten den Staaten der Dritten Welt gegenüber abbauen soll. Diese neue Ordnung setzt allerdings west-östliches Umdenken voraus. Sie verlangt uns Verzicht ab. Sie trifft den Nerv unserer Raubbauwirtschaft, denn sie fordert uns auf, unsere Märkte den Staaten der Dritten Welt zu öffnen. Und nicht zuletzt: Sie setzt weltweite Abrüstung voraus, wenn das Überleben der Menschheit über das Jahr 2000 hinaus gesichert werden soll.
Ich zitiere aus Willy Brandts Vorwort zu diesem Bericht:
»Die jährlichen Rüstungsausgaben nähern sich der Summe von vierhundertfünfzig Milliarden US-Dollar (das sind mehr als zwei Milliarden DM pro Tag), während die Ausgaben für staatliche Entwicklungshilfe weniger als fünf Prozent dieser Aufwendungen ausmachen. Dazu vier Beispiele:
1. Die Militärausgaben allein eines halben Tages würden ausreichen, um das gesamte Programm der Weltgesundheitsorganisation zur Ausrottung der Malaria zu finanzieren…
2. Ein moderner Panzer kostet etwa eine Million Dollar. Mit diesem Geld könnte man auch tausend Klassenräume für dreißigtausend Schulkinder errichten.
3. Für den Preis nur eines Kampfflugzeuges (zwanzig Millionen US-Dollar) könnte man etwa vierzigtausend Dorfapotheken errichten.
4. Mit der Hälfte von ein Prozent der jährlichen Rüstungsausgaben könnte man all die landwirtschaftlichen Geräte anschaffen, die erforderlich sind, um in den armen Ländern mit Nahrungsmitteldefizit die Agrarproduktion bis 1990 zu verbessern und sogar die Selbstversorgung zu erreichen.«
Vielleicht sollte nach diesen Beispielen daran erinnert werden, daß nach Schätzungen der Unicef im Jahr 1978 mehr als zwölf Millionen Kinder unter fünf Jahren an Hunger gestorben sind. Im Jahr 1979, das von den Vereinten Nationen zum »Jahr des Kindes« erklärt worden war, wird diese schreckliche Zahl durch das Kindersterben in Kambodscha gesteigert worden sein.
Ich sage bewußt »gesteigert«. Denn das ist der Zuwachs unserer Tage: Kindersterblichkeit. Einzig hier, unter den Vorzeichen Verelendung, Verslumung, Unterernährung, Hungertod, läßt sich noch Fortschritt errechnen. Ich bin mit Willy Brandt der Meinung, daß - wenn wir überleben wollen - hier die Hauptaufgaben der achtziger Jahre zu suchen sind! Alle Industrienationen, die westlichen und die östlichen, sind zur Abrüstung verpflichtet, so unversöhnlich sie sich ideologisch gegenüberstehen. Der gegenwärtig vernünftelnde Wahnsinn, der sich unter die Formel »Abrüstung durch Aufrüstung« bringen ließe, spricht den Staaten der Dritten Welt das Todesurteil, denn er wird weiteres weltweites Wettrüsten zur Folge haben, ohne irgend jemand Sicherheit zu geben, auch den hochgerüsteten Weltmächten nicht.
Die gegenwärtige weltpolitische Krisenlage zeigt an, daß die Großmächte USA und Sowjetunion ihrer Verantwortung nicht gewachsen sind. Ihre jeweilige innenpolitische Schwäche verführt sie, nach außen aggressiv zu wirken. Untaugliche Machtdemonstrationen, die Angst der beiden Riesen, in Kabul oder Teheran das Gesicht zu verlieren, und oft nur wahlkampfbestimmte Großsprecherei machten zu Beginn dieses Jahres deutlich, daß die Gefahr eines dritten Weltkrieges nicht mehr zu leugnen ist.
Es kann nicht verwundern, daß in dieser Situation die europäischen Staaten in Ost und West kritisch Abstand nahmen zu ihren jeweiligen Großverbündeten. Die europäische Vorstellungskraft reichte aus, sich einen dritten, alles vernichtenden Weltkrieg vorzustellen. Deshalb handelten die west-, aber auch osteuropäischen Staaten richtig, als sie sich den jeweils ihnen verbündeten Großmächten als unbequeme Partner erwiesen. Ihnen gelang es, den sich zuspitzenden Konflikt zu entschärfen und die sich ausweitende Krise einzudämmen.
In dieser realen und nicht herbeigeredeten Krisensituation fiel und fällt weiterhin den beiden deutschen Staaten besondere Verantwortung zu. Gerade weil von Deutschland zwei Weltkriege ausgingen, weil mit und durch Deutschland Europa geteilt ist, bleibt es die Pflicht unseres Volkes, jede Kraftmeierei zu vermeiden, bündnistreu ja, aber nicht bündnisblind zu sein und nur jenen Politikern Verantwortung zu übertragen, die sich bei der Wahrung des Friedens als fähig bewiesen haben.
Um es klar zu sagen: Ich bin für Helmut Schmidt, weil er in krisengeschüttelter Zeit die Nerven behält, weil seine Sachlichkeit überzeugt, weil sich sein kritischer Mut nicht nur dem politischen Gegner, sondern auch den verbündeten Freunden gegenüber bewährt hat - und nicht zuletzt: weil, gemessen an Helmut Schmidts Leistungen, der großsprecherische Gegenkandidat bis zur Schlumpfgröße schrumpft.
Und weiter nicht nur die Dinge beim Namen genannt: Ich stehe zu Willy Brandt, der trotz zurückliegender Krisen und wohl auch persönlicher Niederlagen die Kraft gehabt hat, mit seinem Nord-Süd-Bericht den Menschen wieder ein Ziel zu setzen. Er hat uns die Alternative zu Orwells düsterer Voraussicht gezeigt. Er hat die von ihm begonnene Entspannungspolitik um Einsichten vermehrt, die uns lehren könnten, das kommende Jahrzehnt zu bestehen. Mir jedenfalls hat Willy Brandt immer wieder Grund geboten, nicht nachzulassen, nicht zu resignieren, sondern den politischen Alltag notfalls auch kämpferisch zu bestehen.
Und einem weiteren Politiker gilt mein Dank. Er ist ein Brocken, der uns querliegt. An seiner unverrückbaren Beharrlichkeit haben sich schon viele Schnellstarter das Knie aufgeschlagen. Wenn er schweigt, braut sich etwas zusammen. Wenn er spricht, scheucht seine Rede uns auf. Doch muß es diesem einen und einzigen alten Mann, der unter aller politischen Last dennoch aufrecht steht, muß es einzig Herbert Wehner überlassen bleiben, uns unbequeme Wahrheiten zu sagen! Warum verweigern ihm die stets den Frieden im Munde führenden Kirchen ihre Unterstützung? Er, der letzte und erste Patriot, wird tagtäglich als Verräter diffamiert. Wann wird es endlich soweit sein, daß die Leistungen dieses Mannes, der mehr für Deutschland getan hat, als der Sonthofener Angstbrauer jemals begreifen wird, jene Achtung, jenen, ich sage es, liebevollen Respekt finden, den alle Deutschen ihm schulden.
Sosehr auch mich seine komplizierten Sätze herausfordern, ich stehe zu Herbert Wehner und zu seinen unbequemen Wahrheiten. Allen, die kopfhängerisch nur noch schwarzsehen, die aussteigen wollen, die sich in grüne Idyllen verkriechen, die ein bißchen Titanic und Untergang spielen wollen, ihnen allen rufe ich zu: Es ist ein Glück, daß es Herbert Wehner und Willy Brandt gibt und daß mit Helmut Schmidt ein Politiker als Bundeskanzler Verantwortung trägt, der den gegenwärtigen Krisen gewachsen ist.
Schlimm stünde es um uns, wären wir auf Politiker angewiesen, die die Krise herbeigehofft haben, die die Krise herbeireden wollten, die, kämen sie an die Macht, die Krise in Person wären.
Sie schrecken vor nichts zurück. Sie haben keine Bedenken. Alten Menschen, die zwei Inflationen erlebt haben, jagen sie Furcht ein, indem sie eine neuerliche Geldentwertung beschwören. Mal unterschwellig, mal offen diffamieren sie ihre Gegner, ordnen sie der »Moskau-Fraktion« zu, reden von Betrug und Betrügern. Dabei sind sie es, die sich und die Demokratie um eine ernstzunehmende Alternative betrügen. Über zehn Jahre hatten die Christdemokraten Zeit, als Oppositionspartei wieder regierungsfähig zu werden. Doch außer Obstruktion und Mißbrauch des Bundesrates fiel ihnen nichts ein. Nacheinander haben sie Kiesinger, Barzel, dann Kohl verschlissen. Schließlich blieb einer übrig, der die zuvor Genannten nacheinander aufs Kreuz gelegt hatte.
Doch eigentlich sollte, wenn von den achtziger Jahren und ihren Aufgaben die Rede ist, nicht über einen Mann gesprochen werden, der ein Produkt der fünfziger Jahre ist. Aber er hat sich nun mal den Christdemokraten als Kanzlerkandidat aufgezwungen. Es wäre gefährlich, ihn hier, womöglich aus schöngeistigen Gründen, auszusparen.
Wie immer man zu ihm steht: Strauß verkörpert das den Deutschen notwendige Gruseln. Lange wühlte er im Kostümverleih nach ihm passenden Möglichkeiten, nach einer ihm passenden Rolle. Er probierte an, verwarf, beschimpfte den Garderobenspiegel und wollte sich schlanker tragen, als ihm kleidsam ist. Denn immer, auch bei erfolgreichen Auftritten, hängt ihm der Makel an, eine begabte Fehlbesetzung zu sein. Eine Zeitlang kopierte er den Kanzler Schmidt, was schwieriger war, als man vermuten mochte. So lief er Rollen hinterdrein und wurde immer unkenntlicher.
Dabei gibt es ihn: so treuherzig wie brutal. Man sehe ihn rückblickend in Chile wie in Griechenland zuvor: allzeit den Militärdiktaturen vertraut. Man sehe ihn in Portugal und Spanien: den Resten der Falange gewogen. Wo immer er unterwegs war und ist, sieht man ihn Arm in Arm mit der Reaktion.
Man lese seine Sonthofener Rede, die er am 19.November 1974, unserem Gedächtnis zur Probe, gehalten hat. Man lese diesen Entwurf zur Gewinnung der Macht, damit er wieder erkennbar wird, damit uns erinnerlich bleibt, wie wirr und präzise sein Terror nach Ausdruck sucht. Und doch wollte ihm keine der Krisen, die er herbeiwünschte, die zu fördern er seine Parteigänger aufrief, gefällig werden. So düster er in Sonthofen auftrug, keine der biblischen Plagen hat ihn zum Retter aus Krisennot gemacht. Was mit Kalkül geheckt wurde, die große Angst, hat sich durch seinen Redefluß nicht ins Gemüt der Deutschen schwemmen lassen, so gastlich es sonst allen Ängsten offensteht; weshalb er sogar auf eigenem Feld ein minderer Prophet geblieben ist.
Weder bricht der Staat unter Verschuldungen zusammen, noch ist die Zahl der Arbeitslosen in seine Wunschhöhe geklettert. Trotz dümmster Gesetze flaute der Terrorismus ab. Die Industrie, bisher seinesgleichen mit Geldern gefällig, tat ihm den ganz großen Gefallen nicht, wollte keinen alles mitreißenden Zusammenbruch, sondern nutzte die Konjunktur und investierte, selbstredend steuerbegünstigt. Selbst die weltweiten Krisen, auf die in Sonthofen ruinöse Hoffnung verschwendet wurde, trafen die Bundesrepublik nur abgeschwächt, weil die sozialliberale Koalition ihnen standhielt; der Kanzler notfalls die Nachbarn belehrend.
Kein Massenelend half. Kein bundesweites Heulen und Zähneklappern, keine gebündelten Schreie nach dem Erlöser ließen den Namen des Angstbrauers laut werden. Ungerufen zwang er sich seiner Partei auf. Nun steht er hinter den Kulissen bereit. »Die Räuber« stehen auf dem Programm. Zwei Hauptrollen will er verkörpern, will Franz und Karl Moor zugleich sein. Aber das Stichwort kommt nicht. Es darf nicht kommen. Sorgen wir alle dafür, daß am 5.Oktober das Stichwort für seinen Auftritt nicht kommt.
Doch schon merke ich, daß Strauß meiner Rede die Zeit stiehlt. Wir sollten uns wichtigeren Themen zuwenden, den Problemen der achtziger Jahre. Was muß getan werden, damit diese achtziger Jahre nicht schrecklich, das heißt zu Orwells Jahrzehnt werden?
Bei George Orwell wird die sogenannte Neusprache gesprochen. Wörter wie »Unperson« und »Gutdenken« stehen erstmals bei ihm. Das Gedächtnis wird der »Wirklichkeitskontrolle« unterworfen. In der Neusprache heißt das: »Zwiedenken«. Da das »Friedensministerium« alle Kriegsangelegenheiten behandelt, heißt jenes Ministerium, das mit Hilfe der »Gedankenpolizei« Recht und Ordnung aufrechterhält, »Ministerium für Liebe«. Und weil das für Propaganda zuständige Ministerium folgerichtig »Wahrheitsministerium« heißt, steht auf weithin sichtbaren Spruchbändern: »Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.«
Und wir? Ist uns nicht auch Orwells Neusprache mittlerweile geläufig? Wie heimelig klingt das Wörtchen »Lauschaktion«. Durch Rationalisierungsmaßnahmen arbeitslos gewordene Facharbeiter nennen wir »freigestellte Arbeitskräfte«. Einen Ort, an dem der anfallende Atommüll gelagert und gegebenenfalls wieder aufbereitet werden soll, nennen wir, als hätte Orwell unsere Feder geführt: »Entsorgungspark«. Sind wir weit weg von der »Gedankenpolizei«? Ist uns das »Zwiedenken« nicht schon geläufig? Findet bei der Produktion sogenannter »ausgewogener« Fernsehprogramme nicht schon jene hier zitierte »Wirklichkeitskontrolle« statt? Ja, sind unsere auf »Erkenntnisse« erpichten Technologien nicht heute schon jenen Apparaten überlegen, die bei Orwell erkenntnisdienstliche Wahrheitsfindung betreiben?
»Also ganz so schlimm ist es nicht!« höre ich rufen. »Aber anders schlimm!« hält jemand dagegen. »Und in Teilbereichen ein wenig schlimmer sogar!« ließe sich sagen.
Zum Beispiel die täglich einander löschenden Nachrichtenschübe. Wir wissen und vergessen alles, bis zu den Stellen hinterm Komma genau. Mit altbekannter Fistelstimme lehrt uns die Vernunft, den neuesten Wahnsinn als relativen Fortschritt zu begreifen. Es muß uns einleuchten, daß nur Aufrüstung die allseits ersehnte Abrüstung einleiten kann. Um unserer Demokratie Erkenntnisse zu vermitteln, wird jedermann an Rastersysteme verfüttert. Und dem Energiemangel begegnen wir mit gesteigerter Produktion. Wir schlucken Tabletten gegen Tablettenschäden. Unsere Feiertage sind Anlässe für Konsum, unsere Jahreszeiten enden in Schlußverkäufen. Und schlau sind wir: Um die Lebensmittelpreise in dieser regional überfressenen, doch weithin unterernährten Welt weiterhin stabil zu halten, türmen wir Butter- und Schweinefleischberge. Weil wir für jeden Schrecken passende Wörter finden, deckt das Wort »Versorgungslücke« auch den vielstelligen Tod ab.
Doch haben wir einen neuen, einen polnischen Papst, der so unfehlbar wie der persische Khomeini ist. Allgemein mangelt es nicht an großen Führerfiguren, die sich in Orwells Big-Brother-Rolle üben: Ein bigotter Prediger in Washington und ein Biedermann in Moskau lassen entscheiden, was sie der Welt als ihre Entscheidung kundtun. Natürlich gibt es als Markenzeichen des
Heils noch immer den guten alten Kapitalismus und den guten alten Kommunismus: Nur werden die beiden, dank ihrer altbewährten Feindschaft - was Orwell vorausgesagt hat - einander immer ähnlicher. Zwei böse Greise, die wir lieben müssen, weil ihre uns angetragene Liebe unabweisbar ist. Big Brother hat einen Zwilling. Allenfalls läßt sich darüber streiten, ob die Big-Brother-Zwillinge eineiig oder zweieiig über uns wachen.
So jammern wir uns in das neue Jahrzehnt. Es ist schon so: Seitdem die Aufklärung als heilige Kuh trockensteht, ist dem Fortschritt kein Saft mehr abzumelken. Aussteigen wollen unsere Streichelkinder, sobald ihnen die Fahrkosten ihrer Umwege zugesichert sind. Wehleidig flüchten die Revolutionäre von gestern - unter Protest! - ins Beamtenrecht. Und jeder behauptet, als gehöre sich das, Angst zu haben.
Dagegen will ich hier ansprechen. Noch können wir sagen, was uns bedrückt, was uns das Fürchten lehren will. Noch sind wir handlungsfähig, wenn wir nur wollen. Ich nannte zu Beginn meiner Rede den von Willy Brandt vorgelegten Bericht der Nord-Süd-Kommission, unter dem Titel »Das Überleben sichern«. Willy Brandt ruft uns zum Handeln auf. So ungeschminkt sein Bericht unsere Gefährdungen aufzeigt, steht er doch alternativ zu Orwells Schreckensvision. Wie jämmerlich liest sich dagegen jenes Sonthofener Gebräu, das die Angstmacherei zum Mittel der Politik erheben wollte.
In Willy Brandts Bericht wird uns, wenn wir überleben wollen, konsequentes Umdenken, die Überprüfung unserer Bedürfnisse und folgerichtig eine zeitgemäße Askese empfohlen.
Das heißt: nein sagen zu den Angeboten. Die erstaunlichen Erfindungen ausschlagen, sich zur technischen Entwicklung, in deren Verlauf alles Machbare auch gemacht wurde, bewußt fehlverhalten. Das heißt: das Machbare über den Prüfstein der Notwendigkeit stolpern lassen. Alltäglich konkret wird das bedeuten müssen: nein sagen zum Kabelfernsehen und zum privatwirtschaftlichen Fernsehen, weil wir dieser Errungenschaften nicht bedürfen. Konkret alltäglich muß das bedeuten: die rigorose Geschwindigkeitsbegrenzung, die schon lange überfällig ist. Wir sind auf selbstmörderische Weise ohnehin zu schnell.
Aber auch die Erhebung einer progressiven Steuer zur Entwicklung der Dritten Welt wird die Konsequenz dieser notwendigen Askese sein.
Und dringend empfohlen ist diese Askese den christlichen Kirchen, die wieder glaubwürdig, das heißt arm werden sollten, wie Jesus Christus arm gewesen ist. Mit anderen Worten: Die in der Bundesrepublik erhobene Kirchensteuer sollte nicht mehr kirchlichem Selbstzweck, sondern ausschließlich der Sozialarbeit und den Staaten der Dritten Welt zugute kommen.
Es ließe sich die Liste dieser Notwendigkeiten fortsetzen, denn ob wir wollen oder nicht: Weil die Welt an unserer Verschwendungssucht leidet, werden uns die achtziger Jahre jene Askese auferlegen, die uns - um auch etwas Positives zu sagen - allesamt schlanker und schöner machen wird.
Ich möchte zum Schluß in eigener Sache sprechen und als Schriftsteller eine Aufgabe definieren, die sich im Verlauf der achtziger Jahre den beiden deutschen Staaten stellen wird. So krisenanfällig die Weltpolitik ist, nichts kann uns von der Pflicht befreien, das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten weiterhin zu entspannen und uns zu einem nationalen Selbstverständnis zu verhelfen, das den Deutschen in beiden Staaten angemessen sein sollte und das unsere Nachbarn nicht fürchten müssen.
Als Schriftsteller habe ich erfahren, wie tragfähig sich besonders die Literatur zwischen den beiden deutschen Staaten bewiesen hat. Ausgerechnet sie, die vielgeschmähte, die angeblich so zersetzende, die hier verlachte, dort auf das Wort Zensur gereimte Literatur hat sich durch keine Mauer aus- oder einsperren lassen: Sie ist gesamtdeutsch geblieben. Mehr noch: Die Wechselbeziehung zwischen den beiden deutschen Literaturen hat in drei Jahrzehnten anfangs unmerklich, wie gegen eigene Absicht, später dennoch ein gesamtdeutsches Dach entstehen lassen, unter dem sich leben ließe: in zwei deutschen Staaten einer Kulturnation.
Diese meine These, die schließlich, im Sinne der Deutschlandpolitik, zur Forderung wird, fußt auf eigener Erfahrung. Im Verlauf der siebziger Jahre besuchten einige Westberliner Autoren, darunter ich, in regelmäßigen Abständen, etwa alle acht Wochen, Ostberliner Autorenkollegen in ihren Privatwohnungen. Wir lasen uns aus unseren Manuskripten vor, kritisierten einander und teilten obendrein den unter Tapeten oder sonstwo eingebauten Wanzen einiges über die deutsche Literatur, ihre Tradition und ihre Entwicklung mit. Ob der Staatssicherheitsdienst der DDR daraus lehrreichen Nutzen gezogen und seine Erkenntnisse, im gesamtdeutschen Sinn, mit den Erkenntnissen des bundesdeutschen Verfassungsschutzes verglichen hat, läßt sich nur erahnen.
Doch soviel ist sicher: Diese ost-westlichen Literaturgespräche folgten der Tradition der europäischen Aufklärung und ihrer deutschen Entsprechung. Wir ließen uns Logau und Lessing, Büchner und Heine nicht halbieren. So deutlich besonders uns die politische Teilung bewußt war, so gewiß und notwendig blieb uns das Überdauern der weitgefächerten, tief wurzelnden, deshalb nicht zu teilenden deutschen Kultur. Wir waren uns näher, als wir vermutet hatten. Und selbst die widersprüchlichen Erfahrungen - dort mit der Zensur, hier mit einer kulturbetriebsamen Barbarei - entsprachen einer deutschen Tradition. Die Lügen in der Staatszeitung »Neues Deutschland« halten Schritt mit den Lügen in Springers Zeitungen. Und die Bereitschaft, Schriftsteller »Ratten und Schmeißfliegen« zu nennen, ist gleichfalls in beiden deutschen Staaten variationsreicher Sprachgebrauch. Denn selbst in ihrer Verneinung ist unsere Kultur gesamtdeutsch geblieben.
Man mag es als gewagt und ungesichert bezeichnen, wenn ich dennoch versuche, den Begriff der deutschen Nation aus unserer Kultur zu beziehen, zumal es schwerfallen wird, diese bisher nur literarische Formel ins Politische zu übersetzen. Deshalb will ich mich in einigen Thesen erklären:
1. Die politische, wirtschaftliche und ideologische Teilung Deutschlands, als Folge des Zweiten Weltkrieges, ist vollzogen und nicht aufzuheben.
2. Einer Wiedervereinigung Deutschlands steht nicht nur die weltpolitische Blockteilung im Wege, sondern auch die Ablehnung einer abermaligen Machtballung in der Mitte Europas durch unsere östlichen und westlichen Nachbarn.
3. Dennoch muß das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander als ein besonderes angesehen werden: Ihre geschichtliche und kulturelle Entwicklung legt ihnen auf, sich als zwei Staaten einer Nation zu begreifen.
4. Sollten sich die beiden deutschen Staaten dieser gemeinsamen Aufgabe entziehen, entstünde die Gefahr eines nationalen Vakuums, das in absehbarer Zeit, wie schon oft in der deutschen Geschichte, von Demagogen angefüllt werden würde.
5. Da unter der Regierung der sozialliberalen Koalition das Gespräch zwischen den beiden deutschen Staaten begonnen wurde, stellt sich zuallererst ihr die Aufgabe, im Verlauf der achtziger Jahre diese Politik fortzusetzen und ein Kulturabkommen zu verhandeln, das beiden Staaten den Fortbestand der Nation als Kulturnation sichert.
6. Dieses Kulturabkommen soll sich beweisen, indem es die Nationalstiftung deutscher Kultur zur gemeinsamen Aufgabe beider Staaten erklärt.
7. Die Nationalstiftung deutscher Kultur soll von der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland gleichberechtigt gegründet, getragen und verwaltet werden; diese kulturelle Gemeinsamkeit sichert und definiert die Existenz zweier deutscher Staaten einer Kulturnation und schließt die politische Vereinigung der beiden Staaten aus.
Mit diesen sieben Thesen habe ich eine weitere Aufgabe für die achtziger Jahre umrissen. Nur wenn es uns gelingt, uns im eigenen Bereich zu erklären und zu begreifen, werden wir auch unseren Nachbarn begreifbar werden und nicht mehr - wie man immer noch hört - unheimlich sein.
In diesen Wochen hat uns das polnische Volk ein Beispiel gegeben. In einem System, das Orwellsche Machtverhältnisse anstrebte, haben die polnischen Arbeiter dennoch Veränderungen erkämpft. Wir haben kein Recht, den Polen Ratschläge zu erteilen. Eher könnten uns der Mut, die Ausdauer und die politische Vernunft des polnischen Volkes zum Ansporn werden, hier bei uns und nach unseren Möglichkeiten dafür zu sorgen, daß die achtziger Jahre nicht Orwells Jahrzehnt werden.
1981
Juni 1981
Literatur und Mythos
Rede auf dem Schriftstellertreffen in Lahti (Finnland)
Das Thema »Literatur und Mythos« macht mich vorerst verlegen, weil es die Gewißheiten und die Begriffsgläubigkeit des Literaturwissenschaftlers voraussetzt; ein Ansinnen, dem ich mich gerne verweigern will: Ich bin nicht gewiß, und die gängigen Begriffe taugen allenfalls als Sargdeckel. Auch haben mich Erfahrungen mit dem Wortfeld Mythos, Mythen, mythisch mißtrauisch werden lassen, zumal wir in Deutschland noch immer die Folgen jener Politik tragen müssen, die einen neuen Mythos schaffen wollte, doch deren Ergebnis Auschwitz hieß.
Diese Erfahrungen mit dem Irrationalismus und seinen realen, bis in unsere Tage lastenden Ausscheidungen haben uns vernunftgläubiger gemacht, als es - um den Jargon unserer Tage zu benutzen - »im Kopf auszuhalten« war. Jedem Wunder wurden die Kosten nachgerechnet. Zum Chaos fiel uns die Parzellierung ein. In jede Dunkelheit leuchtete die Tranfunzel statistischer Erhebung. Wir bedienten uns der Vernunft, als sei sie ein Gegengift. Wir schnupften, inhalierten sie, injizierten einander mit Vernunft, um uns, so abgespritzt, immun zu machen gegen neuerliche Versuchungen, in denen innerhalb des konturlosen Sammelbegriffs »Irrationalismus« auch die Wörter Mythos, Mythen, mythisch wabern.
Das Ergebnis ist mittlerweile einsehbar: Ein immer engerer, jede Gefährdung abweisender Vernunftbegriff schuf sich unter dem Deckmantel vernünftelnder Sprache seinen hausgemachten Irrationalismus, gipfelnd im Mythos vom Fortschritt. Weshalb auch das Unterfutter des neuen, vernunftgesättigten Irrationalismus mit allerlei Mythen angereichert ist, deren Setzlinge dem Treibhaus der einen, der anderen Ideologie entstammen, so daß der Erfolg (mit seinen leistungsstrotzenden Erfolgsmythen) den angeblich klassenlosen und den vorgeblich pluralistischen Gesellschaften als Überbegriff gemein ist.
Und auch sie, die Vernunft, will nicht mehr in Sack und Asche laufen. Seitdem sie als A und O der europäischen Aufklärung bereits vor der Französischen Revolution vergöttlicht wurde und im Verlauf der Revolution auch folgerichtig zu Tempeln und Tempelchen kam, ist sie, wie unser Fortschrittsbegriff, zum Mythos aufgeputzt worden: die Vernunft transzendiert. Nun schaut sie melancholisch drein und verlangt, weil sie diesen saturnischen Zustand nicht aushält, nach Tabletten, die glücklich machen.
Die Gegensätze sind aufgehoben. Was man meinte, fein säuberlich und ideologisch lupenrein getrennt zu haben - hier die klärende, aufklärende, folgerichtig den Fortschritt beschleunigende Vernunft, dort die begrifflich als Irrationalismus abgeurteilte Unvernunft -, ist heillos miteinander verquickt. Wir schlingern, orakeln und liefern uns, weil handlungsunfähig geworden, neuzeitlichen Schamanen, den Computern aus. Allenfalls spricht noch aus Märchen Wahrheit, während uns die so vernünftig geknüpften Sachzwänge unserer Tage um jede Erkenntnis bringen. Mit technischer Präzision, also eindeutig und ohne zwielichtiges Geheimnis, ist uns die Apokalypse vorprogrammiert.
Was Johannes auf Patmos niederschrieb - sei es wie unter rauschhaftem Zwang, sei es mit der Gründlichkeit eines Schriftstellers, der immer wieder verbessernd den treffenden Ausdruck sucht -, dieses so vieldeutige, mit Geheimnissen wuchernde und nebenbei lustvoll mit der Zahl Sieben spielende Stück Literatur - sieben Leuchter, sieben Engel, sieben Posaunen -, das immer wieder - hier abgesehen von theologischen Haarspaltereien - kreative Neudeutungen provozierte - ich denke an Albrecht Dürers Holzschnittfolge, in der die Wörtlichkeit der apokalyptischen Offenbarung bis ins Detail bildhaft wird -, dieses Glanzstück literarischer Erhellung und Eindunkelung, dieser siebenmal versiegelte Mythos vom Weltuntergang verspricht heutzutage, platterdings eingelöst zu werden. Was heißt hier das Siebte Siegel! Der Mensch, also die Technik macht’s möglich. Wir entsiegeln alles. Uns bleibt nichts verborgen. Wir dulden keine Informationslücke.
Wollte ein heutiger Johannes als Schriftsteller seine Offenbarung zu Papier bringen, es käme eine Doomsday-Kolportage, ein trivialer Science-fiction-Aufguß dabei heraus; es sei denn, der neue Johannes wäre ein Stanisław Lem. Der ginge sarkastisch bis ironisch mit den altbackenen und neubackenen Mythen um. Der ließe seinen Professor Donda seine »Dondaische Barriere«, die Grenze des Wissenszuwachses errichten, hinter der jede Zivilisation, die bestrebt ist, alles zu wissen, jedes und auch das Siebte Siegel zu brechen, also die absolute Information zum Ziel hat, zwangsläufig die totale Ignoranz des Wissens zeitigt, sich aufhebt und in die Leere fällt. Und diese Leere, das Nichts - schon wieder ein Mythos! - schafft Platz für nachhallendes, also literarisches Gelächter.
Eigentlich sollten wir froh sein, daß die göttliche Vernunft mittlerweile ihren Dachschaden so deutlich als unreparierbar zur Schau trägt. Seitdem nimmt sie uns nicht mehr so streng in die Pflicht. An ihren kategorischen Imperativen gemessen, wurde sie komisch, hüpfte wie Candide von einer Panne zur nächsten und erlaubt endlich auch uns Sprünge und Unterstellungen. Sie verlangt geradezu, daß ihr ärmlich graues Magisterröckchen, abgewetzt, wie es ist, daß ihre schlotternde Armseligkeit ein wenig aufgeputzt und angereichert wird.
Ist nicht die Literatur, als der Aufklärung ungeratenes Kind, besonders dazu geeignet, die Anfänge unserer neuzeitigen Entwicklung, Montaigne und seine Essays, zu beschwören, die Vernunft aus ihrer puritanischen Enge zu lösen und ihr die griesgrämige Rechthaberei auszutreiben? Könnten nicht sie, die Literaten, ihr, der Vernunft, die immerhin vernünftige Einsicht beibringen, daß Märchen, Mythen und Sagen nicht außerhalb unserer Wirklichkeit entstanden sind, also nicht irreal am Rande hausen und reaktionäre Finsternisse beschwören müssen, sondern Teil unserer Realität und kräftig genug geblieben sind, um uns klarer, wenn auch mit gesteigertem Ausdruck in unserer existentiellen Not und Wirrnis darzustellen, als es die überdies wortarm gewordene, nur noch im Fachjargon nuschelnde Vernunft vermag?
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als ich, ein junger unwissender Mann, dessen Neugierde grenzenlos war, wie viele meiner Generation (mehr aus Trotz denn wissend) dem Existentialismus und seinen Moden zulief, las ich zum erstenmal Camus’ »Mythos von Sisyphos«, ohne recht zu begreifen, was mich faszinierte. Heute, gebeutelt von Erfahrungen und auch gezeichnet von der produktiven Vergeblichkeit des politischen Steinewälzens, ist mir Camus wieder nah, ist die Mär vom rastlosen Stein, der, Mal um Mal bergauf gewälzt, nicht liegenbleiben will, ist mir die heroische Absurdität des Götter spottenden und den Stein bejahenden Sisyphos gegenwärtig. Sie beweist sich alltäglich. Dieses den Mythos in wenige Sätze fassende Bild vom heiteren Steinewälzer weist die menschliche Existenz komplexer und obendrein sinnlicher nach, als es der Informationswust unserer Tage oder gar die soziologische Überproduktion vermag.
Vielleicht ist es die archaische Strenge, die ins Einfache gesteigerte Komplexität der Mythen, die uns immer wieder einholt und uns, die wir versucht sind, in eine Unzahl statistischer Einzelheiten auseinanderzufallen, wiederum sammelt und kenntlich macht. Wie wir ja auch im Märchen uns wiedererkennen und uns seit Menschengedenken in Mythen aufgehoben sehen. Wir sind Echo und Narziß. Drei Wünsche sind uns freigestellt. Brot und Wein bedeuten mehr als Essen und Trinken. Den Jungbrunnen suchen wir, den uns die Fernsehwerbung verspricht. Jedem Goliath ist sein David gewiß. Jedermanns Traum: endlich den Fisch fangen, der zu uns spricht.
An diesen Beispielen, die nur Stichworte sein können, mag deutlich werden, daß jedenfalls meine schriftstellerische Arbeit ohne die stilbildende Kraft des Märchens nicht denkbar ist. Sie erlaubt Einsicht in eine weitere, das heißt die menschliche Existenz erweiternde Wirklichkeit. Denn so verstehe ich Märchen und Mythen: als Teil, genauer: als Doppelboden unserer Realität. Der nicht nur kindliche Wunsch der Menschen, fliegen zu können, klein zu bleiben, unsichtbar zu sein, ja, fernwirkend durch bloße Wunsch- oder Stimmkraft Gutes oder Schaden anzurichten, zum Beispiel Glas zu zersingen, und nicht zuletzt das Verlangen, die Zeit aufheben, in jeder Zeitweil des vorgeblich Vergangenen, des vorgeblich Zukünftigen gegenwärtig zu sein, diese so verstiegen anmutenden Sehnsüchte sind dennoch nicht unwirklich, nicht außerhalb der Realität, sondern bestimmen unsere Wirklichkeit in Tag- und Nachtträumen, aber auch im alltäglichen, oft gedankenlosen Sprachgebrauch. Von der Achillesferse bis zum Ödipuskomplex, vom Schlaraffenland bis zum Paradies auf Erden, von der Dreieinigkeit bis zur Bösen Sieben reichen die Relikte einer Bild-, Zeichen- und Bedeutungswelt, die wir annehmen und nicht als irrational diffamieren sollten.
Die Literatur lebt vom Mythos. Sie schafft und zerstört Mythen. Sie erzählt die Wahrheit jedesmal anders. Ihr Gedächtnis speichert, was wir erinnern sollten.
Vielleicht gelingt es uns eines hoffentlich nicht zu späten Tages, wieder in Bildern und Zeichen zu denken, indem wir unserer Vernunft erlauben, an Märchen zu glauben, wie närrisch mit Zahlen und Bedeutungen zu spielen, der Phantasie Auslauf zu gewähren und zu erkennen, daß wir, falls wir überleben, allenfalls - und sei es mit Hilfe der Literatur - in Mythen überleben werden.
Oktober 1981
Otto Pankok
Berlin, am 27.Oktober 1981
Lieber Rainer Herrmann,
vielen Dank für Ihren Brief. Es stimmt, daß ich von Ende 1951 bis Ende 52, insgesamt etwa zweieinhalb Semester lang, Schüler von Otto Pankok gewesen bin.
Meine Ausbildung begann in Düsseldorf an der Kunstakademie als Bildhauer bei Professor Sepp Mages, einem Mann, der mir handwerklich sehr viel vermittelt hat, doch mit zunehmendem Drang nach künstlerischer Eigenständigkeit kam es auch zu Spannungen zwischen Mages und mir; deshalb wechselte ich zu Otto Pankok, dessen Schüler damals eine Ansammlung begabter und verrückter, schräger und bunter Vögel gewesen sind. Unter anderem arbeitete ich mit Franz Witte in einem Atelier, einem der begabtesten unter den jungen Düsseldorfer Malern, der leider später - labil, wie er war - dem Scheinglanz der Düsseldorfer Altstadt und den Verführungen einer Pseudo-Bohème erlegen ist. Als er vierzigjährig starb, war Franz Witte nur noch ein Schatten seiner selbst.
Damals jedoch, in den beginnenden fünfziger Jahren, waren wir alle unvorstellbar fleißig und kreativ. Es galt, viel nachzuholen; alles, was meiner Generation während der Zeit des Nationalsozialismus vorenthalten worden war, mußte neugierig erobert, aufgesogen, verarbeitet, hier epigonal, dort mit Ansätzen von Selbständigkeit in eigenes Tun umgesetzt werden.
Das konnte man unter Otto Pankoks mal brummiger, mal lässiger, insgesamt unakademischer Anleitung ungehemmt tun. Eigentlich bekamen wir ihn selten zu Gesicht, weil ihn seine eigene Arbeit - ich erinnere großformatige Kohlezeichnungen zumeist mit Zigeunermotiven - in seinem Atelier festhielt. Im Gegensatz zu meinem ersten Lehrer, Sepp Mages, dessen Formsprache, wie unberührt vom Zeitgeschehen, klassizistisch geblieben war, vermittelte Otto Pankok seinen individuellen Spätexpressionismus. Das Gegensätzliche dieser beiden Künstler, die übrigens miteinander befreundet waren, hat mich später gereizt, beide auf satirische Art und Weise in meinem Roman »Die Blechtrommel« zu portraitieren. (Zu finden im 3.Teil, das Kapitel »Madonna 49«.)
Anfang 1953 habe ich dann abermals den Lehrer gewechselt, indem ich das Wirtschaftswunder in Düsseldorf hinter mir ließ, nach Berlin ging und dort an der Hochschule für Bildende Künste Schüler von Karl Hartung wurde.
Ich freue mich zu hören, daß nun in Mülheim eine Schule nach Otto Pankok benannt worden ist, und hoffe, daß sich viel von seinem unabhängigen Geist, von seinem sozialen Engagement und seinem politischen Mut den Schülern der Otto-Pankok-Schule vermitteln möge.
Freundlich grüßt Sie
Ihr Günter Grass
P.
November 1981
Die Bundesrepublik Deutschland ist (k)ein Einwanderungsland
Rede auf einem Kongreß der Sozialdemokratischen Wählerinitiative in Berlin
Meine Damen und Herren,
ich gehöre mit zu den Gründern und Begründern der Sozialdemokratischen Wählerinitiative. Ende der sechziger Jahre, als wir noch glaubten, man könne in diese relativ junge Republik demokratische Impulse mit dauerhafter Wirkung hineintragen, gab es einen Elan, gab es eine Möglichkeit, so etwas aufzubauen. Und es hat sich auch erwiesen, daß diese Sozialdemokratische Wählerinitiative in ihrem kritischen Verhältnis zur SPD immer wieder Gelegenheit genommen hat, der Partei unangenehme Fragen zu stellen, ihr oft Themen aufzureden, denen sie sich sperrte. Unter anderem war es das Thema der Ausländerpolitik, das Zusammenleben der Deutschen mit Ausländern, die zum Gutteil in unser Land gerufen worden sind, die man gebraucht, benötigt, benutzt hat und die dann behandelt wurden zum Gotterbarmen. Dieses Problemthema gibt es schon über ein Jahrzehnt und länger.
Damals war schon deutlich, daß es notwendig war, hier nicht etwa ein einseitiges Konzept zu praktizieren, indem man sagte, die Ausländer müssen sich in unsere Lebensgewohnheiten hineinfügen und das annehmen, was wir hier praktizieren, dann wird alles gut sein. Nein, ob Türken, Jugoslawen, Italiener, was immer sie auch waren, sie brachten ihre eigene Kultur mit, eine Kultur, die sich durchaus neben unserer eigenen Kultur sehen lassen kann und von der wir ja auch bis in die Trivialbereiche hinein profitiert haben.
Berlin kann auf Dauer gesehen nicht aus eigener Substanz leben. Die Stadt dörrt aus, sie verfilzt, sie ist verkrustet, sie ist allerdings auch eine Stadt ohne Hinterland. Ich sage das nicht als Entschuldigung, sondern als Erklärung. Es gibt immer wieder Westdeutsche, die ihren eigenen Filz zu Hause vergessen und den überdeutlichen Berliner Filz zum Anlaß nehmen, hier ihre Kritik loszuwerden. Berlin ist auf den Zuwachs, auf den Zustrom von Menschen von außerhalb angewiesen. Nur durch eine Öffnung der Stadt gerade den Ausländern gegenüber ist die Zukunft dieser Stadt sicherzustellen.
Hier müßte man an eigentlich recht gute preußische Traditionen anknüpfen. Dieser Staat Preußen, die Ausstellungen haben es nochmal deutlich gemacht, ist entstanden, weil man - sicher auch aus Kalkül und Berechnung - begriffen hatte, daß auf diesen Sandboden Menschen gebracht werden mußten.
Politische, religiöse Flüchtlinge, in den damaligen Jahrhunderten war das deckungsgleich, fanden hier ihre Heimat und haben Preußen entstehen lassen, haben von Anfang an ihre Chance gehabt. Wer einen Blick ins Berliner Telefonbuch wirft, wird an den Namen erkennen können, daß Berlin eine Summe von Einwanderung gewesen ist.
Das hat sich geändert. Dieses Sich-Abkapseln, und das auch noch in einer Lage als Stadt ohne Hinterland, wird auf die Dauer den Ruin Berlins bewirken.
Nach 1945 hat es wieder eine Einwanderungswelle gegeben. Es waren über neun Millionen Flüchtlinge, die aus den verlorenen Ostprovinzen, auch aus anderen Ländern des Ostens, nach Westen strömten. Und ich behaupte hier, daß die Reaktion eines Großteils der westdeutschen Bevölkerung auf diese Ostflüchtlinge die Reaktion war wie auf Ausländer, obgleich es sich um Deutsche handelte.
Ich habe zwei Jahre nach Kriegsende meine Eltern auf einem rheinischen Bauernhof wiedergefunden. Sie waren dort in dem bösen Winter 46/47 in der Futterküche untergebracht und aßen erfrorene Kartoffeln und wurden von den rheinischen Großbauern wie der letzte Mist behandelt. Die Rede war: Die sollen doch hingehen, wo sie herkommen! Es wurde nicht zur Kenntnis genommen, daß wir einen Krieg angefangen und verloren hatten, daß diese Flüchtlinge gemeinsam mit den Ausgebombten in den Großstädten, die noch am ehesten Verständnis für die Ostflüchtlinge hatten, die Hauptlast des verlorenen Krieges zu tragen hatten.
Dennoch hat man politisch richtig gehandelt. Diese neun Millionen Flüchtlinge sind nicht in Lager gesperrt worden. Man hat sie nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Man hat sehr rasch begriffen, daß diese neun Millionen Flüchtlinge mit einem Nichts im Hintergrund natürlich der Motor gewesen sind für das, was man später das Wirtschaftswunder genannt hat.
Ein Jahrzehnt später begann dieses Wirtschaftswunder, Arbeitskräftemangel aufzuzeigen. Es wurden Ausländer, in erster Linie aus Italien, aber auch aus anderen Ländern, ins Land gerufen. Der Boom der Wirtschaft, die beständigen Zuwachsraten ließen die Zahl der Gastarbeiter anschwellen und anschwellen. Und erst, als es Anfang der siebziger Jahre nach der ersten Erdölkrise auf einmal hieß, mit dem Zuwachs ist auf die Dauer nicht zu rechnen, war man sehr rasch bereit, die Leute wieder abschieben zu wollen, denen man einen großen Teil des Wirtschaftswunders verdankt. Es wird sich heute nicht mehr so machen lassen.
Wir wissen es aus den Zahlen, daß ein Großteil der Kinder dieser Gastarbeiter hier aufgewachsen ist, daß ihre Bindungen an die Bundesrepublik, wie immer die aussehen mögen, stärker sind als an das Heimatland ihrer Eltern. Wir werden mit ihnen leben müssen. Es wird uns keine Abkapselungspolitik dabei helfen, zumal wir im Verlauf der nächsten zwei Jahrzehnte mit einem Einwanderungstrupp zu rechnen haben werden, der sich mit den Normaleinwanderern, ich nenne sie mal so, die wir selbst ins Land gerufen haben, nicht mehr vergleichen läßt.
Das Anschwellen der Weltbevölkerung von viereinhalb Milliarden auf über sieben Milliarden im Jahre 2000 wird, ich wage das zu behaupten, eine neue Form von Völkerwanderung zur Folge haben. Diese Völkerwanderung wird nicht nur asiatischen und afrikanischen und südamerikanischen Ursprungs sein und sich in alle Industriestaaten hinein ergießen. Auch in den Ländern des Ostblocks, selbst wenn sie bessere Abwehrmechanismen haben, wird man auf Dauer diesem Druck nicht standhalten können. Es wird zu Bewegungen innerhalb Europas führen, da es auch dort zum Austausch von Bevölkerungsgruppen kommen wird.
Ich glaube, die Aufgabe von Politikern liegt in erster Linie wohl darin, sich den Blick freizuhalten aus der pragmatischen Anforderung des Alltags in Zukunftsentwicklungen hinein. Diese Zukunftsentwicklungen sind heute schon zu erkennen. Sie haben in Ländern, die früher große Kolonialreiche hatten, deutliche Spuren hinterlassen. Ich denke zum Beispiel an Großbritannien, ich denke an Holland.
Eine derartige Entwicklung werden wir in Deutschland nicht haben, weil wir zu spät und zu kurzfristig zu Kolonien gekommen sind. Aber der Ruf der Bundesrepublik, ein Einwanderungsland zu sein, ein Ruf, den wir selbst aus vulgär-materialistischen Gründen jahrelang gefördert haben, indem wir die Gastarbeiter hereinholten, dieser Ruf wird bestehen bleiben; und ein anderer Ruf, auf den wir eigentlich stolz sein sollten, daß die Bundesrepublik lange als ein Land galt, in dem Menschen, die politisches Asyl suchen, eine Heimat finden können, dieser Ruf droht verlorenzugehen.
Wenn wir als Sozialdemokraten oder als Leute, die sich einer solchen Gruppierung nahe sehen, es nicht verstehen, dem überlieferten Begriff Solidarität, diesem leergequatschten Begriff Solidarität, einen neuen Inhalt zu geben, wie wir es in Polen zur Zeit erleben; wenn wir es nicht verstehen, unseren ausländischen Mitbürgern gleiche Rechte zu garantieren und ihnen die Chance einzuräumen, hier zu leben und gleichzeitig ihre Kultur weiter zu entfalten; wenn wir diese Solidarität nicht aufbringen, werden wir an unserem eigenen Egoismus scheitern.
Dezember 1981
Die Preisgabe der Vernunft
Statements beim Ostberliner Schriftstellertreffen
Auch für mich, also jemand, der eigentlich nicht dazu neigt, sich von Weltuntergangsstimmungen tragen zu lassen, ist das Ende menschlicher Anwesenheit auf dem Planeten Erde vorstellbar geworden. Keine Naturgewalten, wir bedrohen uns. Kein unwägbares Schicksal ist über uns verhängt, sondern ureigenes Machwerk. Auf vielfältige Weise sind wir Menschen bemüht, die Grundlagen unserer Existenz zu zerstören oder Voraussetzungen zu schaffen, die die Vernichtung der menschlichen Gesellschaft zur Folge haben werden, wenn wir zur grundsätzlichen Umkehr nicht fähig sind.
Gleich welcher angeblich menschenbeglückenden Ideologie wir anhängen, wir vergewaltigen die Natur. Wir beuten sie aus. Wir erschöpfen sie und ihre Reserven, obgleich wir nur Laune oder reich ausgestattetes Nebenprodukt der Natur sind und in Bescheidenheit, auf Grund unserer Fähigkeiten, das wissen sollten.
Wir beuten aber nicht nur die Natur, wir beuten uns selber aus, wobei jede unserer Ideologien die ihr eigene Ausbeutungsmethode entwickelt hat. Wir sind nicht nur bis an die Zähne, sondern weit über den Horizont unseres eigenen Begreifens bewaffnet und mittlerweile als Sklaven eines falschen Fortschrittsbegriffs fähig, uns selbst zu vernichten.
Von dieser letzten Bedrohung soll hier, ohne daß wir die anderen Bedrohungen aus dem Blick verlieren, die Rede sein, von der Gefahr eines dritten, alles vernichtenden Weltkrieges, von der zunehmenden Militarisierung des Denkens, von der Preisgabe der Vernunft.
Schriftsteller und Wissenschaftler sprechen aus ihrer Erfahrung, die nicht gering, sondern in der Regel vielschichtiger als die der Politiker ist.
Ich habe mich kurz in sieben Thesen gefaßt.
Erstens: Nach zwei Weltkriegen und dem ersten wahrhaftig mörderischen Einsatz von Atombomben hatten sich die Großmächte entschlossen, trotz aller Gegensätze und Konflikte dem Frieden Vorrang zu geben. Dennoch sind es die Großmächte gewesen, die begrenzte Kriege ausgelöst, gefördert oder verlängert und so den Weltfrieden bis in die jüngste Zeit gefährdet haben. Vietnam und Afghanistan seien stellvertretend genannt für den seit drei Jahrzehnten anhaltenden konventionellen Krieg. Nicaragua und Polen stehen schrecklich auf der Tagesordnung. Unser Frieden ist ein Scheinfrieden.
Zweitens: Dieser Frieden zwischen den Großmächten und den ihnen jeweils verbündeten Militärblöcken beruhte die längste Zeit auf dem Prinzip der gegenseitigen Abschreckung, auf dem Gleichgewicht des Schreckens, weshalb immer schrecklichere Waffensysteme eingeführt wurden, um jeweils der anderen Seite die atomare Abschreckung glaubhaft zu machen, damit, so sagte man, der Weltfrieden erhalten bleibe.
Drittens: Dieses System der Friedenssicherung hat die Großmächte und ihre Verbündeten zum permanenten Rüstungswettlauf verleitet. Das mittlerweile angehäufte Rüstungspotential könnte die Menschheit mehrmals ausrotten. Es droht, außer Kontrolle zu geraten. Es läßt sich nicht mehr zählen, also ins Gleichgewicht bringen. Es kann den Frieden nicht mehr durch Abschreckung sichern. Es hat sich um seine Funktion gebracht.
Viertens: Noch beharrt die Politik der Großmächte auf Vorrüstung und Nachrüstung, wenngleich sie immer dringlicher und gelegentlich sogar glaubwürdig von der Notwendigkeit weltweiter Abrüstung sprechen.
Dieses Verhalten der Politik beider Blocksysteme, insbesondere der jähe Wechsel von Drohgebärden und Friedensbeteuerungen, mutet genau besehen infantil an. Weil ständig überfordert, trumpfen sie auf. Weil bei ihnen zu Hause Krisen und Mißwirtschaft herrschen, sehen sie sich versucht, die Flucht nach vorne anzutreten. Ihre übermenschliche Kraft läßt ihre Bewegungen oft genug zum Zeugnis der Unmenschlichkeit geraten. Sie wollten geliebt werden und ernten zunehmend Haß oder Verachtung. Man fürchtet sie, und insgeheim fürchten auch sie sich.
Fünftens: Schon jetzt hat das Versagen der Politik und der Politiker beider Weltmächte katastrophale Auswirkungen. Über die Hälfte der Wissenschaftler arbeiten der Rüstung zu. Die Milliardenbeträge für die weltweite Aufrüstung erlauben keine wirksame Hilfe für die notleidende Dritte Welt, denn mit der Rüstung wachsen einzig Armut, Elend und die Zahl der Verhungerten: jährlich fünfzehn Millionen Menschen. Und die Angst wächst, denn wo mit nur noch vernünftelnden Reden die Vernunft außer Kraft gesetzt wird, ist das Ende menschlicher Existenz vorstellbar.
Sechstens: Nur noch Verweigerung und anhaltender Protest können eine Umkehr erzwingen. Notwendig ist es, daß die ständig wachsende Friedensbewegung ihre Entsprechung in Osteuropa findet. Vielleicht könnte es dieser so sich ausweitenden, spontanen und urdemokratischen Massenbewegung gelingen, die Politiker zur Vernunft zu bringen und den beiden Weltmächten ihre Verantwortung bewußtzumachen.
Siebentens und letztens: Aber auch den beiden deutschen Staaten fällt Verantwortung, ich meine besondere Verantwortung zu.
Zwei Weltkriege gingen von deutschem Boden aus. Noch heute tragen die Deutschen an dieser Schuld und ihren Folgen, deshalb sind die Politiker beider deutschen Staaten verpflichtet, den ihnen zugeordneten Großmächten kritisch mahnende Verbündete zu sein. Diese gesamtdeutsche Verantwortung für den Frieden sind wir uns und Europa schuldig. Wir sollten in Ost und West Schrittmacher der Abrüstung sein. Wir sollten mit den durch Abrüstung frei werdenden Mitteln den Staaten und Völkern der Dritten Welt helfen, Hunger und Armut zu besiegen. Diese deutsche Verpflichtung sollte unumstritten sein, denn auch Hunger ist Krieg.
[…]
Natürlich fühle ich mich nicht von den Russen bedroht. Ich glaube, ich kenne auch die Amerikaner als Volk gut genug, um sagen zu können, daß niemand sich von den Amerikanern bedroht fühlen muß. […]
Wovon ich mich aber bedroht fühle - das versuchte ich in meinen Thesen deutlich zu machen -, das sind beide Großmächte, die aus ihrer Überforderung heraus und aus ihrem Bedürfnis, nicht nur im eigenen Lande, sondern weltweit geliebt zu werden, Anstrengungen machen, die über ihr Vermögen gehen, die zu Gesten ansetzen, die friedfertig gemeint sind, die ein Vokabular benutzen, das in diese Richtung zielt und wo am Ende Aggressionen herauskommen.
Die letzten dreißig Jahre sind gezeichnet von friedfertigen Gesten, die aggressiv ausliefen, jeweils zurückzuführen auf die eine und die andere Großmacht. Es mag sein, daß das atomare Gleichgewicht bei solchen Anlässen ein Auswachsen dieser Krise verhindert hat. Aber da seit geraumer Zeit dieses atomare Gleichgewicht entweder nicht mehr da ist oder nicht mehr feststellbar ist, ist also ein Vakuum entstanden, sind Krisen, wie sie noch in den fünfziger und sechziger Jahren bis in den Anfang der siebziger Jahre hinein gang und gäbe waren und in denen sich nicht die Gefahr eines dritten Weltkrieges abzeichnete, heute, obgleich sie nicht größer sind als begrenzte Konflikte, durchaus geeignet, die eine oder andere Großmacht zu ersten, zweiten und dritten Schritten in dieser Richtung zu verführen. Beide Großmächte. Ich finde es, um von Politik zu sprechen, die Angst und Mißtrauen sät, zum Beispiel verwerflich und schlimm, daß die Vereinigten Staaten ein Militärabkommen mit der Volksrepublik China schließen. Sie müssen wissen, daß diese Geste, die im Grunde, militärisch genau berechnet, gar nicht viel hergibt, dennoch bei der Sowjetunion ein Umklammerungsgefühl auslöst. Das sind Dinge, die die unmittelbar vorhandene Angst, die Unberechenbarkeit im einen wie im anderen Block steigern. Es gibt ähnliche und vergleichbare Gesten seitens der Sowjetunion, das Engagement in Afrika, wo Kuba, ein Land, das mit sich selbst schwer zu kämpfen hat, benutzt wird, sich in Afrika einzusetzen, mit dem Ergebnis - natürlich sind die Kubaner überfordert, sie haben von der Mentalität dort genauso wenig Ahnung wie die Amerikaner oder die Russen in Ägypten -, daß sie nach wenigen Jahren, auch wenn sie anfangs begrüßt wurden, gehaßt und verachtet werden. Zwei ungeliebte Riesen, die auf Liebe aus sind und uns ihr Geliebtseinwollen gelegentlich unter Drohung antragen. Das ist ein Grund für ihre Gefährlichkeit. Ich möchte darauf hinweisen, daß es sich nicht nur um die beiden Großmächte handelt. Wir sollten diesen Punkt nicht außer acht lassen. Selbst wenn es gelingt, was wir alle hoffen, dieses Ende, nämlich den dritten Weltkrieg, zu vermeiden, wird auf uns alle, auf alle Industrienationen, westliche und östliche, etwas zukommen, weil wir einer Verantwortung ausgewichen sind, für die wir noch einmal schwer bezahlen müssen: die Vernachlässigung der Dritten Welt, die Ausbeutung der Dritten Welt.
Ich weiß, es gibt dort ideologische Gerüste, die das eine wie das andere Verbrechen, von beiden Großmächten und ihren Blocksystemen zu verantworten, jeweils relativieren oder verdecken. Das Ergebnis ist, daß die Armut dort und die Verelendung in einem erschreckenden Maße zunehmen. Und das alles mit einer stattfindenden Bevölkerungsexplosion, während einer Weltbevölkerungssteigerung von jetzt 4,5 Milliarden auf bis zum Jahr 2000 annähernd sieben Milliarden. Diesen Druck werden wir alle zu spüren bekommen. Begegnen kann man diesem Druck nur, indem man - Willy Brandt hat das in seinem Nord-Süd-Bericht deutlich gemacht - zur weltweiten wechselseitigen Abrüstung kommt und gleichzeitig sicherstellt, daß ein Teil dieser dann frei werdenden Kosten sich zugunsten der Dritten Welt auszahlt.
1982
Februar 1982
Der Dreck am eigenen Stecken. Der »freie Westen« und das Kriegsrecht in Polen
Vielleicht gehört jene Meldung eines Lebensmittelkonzerns, die für alle Haushalte bestimmt war, indem sie versicherte, die Versorgung des Marktes mit polnischen Weihnachtsgänsen sei gesichert, zu den wenigen ehrlichen Zeugnissen deutscher Anteilnahme nach dem 13.Dezember 1981. Unbedenklich spricht diese Meldung aus, wie schlimm es um Polen bestellt ist, wie erbärmlich um uns. Einzig das Erschrecken über diese »Marktinformation« - wohl niemand wagte zu lachen - könnte die hoffentlich nur verschüttete Fähigkeit fördern, noch heute, Monate später, Scham zu empfinden. Als über Polen das Kriegsrecht verhängt wurde, stellte dieses neue Beispiel machtpolitischer Brutalität nicht nur den Ostblock und dessen Führungsmacht bloß; auch die Heuchelei des Westens trat zutage. Da beteuerten die Feinde und Verächter der heimischen Gewerkschaften lauthals ihre Solidarität mit der polnischen Gewerkschaft »Solidarność«. Die Freunde und Nutznießer mittelamerikanischer Diktaturen spielen sich - allen voran der US-Präsident Reagan - als Tugendwächter auf, dazu berufen, das am polnischen Volk begangene Unrecht zu verurteilen. Und alle, die seit Jahren den Boykott Südafrikas als Maßnahme gegen die dort praktizierte Rassendiskriminierung entweder unterlaufen oder als untaugliche Sanktion ablehnen, waren schnell bereit, das russische und das polnische Volk mit Boykott zu bestrafen.
Wer diese Heuchelei nicht mitmachte oder sie gar beim Namen nannte, geriet in Verdacht, die Sanktionen der polnischen Militärregierung heimlich gutzuheißen, ein »Helfer Moskaus« zu sein. Und auch dort fand man zur altbewährten Sprachregelung und beschwor wieder einmal die Gefahr der Konterrevolution. Aus den Lagern der beiden in der Sache so gegensätzlichen und ideologisch verfeindeten Weltmächte klang es gleichlaut und verteufelnd gleichgestimmt über Polen und polnische Not hinweg, auf Kosten Polens.
Andererseits verschlug es den Einsichtigen, also all jenen die Sprache, die mit abwägender Vernunft der neuen Krise begegnen wollten. Wohl den Gegensatz suchend zum verdoppelten Geschrei, wollten sie leise sprechen, frei von Emotion. Ihr Protest verhauchte und konnte nur Mißverständnisse zur Folge haben. Die ersten Äußerungen der SPD und des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach der Verhängung des Kriegsrechtes in Polen lesen sich wie regierungsamtliche Verlautbarungen: als sei man unbetroffen, als werde bei der Verfolgung der polnischen Gewerkschaft Solidarność nicht auch die gesamte freie Gewerkschaftsbewegung in Mitleidenschaft gezogen, als wolle man dem »demokratischen Sozialismus« auch im Westen keine Zukunft mehr geben.
Dabei hätte die zur Zeit unterdrückte polnische Volksbewegung auch hier deutlich machen können, wie notwendig unserem mittlerweile verkrusteten Gesellschaftsgefüge - den Parteien, der staatlichen Bürokratie, den Gewerkschaften - eine vergleichbare, heilsam Unruhe stiftende Basisbewegung wäre. Denn nicht nur das kommunistische System sowjetrussischer Machart ist am Ende und um den Rest sozialistischer Substanz gebracht; auch die westliche Welt gibt mehr und mehr ihr demokratisches Selbstverständnis auf und produziert nur noch die ihrem kapitalistischen Wirtschaftssystem gemäßen Krisen. Das nach wie vor ohrenbetäubende Getöse der beiden herrschenden Ideologien - Kommunismus und Kapitalismus - ist nichts als das Arbeitsgeräusch ihres weltweiten Leerlaufs.
Dieser Verlust des eigenen Gesichts sollte uns bewußt sein, wenn wir die anderen anklagen. Auch wenn wir noch so empört fuchteln und die Menschenrechte beschwören, der Dreck am eigenen Stecken will nicht abfallen!
Jener Hochmut, der es seit Jahren den westlichen Nato-Politikern erlaubt, vormals die Militärdiktatur in Griechenland, jetzt die der Türkei wie ein Kavaliersdelikt hinzunehmen, das Verbrechen des bis heute verhängnisvoll nachwirkenden Vietnamkrieges zu verharmlosen und das zynische Bündnis der US-Regierung mit jedem Diktator - wenn er nur weit genug rechts steht - zu tolerieren, dieser anhaltende Ausverkauf der westlichen, auf Demokratie fußenden Prinzipien hat uns alle unglaubwürdig gemacht.
Erbärmlich wortlos oder wortreich heuchelnd stehen wir da, sobald im Machtbereich des Leninismus-Stalinismus mit Gewalt zugeschlagen, 1968 die Tschechoslowakei okkupiert, ab 13.Dezember 1981 das polnische Volk in eine nur neu anmutende, im Grunde althergebrachte Knechtschaft gezwungen wird.
Das alles ist beschämend. Und wären wir fähig zur Scham, dann fände unser Protest auch andere, allseits zutreffende, uns mitbetreffende Worte. Diese noch mangelnde Scham ließe erkennen, daß erst das Eingeständnis eigener Fehlbarkeit uns erlaubt, die Fehler der anderen zu benennen, daß erst die Minderung selbst begangenen Unrechts fähig macht, den anderen zu ermutigen, sein unrechtes Handeln einzustellen.
Stünde doch die katholische Kirche so mutig auf seiten der Armen, Hungernden und Verfolgten in Lateinamerika, wie sie mutig auf seiten des unterdrückten und ausgepowerten polnischen Proletariats steht.
Käme doch den westdeutschen Gewerkschaften der solidarische Gedanke, bei den anstehenden Tarifverhandlungen ein Prozent mehr Lohn zugunsten der polnischen Arbeiter auszuhandeln; doch nicht aus Mitleid, sondern aus Dankbarkeit für nachwirkende demokratische Impulse, die von Polen ausgingen und uns hilfreich sein könnten.
Möge doch die Friedensbewegung begreifen, daß das über Polen verhängte Kriegsrecht auch unseren Friedenswillen betrifft, ja, daß der Ausnahmezustand in Polen hierzulande seine Entsprechung fände, beschlösse die Bundesregierung - und sei es als neuaufgelegte Große Koalition - die Notstandsgesetze in Kraft zu setzen.
Und schlüge doch endlich die deutschen Sozialdemokraten die Erkenntnis, daß man das Argument für den demokratischen Sozialismus, auch aus Gründen der Entspannungspolitik, nicht aufgeben darf, sonst machen sich Strauß und Kohl zu Fürsprechern einer Bewegung, die sie für Polen gutheißen und die sie hier, wo immer sie sich zaghaft rührt, niederknüppeln möchten.
Anfang Dezember 1970 begleiteten Siegfried Lenz und ich mit anderen Willy Brandt nach Warschau. Die deutsch-polnischen Verträge wurden unterschrieben. Die mühsame, noch immer nicht abgeschlossene Aussöhnung zwischen beiden Völkern begann unter schwierigen Bedingungen. Vierzehn Tage später streikten in den polnischen Ostseehäfen die Arbeiter und stellten, neben der Rücknahme der Preiserhöhung für Grundnahrungsmittel, zum erstenmal die Forderung nach der Selbstbestimmung der Arbeiter. Die Regierung Gomułka wurde von der Regierung Gierek abgelöst. Doch der Personenwechsel brachte nichts außer neuer Mißwirtschaft. Zehn Jahre lang hielten die polnischen, um ihre Hoffnung betrogenen Arbeiter still, dann solidarisierten sie sich abermals. Über ein Jahr lang wuchs sich der anfängliche Streik über die Gründung einer freien Gewerkschaft zu einer Volksbewegung aus, die manchmal außer Kontrolle zu geraten drohte. Doch niemand - und wir zuallerletzt - hat das Recht, von der Gewerkschaft Solidarność jenes Augenmaß zu verlangen, das den Regierungen über drei Jahrzehnte lang fehlte. Niemand kann die Arbeiter für das verfehlte zentralistische Wirtschaftssystem des Leninismus und dessen in die Verelendung führende Pleite verantwortlich machen.