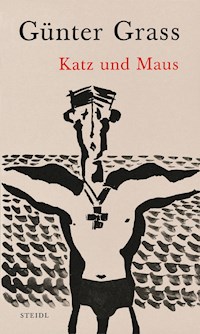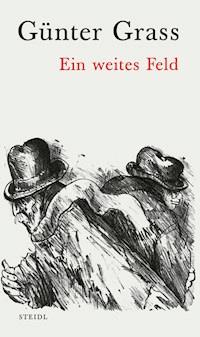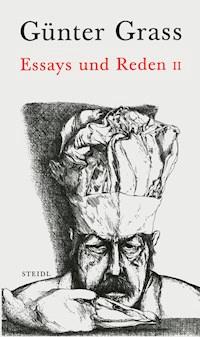Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Allerseelen 1989 führt sie in Gdansk zusammen: Witwer und Witwe, Alexander und Alexandra, ein deutscher Professor für Kunstgeschichte und eine polnische Restauratorin. Beide sind Vertriebene; und beider Eltern haben sich gewünscht, einst in ihrer Heimaterde zu ruhen. So kommt es zur Idee einer Deutsch-Polnischen Friedhofsgesellschaft — die Vertriebenen sollen als Tote auf „Versöhnungsfriedhöfe“ zurückkehren dürfen. Aus der Idee wird Wirklichkeit, aber mit den neuen Gesellschaftern kommen neue Interessen ins Spiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Unkenrufe
1
Der Zufall stellte den Witwer neben die Witwe. Oder spielte kein Zufall mit, weil ihre Geschichte auf Allerseelen begann? Jedenfalls war die Witwe schon zur Stelle, als der Witwer anstieß, stolperte, doch nicht zu Fall kam.
Er stellte sich neben sie. Schuhgröße dreiundvierzig neben Schuhgröße siebenunddreißig. Vor den Auslagen einer Bäuerin, die in einem Korb gehäuft und auf Zeitungspapier gebreitet Pilze, zudem in drei Eimern Schnittblumen anbot, fanden Witwer und Witwe einander. Die Bäuerin hockte seitlich der Markthalle zwischen anderen Bäuerinnen und dem Ertrag ihrer Kleingärten: Sellerie, kindskopfgroße Wruken, Lauch und rote Bete.
Sein Tagebuch bestätigt Allerseelen und gibt die Schuhgröße preis. Ins Stolpern hat ihn die Bürgersteigkante gebracht. Doch das Wort Zufall kommt bei ihm nicht vor. »Es mag an diesem Tag, zu dieser Stunde - Schlag zehn Uhr - Fügung gewesen sein, die uns zusammenführte…« Sein Bemühen, die dritte, stumm vermittelnde Person leibhaftig zu machen, bleibt vage wie sein Versuch, in mehreren Anläufen ihr Kopftuch zu bestimmen: »Kein eigentliches Umbra, mehr Erdbraun als Torfschwarz…« Besser gelingt ihm das Ziegelwerk der Klostermauer: »Von Schorf befallen…« Den Rest muß ich mir einbilden.
Nur wenige Sorten Schnittblumen standen noch in den Eimern: Dahlien, Astern, Chrysanthemen. Den Korb füllten Maronen. Vier oder fünf kaum vom Schneckenfraß gezeichnete Steinpilze lagen gereiht auf einer verjährten Titelseite der lokalen Tageszeitung »Głos Wybrzeża«, dazu ein Büschel Petersilie und Einwickelpapier. Die Schnittblumen waren dritte Wahl.
»Kein Wunder«, schreibt der Witwer, »daß die Stände neben der Dominikshalle so dürftig bestellt aussahen, schließlich sind an Allerseelen Blumen gefragt. Bereits am Tag zuvor, auf Allerheiligen, ist die Nachfrage oft größer als das Angebot…«
Obgleich die Dahlien und Chrysanthemen mehr hergaben, entschied sich die Witwe für Astern. Der Witwer blieb unsicher: »Selbst wenn mich die überraschend späten Steinpilze und Maronen an diesen besonderen Stand gelockt haben mögen, folgte ich doch nach nur kurzem Schreck - oder war es der Glockenschlag? - einer Verführung besonderer Art, nein, einem Sog…«
Als die Witwe aus den drei oder vier Eimern die erste, dann eine weitere, unschlüssig eine dritte Aster zog, diese zurückstellte, um sie gegen eine andere zu tauschen und dann eine vierte herauszurupfen, die gleichfalls zurück und ersetzt werden mußte, begann auch der Witwer, Astern aus den Eimern zu ziehen und diese, wählerisch wie die Witwe, auszuwechseln, wobei er rostrote zog, wie sie rostrote gezogen hatte; immerhin standen noch blaßviolette und weißliche zur Wahl. Dieser farbliche Gleichklang hat ihn närrisch gemacht: »Welch leise Übereinkunft! Wie ihr sind mir rostrote Astern, die still vor sich hin brennen, besonders lieb…« Jedenfalls blieben beide aufs Rostrot versessen, bis die Eimer nichts mehr hergaben.
Weder der Witwe noch dem Witwer reichte es zum Strauß. Schon wollte sie ihre magere Auswahl in einen der Eimer stoßen, als das begann, was Handlung genannt wird: Der Witwer übergab der Witwe seine rostrote Beute. Er hielt hin, sie griff zu. Eine wortlose Übergabe. Nicht mehr rückgängig zu machen. Unlöschbar brennende Astern. So fügte sich das Paar.
Schlag zehn: Das war die Katharinenkirche. Was ich über den Ort ihrer Begegnung weiß, mengt meine teils verwischte, dann wieder überdeutliche Ortskenntnis mit des Witwers forschendem Fleiß, dessen Ausbeute er in Häppchen seinen Notizen beigemengt hat, etwa, daß der von achteckiger Grundfläche über sieben Stockwerke hoch ragende Wehrturm als nordwestlicher Eckturm zur großen Stadtmauer gehörte. Ersatzweise wurde er »Kiek in de Köck« genannt, als ein geringerer Turm, der vormals so hieß, weil er ans Dominikanerkloster grenzte und täglichen Einblick in die Töpfe der Klosterküche erlaubte, mehr und mehr zerfiel, bei dachlosem Zustand Bäume und Sträucher trieb, deshalb zeitweilig »Blumentopf« hieß und mit den Resten des Klosters gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts abgerissen werden mußte. Auf dem geräumten Gelände wurde ab 1895 in neugotischem Stil eine Markthalle gebaut, die, Dominikshalle genannt, den Ersten und Zweiten Weltkrieg ausgehalten hat und bis heute unter ihrer breit gewölbten Dachkonstruktion in sechs Budenreihen ein mal üppiges, oft nur dürftiges Angebot vereinigt: Stopfgarn und Räucherfisch, amerikanische Zigaretten und polnische Senfgurken, Mohnkuchen und viel zu fettes Schweinefleisch, Plastikspielzeug aus Hongkong, Feuerzeuge aus aller Welt, Kümmel und Mohn in Tütchen, Schmelzkäse und Perlonstrümpfe.
Vom Dominikanerkloster ist nur die düstere Nikolaikirche übriggeblieben, deren innere Pracht ganz auf Schwarz und Gold beruht; ein Nachglanz einstiger Schrecken. Doch der Markthalle haftet die Erinnerung an den Mönchsorden nur namentlich an, desgleichen einem sommerlichen Fest, das, Dominik genannt, seit dem späten Mittelalter allen politischen Wechsel überlebt hat und gegenwärtig mit Trödel und Ramsch Einheimische und Touristen anzieht.
Dort also, zwischen der Dominiksmarkthalle und Sankt Nikolai, schräg gegenüber dem achteckigen »Kiek in de Köck«, fanden sich Witwer und Witwe zu einer Zeit, in der das Untergeschoß des ehemaligen Wehrturms mit handgemaltem Schild »Kantor« als Wechselstube ausgewiesen war. Viel Kundschaft bei offener Tür und eine Schiefertafel neben dem Eingang, auf der, stündlich verändert, der amerikanische Dollar im Verhältnis zur Landeswährung teurer und teurer wurde, gaben Zeugnis von der allgemeinen Misere.
»Darf ich?« So begann das Gespräch. Der Witwer wollte nicht nur seine, er wollte auch ihre Astern, den nun einzigen Strauß, bezahlen und zog Scheine aus der Brieftasche, unsicher angesichts der an Nullen so reichen Währung. Da sagte die Witwe mit Akzent: »Nichts dürfen Sie.«
Mag sein, daß ihr Gebrauch der fremden Sprache dem Verbot zusätzliche Schärfe beimischte, und hätte nicht eine sogleich drangeknüpfte Bemerkung »Nun ist schöner Strauß doch noch geworden« das eigentliche Gespräch eröffnet, wäre die zufällige Begegnung zwischen Witwer und Witwe mit dem Kursverfall des Złoty zu vergleichen gewesen.
Er schreibt, es habe, noch während die Witwe zahlte, ein Gespräch über Pilze, besonders über die späten, verspäteten Steinpilze begonnen. Der nicht enden wollende Sommer und milde Herbst seien als Gründe genannt worden. »Doch meinen Hinweis auf die globale Klimaveränderung hat sie einfach verlacht.«
An einem heiter bis wolkigen Novembertag standen beide einander zugewendet, und nichts konnte sie von dem Blumenstand und den Steinpilzen trennen. Er in sie, sie in ihn vergafft. Die Witwe lachte häufig. Ihren akzentuierten Sätzen war Gelächter vor- und nachgestellt, das grundlos zu sein schien, bloße Vor- oder Zugabe. Dem Witwer gefiel dieses ans Schrille grenzende Lachen, denn in seinen Papieren steht: »Wie ein Glockenvogel! Manchmal erschreckend, gewiß, dennoch höre ich sie gerne lachen, ohne nach den Gründen ihrer häufigen Belustigung zu fragen. Mag sein, daß sie über mich lacht, mich auslacht. Aber auch das, ihr lachhaft zu sein, gefällt mir.«
So blieben sie stehen. Oder: so stehen die beiden mir, damit ich mich gewöhne, ein Weilchen und noch ein Weilchen Modell. War sie modisch - er fand »zu modisch aufgedonnert« - gekleidet, gab ihm sein Tweedjackett zur Cordhose ein saloppes Aussehen, passend zur Kameratasche: als Bildungsreisender ein Tourist besserer Sorte. »Wenn nicht die Blumen, darf ich, bitte, dann den Gegenstand unseres gerade begonnenen Gesprächs, einige Steinpilze, diesen hier, den, den und noch den, auswählen und Ihnen zum Geschenk machen? Nicht wahr, sie sehen einladend aus.«
Er durfte. Und sie gab acht, daß er der Marktfrau nicht zu viele Scheine hinblätterte. »Hier alles irre teuer!« rief sie. »Aber für Herr mit Deutschmark billig immer noch.«
Ich frage mich, ob er seine Währung kopfrechnend in Vergleich zu den vielstelligen Zahlen der Złoty-Scheine gebracht und ob er ernsthaft, ihr Gelächter nicht fürchtend, erwogen hat, seinen im Tagebuch notierten Hinweis auf Tschernobyl und die Folgen als nachträgliche Warnung auszusprechen. Sicher ist: Vorm Kauf fotografierte er die Pilze und nannte die Firmenmarke seiner Kamera japanisch. Weil er den Schnappschuß schräg steil von oben machte und dabei die Schuhkappen der hockenden Marktfrau ins Bild kamen, zeugt dieses Foto von der erstaunlichen Größe der Steinpilze. Die beiden jüngeren sind im bauchigen Stiel breiter als die hoch gewölbten Hüte; den fleischigen, in sich gewundenen Leib der älteren beschatten breitrandige, wulstig mal nach innen, mal nach außen gerollte Krempen. Wie sie liegend zu viert ihre hohen und weiten Hüte gegeneinander kehren und dabei vom Fotografen so gelegt sind, daß es kaum zu Überschneidungen kommt, bilden sie ein Stilleben.
\1
Und wahrscheinlich hat der Witwer einen entsprechenden Kommentar gegeben; oder war sie es, die »Schön wie Stillleben« gesagt hat? Jedenfalls fand die Witwe in ihrer Umhängetasche ein Einkaufsnetz für die in Zeitungspapier eingeschlagenen Pilze, zu denen die Marktfrau ein Bund Petersilie legte, als Zugabe.
Er wollte das Netz tragen. Sie hielt fest. Er bat darum. Sie lehnte ab: »Erst schenken und dann schleppen noch.«
Ein kleiner Streit, dieses Hin und Her, wobei der Inhalt des Netzes keinen Schaden nehmen durfte, hielt das Paar an Ort und Stelle, als hätten beide ihren Treffpunkt nicht aufgeben, noch nicht aufgeben wollen. Mal nötigte er ihr, dann wieder sie ihm das Netz ab. Auch die Astern sollte er nicht tragen dürfen. Gut eingespielt, wie seit langem einander vertraut, stritt das Paar. In jeder Oper hätten sie ihr Duett singen können, schon wüßte ich, nach wessen Musik.
Und an Zuschauern fehlte es nicht. Stumm sah die Marktfrau zu. Ringsum war alles Zeuge: der achteckige Wehrturm, dessen neuester Untermieter, die gedrängt volle Wechselstube, seitlich die breit gelagerte, wie von Dünsten geblähte Markthalle, düster Sankt Nikolai, die Bauersfrauen benachbarter Marktstände und mögliche Kundschaft; denn zwischen all dem staute und entzerrte sich ärmlich ein nur der alltäglichen Not gehorchender Menschenauftrieb, dessen knappes Geld stündlich an Wert verlor, während Witwe und Witwer einander wie Zugewinn verrechneten und nicht voneinander lassen wollten.
»Nun muß ich gehn noch woanders.«
»Wenn ich Sie, bitte, begleiten dürfte.«
»Na, ist bißchen weit weg.«
»Es wäre mir eine Freude, wirklich…«
»Aber auf Friedhof muß ich…«
»Wenn ich nicht allzusehr störe…«
»Na, gehn wir schon.«
Sie trug den Asternstrauß. Er trug im Einkaufsnetz die Pilze. Er hager vornübergebeugt. Sie mit kurzen, hart aufstoßenden Schritten. Er, zum Stolpern neigend, leicht schleppend und gut einen Kopf größer als sie. Sie waschblauäugig, er weitsichtig. Ihr in Richtung Tizianrot geschöntes Haar. Sein graumeliertes Oberlippenbärtchen. Sie nahm den Geruch ihres vorlauten Parfüms mit, er die leise Widerrede seines Rasierwassers.
Beide verschwanden im Gedränge vor der Markthalle. Nun war auch des Witwers Baskenmütze weg. Kurz vor Schlag elf von Sankt Katharinen herab. Und ich? Ich muß dem Paar hinterdrein.
Ab wann hatte er vor, mir seinen verschnürten Krempel ins Haus zu schicken? Hätte ihm nicht ein Archiv als Adresse einfallen können? Mußte der Narr sich in mir den gefälligen Narren ausgucken?
Dieser Stoß Briefe, die gelochten Abrechnungen und datierten Fotos, seine mal als Tagebuch, dann wieder als Silo zeitraffender Spekulationen geführte Kladde, der Wust Zeitungsausschnitte, die Tonbandkassetten - all das wäre besser bei einem Archivar abzulagern gewesen als bei mir. Er hätte wissen müssen, wie leicht ich ins Erzählen gerate. Wenn kein Archiv, warum hat er nicht einen eilfertigen Journalisten beliefert? Und was hat mich genötigt, ihm, nein, den beiden nachzulaufen?
Nur weil er und ich vor einem halben Jahrhundert Arsch neben Arsch die Schulbank gedrückt haben sollen? Er behauptet: »In der Bankreihe an der Fensterseite.« Ich kann mich nicht erinnern, ihn neben mir gehabt zu haben. Petri-Oberrealschule. Schon möglich. Aber nur knappe zwei Jahre lang bin ich da rein und raus. Mußte zu oft die Schule wechseln. Mal so, mal so gemischter Pennälerschweiß. Mal so, mal so bepflanzte Pausenhöfe. Weiß wirklich nicht, wer wo und ab wann neben mir Strichmännchen gekritzelt hat.
Als ich das Paket öffnete, lag sein Begleitbrief obenauf: »Du wirst bestimmt irgendwas damit anfangen können, gerade weil alles ans Unglaubliche grenzt.« Er duzte mich, als wäre ihm die Schulzeit unvergänglich geblieben: »In anderen Fächern warst Du gewiß keine Leuchte, aber Deine Aufsätze ließen schon früh erkennen…« Ich hätte ihm seinen Kram zurückschicken sollen, aber wohin? »Im Grunde könnte das alles von Dir erfunden sein, aber gelebt, erlebt haben wir, was vor nunmehr einem Jahrzehnt geschah…«
Er hat sich vorausdatiert. Sein Brief gibt als Datum den 19.Juni 1999 an. Und gegen Schluß schreibt er, bei sonst klarer Diktion, über weltweite Vorbereitungen zur Feier der Jahrtausendwende: »Welch unnützer Aufwand! Dabei geht ein Säkulum zu Ende, das sich Vernichtungskriegen, Massenvertreibungen, dem ungezählten Tod verschrieben hatte. Doch nun, mit Beginn des neuen Zeitalters, wird wieder das Leben…«
Und so weiter. Lassen wir das. Nur so viel stimmt: Sie trafen einander am 2.November bei sonnigem Wetter, wenige Tage bevor in Berlin die Mauer hinfällig wurde. Als eine Allerweltsgeschichte hätte beginnen können, begann sich die Welt oder ein Teil dieser unabänderlichen Welt tatsächlich zu verändern, und zwar ohne Umstände zu machen, im Schweinsgalopp. Überall wurden Denkmäler gestürzt. Mein ehemaliger Mitschüler nahm diese oft gleichzeitig auftrumpfenden Tatsachen in seiner Kladde zur Kenntnis, doch handelte er sie wie bloße Tatsachenbehauptungen ab. Fast widerwillig gab er in Klammersätzen Ereignissen Raum, die allesamt historisch genannt sein wollten, ihn jedoch irritierten, weil sie, schreibt er, »vom Eigentlichen ablenken, von der Idee, von unserer großen, die Völker versöhnenden Idee…«
Und schon bin ich drin in seiner, in ihrer Geschichte. Schon rede ich, als wäre ich dabeigewesen, von seinem Tweedjackett, von ihrem Einkaufsnetz und verpasse ihm eine Baskenmütze, weil es die gibt, wie die Cordhose und ihre Stöckelschuhe, und zwar auf Fotos, die mir schwarzweiß und farbig vorliegen. Wie ihre Schuhgrößen sind ihm ihr Parfüm und sein Rasierwasser mitteilenswert gewesen. Das Einkaufsnetz ist keine Erfindung. Später beschreibt er liebevoll, ja, tickhaft jede Masche des Gebrauchsgegenstandes, als wollte er ihn zum Kultgegenstand erheben; doch die frühe, schon beim Kauf der Steinpilze plazierte Einführung des gehäkelten Erbstücks - die Witwe fand das Netz im Nachlaß ihrer Mutter - ist meine Zutat, wie die vorweggenommene Baskenmütze.
Als Kunsthistoriker und obendrein Professor konnte er nicht anders: Wie er Bodengrabplatten und Grabsteine, Sarkophage und Epitaphe, Beinhäuser, Gruftgewölbe und mottenzerfressene Totenfahnen, die rund um die Ostsee überlieferte Ausstattung gotischer Backsteinkirchen sind, durch Abreibung lesbar, heraldisch bestimmt und emblematisiert, schließlich durch kurzgefaßte Familiengeschichten einst namhafter Patriziergeschlechter beredt gemacht hatte, waren ihm nun die Einkaufsnetze der Witwe - sie erbte nicht nur das eine, sondern ein halbes Dutzend - Zeugnisse vergangener Kultur, verdrängt von häßlichen Wachstuchtaschen und radikal entwertet durch den Plastikbeutel. Er schreibt: »Vier der Einkaufsnetze sind gehäkelter Natur, zwei sind geknüpft, wie früher Fischernetze von Hand geknüpft wurden. Von den gehäkelten ist nur eines einfarbig moosgrün, die drei anderen und die geknüpften Netze sind mehrfarbig gemustert…«
Und wie er in seiner Doktorarbeit die drei Disteln und fünf Rosen im Wappen des Theologen Aegidius Strauch aus dem Flachrelief eines Grabsteins in Sankt Trinitatis, wo Strauch gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts Pfarrer gewesen ist, deutet und mit den Wechselfällen eines streitbaren Lebens in Beziehung setzt - Strauch verbrachte Jahre in Festungshaft -, so deutelte er an den geerbten Einkaufsnetzen der Witwe. Weil sie in ihrer Umhängetasche aus Kalbsleder jederzeit zwei von den sechs mit sich führte, leitete er diese Vorsorge von der in allen Ostblockstaaten herrschenden Mangelwirtschaft ab: »Plötzlich gibt es irgendwo frischen Blumenkohl, Salatgurken, oder ein fliegender Händler bietet neuerdings aus dem Kofferraum seines Polski Fiat Bananen an, und sogleich sind die praktischen Netze greifbar, denn Plastiktüten sind im Osten immer noch rar.«
Und dann beklagt er zwei Seiten lang den Niedergang handgefertigter Produkte und den Sieg des westlichen Kunststoffbeutels als ein weiteres Symptom menschlicher Selbstaufgabe. Erst gegen Schluß seiner Klage werden ihm wieder die Einkaufsnetze der Witwe lieb, prall gefüllt mit Bedeutung. Und solch ein Netz habe ich vorgreifend beim Pilzeinkauf vermutet, und zwar das einfarbig gehäkelte.
Ich lasse den Witwer das Erbstück tragen und muß zugeben, daß ihm, wie er leicht vornübergebeugt neben der stöckelnden Witwe schlurft, außer der Baskenmütze das Einkaufsnetz wie angepaßt ist, als habe nicht sie, als hätte er geerbt, als wäre die japanische Kamera nur geborgt, als werde er von nun an daheim, etwa auf dem Weg zur Ruhr-Universität, seine Fachliteratur, dicke Wälzer zum Thema barocker Emblematik, in einem gehäkelten oder geknüpften Einkaufsnetz tragen.
Auch wenn ich mich an einen Mitschüler seines Namens nicht erinnern kann, schon ist er mir mit seinen eingefleischten Schrullen und beginnenden Altersbeschwerden vertraut; und gleichfalls gewinnt die Witwe, wie sie neben ihm Schritt vor Schritt Richtung Friedhof setzt, durch bloße Willensstärke Kontur: Sie wird ihm das Schlurfen abgewöhnen. Ein langer, dennoch kurzweiliger Fußweg, denn die Witwe unterteilte ihn, indem sie erklärend in knappen, alles verknappenden Sätzen sprach und ab und an ihr Glockenvogelgelächter entließ. Zwischen der Katharinenkirche und der Großen Mühle, an denen vorbei der Radaunekanal kaum noch Wasser führt, sagte sie: »Stinkt schon. Aber was stinkt nicht hier!«, und vor dem Hotelhochbau »Hevelius« wußte sie: »Na, wird werter Herr Zimmer mit Blick haben auf Stadt von ganz oben.«
Doch seitlich der Bibliothek, dann vorm Portal der ehemaligen Petri-Oberrealschule - beides preußisch-neugotische Gebäude, die der Krieg ausgespart hatte - kam der Witwer zum Zug. Er bekannte, frühreif ein Bibliothekshocker gewesen zu sein, nannte den immer noch als Schule betriebenen Kasten »meine ehemalige Penne« und erklärte ihr umständlich diesen Schülerausdruck. Erst als die Jakobskirche hinter ihnen lag, ließ er von seinen Frühprägungen ab: welche Lektüre ihn im Lesesaal der Stadtbibliothek infiziert und zugleich geimpft habe. »Sie können sich nicht vorstellen, wie heißhungrig ich gewesen bin. Zum Beispiel auf alle Knackfuß-Künstlermonographien. Hab’ jeden Band verschlungen…«
Und dann weitete sich vor dem Tor zur Leninwerft - kurz bevor sie umbenannt wurde - der Platz mit den drei hochragenden Kreuzen, an denen gekreuzigt drei Schiffsanker hängen. Die Witwe sagte: »Das war mal gewesen Solidarność« und hatte dann doch einen weiteren Satz übrig, der die Schroffheit ihres Nachrufs ein wenig mildern sollte: »Aber Denkmäler bauen können wir Polen immer noch. Überall Märtyrer und Denkmäler von Märtyrer!« Kein Gelächter vor- oder nachgestellt.
Der Witwer will diesem Satz der Witwe »eine an Verzweiflung grenzende Bitterkeit« abgehört haben. Nur stumme Gesten seien ihr übriggewesen. Dann habe sie einen Asternstiel aus dem Strauß gerupft, diesen zu den gehäuften Blumen vor die Gedenkmauer gelegt und ihm auf seine Bitte hin ein dem Denkmal eingeschriebenes Gedicht des Dichters Czesław Miłosz Zeile nach Zeile übersetzt: die Vergeblichkeit feiernde Verse. Danach habe sie unvermittelt sich selbst und ihre Familie mit dem Dichter und dessen Familie als »vertriebene Flüchtlinge von Osten weg nach westliche Gegend« vereinigt und sogleich einen weiteren Bogen geschlagen: »Wir sind alle von Wilno rausgemußt, wie Sie sind von hier weggemußt alle.«
Noch auf dem Platz, doch schon im Gehen, griff sie zur Zigarette.
Um den weiteren Weg der beiden zum Friedhof abzukürzen: Rauchend führte die Witwe den Witwer aus der Stadt über eine Brücke, die, seit Niederlegung der Befestigungswälle und dem Bau des Hauptbahnhofs, alle von Danzig oder Gdánsk nach Westen führenden oder aus westlicher Richtung nach Gdánsk oder Danzig laufenden Eisenbahngleise überwölbt. Da in des Witwers Notizen polnische und deutsche Schreibweisen willkürlich wechseln, folge ich seinen unentschlossenen Benennungen, sage nicht Brama Oliwska, sondern: Die Witwe führte ihn aus der Stadt hinaus zur Straßenbahnhaltestelle Olivaer Tor, dann auf der links abzweigenden Chaussee nach Kartuzy den sanft anhebenden Hagelsberg hinauf bis zur Tankstelle für bleifrei tankende Touristen, der gegenüber ein alter, von Buchen und Linden verschatteter Friedhof liegt, der vormals den Kirchgemeinden Heiliger Leichnam, weiter oben Sankt Joseph und Sankt Birgitten und am westlichen Rand etlichen freireligiösen Gemeinden diente. Weil schon seit Jahren überfüllt, schien er außer Betrieb zu sein. Kein offenes Tor gab den Zugang frei. Sie liefen den vom Gebüsch durchwachsenen Zaun entlang. Gegenüber dem auf ansteigender Wiese benachbarten Soldatenfriedhof mit Ehrenmal der Roten Armee, auf dessen Vorfeld ein Dutzend Halbwüchsige Fußball spielten, wußte die Witwe ein Loch im Zaun.
Und dann - kaum standen sie unter Bäumen und zwischen überwucherten Einzel- und Doppelgräbern - stellte sich der Witwer förmlich der Witwe vor: »Gestatten Sie, daß ich mich Ihnen, natürlich viel zu spät, bekannt mache: Alexander Reschke mein Name.«
Ihr Lachen brauchte Zeit und muß auf ihn, zumal zwischen Grabreihen, deplaziert gewirkt haben, erklärte sich aber, als nun sie, immer noch lachend, gleichzog: »Alexandra Piątkowska.«
In Reschkes Kladde ist mit dieser Eintragung die Fügung besiegelt. Was hilft es, wenn seinem nur berichtenden Mitschüler - man wird uns als Untertertianer in eine Schulbank gezwängt haben - dieser Gleichklang zu stimmig ist, passend allenfalls für ein Singspiel nach berühmtem Vorbild, geeignet für Märchenfiguren, doch nicht für dieses vom Zufall verkuppelte Paar; es muß dennoch bei Alexander und Alexandra bleiben, schließlich ist es deren Geschichte.
Doch auch den Witwer und die Witwe, wie ich sie bisher nannte, selbst wenn ihnen nicht bewußt sein konnte, daß sie einander verwitwet zugelaufen waren, wird die Distanzlosigkeit der Vornamen erschreckt haben. Auf Eigenständigkeit aus, suchte Alexandra Piątkowska ihren Weg zwischen Gräberfeldern. Sie verschwand hinter Grabsteinen, tauchte wieder auf, war abermals weg, entfernte sich; und Alexander Reschke hielt gleichfalls Abstand. Wo Herbstlaub raschelte, schlurfte er auf bemoosten Wegen. Seine Baskenmütze verdeckt, wieder da. Wie ziellos zögerte er vor diesem, vor jenem Grabstein: viel Diabas und auf Hochglanz polierter Granit, wenig Sandstein, Marmor und Muschelkalk.
Alle Steine sagten unter polnischen Namen Sterbedaten ab Ende der fünfziger Jahre auf, nur jene zahlreichen, in einem abseits liegenden Feld gereihten Kindergräber nicht, die auf das Seuchenjahr ’46 datiert waren: Holzkreuze und Kissensteine. Die Stille unter den Friedhofsbäumen ließ sich durch das entfernte Geschrei der Fußball spielenden Halbwüchsigen nicht aufheben, sogar die Geräusche der Tankstelle blieben ausgesperrt. Ich lese: »Hier wurde mir das Wort Friedhofsruhe wieder bewußt.«
Dennoch war Alexander Reschke auf Suche. Er fand am Rand des Friedhofs zwei schiefstehende Steine, später zwei weitere, gänzlich verkrautet, und hatte Mühe, ihnen irgendwas abzulesen. Mit weit zurückliegenden Sterbedaten - Anfang der zwanziger bis Mitte der vierziger Jahre - und mit Inschriften über den Namen - »Hier ruht in Gott«, »Der Tod ist das Tor zum Leben« oder »Hier liegt unsere liebe Mutti und Omi« - erinnerten sie an die Vorvergangenheit der Friedhofsanlage. Reschke notiert: »Auch diese Steine aus üblichem Material: Diabas und schwarzschwedischer Granit.«
Für ein Weilchen lasse ich ihn bei den übriggebliebenen Steinen. Frau Piątkowska wird inzwischen den Strauß Astern am Grab ihrer Eltern in eine Vase gestellt haben. Dieser Doppelgrabstelle sage ich nach, daß sie, buchsbaumumrandet, weniger überwuchert ist als die benachbarten Grabstellen. Der Vater starb ’58, die Mutter ’64. Beide sind keine siebzig Jahre alt geworden. Auf allen Feldern kann ich Allerseelen-Betrieb beobachten: Hier und da bezeugen Windlichter an Grabstellen Besuch, der wieder gegangen ist.
Doch Witwe und Witwer hatten keinen Blick frei.
»War bei Mama und Papa. Was mein Mann ist gewesen, liegt auf Waldfriedhof Sopot.« Das sagte Alexandra Piątkowska, als sie sich neben Alexander Reschke stellte, den die übriggebliebenen Grabsteine um die Gegenwart gebracht hatten; die Stimme seitlich hinter ihm wird ihn vielleicht erschreckt, jedenfalls zurückgeholt haben.
Wieder das Paar. Weil sie sich als Witwe zu erkennen gegeben hatte, hätte nun er vom Tod seiner Frau sprechen müssen und gleichfalls vom frühen, zu frühen Tod der Eltern, doch trug er seinen Berufsstand nach, gab sich als Doktor der Kunstgeschichte und Professor mit Lehrtätigkeit im Ruhrgebiet zu erkennen, wollte, um gründlich zu sein, das Thema seiner vor Jahrzehnten abgeschlossenen Doktorarbeit, »Grabplatten und Epitaphien in den Danziger Kirchen«, nicht verschweigen und datierte jetzt erst, unvermittelt, den Tod seiner Frau: »Edith starb vor fünf Jahren.«
Die Witwe schwieg. Dann trat sie näher, noch einen Schritt näher an die schiefstehenden Grabsteine heran, die dem Witwer bemerkenswert gewesen waren. Plötzlich und für den Ort zu laut entlud sie sich: »Schande für Polen ist das! Haben weggeräumt alles, wo bißchen stand deutsch drauf. Hier und überall. Auch auf Waldfriedhof. Haben Tote nicht ruhen lassen gewollt. Einfach plattgemacht alles. Bald nach Krieg schon und später. Schlimmer wie Russen noch. Und das nennen sie Politik, Verbrecher diese!«
Wenn ich Reschkes Notizen folge, versuchte er, die laut gewordene Witwe zu beruhigen, indem er den Einmarsch in Polen, die Konsequenzen des Krieges und den allseits überbetonten Nationalismus als Gründe in etwa dieser Reihenfolge nannte: Natürlich grenze das Auslöschen von Friedhöfen an Barbarei. Auch ihn, das müsse er zugeben, stimme der Anblick solch vergessener Grabsteine wehmütig. Gewiß wünsche man sich humaneren Umgang mit Toten. Schließlich sei das Grab des Menschen letztgültiger Ausdruck. Doch immerhin habe man die Grabplatten über den Gräbern deutschstämmiger Patriziergeschlechter in allen Hauptkirchen, auch in der Hospitalkirche zum Heiligen Leichnam, vor Vandalismus weitgehend geschützt. Nein, nein, er verstehe ihren kaum zu beschwichtigenden Zorn. Durchaus vertraut sei ihm der Wunsch, die Gräber der nächsten Angehörigen in gutem Zustand zu wissen. Bei seinem ersten Nachkriegsbesuch in Gdánsk - »Das war im Frühjahr ’58, als ich an meiner Doktorarbeit saß« - habe er das Grab der Großeltern väterlicherseits auf den einst Vereinigten Friedhöfen besuchen wollen. Ja doch, schrecklich sei es gewesen, einen wüsten, wie vom Mutwillen heimgesuchten Ort vorzufinden. »Dieser Anblick! Glauben Sie mir, Frau Piątkowska, ich begreife Ihre Empörung. Mir allerdings war nur Trauer möglich, die sich durch mittlerweile geschichtlich gewordene Tatsachen relativiert hat. Schließlich ist diese Barbarei zuallererst von uns begangen worden. Ganz zu schweigen von all den anderen unsäglichen Untaten…«
Das Paar schien gemacht für solche Gespräche. Er beherrschte den hohen Ton gehobener Sprache; sie konnte glaubhaft in Wut geraten. Unter hochragenden, allen politischen Wechselfällen entwachsenen Buchen und Linden, die ihr Laub fallen ließen, und angesichts der beiden schiefstehenden Grabsteine waren sich Witwe und Witwer einig, daß irgendwo und ganz gewiß auf Friedhöfen die verfluchte Politik aufhören müsse. »Sag’ ich ja«, rief sie, »mit Tod hört Feind auf, Feind zu sein.«
Sie nannten einander Herr Reschke und Frau Piątkowska. Nach jeweiligem Bekenntnis entspannt, bemerkten sie plötzlich, daß nah und fern weitere Friedhofsbesucher mit Blumen und Windlichtern ihrer Toten gedachten. Und jetzt erst sagte die Witwe, was wörtlich die Kladde des Witwers festgehalten hat: »Natürlich wollten Mama und Papa viel lieber auf Friedhof in Wilno zu liegen kommen und nicht hier, wo fremd war alles und ist geblieben fremd.«
War das schon der zündende Satz? Oder blieb ihr Friedhofsgespräch weiterhin von abgeräumten Grabsteinen beschwert? Mein ehemaliger Mitschüler, der seinen Doktor gemacht und es bis zum Professor gebracht hat, Reschke, dieser Zunftmeister erhabener Rede, überliefert mir zwar eine Galerie gereihter Stimmungsbilder - »Die herbstlichen Bäume gaben dem Ort der Vergänglichkeit ihren wortlosen Kommentar…« oder: »So hat der wuchernde Efeu die gewaltsame Räumung des Friedhofs überstanden und ist auf ihm gemäße Weise siegreich, wenn nicht unsterblich geblieben…« -, doch erst nach einer kritischen Bemerkung - »Mußte sie unbedingt auf dem Friedhof rauchen!« - gesteht er ein: »Warum zögerte ich, Alexandra von den gewiß bodenlosen Hoffnungen meiner Eltern zu berichten, die, selten ausgesprochen, nur dieses Ziel hatten: daheim begraben zu werden, einst doch noch in Heimaterde ruhen zu dürfen; wenngleich beide keine Rückkehr zu Lebzeiten erhofft haben? Wie Alexandras Eltern mußten sie sich mit der Fremde vertraut machen.«
Das Paar blieb. Ihr Friedhofsgespräch kannte kein Ende. Schließlich fanden sie eine gußeiserne Bank, der es gelungen war, mit dem Efeu zu überdauern. Von Taxusgebüsch abgeschirmt, saßen sie. Nach Reschkes Eintragungen sei einzig die benachbarte Großtankstelle von dieser Welt gewesen, denn den Halbwüchsigen habe das Fußballspiel im Vorfeld des sowjetischen Soldatenfriedhofs keinen Spaß mehr gemacht. Und rauchend, immerfort rauchend, als werde Erinnerung durch Zigarettenpaffen gefördert, habe Alexandra - so heißt sie jetzt in seinen Papieren - von ihrer Kindheit und den Jugendjahren in Wilno erzählt, wie Vilnius oder Wilna auf polnisch genannt wird. »Das hat alles, als Piłsudski von Litauen weggenommen hat, wieder Polen gehört. War weiß und gold von Barock. Und um schöne Stadt rum stand Wald, immerzu Wald…«
Dann, nach lustigen Schulgeschichten, in denen es um Freundinnen, unter ihnen zwei jüdische, um Ferien auf dem Land und um das Absammeln von Kartoffelkäfern ging, sei ihr abrupt der Faden gerissen: »Nur im Krieg war schrecklich in Wilno. Seh’ ich noch Tote auf Straße liegen.«
Wieder das Geräusch der Großtankstelle. Die Friedhofsbäume ohne Vögel. Die Raucherin, der Nichtraucher. Das Paar auf gußeiserner Bank. Und plötzlich dann, weil ihr das Plötzliche lag und weil sie dem Gleichklang der Vornamen und dem gemeinsamen Stand des Verwitwetseins noch eine weitere Doppelung draufsetzen wollte, überraschte ihn ihre berufliche Erklärung: »Bin ich von gleiche Fakultät wie der Herr. Aber Kunstgeschichte nur sechs Semester und Professor kein bißchen. Dafür praktisch, sehr praktisch!«
Reschke erfuhr, daß die Piątkowska seit gut dreißig Jahren als Restauratorin tätig gewesen und als Vergolderin spezialisiert war. »Na, alles. Mattvergoldung und Glanzvergoldung mit Blattgold aus Dukatengold. Nicht nur Barockengel, auch Polimentvergoldung auf Stuckmarmor. Und bin gut für geschnitztes Rokokoaltar. Überhaupt Altäre. Hab’ ich drei Dutzend schon fertig. In Dominikanerkirche und überall. Kriegen wir Material aus Dresden, VEB Blattgold, wo volkseigene Goldschlägerei ist…«
Muß das unter Friedhofsbäumen, die sich zusehends entblößten, ein Fachsimpeln zwischen dem Emblematiker und der Vergolderin verschnörkelter Embleme gewesen sein! Wenn er von den achtunddreißig bei Curicke aufgeführten Epitaphen in Sankt Marien erzählte, gab sie Bericht von ihrer vergoldenden Arbeit an einem lange verschollenen Epitaph aus dem Jahr 1588. Sprach er vom niederländischen Manierismus, zählte sie das halbe Pferd im roten Feld und die drei Lilien auf blauem Grund im Wappen des Jakobus Schadius als vergoldenswert auf. Er lobte die Anatomie der im Relief aus Gräbern auferstandenen Knochengerüste, sie erinnerte ihn an den goldenen Anfangsbuchstaben auf schwarzem Grund im unteren Breitoval. Er lockte sie treppab in Gruftgewölbe, sie führte ihn in Sankt Nikolai von Altar zu Altar.
Nie ist zwischen Grabsteinen so viel von Goldgründen, Poliergold, Handvergoldung und handwerklichem Zubehör, dem Vergolderkissen, dem Vergoldermesser geredet worden. Man hätte, nach Reschke, der bis zu den Pharaonengräbern zurückging, Gold zur eigentlichen Totenfarbe ausrufen müssen: Gold auf Schwarz. Diese zwischen Rotgold und Grüngold schillernde Verklärung. »Des Todes güldener Abglanz!« rief er und konnte sich nicht genugtun.
Erst als die Piątkowska von einer Jahre zurückliegenden Tätigkeit berichtete, die ihr den Orgelprospekt der Johanniskirche, der im Krieg ausgelagert worden war und so gerettet wurde, bis ins Detail vertraut gemacht hatte, gewann wieder ihr Lachen Vorhand: »So was muß mehr sein. Ihr kauft mit Deutschmark Orgel ganz neu für Kirche Marii Panny. Wir machen alten Prospekt schön mit Blattgold, was kostet nicht viel.«
Dann schwiegen sie. Oder richtiger: Ich vermute Schweigen zwischen dem Paar. Doch der Nachweis deutsch-polnischer Zusammenarbeit in Sachen Orgel und Orgelprospekt war wiederum von zündender Qualität. In Reschkes Kladde steht: »So muß es sein! Warum nicht gleichermaßen sinnvoll auf anderem Gebiet?«
Möglich, daß sich die Raucherin und der Nichtraucher noch zwei, drei Zigaretten lang der Friedhofsstimmung überlassen haben. Vielleicht nahm ihre Idee erste Gestalt an, um sich mit dem Zigarettenrauch wieder zu verflüchtigen. Jedenfalls lag sie in der Luft, wollte ergriffen werden.
Er teilt mit, Alexandra habe ihn dann noch ans Grab ihrer Eltern geführt, nein, gebeten: »Ich werd’ froh sein, wenn Sie kommen möchten an Grab von Mama und Papa.«
Angesichts zweier Windlichter beiderseits der Vase mit den rostroten Astern vor dem breitformatigen Granit - mit übrigens frisch vergoldeter Schrift - ist es unvermittelt wieder die Witwe gewesen, die der Handlung Auftrieb gab. Als wäre ihr am Elterngrab mütterlicher Rat erteilt worden, wies die Piątkowska mit Fingerzeig auf das gehäkelte Erbstück, das dem Professor noch immer anhing, lachte kurz auf und sagte: »Jetzt mach’ ich uns Pilze fein mit kleingehackt Petersilie drauf.«
Durch das Loch im Friedhofszaun wechselten sie in die frühnachmittägliche Gegenwart. Nun trug die Witwe das Einkaufsnetz. Der Witwer hatte sich fügen müssen und auch diesmal keinen Hinweis auf Tschernobyl und die Folgen gewagt.
Sie nahmen die Straßenbahn und fuhren am Hauptbahnhof vorbei bis zum Hohen Tor, das Brama Wyżynna heißt. Alexandra Piątkowska wohnte in der ul. Ogarna, die, rechter Hand und parallel zur Langgasse, dem Verlauf der ehemaligen Hundegasse folgt. Diese Gasse, die wie die übrige Stadt gegen Kriegsende bis auf Fassadenreste niederbrannte, wurde im Verlauf der fünfziger Jahre täuschend getreu wieder aufgebaut und verlangt, wie alle Haupt- und Nebengassen der auferstandenen Stadt, nach einer gründlichen Restaurierung: So mürbe bröckelt von den Gesimsen der Stuck. Reschke sah blasigen Putz abblättern. Vom Hafen her wehende Schwefeldünste hatten alle steingehauenen Giebelfiguren entstellt. Vor der Zeit gealtert. An einige besonders hinfällige Fassaden gelehnt, standen schon wieder Gerüste. Ich lese: »Dieser viel bewunderten, aufwendig fortwährenden Täuschung ist kein Ende gesetzt.«
Da Wohnungen im historischen Bereich der Alt- und Rechtstadt begehrt waren und nicht ohne Parteilichkeit vergeben wurden, wird der Piątkowska ihre bis Anfang der achtziger Jahre aufrechterhaltene Mitgliedschaft in der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und mehr noch ihre Tätigkeit als mit Verdienstorden dekorierte Restauratorin nützlich gewesen sein. Sie wohnte dort seit Mitte der siebziger Jahre. Zuvor hatte sie mit ihrem Sohn und ihrem Mann, bis zu dessen vorzeitiger Pensionierung - »Jazek war bei Handelsmarine« -, zwei Zimmer in einer Neubausiedlung zwischen Sopot und Adlershorst, dem heutigen Orłowo, bewohnt, weshalb ihr ein langer Arbeitsweg zu den Werkstätten der Innenstadt vorgeschrieben war; verständlich, daß sie bei der Partei Beschwerde führte. Als langjähriges Mitglied - sie gehörte schon ’53, bei den Weltjugendfestspielen in Bukarest, dazu - glaubte sie, nahegelegenen Wohnraum beanspruchen zu können. Damals befanden sich die Ateliers der Restauratoren und Vergolder im Grünen Tor, einem Renaissancegebäude, das die Langgasse und den Langen Markt in östlicher Richtung zum Fluß, zur Mottlau hin, abschließt.
Wenige Jahre nach dem Umzug in die Hundegasse starb ihr Mann an Leukämie. Und als sich Witold, der spät geborene einzige Sohn, gleich zu Beginn der achtziger Jahre - kaum hatte der General das Kriegsrecht ausgerufen - nach Westen absetzte, um in Bremen zu studieren, war die Witwe in der vormals engen, nun geräumigen Dreizimmerwohnung allein, aber nicht unglücklich.
Dem Doppelhaus ul. Ogarna 78/79 hatte die Baugeschichte, wie sonst keinem Haus in der Hundegasse, als Terrasse einen Beischlag zugestanden. Während der Kriegsrechtszeit war zuunterst und hinter eigenem Portal die Regierungsagentur »Polska Agencja Interpress« eingezogen, die nun einen privaten Status suchte. Den geräumigen Beischlag grenzten zur Gasse hin in Sandstein gehauene Reliefs ab: Amoretten mit Amor im Spiel. Reschke beklagte deren Zustand: »Man wünschte sich diese heiteren Zeugnisse bürgerlicher Kultur vor Steinfraß und Moosbefall geschützt.«
Die Wohnung im dritten Stock lag am Ende der Gasse, die wie alle nach Osten laufenden Gassen der Rechtstadt mit einem Tor, dem Kuhtor, zur Mottlau hin ausläuft. Vom Wohnzimmer aus gesehen, standen der schlanke Rathausturm und der stumpfe Turm der Marienkirche im Blick, beide von den Giebeln der gegenüberliegenden Häuserfront im oberen Drittel wie abgeschnitten. Das Zimmer des Sohnes, nun Arbeitszimmer der Piątkowska, öffnete nach Süden hin Aussicht über die Schnellstraße. Dort war im vormals Poggenpfuhl genannten Teil der Vorstadt nur die Petrikirche geblieben. Auch das gleichfalls nach Süden gelegene Schlafzimmer zeigte die Witwe dem Witwer mitsamt angrenzendem Bad. Und in der Küche neben dem Wohnzimmer sagte Alexandra Piątkowska: »Sie sehen, der Herr, ich lebe in Luxus schon, wenn man Vergleich macht mit allgemeine Verhältnisse.«
Warum, verdammt, bin ich mitgegangen? Was zwingt mich, ihm nachzurennen? Und was habe ich auf Friedhöfen oder in der Hundegasse zu suchen? Warum überhaupt sitze ich seinen Spekulationen auf? Vielleicht, weil die Witwe…
In seinen Notizen hat Reschke, gleich nach der Beschreibung der Dreizimmerwohnung, noch einmal rückblickend ihre Augen auf sich wirken lassen: »Unter den Friedhofsbäumen wandelte sich das Waschblau ihres Blicks zum Lichtblau, wobei die strahlende Helligkeit durch schwarze, ich meine, zu schwarz getuschte Wimpern gesteigert wurde. Als wirr stehende Spieße umzäunten sie die oberen, die unteren Augenlider. Dazu vielfach verästelte Lachfalten…« Und dann erst zitierte er seine Angaben zu westlichen Wohnverhältnissen: »Auch ich bewohne nach dem Tod meiner Frau - es war Krebs - und seitdem die Töchter außer Haus sind, eine allerdings geräumige Dreizimmerwohnung von studioartigem Zuschnitt, freilich in einem unansehnlichen Neubau mit wenig imposantem Ausblick. Eine Industrielandschaft, die von relativ viel Grünfläche aufgelockert wird…«
Hier unterbrach bis in die Küche hinein das langanhaltende und tragisch klingende Glockenspiel vom Rathausturm her ihren westöstlichen Wohnungsvergleich; sie werden noch oft so einprägsam unterbrochen werden. Nach letztem Ton kommentierte die Witwe: »Bißchen laut. Aber gewöhnt man sich an Gebimmel.«
Aus seiner Kladde weiß ich, daß sie ihm zum Petersiliehacken eine Küchenschürze umgebunden hatte. Sie putzte die vier dickbauchigen, breitkrempig und bucklig beschirmten Steinpilze, deren Stiele weder holzig noch wurmstichig waren. Wenig Abfall: außer dem moosigen Unterfutter der Pilzhüte geringe Schneckenfraßspuren. Dann bestand er darauf, ihr beim Kartoffelschälen zu helfen. Das gehe ihm, weil seit dem Tod seiner Frau geübt, leicht von der Hand.
Der die Küche besetzende Geruch der Steinpilze nötigte beide, sich in Benennungen zu versuchen. Ich kann bei Reschke nicht lesen, ob er oder sie den Ausdruck »erregender Geruch« gewagt hat. Ihn erinnerten die Steinpilze an seine Kindheit, als er mit der Großmutter mütterlicherseits in den Mischwäldern um Saskoschin Pfifferlinge gesucht habe. »Solche Erinnerungen haften stärker als alle Pilzgerichte, die in italienischen Gaststätten auf den Tisch kommen, letztmalig in Bologna, als ich mit meiner Frau…«
Sie bedauerte, noch nie in Italien gewesen zu sein, doch hätten längere Aufenthalte in Westdeutschland und Belgien Ersatz geboten: »Polnische Restauratoren bringen Devisen. Na, wie polnische Mastgänse sind gut für Export. War auf Arbeit in Trier, Köln und Antwerpen schon…«
»Sie benutzt die Küche gelegentlich als Werkstatt«, schreibt Reschke und weist auf ein Regal voller Flaschen, Dosen und Werkzeug hin. Die Steinpilze hätten den anfänglich vorherrschenden Firnisgeruch »und obendrein Alexandras Parfüm« übertönt.