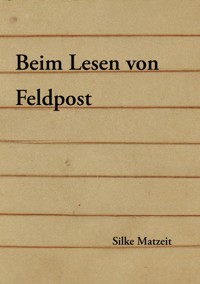
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"In Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte", hat der Historiker Raul Hilberg einmal geschrieben. Doch auch mehr als 75 Jahre nach Kriegsende ist das Wissen darüber verschüttet oder verdrängt. Die Kriegserlebnisse und die Täterschaft der Vorfahren, ihre Unterstützung für den Nationalsozialismus, Verlust, Schuld und Scham: in deutschen Familien wird darüber oft kaum gesprochen. Am Beispiel ihres Großvaters Erhard Richter und seiner Feldpost aus West- und Ostfront zeigt Silke Matzeit in diesem Essay ihre ganz persönlichen Wege auf, die kollektive und die eigene Familiengeschichte zu erforschen, zu betrauern und damit leben zu lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Fünf Erlebnisse, oder: Der Krieg in mir
2. Recherche: Die Kinder und Enkel der Kriegsgeneration
2.1. Erinnerungen
2.2. Familienerzählungen, die Nazizeit und das „kommunikative Gedächtnis“
3. Mein Erinnerungen, meine Quellen
4. Mein Großvater
5. Die Feldpost und ich
5.1. Sterben im Krieg
5.2. Verbrechen
5.3. Marschieren
5.4. Uniformen
5.5. Vormarsch / Ukraine
5.6. Die Familie und der Soldat
5.7. Strategie und Kriegsführung
5.8. Frauen
5.9. Essen
5.10. Versorgung – etwa zeitgleich – an der „Heimatfront“
5.11. Pferde
5.12. Die Dörfer: „Tote Zonen“ und der angebliche „Kampf gegen Partisanenunterstützer“
5.13. Verwundung
5.14. „Evakuierung“, „Aussiedlung“ und „Umsiedlung“
5.15. Verbrannte Erde
5.16. Das Haus durch den Schornstein verlassen
5.17. Flucht und Vertreibung
5.18. „Volksdeutsche“: Verschleppung und Arisierung
5.19. Erleichterung, „hinten“ zu sein
5.20. Verhalten der Truppe und die Frage nach dem Humanismus
5.21. Propaganda und Zweifel
5.22. Karriere und „neue Normalität“
5.23. Sorge; Angst
5.24. Ungewisse Zukunft
5.25. Die letzte Reise
5.26. Deportation und Zwangsarbeit
5.27. Lager
5.28. Krieg als Arbeit, und die Arbeitskollegen/ Kameraden als einzige Bezugsgruppe
5.29. Der Führer und der „Endsieg“
5.30. Hitze und Kälte
5.31. Der nahende Winter
5.32. Sarkasmus und wankende Illusionen
5.33. Angst um die Familie; Hoffnung auf Zukunft in der Heimat
5.34. Weihnachten
5.35. Tod
6. Gedenken und leben
7. Aufbruch
Literatur und Inspiration
Liebe Leserinnen und Leser,
als ich diese Zeilen schreibe, ist wieder Krieg in der Ukraine, dem Schauplatz dieses Essays. Vergessene Namen, Orte tauchen in den Nachrichten auf; wir überschreiben mit Neuigkeiten von heute bereits das, was sich dort vor nur zwei Generationen abspielte. Aber wie beim Aufeinanderlegen verschiedener Dias verschwinden die alten Bilder nicht völlig. Sie sind Bestandteil des Ganzen, des Aktuellen. Die Ukraine, das ist ein Land im Krieg, damals wie heute. Ein Land, das von Aggressoren bekämpft wird und sich zu wehren weiß. Ein Land, das auch Landschaft meiner Seele ist, Schauplatz meiner Träume und Alpträume. Die Ukraine ist für mich das Tor zum Verborgenen. Eine Reise zum Krieg in mir.
Mein Großvater Erhard Richter hat den Zweiten Weltkrieg in Frankreich und an der Ostfront nicht nur miterlebt, sondern als Offizier der Wehrmacht auch mitgetragen. Als Zeugnis seines Lebens, seiner Reise und seiner Gedankenwelt sind zahlreiche Briefe überliefert, die die Grundlage für dieses Essay bilden. Ihre Lektüre war für mich der Kristallisationspunkt, von dem aus der Nebel der Geschichte zu etwas Konkretem werden konnte. Das Lesen selbst war für mich also auch eine Reise.
Warum musste dieses Essay für mich sein? Warum lässt man die alten Briefe nicht einfach im Schrank? Ich kann es nicht genau benennen, aber für mich darf der Schatz nicht einfach liegenbleiben, wo er ist. Ein Schatz kann leicht auch ein Fluch sein oder werden. Er möchte ans Tageslicht. Ich glaube: Ohne den Blick in die Vergangenheit laufen wir blind durch unsere Erinnerungen, durch unser Inneres. Die Vergangenheit ist ohnehin niemals abgeschlossen. Unsere Aufgabe ist es, ihr „unversöhnlich“ gegenüberzustehen und ihr gleichzeitig Platz zu geben im Eingedenken. So kann Zukunft eine Chance haben.
Die Frage bleibt also: Wie kann ich weiterleben nach dem, was meine Großeltern getan haben? Welche Bedeutung haben ihre Träume (und ihre Taten) für mich, für meine Generation, die „Baby-Boomer“? Ich bin Vertreterin der letzten Generation, die diese Großeltern noch persönlich kannte. Was haben wir davon bereits weitergegeben an die eigenen Kinder? Es lohnt sich, da noch einmal genauer hinzusehen. Dies habe ich im meinem Essay versucht.
Als Leserin oder Leser können Sie mir dabei entweder auf dem ganzen Weg folgen oder dieses Essay selektiv lesen. Es ist eine lose Kette von verschiedenen Textsorten: Berichte vom Frontgeschehen in den späten Kriegsjahren, Einblicke in Forschungsergebnisse, meine assoziativen Träume und literarischen Texte, und natürlich hauptsächlich Auszüge aus der Feldpost meines Großvaters, zum Teil von mir kommentiert. Die unterschiedlichen Schriftarten sollen dabei als Wegmarken und Orientierung dienen.
Außerdem ist mein Essay in verschiedene Kapitel unterteilt, die auch für sich stehen können:
Im ersten Kapitel beschreibe ich fünf auslösende Erlebnisse.
Im zweiten Kapitel geht es – eher allgemein – um die Kinder und Enkel der Kriegsgeneration, über das Erinnern von Krieg und Holocaust, auch in Familienerzählungen bis heute. Im dritten Kapitel kommt mein erster Traum ins Spiel. Ich mache mich auf den Weg.
Im vierten Kapitel skizziere ich das zivile und militärische Leben meines Großvaters und die Entstehungsumstände der Feldpost. Ich beschreibe, was mich daran bewegt.
Im fünften – längsten – Kapitel beschäftige ich mich in chronologischer Folge mit 35 Themen bzw. Ereignissen aus der Feldpost, die in sich weitgehend unabhängig voneinander sind.
Kapitel Sechs ist dem „Gedenken“ und Kapitel Sieben dem „Aufbruch“ gewidmet.
Kommen Sie mit mir auf die Reise in das unbekannte Land des Erinnerns!
Berlin, im April 2023
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut
In der wir untergegangen sind
Gedenkt,
Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht
Auch der finsteren Zeit
Der ihr entronnen seid.
Bertolt Brecht, „An die Nachgeborenen“, 1952
1. Fünf Erlebnisse, oder: Der Krieg in mir
Ushgorod/Ukraine, Sommer 2009
Wir kommen an. Weites, warmes Land, diesig. Bahnhöfe. Bahnübergänge, niedrige Orte. Brache, Korn. Hinter dem nächsten Berg erahne ich etwas.
… hier war ich schon einmal!
Ich bin in einer Gruppe von Wissenschaftlern unterwegs an den Außengrenzen der EU. Wir besuchen auch eine katholische Kirche. Halbverfallen, dunkel, feucht. Votivbilder „Der Herr hat geholfen“ in tausend Variationen, im Vorraum, im Westwerk. Draußen Idylle, Verfall. Ein Gutshof. Ein Friedhof. Vor dem Friedhof habe ich Angst. Ich gehe da nicht hin.
Gorki-Theater, Berlin 2014
Ich bin mit meiner Tochter in einem Stück zum Jugoslawienkrieg. Dokumentartheater über Schuld, Erinnern, Vergessen. Darüber, ob Vergebung möglich wäre. Es erwischt mich kalt, versetzt mich in Panik. Fluchtreflexe. Ich hatte offenbar vollkommen verdrängt, wie traumatisch dieser Krieg mitten in Europa auf mich als junge Erwachsene eingewirkt hat.
Ich bin damals die Donau abgefahren, es war kurz vor dem Jugoslawienkrieg, von West nach Ost, von der Quelle bis zur Mündung, von Deutschland bis zum Schwarzen Meer. Der Weg: mit dem Fahrrad, dem Drahtesel. Genügend Autos gab es damals ja auch nicht. Damals, als die Wehrmacht hier war.
Berlin, 1988
Ich lebe jetzt in der Frontstadt, der geteilten Stadt: An einem Ort schmerzhafter jüngster Geschichte. Es gilt formal immer noch Kriegsrecht. Überall Soldaten. Freunde oder Feinde. „Wer seinen Personalausweis vergessen hat, kann erschossen werden“. Thema meiner Arbeit zum zweiten Staatsexamen: Der Truppenabzug der Amerikaner.
Gorki-Theater, Berlin 2015
Die Nibelungen. Hagen von Tronje, gespielt von Dimitri Schaad, hält seinen berühmten Monolog, in dem er erklärt, warum er Siegfried töten musste: Zum Wohle des Landes. Für die Ehre.
In diesem Stück wird ein modernisierter, bearbeiteter Text verwendet. Hagen benutzt ein Zitat von Außenminister Guido Westerwelle (FDP): „Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt - und das bin ich.“ Mir läuft es kalt den Rücken herunter. Das Publikum klatscht. Dann geht Hagen – fast unmerklich – in Zitate von Joseph Goebbels über, aus der Sportpalastrede. „Das Abendland steht in Gefahr.“ „Unser Kampf ist eine Bewährungsprobe. Die Frage ist also nicht die, ob die Methoden, die wir anwenden, gut oder schlecht sind, sondern ob sie zum Erfolge führen.“ Das Publikum lacht, klatscht. Auch noch, als Hagen weiterspricht: „Ich gebe meiner tiefen Überzeugung Ausdruck, daß das deutsche Volk durch den tragischen Schicksalsschlag von Stalingrad innerlich auf das Tiefste geläutert worden ist. Es hat dem Krieg in sein hartes und erbarmungsloses Antlitz hineingeschaut. Es weiß nun die grausame Wahrheit und ist entschlossen, mit dem Führer durch dick und dünn zu gehen.“ Mir wird schlecht.
Freie Universität, 1992
In meinem literaturwissenschaftlichen Studium, in Musik und Kulturwissenschaft ist mein Thema „Parzival“: Die Frage, die man nicht stellen darf. „Nie sollst Du mich befragen“. Die Frage danach, ob man miteinander verwandt ist. Die Frage danach, was geschieht, wenn man unwissentlich seinen Bruder tötet; seinen Vater.
Je älter ich werde, desto ungemütlicher ist es, wenn mir – unvermittelt – die Kriegsvergangenheit meines Großvaters in den Sinn kommt. Wenn er mir über den Weg läuft. Wenn ich merke, dass ich mich – unwissentlich – in „seinen“ Räumen aufhalte. Wenn ich sein Leben lebe. Es lässt sich nicht mehr kontrollieren. Es lässt sich nicht mehr leugnen.
2. Recherche: Die Kinder und Enkel der Kriegsgeneration
Ich beginne, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Mit dem Leben von Kindern von Holocaust-Überlebenden. Mit Methoden der Erzählung; Storytelling. Mit dem Thema „Kriegsenkel“. Ich lese ein Buch über Psychoanalyse und Holocaust. Es geht dort auch um die Kinder der Täter und deren mangelnde Fähigkeit, Konflikte auszutragen. Ich erkenne mich vollkommen wieder.
Ein Psychologe, der mit Kriegskindern arbeitet, erzählt folgenden Fall:
„Der Patient wollte einem Doktoranden, dessen Arbeit er sehr schätzte, ein »summa cum laude« (mit höchstem Lob, Note 1) geben. Ein Kollege, der als Co-Referent die Arbeit beurteilen sollte, meinte dazu, er finde sie gut, aber »summa« gebe er grundsätzlich nicht. Der Patient fühlte sich in dieser Situation hilflos – unfähig, ein Argument zu finden. Er erzählt mir davon als von einem Teil seiner Symptomatik. Ich sagte zu ihm »Ihr Kollege ist aus dem allgemeinen Bewertungssystem ausgebrochen. Alle Arbeiten werden auf einer Skala von »summa« bis zu »ohne Prädikat« beurteilt, nur ihr Kollege fängt eine Stufe tiefer an – zum Nachteil ihres Doktoranden«. Der Patient erwiderte: »Sie haben recht, eigentlich ist das unglaublich anmaßend«. Erst danach konnte er seinen Standpunkt in dem Fall nachdrücklich und erfolgreich vertreten. Er hatte sich den Idealen seines Vaters zwar entzogen, aber für sich keine verbindlichen Normen gefunden; seine tiefe Unsicherheit und sein Selbstzweifel machten ihn oft orientierungslos und in Konflikten handlungsunfähig.“1
Was sind meine Handlungsoptionen – heute? Kampf, Flucht oder Erstarrung? Warum bin ich in Konflikten oft so blockiert? Warum kann ich „unsere Mütter, unsere Väter“ bisweilen kaum aushalten? Hat es etwas damit zu tun, dass mein Großvater auch Täter war? Anhänger des Nationalsozialismus? Mit seinem Tod an der Ostfront? Mit seinen Genen in mir, vielleicht sogar seinem Erleben? Seinen ungelösten Fragen? Sind das seine Erinnerungen, oder sind es meine?
1 Martin Bergmann, „Kinder der Opfer, Kinder der Täter. Psychoanalyse und Holocaust“
2.1. Erinnerungen
„Der Reichtum des Lebens beruht auf Erinnerungen, die wir vergessen haben.“
(Cesare Pavese)
Wie erinnern wir uns, und wie wollen wir im Gedächtnis bleiben? Welches Bild malen wir von uns, in schriftlichen Zeugnissen? Und wie gehen wir, die Nachgeborenen, mit diesen schriftlichen Zeugnissen um? Schriftkultur begründet Erinnerung.
Das Gedächtnis (das kulturelle, das individuelle, das kollektive) entwickelt sich nicht in Isolation, sondern ist immer schon sozial auf andere Individuen und, auf politischer Ebene, auf andere Gruppen bezogen, wo es auf andere Gedächtnisse reagiert. Die Nachträglichkeit der Erinnerung, die beim Trauma so auffällig ist, gilt für das Gedächtnis überhaupt. Deshalb richtet sich das, was wir erinnern, nicht nach dem, was eigentlich gewesen ist, sondern danach, wovon wir später eine Geschichte erzählen können. Was aus der Vergangenheit erinnert wird und was nicht, hängt letztlich davon ab, von wem und wozu die Geschichte gebraucht wird.
Das Gedächtnis ist an Orte gebunden. Dies wird in der Thora, der Heiligen Schrift der Juden, deutlich:
„Gedenk! Erinnere dich! Thiskor!“ In drei Sprachen klang es mir von frühester Kindheit ins Ohr. „Was deinen Ahnen irgendeinmal an Unrecht geschehen ist, vergiß es nie; was sie anderen Böses angetan haben, denk’ daran und an die Gerechtigkeit der Strafe, die sie erlitten haben. Was ihnen Gutes zugestoßen ist, behalt’ es im Gedächtnisse; wer dir einen Trunk Wasser gereicht hat, lösch’ die Erinnerung an ihn nie aus, denn er hat gehandelt wie Rebekka, die dem fremden Elieser den labenden Trunk gereicht hat. Jedes Mal, wenn du den Fuß auf die Stelle setzt, an der du jemandem Unrecht getan hast, sollst du das Weh empfinden, an dem du schuldig warst, bist, sein wirst.“2
Erinnerung ist aber auch an Ereignisse und Namen gebunden, wie es die Thora an anderer Stelle beschreibt:
„Gedenke (zachor), was dir Amalek antat auf dem Wege, als ihr auszogt aus Ägypten, wie sie auf dem Weg über dich kamen und wie sie, als du müde und matt warst, alle, die aus Schwäche hinter dir zurückblieben, von dir abschnitten und Gott nicht fürchteten. Es sei so: Wenn dir Adonaj, dein Gott, Ruhe gewährt vor allen deinen Feinden ringsum, in dem Lande, das Adonaj, dein Gott, dir zum Eigentum gibt, es zu erben, so wirst du wegwischen den Namen Amaleks unter dem Himmel. Nicht sollst du vergessen (lo tischkav)!“
Ein ähnliches Motiv findet sich in der biblischen Geschichte von Josef. In 1. Mose 41,51 heißt es:
„Josef nannte den Erstgeborenen Manasse (menaschä) – damit brachte er zum Ausdruck: »Vergessen lassen (naschschani) hat Gott mich ja all meine Qual und mein ganzes Vaterhaus«“. Der Name Manasse hält das Vergessen fest, doch wann immer Josef den Namen seines Sohnes nennt, kehrt das Vergessene wieder.“3
Man kann auch sagen, gerade was man vergessen will, vergisst man ganz bestimmt nicht.
Aber sollen und können Menschen möglichst alles erinnern, oder ist es auch gut, dass sie vergessen? Und wenn ja, was vergessen sie?
Der Theologe Jürgen Ebach schreibt dazu:
„Es gibt Stellen der hebräischen Bibel, die auf den ersten Blick in eine Erinnerungsreligion und -kultur nicht zu passen scheinen. Denn da geht es um den Abbruch der Erinnerung selbst. »Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht!«, lesen wir in Jes. 43,18, und in Jes. 65,17 heißt es in der Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde: »An das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr ans Herz kommen.« Wieder stoßen wir auf jene seltsame Verbindung von Erinnern und Vergessen, die wir schon bei den Amalek-Texten sahen. Es geht nicht darum, das Alte und Vergangene aus dem Gedächtnis zu streichen. Gerade an den Stellen des Jesajabuches, die wie ein Erinnerungsverbot klingen, kommt das Neue und das ganz Neue in den Bildern des Alten in den Blick. Wie denn auch sonst könnte ich etwas ganz Neues sehen, wenn nicht im Blick auf das Alte? Nein, es geht nicht um eine Entsorgung der Vergangenheit, wohl aber darum, dass sie nicht länger das bleibt, was ‚nun einmal’ so ist. Es soll weiter gehen, aber damit es weiter geht, darf es nicht ‚immer so’ weiter gehen. Erinnerung und Abbruch des Erinnerten sind kein Widerspruch. Es bedarf gerade der Erinnerung, um nicht ewig fortzusetzen, was nicht fortgesetzt werden soll.
Davon handelt Psalm 78; in den Versen 5-8 heißt es:
(Gott) hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und befahl damit unseren Eltern, dies ihren Kindern kundzutun, auf dass die künftige Generation sie verstehe, die Kinder, die geboren werden, so dass auch sie aufstehen und es ihren Kindern erzählen. […] Damit sie nicht würden wie ihre Eltern […].“4
Erinnern hat also etwas mit den Eltern zu tun. Mit dem, was die Eltern getan und erfahren haben. Und dass wir daraus lernen sollen. Also auch aus ihren Fehlern. Auch ihren Fehlern uns gegenüber. Und dann möglichst noch vergeben. Aber geht das überhaupt?
In ihrem Werk „Am Anfang war Erziehung“ geht Alice Miller davon aus, dass das betroffene Kind später die Erwachsenen und ihre Beweggründe verstehen kann. Das Begreifen des Geschehenen ist vor allem wichtig, um diese Verhaltensmuster nicht selbst zu wiederholen. Zwar betont Alice Miller, dass es notwendig ist, auch den aufkommenden Zorn zuzulassen (denn genau das war ja in der Kindheit systematisch – vor allem unter Androhung des Liebesentzugs – verboten worden). Aber letztlich könnte daraus auch Vergebung entstehen.
Was passiert, wenn wir – oder unsere Eltern – uns an nichts erinnern (wollen), zum Beispiel an Traumatisches?
Alice Miller schreibt dazu:
„Nicht Erinnertes wird »abgespalten«. Abgespaltene Erinnerungen werden im Anderen (oft in einer Art Wiederholungszwang) bekämpft – oder im Inneren wie in einer Kammer eingeschlossen und »vergessen«. Die einzigen, die garantiert Zugang zu dieser Kammer bekommen, sind die eigenen Kinder.“5
Insbesondere bei der Generation der Kriegskinder – unseren Eltern – kann man eine starke Traumatisierung beobachten, die im Alter oft wieder stärker sichtbar wird. Die Traumatisierung resultiert auch aus einer Art „Überidentifikation“ mit ihren Eltern. Dies gilt offenbar insbesondere, wenn die Eltern – oft kriegsbedingt – früh verstorben sind.
Alice Miller schreibt:
„Wie wenig sie (die Kinder) sich von ihren Eltern getrennt erlebten, zeigte auch ihr mangelndes Zeitempfinden: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (sie hatten eigentlich keine Zukunft, weil sie nur in der Vergangenheit lebten) flossen ununterscheidbar ineinander, weil sie unfähig waren, sich von ihrer Vergangenheit (und der der Eltern) zu lösen. Unterschiede, soweit sie sie intellektuell wahrnahmen, schienen ihnen nur äußerlich, nicht das Wesen der Dinge und
Menschen betreffend.“6
Kann man das heilen? Kann ich das bearbeiten, auch wenn meine Eltern darüber nicht sprechen können, sprechen wollen? Ist es dafür nicht schon zu spät?
Wie erinnert sich ein Mensch an seine Kindheit, wenn das Erinnerte nicht mehr mit den Eltern „abgeglichen“ werden kann, weil die Eltern bereits tot sind? Kann man Erinnerung auch verändern, überschreiben? Und wodurch geschieht das?
„Wie sollten die neuen Kenntnisse, die es (das Kind) erwirbt – Kenntnisse von Geschehnissen, Betrachtungen und Vorstellungen – nicht auf seine Erinnerungen zurückwirken? Die Erinnerung ist in sehr weitem Maße eine Rekonstruktion der Vergangenheit mit Hilfe von der Gegenwart entliehenen Gegebenheiten und wird im übrigen durch eine andere, zu früheren Zeiten unternommene Rekonstruktion vorbereitet.“7
Das Gedächtnis ist auch in hohem Maße selektiv. Nach welchen Kriterien selektiert das Gedächtnis, und warum?
„Es ist allem Anschein nach so, als müsse das Gedächtnis sich erleichtern, wenn der Strom der Ereignisse, die es behalten muss, anschwillt.“8
Gerade das, was wir vergessen haben, bestimmt unsere Erinnerung. Der Tod zum Beispiel. Der Tod, den für unsere unsere Großeltern im Krieg allgegenwärtig war. Der Tod, den sie Anderen gebracht haben. Er ragt hinein in mein Leben. In mein Erleben. In die Orte, die ich aufsuche, in die Bilder, die ich sehe, und in die Texte, die ich lese.
sarajewo
der zehnte weiße friedhof
an einem jener hänge
ist ein ensemble
von bienenkästen: sammelt
den honig, fleißige tierchen,
winzige tote
Jan Wagner, „Regentonnenvariationen“, 2014
2 Manès Sperber, „Die Wasserträger Gottes“
3 „Erinnern und Vergessen“ Prof. Dr. Jürgen Ebach Bochum, auf dem Ev. Kirchentag in Hamburg 2013 in seinem Skript „Unbehagen mit der Erinnerung“
4 Ibid.
5 Alice Miller, „Am Anfang war Erziehung“
6 Ibid.
7 Maurice Halbwachs, „Das kollektive Gedächtnis“
8 Ibid.
2.2. Familienerzählungen, die Nazizeit und das „kommunikative Gedächtnis“
Das Gedächtnis über die Nazizeit ist noch einmal ein besonderes Kapitel. Es ist ja unstrittig, dass Menschen – unsere Vorfahren – in dieser Zeit falsch gehandelt, Zerstörung gebracht und Schuld auf sich geladen haben. „In Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte“, schreibt Harald Welzer. Und doch heißt es in den allermeisten Familien übereinstimmend über mehrere Generationen: „Opa war kein Nazi“.
„Das »kommunikative Gedächtnis« ist eine eigensinnige Verständigung der Gruppenmitglieder darüber, was sie für ihre gemeinsame Vergangenheit halten, und das Familiengedächtnis ist ein zentraler Teilbereich desselben. Es ist ein lebendiges Gedächtnis, dessen Wahrheitskriterien an Wir-Gruppenidentität und -loyalität orientiert sind.“9
In meiner engeren Herkunftsfamilie wurde viel über die Nazizeit gesprochen, und ich konnte meine Eltern und zum Teil auch die Großeltern dazu befragen. Die mögliche oder auch tatsächliche persönliche Schuld der Soldaten und Offiziere in der Wehrmacht wird von den „Kriegskindern“ in meiner Familie jedoch häufig ausgeblendet.
Wir haben uns inzwischen damit abgefunden, dass jeder seine eigene Geschichte erzählt. Meine Mutter fühlt sich als Hauptbetroffene (sie wurde durch den Krieg zur Waise). Sie versucht, Verständnis für ihren „guten Papi“ zu wecken und Anteilnahme für ihr Leid zu bekommen. Meine Töchter sagen: „Grautöne sind für uns nicht relevant; in der Wehrmacht, das waren alles Nazis, und da gibt es auch nichts zu entschuldigen“. Ich stehe mittendrin. Wir reden, aber unsere Gespräche sind meistens schon nach wenigen Sätzen vorbei. Es gibt keine gemeinsame Erkenntnis und keine gemeinsame emotionale Realität – bestenfalls Respekt und Toleranz. Warum führen wir diesen Konflikt nicht zu Ende? Der Konflikt wäre das Produktive, der Stillstand aber ist das Gemeinsame.
Ein Beispiel: Der Vater des Schwagers meiner Mutter wurde bei Kriegsende im KZ Buchenwald interniert und später von den Sowjets hingerichtet. Der Sohn dieses Buchenwald-Häftlings ist jetzt über 80 Jahre alt. Er spielt Computerspiele darüber, wie der Krieg noch hätte gewonnen werden können, und wirkt wie ein Militärexperte. Das Buch „Der Brand“ von Jörg Friedrich, über den alliierten Bombenkrieg auf Dresden, hat ihn sehr bewegt. Sein Vater ist immer noch der „gute Papi“, von dem man nicht weiß, warum die Russen ihn hingerichtet haben. Aber man ist sich sicher: Es war nicht gerechtfertigt.
Ähnlich ist es beim Ehemann meiner Großtante. Er war bei Kriegsende nachweislich am Leben, „tauchte dann aber nie wieder auf“, so die Familienlegende.
Ich entdecke das sowjetische Militärgefängnis durch Zufall, auf einem Spaziergang durch den Neuen Garten in Potsdam. Dreißig Jahre wohne ich da schon in Berlin . Die Ausstellung macht mich neugierig. Da die Gedenkstätte geschlossen ist, sehe ich mir später zu Hause die digitale Version an. Da schaut er mich an, der vermeintlich verschollene Papi, auf einer Schautafel, mit ausführlichem Lebenslauf, Hintergründen seiner Inhaftierung, und großem Foto. Das Foto und viele Rechercheinformationen kommen laut Bildunterschrift „aus dem Archiv der Familie R.“
Tatsächlich war er, ehemaliger Offizier der Wehrmacht, nach dem Krieg Mitbegründer einer nationalsozialistischen Widerstandsgruppe gegen die Besatzer Deutschlands. Er wurde gefasst und in die Untersuchungshaftanstalt der sowjetischen Besatzungmacht in der SBZ bzw. der DDR gebracht. Dort, in Potsdam, wurde er dann vor ein sowjetisches Militärgericht gestellt. Das Gericht verurteilte ihn zum Tode. Er wurde deportiert und nahe Moskau im Jahr 1951 hingerichtet.
Sein Foto aber hat hier auf mich gewartet, in einer Gedenkstätte vor unserer Haustür, dreißig Jahre schon.
Bei den Familienerzählungen über diese Schicksale steht in meiner Familie oft im Vordergrund, dass die Russen ohne Rechtsgrundlage, aus Rache gehandelt haben könnten. Nicht nur hier fühlt man sich als Opfer einer Siegerjustiz. Das eigene Tun wird beschönigt, tritt in den Hintergrund. Man behauptet, nichts zu wissen. Opfererzählungen. Die Sehnsucht, das Opfer zu sein. Die eigene Täterschaft ist so allgegenwärtig, dass man es nur aushält, wenn man den Opferstatus der anderen relativiert. Das eigene, auch das individuelle gewaltsame Handeln wird legitimiert; „wir haben ja aus Notwehr gehandelt“. Das entlastet und relativiert die Schuld.
Bestenfalls wird der Status Quo der Nachkriegszeit schöngeredet. Über meine Großtante und ihrem Mann, den Häftling aus Potsdam, heißt es bis heute: „Na, die hätten sich sowieso nicht vertragen.“
Warum behauptet man eigentlich immer, nichts zu wissen? Warum erzählt man unvollständige, nebulöse Geschichten, deren Fehler und Lücken eigentlich jedem sofort auffallen müssten? Erwartet man ernsthaft von uns, der Enkel- und Urenkelgeneration, dass wir diese Stories glauben? Und warum glauben wir sie?
Es werden unter uns Frauen auch rudimentäre Geschichten von Vergewaltigungen nach dem Krieg erzählt. Mehrere Frauen aus meiner Familie wurden vergewaltigt; von Russen in Berlin, und von Engländern in Göttingen. Eine der Frauen konnte sich die Registriernummer des Gewehres merken, mit dem sie niedergehalten wurde. Offenbar gab es dann auch Konsequenzen für diesen Täter.
Alle diese Frauen waren Mütter; ihre Kinder sind meine Onkel und Tanten.
Diese Onkel und Tanten, diese Eltern, sprechen nicht darüber, dass sie ein Vergewaltigungskind sein könnten. Dass sie Vergewaltigungskinder gekannt haben müssen. Wie sie sich dabei fühlen. Wie sie das beeinflusst haben könnte im Umgang mit ihren eigenen Kindern. Mit uns.
Meine Tochter M. schickt mir ein Meme:
So kann ich wenigstens ein bisschen darüber lachen. Ich spüre Dankbarkeit, dass es eine Generation nach mir gibt. Menschen, die die guten Großeltern nicht mehr gekannt haben, und die sich ganz respektlos Memes ausdenken und neue Fragen stellen.
Ich hingegen habe die guten Großeltern noch gekannt und geliebt.
Ich sehe meine Großmutter, ehemalige Reichsarbeitsdienstführerin, damals mit Mutterkreuz, und Parteimitglied, in ihrem Wohnzimmer in Göttingen Sebastian Haffners „Anmerkungen zu Hitler“ lesen. Sie sitzt dabei am Schreibtisch ihres verstorbenen Mannes. Wir nennen diesen Schreibtisch heimlich „den Adolf-Hitler-Schreibtisch“. Meine Großmutter hat das Portrait ihres Mannes in Wehrmachtsuniform neben sich aufgestellt, mit schwarzer Schleife.
Ich sehe, wie meine Großeltern in Stadthagen sich vor dem Fernseher angewidert abwenden, sobald Willy Brandt spricht. Der Kniefall von Warschau, die Ostverträge: das passt ihnen nicht. Aber nicht, weil es eine schlechte Idee wäre. Sondern weil es von einem Sozi kommt. Meine Oma äfft gekonnt nach, wie Willy Brandt spricht. Auf meine Frage, warum sie sich politisch nicht engagieren, sagen sie: „Wir sind einmal verraten worden; nie wieder“.
Meine eigenen Eltern, die Kinder dieser Großeltern, wählen liberal, sozialdemokratisch und grün. Meine Mutter engagiert sich zudem seit den Achtzigern in der Gewerkschaft und gegen Aufrüstung. Meine Eltern beziehen Position im Streit über die atomaren Endlager. Sie beginnen als Siebzigjährige, gemeinsam zu Demonstrationen zu gehen. Das macht mich stolz. Aber: Wenn es um die mögliche persönliche Beteiligung ihrer Eltern (beide Großväter waren Offiziere) an Vernichtungskrieg und Völkermord geht, werden sie einsilbig.
Meine Mutter sagt 2017, als wir über ihren Vater sprechen:
„Na, er war ja auch nicht für Hitler. Er war ja nur im Baukommando.“
„Er wusste spätestens 1942, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war.“
„Er wollte Professor für Sportwissenschaft werden. Ein Professor aus der Uni Göttingen sagte später zu mir: »Ihr Vater war ja so gut, in allen Fächern, den hätten wir nicht ziehen lassen«. Dafür musste man ja in der Partei sein.“
„Ja, er ist aus der Kirche ausgetreten. Seine erste Frau auch; ebenso seine zweite. Schon seine Schwiegereltern standen der Kirche sehr kritisch gegenüber.“
Fakt ist: 69% der Deutschen glauben, dass ihre Vorfahren nicht zu den Tätern zählen, 29% glauben, dass ihre Vorfahren Opfern geholfen haben, z.B. indem sie Juden versteckten. In Wirklichkeit waren es unter 0,1%.10
Oder, wie es in einem Witz heißt:
„… eigentlich ein Wunder, dass der Krieg so lange gedauert hat, wenn alle nur Funker und Sanitäter waren.“
Sabine Moller schreibt:
„Die einzelnen Generationenangehörigen der Familien haben durchaus verschiedene Bilder von den in Rede stehenden Ereignissen und Verhältnissen, was aber in der sozialen Situation des Erinnerns und Erzählens nur selten manifestiert wird.“11
Trotzdem, meine Eltern erzählen uns immer wieder Geschichten aus dieser Zeit. Oft werden sie ähnlich oder sogar wortwörtlich erzählt. Es scheint auch nicht darauf anzukommen, ob man es schon einmal erzählt hat, oder wem man es erzählt. Logik und Kohärenz bleiben dabei immer mal wieder auf der Strecke.
Warum sind die Geschichten oft so ungenau und schon allein deshalb so schwer zu glauben?
Dazu Sabine Moller:
„Im Unterschied zu den meisten im Alltag erzählten Geschichten fehlt mit den Orts- und Zeitangaben und der Nicht-Benennung der handelnden Personen in den erzählten Geschichten oft der Orientierungsteil; jemand, der die Geschichte nicht kennt, wird über deren Rahmen völlig im Unklaren gelassen. Allerdings treten oft keine Täter auf, sondern nur ohnmächtige Zuschauer. […] Statt jedoch zu sagen, dass man über die genauen Umstände nichts weiß, beginnt man, aus Fragmenten eine halbwegs kohärente Geschichte zusammenzubauen. Hier zeigt sich, dass jeder der Beteiligten bestrebt ist, den fehlenden Orientierungsteil mit eigenen Vermutungen und Ergänzungen zu ersetzen. In der Schilderung wechseln sich Fragmente des historischen Geschehens und Schlussfolgerungen ständig ab. Insgesamt bleiben die Geschichten oft kurz und ziemlich unklar.“12
Wie ist das mit den Geschichten, die sich nicht beschönigen lassen? Die man auch durch Auslassungen nicht gut machen kann? Was ist mit den „schlimmen Geschichten“, von denen man weiß, an die man sich aber nicht erinnern möchte? Wie werden diese in das Konstrukt von Erinnern und Vergessen, von sozialer Übereinkunft und Gruppenloyalität, in „Über“-identifikation mit den Eltern eingebaut? Wie werden sie erzählt?
Sabine Moller berichtet von einem Interview in einer Familie. Diese erzählt von ihrem Vater, einen Kriegsteilnehmer, der bereits tot ist. Der Vater habe im Krieg angeblich seinen Vorgesetzten erschossen, um zu verhindern, dass dieser drei Kinder erschießt.
Sabine Moller schreibt:
„Dass auch tragische, gewaltsame und schuldbehaftete Geschichten folgenlos geblieben sind, irritiert die Familie bei der Vergegenwärtigung der Vergangenheit genauso wenig wie alle anderen Inkonsistenzen und logischen Widersprüche der Geschichte: die fehlenden Orts-, Zeit- und Personenangaben, das Fehlen jedes kausalen Zusammenhangs, das eigentümliche Schuldgefühl des Vaters. Die ganze Geschichte ist von einer Art Nebel umgeben; das macht sie nicht nur interessant und irritierend, sondern auch in höchstem Maße deutungsoffen. Eigentlich lebt die Geschichte von Leerstellen, die beliebig aufgefüllt werden können.“13
In einer anderen von ihr interviewten Familie berichten die Gesprächsteilnehmer, wie der – inzwischen verstorbene – Vater der Familie als Soldat Zuschauer bei einer Erschießung wurde.
Sabine Moller kommentiert:
„In der Darstellung der Familie repräsentiert er oft sogar eine moralische Instanz; er hat ja nur zugesehen, und das ist »interessant und unproblematisch«, denn man kann dann immer sagen, dass er nicht nur nicht geschossen hat, sondern auch nicht geschossen hätte. Und übrigens vergisst man dabei, dass es ja ein stilisiertes Dilemma ist: »schießen oder nicht schießen«, und dass es das moralisch eigentlich Skandalöse ist, dass man dabeigewesen ist, vielleicht sogar extra hingegangen, und nichts gemacht hat. So wird die Geschichte in ein »moralisches
Off« gestellt, das keine Fragen mehr aufwirft.“14
Insgesamt findet die Forschung in vielen Familien Heroisierungstendenzen – oft über Generationen hinweg und entgegen historischer Erkenntnisse. Diese Heroisierungen dienen auch der transgenerationellen Identifikation und Vergewisserung.
Sabine Moller erklärt das an einem beispielhaften Satz aus einem Interview mit einer Unternehmerfamilie:
„Wir haben ja unsere Zwangsarbeiter gut behandelt“.
Sie schreibt dazu:
„Hier sieht man drei Aspekte: Das Fehlen jedes Kontextes, wieso man überhaupt Zwangsarbeiter beschäftigen konnte; die Verwendung von Possessivpronomen („unser Vater“), die auch andere Generationen mit einschließen, die eine menschlich-solidarische Komponente haben und ein Hierarchieverhältnis begründen, und schließlich die Betonung, dass man immer gut zu diesen Menschen gewesen sei.“15
Mir fällt auf, dass meine Mutter mit zunehmendem Alter oft am Telefon sagt „Dein Vater“ oder „Dein Onkel“, nicht aber deren Vornamen nennt – was sie früher immer getan hat. Ich glaube, sie versucht mit mir eine gemeinsame Realität, vielleicht auch eine Loyalität herzustellen. Sie möchte Verständnis, Einfühlung in ihre emotionale Not. Sie möchte Kind sein können.
Und noch etwas fällt mir auf: Bei unseren Gesprächen über das Thema „Nazizeit“ (für meine Eltern gleichbedeutend mit „Kindheit“) bemerke ich, dass meine Eltern ihre „Erinnerungen“ nicht selten aus Erzählungen anderer, gelegentlich sogar aus Filmen entnehmen.
Andererseits lassen sie sich durch „neue“ Fakten nicht so leicht davon abbringen, dass ihre „Erinnerung“ richtig ist. Sie reagieren zum Beispiel mit Befremden, wenn sie einen Farbfilm aus der Nazizeit sehen.
Das hat offenbar nicht nur etwas mit der Farbe, sondern auch mit der Fiktionalität zu tun:





























