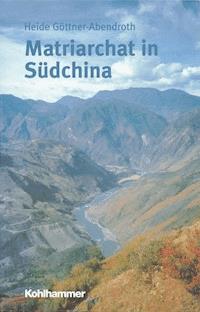Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Europas bekannteste Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth zeigt eine unbekannte Seite der Alpen und fasst in diesem Buch ihre landschaftsmythologischen Forschungen in der Schweiz, in Deutschland, Südtirol und Österreich zusammen. Dabei betreibt sie Feldforschung und verknüpft das Wissen von Mythologie, Volkskunde, Sprachforschung und Geografie mit den archäologischen Funden aus den frühen Alpenkulturen. Mit ihrem geschulten Blick gelingt es ihr, die alten Geschichten und Sagen zu erkennen, die in die Landschaft eingeschrieben sind. Grundlage dafür ist die genaue Betrachtung verschiedener Bergformen und ihrer Umgebung, die sie der Symbolik und der Sichtweise früherer matriarchaler Kulturen zuordnet. Das ergibt völlig neue Einsichten in bekannte und weniger bekannte Alpen-Gegenden, die wegen ihrer Schönheit auch heute noch die Menschen anziehen. Das Buch macht es uns möglich, diese Gegenden mit einem neuen Blick zu erwandern. Es gibt uns einen verschütteten Teil unseres kulturellen Erbes zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heide Göttner-Abendroth
Berggöttinnen der Alpen
Matriarchale Landschaftsmythologie in vier Alpenländern
Heide Göttner-Abendroth
Berggöttinnen der Alpen
Matriarchale Landschaftsmythologie in vier Alpenländern
Zum Buch:
Europas bekannteste Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth zeigt eine unbekannte Seite der Alpen und fasst in diesem Buch ihre landschaftsmythologischen Forschungen in der Schweiz, in Deutschland, Südtirol und Österreich zusammen.
Dabei betreibt sie Feldforschung und verknüpft das Wissen von Mythologie, Volkskunde, Sprachforschung und Geografie mit den archäologischen Funden aus den frühen Alpenkulturen. Mit ihrem geschulten Blick gelingt es ihr, die alten Geschichten und Sagen zu erkennen, die in die Landschaft eingeschrieben sind. Grundlage dafür ist die genaue Betrachtung verschiedener Bergformen und ihrer Umgebung, die sie der Symbolik und der Sichtweise früherer matriarchaler Kulturen zuordnet. Das ergibt völlig neue Einsichten in bekannte und weniger bekannte Alpen-Gegenden, die wegen ihrer Schönheit auch heute noch die Menschen anziehen. Das Buch macht es uns möglich, diese Gegenden mit einem neuen Blick zu erwandern. Es gibt uns einen verschütteten Teil unseres kulturellen Erbes zurück.
Mit freundlicher Unterstützung der Abteilung Deutsche Kultur in der Südtiroler Landesregierung über das Südtiroler Kulturinstitut, und der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Ebenso kam freundliche Unterstützung vom Fonds für Matriarchatsforschung im „Förderverein der Akademie HAGIA e.V.“, www.hagia.de und von der „Gerda-Weiler-Stiftung für feministische Frauenforschung“, D-53894 Mechernich, www.gerda-weiler-stiftung.de
1. Auflage © Edition Raetia, Bozen 2016
Lektorat: Joe Rabl Korrektur: Ex Libris Genossenschaft, Bozen Umschlaggestaltung: Arnold Dall’O
ISBN 978-88-7283-556-2
eISBN 978-88-7283-578-4
Unseren Gesamtkatalog finden Sie unter www.raetia.com Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an [email protected]
Dieses Buch ist Cécile Keller gewidmet.
Zusammen unternahmen wir auf landschaftsmythologischen Spuren viele Reisen und Wanderungen in der Schweiz und in anderen Alpenländern. Stets war es eine schöne und kreative Zusammenarbeit.
Mein Dank gebührt allen Unterstützerinnen dieses Buches:
In erster Linie den Frauen, die in den Fonds für Matriarchatsforschung im „Förderverein der Akademie HAGIA e. V.“ spendeten und damit erheblich zur Drucklegung dieses Buches beitrugen: www.hagia.de
dann der Gerda-Weiler-Stiftung für ihre freundschaftliche Unterstützung: „Gerda-Weiler-Stiftung für feministische Frauenforschung“ D-53894 Mechernich, www.gerda-weiler-stiftung.de
Mein Dank geht auch an die Abteilung Deutsche Kultur in der Südtiroler Landesregierung über das Südtiroler Kulturinstitut, die Autonome Region Trentino-Südtirol und die Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Ebenso danke ich Christina Schlatter, die mir oft und zuverlässig bei der Recherche von speziellem Material zur Seite stand und vieles anderes mehr.
Inhalt
Einführung in die matriarchale Landschaftsmythologie
Auf den Spuren von „Ötzis“ Göttin
Zur Kulturepoche der Jungsteinzeit in den Ötztaler Alpen
Im Reich der Fanes-Königinnen
Mythische Berge in den Dolomiten in Italien
Die gebärende Berggöttin und ihr Tal
Der Landschaftstempel Oberhalbstein-Surses in der Ostschweiz
Das Salz des Lebens
An den Flüssen Saalach und Salzach bei Reichenhall und Hallein
Der Garten der Percht
Das Berchtesgadener Land in den deutschen Alpen
Die Bergkönigin und ihr Drache
Rigi und Pilatus am Vierwaldstättersee
Vom Mutterhorn zur Jungfrau
Andere bedeutende Berggöttinnen der Alpen
Das Mutterhorn
Im Zermatter Tal im Wallis, Westschweiz
Die „Weiße Kuh“
Das Lötschental im Wallis, Westschweiz
Wo die Dreifaltige ragt …
Im Berner Oberland in der Zentralschweiz
Anmerkungen
Bildverzeichnis
Literaturliste
Die Autorin
Einführung in die matriarchale Landschaftsmythologie
Begriff und Grundzüge
Wenn in diesem Buch besondere Landschaften in den Alpen aus der Perspektive der matriarchalen Landschaftsmythologie betrachtet werden, so möchte ich zu Anfang erläutern, was „matriarchale Landschaftsmythologie“ eigentlich heißt. Denn dies kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden.1
„Matriarchale Landschaftsmythologie“ ist zugleich eine Theorie und eine Praxis, die sich gegenseitig bedingen. Ich begann praktisch schon sehr früh damit, als ich im Rahmen der Internationalen Akademie HAGIA ab 1987 fortlaufend Studienreisen in Länder durchführte, deren Landschaften reiche archäologische und kulturhistorische Denkmäler besitzen. Der Fokus lag dabei auf den frühesten Epochen der menschlichen Siedlungstätigkeit, nämlich der Jungsteinzeit und der nachfolgenden Bronzezeit. Zu den Fernreisen kamen viele Wanderreisen in den heimischen Gegenden Mitteleuropas von der Ostsee bis zu den Alpen hinzu, und in wiederholten, längeren Aufenthalten erschloss ich mir verschiedene Alpengebiete in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Ein erstes Ergebnis dieser Forschungstätigkeit ist mein Buch Matriarchale Landschaftsmythologie. Von der Ostsee bis Süddeutschland (2014).2 Dieses Buch hier ist sozusagen die „Zwillingsschwester“ des ersten und enthält meine Forschungen aus den genannten Alpenländern.
Stets zeigte ich auf diesen Reisen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die prachtvollen oder bescheidenen Relikte aus der Jungstein- und Bronzezeit, die überall in Europa zu finden sind. Dabei wurden diejenigen Fragen beantwortet, die bei üblichen Kulturreisen offenbleiben. Die erste Frage war: Warum liegen solche Anlagen jeweils an einem bestimmten Platz in der Landschaft, das heißt, was fügt die umgebende Landschaft zur Anlage hinzu? Es ging also nicht nur um die Monumente, sondern auch um ihre Einbettung in den weiten, natürlichen Raum. Dies führte zu einer umfassenden Art des Sehens, das von dem zerstückelten Sehen völlig verschieden ist, das den modernen Menschen aufgezwungen wird, wenn sie in eine von Straßen, Schildern, Zäunen und Gebäuden zerschnittene Landschaft blicken.
Daraus ergab sich die zweite Frage: Wie haben die Menschen aus jenen sehr frühen Kulturepochen die Landschaft gelesen, um für ihr Monument den entsprechenden Platz zu finden? Dazu muss man tief in ihre Denkweise einsteigen, die sich in ihrer Mythologie und Symbolik zeigt; auf diese Weise kann man sich ihrem Blick auf die Landschaft annähern. Ihre Betrachtungsweise war in jedem Fall symbolisch, wobei die Symbolik aus ihrem matriarchalen Weltbild stammt. Die Kenntnis der matriarchalen Mythologie und Symbolik aus der Jungstein- und Bronzezeit, wie sie die moderne Matriarchatsforschung zur Verfügung gestellt hat, ist deshalb die Voraussetzung für diese Art von Forschung.3 Nur so war es mir möglich, den Mitreisenden Bauwerk und Landschaft im Zusammenhang zu erschließen, wie es von den Erbauern gemeint gewesen sein könnte. In vielen Fällen standen auch Mythen und Sagen zur Verfügung, die sich genau auf diese Plätze beziehen und Fragmente des matriarchalen Weltbildes enthalten. Diese lokalen Mythen und Sagen erläuterte ich an Ort und Stelle. Alles zusammen ergab oft verblüffende Erkenntnisse und führte zu einer neuen Denk- und Sehweise, die Verborgenes und Verschüttetes hervorholen konnte.
Denn die Menschen der Jungsteinzeit, welche die ersten dauerhaften Siedler und Siedlerinnen auf der Erde waren, wandten sich den Landschaften nicht nur unter dem Aspekt des Nutzens zu. Sie errichteten ihre Orte und Kultplätze nicht nur da, wo sie Wasser und fruchtbares Land oder Bodenschätze wie Feuerstein und Salz fanden, sondern sie betrachteten die Erde als ein göttliches Wesen, als eine Urgöttin, worauf unser heutiger Ausdruck „Mutter Erde“ noch hinweist. Grundsätzlich ist eine solche Betrachtensweise, die Erde als Göttin zu sehen, nicht patriarchal. Denn patriarchale Gesellschaften erfinden sich Götter, die in der Regel mit materieller und geistiger Eroberung zu tun haben, aber nicht mit Vorgängen der Lebensschöpfung und -erhaltung wie Gebären, Nähren und Schützen, die der Erde als Mutter von allem Lebendigen zugesprochen werden. Patriarchale Gesellschaften betrachten die Erde und ihre Landschaften unter dem Aspekt des strategischen und ökonomischen Nutzens und profanieren sie damit, während die matriarchale Sichtweise auf die Erde zugleich eine religiöse oder spirituelle Haltung der Verehrung enthält. Diese frühen Menschen wandten sich der Erde als der einen Urgöttin zu, dem Kosmos als der anderen Urgöttin, und versuchten, sowohl die eine wie die andere durch Beobachtung besser zu erkennen, ihre Erscheinungen tiefer zu verstehen und die eigenen kulturellen Schöpfungen nach ihrem Bild zu formen. Auch die früheste Himmelsbeobachtung (Astronomie) war deshalb nicht nur eine wissenschaftliche Technik, sondern zugleich eine religiöse oder spirituelle Handlung, das heißt: Erkennen und Verehren gingen Hand in Hand.
Weil die Erde jedoch eine große, nicht zu überschauende Göttin ist, nahmen die Menschen ihre begrenzten Erscheinungen wie einen Berg, ein Tal, einen See, einen Stein als Teil für das Ganze. Auf Berg und Tal konnten sie sich bewegen oder dort wohnen und alle diese Landschaftszüge gleichzeitig verehren. Bevorzugt wurden dabei Teile der Erde mit ausgeprägt weiblichen Zügen, eben mit Formen, die symbolisch als weiblich gelesen werden konnten. Hier zeigte sich die Erde für die Menschen sinnfällig als Große Frau und Mutter – wie beispielsweise ein Tal in Form eines weiblichen Schoßes; zwei gleichförmige Berge wie Brüste; eine Bergkette in Gestalt einer liegenden Frau; eine halbkreisförmige Schlucht, in der eine Quelle wie ein Schoßwasser entspringt; ein mächtiger Findlingsstein wie ein Nabel oder ein vulva-artiger Quellstein in der Landschaft. Solche Beispiele stammen nicht nur aus Europa, sondern lassen sich weltweit auffinden, was beweist, dass diese Sichtweise auf die Erde einst allgemein war. Trotz der Vielfalt dieser Erscheinungen wussten die Menschen, dass es sich nur um Eine Göttin handelt, denn die Erde wurde die „Eine mit den tausend Gesichtern“ genannt. Es gibt nur Eine Erde, aber Tausende verschiedener Landschaften auf ihr, von denen die ausgeprägt weiblichen als heilig galten. Dieses Heilige wurde nicht scheu gemieden, sondern im Gegenteil bevorzugten es die Menschen, hier zu wohnen, mitten im „Schoß der Landschaft“ oder „am Busen der Natur“. An diesen Wohnplätzen, die zugleich Kultplätze waren, fühlten sie sich am meisten geborgen und mütterlich beschützt.
Da die Menschen der frühesten Ackerbaukulturen sich als Erste dauerhaft niederließen, waren sie auch die Ersten, die solche Landschaften symbolisch betrachteten und nachformten. In den altsteinzeitlichen Kulturepochen vorher wurde Landschaft nicht nachgeformt, sondern die Menschen wanderten in ihr umher und zogen hindurch. Doch nun wurde eine Landschaft, die mit Berg, Hügeln oder Schlucht in irgendeiner Form die Weiblichkeit der Göttin Erde manifestierte, zur konkreten Landschaftsgöttin mit einem konkreten Namen. Die frühesten Siedler und Siedlerinnen richteten ihre Häuser und besonders ihre Kultbauten nach ihr aus und betonten dabei einen bestimmten, weiblichen Zug der Erdgöttin, der ihnen am jeweiligen Ort auffiel. Die Nachformung der Landschaft konnte dabei vieles einschließen, nicht nur Architektur in Holz und Stein, sondern auch die Anlage von Hügeln und symbolischen Erdwällen, die Pflanzung von Bäumen, ebenso die Verbindung von mehreren Wohn-Kultplätzen untereinander, was zum Entwerfen von großräumigen Symbolbildern in der Landschaft führte.
Dafür waren die Sichtlinien von einem Ort zum anderen außerordentlich wichtig. Sichtlinien wurden mithilfe der megalithischen Kalenderanlagen, wie Steinkreise und Steinreihen, nach den kardinalen Himmelsrichtungen bestimmt: die Ost-West-Linie und Nord-Süd-Linie, ebenso die Himmelsrichtungen dazwischen: die Nordost-Südwest-Linie und die Südost-Nordwest-Linie. Diese Richtungen waren nicht nur für die Orientierung, sondern auch mythologisch bedeutungsvoll. Wenn von einem bestimmten Standpunkt aus gesehen Hügel oder Bergspitzen am Horizont genau in ihnen lagen und Orientierungspunkte in der Landschaft boten, wurden diese Himmelsrichtungen auf die Erde projiziert. So entstand ein erstes Ordnungssystem in der jeweiligen Landschaft. Die Hügel entlang der Sichtlinien wurden dann mit Kultplätzen besetzt, und man blickte von jedem Kulthügel direkt zum nächsten. Auf diese Weise wurden die Sichtlinien zu sakralen Kultlinien, denn sie führten schnurgerade von einem Kultplatz zum anderen. Dieses erste Ordnungssystem war zugleich ein Kommunikationssystem, wobei die weiträumige Fernkommunikation mithilfe von Feuern von Hügel zu Hügel hergestellt wurde. Es wurde in der Jungsteinzeit geschaffen, denn die Menschen fanden die Landschaft noch unverstellt und offen vor. In der späteren Kulturepoche der Bronzezeit führten es die Menschen weiter, weil diese Methode, sich über weite Distanzen zu verständigen, ebenso einfach wie wirksam war. Die Telekommunikation galt neben anderem besonders der Ankündigung der großen, heiligen Feste im Jahreszeitenkreis, die vom ganzen Volk gefeiert wurden. Überreste davon finden wir heute noch in dem Brauch von Höhenfeuern, die man in manchen Gegenden in Bayern und in den Alpenländern am Vorabend vor Festtagen anzündet, wie zum Beispiel das Osterfeuer und das Walpurgisfeuer im Frühling, das Sommersonnwendfeuer im Juni und das Martinsfeuer im November.
Die jungsteinzeitlichen Wege folgten ebenfalls den Sicht- und Kultlinien, womit sie die kürzesten, weil schnurgeraden Verbindungen von einem Platz zum anderen darstellten. Auf diese Weise entstanden die frühesten Fernwege über Land, die zusätzlich zu den weiträumigen Wasserwegen auf den Flüssen für den Fernhandel genutzt wurden. Zugleich waren sie Pilgerwege, denn sie führten ja von einem Heiligtum zum nächsten. Man kann dies nicht trennen, denn in diesen frühen Kulturen wurden das Profane und das Sakrale zusammen gesehen, das heißt, Alltagsgegenstände hatten zugleich symbolischen und Alltagshandlungen zugleich rituellen Charakter.
Dieses Ensemble von natürlichen Landschaftsformen, menschlichen Bauwerken, die deren symbolische Bedeutung betonten, und Sichtlinien, die zugleich Kultlinien und Fernwege waren, macht das landschaftsmythologische Gefüge aus, das von den frühesten sesshaften Kulturen geschaffen wurde. Es ist eine Kunst, eine Landschaft so zu sehen und zu formen; wir können sie die Kunst nennen, menschliche Kultur im Einklang mit den Landschaften der Erde zu schaffen. Die Landschaft wurde dabei verehrt, denn zusätzlich zu allen praktischen Vorteilen war diese Kunst zugleich mit religiösen oder spirituellen Handlungen verbunden.
Die matriarchale Jungsteinzeit und der Weg der Symbolik
In der kulturhistorisch ausgerichteten modernen Matriarchatsforschung wurden die matriarchalen Züge der jungsteinzeitlichen Gesellschaft wiederentdeckt und benannt: das Leben in großen Clanhäusern, in denen die Menschen, die in Mutterlinie verwandt sind, zusammenwohnen. Die großen Megalithgräber sind ihrerseits Clangräber und Tempel für die Ahninnen und Ahnen. Die Gesellschaftsordnung zeigt sich als grundsätzlich egalitär; sie ist um die Ahnfrauen und Mütter zentriert.4
Die umfangreiche, ethnologisch ausgerichtete moderne Matriarchatsforschung hat die Kriterien für die matriarchale Gesellschaftsform weitergeführt und detailliert ausgearbeitet, und zwar anhand von heute noch existierenden, indigenen matriarchalen Gesellschaften auf verschiedenen Kontinenten. Sie hat gezeigt, dass die Mütter im Zentrum ihrer Clans nicht „herrschen“, sondern ihre Gemeinschaften durch ein Netz von Räten nach den Prinzipien von Balance und Konsens führen. Das Weltbild ist geprägt von der Auffassung, dass die Welt selbst göttlich ist, sodass die Naturkräfte in Gestalt von Gottheiten verehrt werden. Leben und Tod werden als sich zyklisch abwechselnd gesehen, sodass es keinen ewigen Tod gibt, sondern die Fortdauer des Lebens durch Wiedergeburt. Diese Kriterien wurden an vielen Beispielen ausdrücklich formuliert und damit eine neue Definition von Matriarchat gegeben, die im Gegensatz zu dem alten, leeren Klischee von der „Frauenherrschaft“ steht.5
Bei unserer Aufgabe hier ist immer wieder die Frage zu beantworten, wie sich matriarchale Symbolik trotz der sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse bis in die patriarchalen Jahrtausende hinein erhalten konnte. In der Jungsteinzeit entwickelt, wurde sie auch in der Bronzezeit mit ihren spätmatriarchalen Mustern weitergeführt, sie wurde in dieser Epoche sogar deutlich differenziert und bereichert. Doch auch in der frühpatriarchalen Epoche erlosch sie nicht, obwohl die diversen frühpatriarchalen Reiche rasch entstanden und ebenso rasch wieder zerfielen, auf Kosten der unterjochten Bevölkerung. Aus vielen alten Kultplätzen wurden nun von den Kelten sogenannte „Keltenschanzen“ gemacht, strategische Plätze, die deswegen militärisch so günstig lagen, weil sie sich in einem Netz von Sichtlinien befanden. Als auf die Kelten die frühpatriarchalen Germanen folgten, wurden daraus dann germanische strategische Plätze. Doch zahlreiche Plätze blieben noch Kultorte, wobei die frühere Kultstätte der Göttin zum Platz eines Keltengottes oder germanischen Kriegsgottes umfunktioniert wurde. Aber auch das geschah nicht überall, denn viele Stätten der matriarchalen Göttinnen blieben erhalten, auch wenn sie nun den obersten patriarchalen Vater- und Kriegsgöttern untergeordnet wurden. Diese Göttinnen wurden jetzt mit keltischen, dann germanischen Namen benannt, obwohl sie weder „keltische“ noch „germanische“ Göttinnen waren. Außerdem behielt die bäuerliche Bevölkerung viele Gedanken aus der matriarchalen Weltanschauung bei. Denn noch immer hatte sie mit Mutter Erde zu tun und hing von deren Wohlwollen ab, ebenso davon, welches Wetter oder Unwetter der Himmel ihnen sandte. In den südlichen Teilen Mitteleuropas, besonders in den Alpen und entlang der großen Flüsse, wurde schließlich die römische Kulturschicht darüber gestülpt. Hier erhielten die keltisierten Göttinnen römische Namen, und eine keltisch-römische Mischkultur entstand. Die römischen Kastelle, die Kasernen des neuen Imperiums, wurden wiederum auf die „strategisch günstigen“ Kultplätze gesetzt. Auf die schnurgeraden Kultlinien, die uralten Wege, baute man nun die schnurgeraden Römerstraßen, die jetzt nicht friedliche Händler-Pilger, sondern marschierende Soldaten auf dem schnellsten Weg zum Ziel brachten. Dennoch verraten diese fortgesetzten Überbauungen noch immer, welche Strukturen zuvor in der Landschaft bestanden haben.
Im Mittelalter fuhren die Herrscher mit der Überbauung fort, denn ihre Zwingburgen, heute meist zu Ruinen zerfallen, stehen größtenteils auf alten Kultplätzen jungsteinzeitlich-bronzezeitlicher Herkunft und gewähren den berühmten „strategischen“ Weitblick. Was an Kultstätten noch übrig war, obwohl schon keltisiert, romanisiert oder germanisiert, wurde bewusst mit christlichen Kapellen, Kirchen und Klöstern besetzt. Denn nun wurden alle vorhergegangenen Kulturen unterschiedslos unters „Heidentum“ subsumiert, dessen Stätten verschwinden sollten. Die früheren Gottheiten wurden verteufelt und systematisch ausgemerzt, was insbesondere für die Göttinnen galt – dies brachte einen scharfen, weltanschaulichen Bruch und den Verlust von langen Epochen der Geschichte mit sich. Wo es möglich war, wurden manche der alten Göttinnen und Götter zu „Heiligen“ umfunktioniert und mit Märtyrer-Legenden ausgestattet, und im Hochmittelalter war es dann die christliche Maria, welche die Göttinnen ersetzen und jede Erinnerung an sie tilgen sollte.
Aber das einfache, beharrlich an alten Symbolen und Bräuchen festhaltende Volk las keine Schrift und keine Legenden, sondern orientierte sich an Bildern. Das zwang die jahrhundertelang tätigen Missionare, ihre neuen weiblichen Heiligen und insbesondere die christliche Madonna in den uralten, matriarchalen Bildern von Göttinnen erscheinen zu lassen und sie mit deren Symbolik zu schmücken. Auf diese Weise sollte das der Schrift unkundige Volk endlich begreifen, dass nun die neuen christlichen Frauen all das vermochten, was früher die Göttinnen taten – allerdings ihrem „Herrn Gott“ untergeordnet und ihm dienend ergeben.
Auf diese Weise lebte die matriarchale Symbolik in genauer Übertragung, aber durch die neue Interpretation ins Gegenteil verkehrt, noch immer weiter, bis ins 17. Jh. Das Volk las die Symbolik jedoch weiterhin naiv auf die alte Weise und verstand die neue Interpretation meist nicht. So wurde die umfunktionierte, matriarchale Symbolik noch immer getreu, wenn auch in anderer Absicht, weitergegeben. Sie reichte bis zu den barocken Kirchenmalern, die sich stereotyp an die Vorgaben zur Gestaltung der Bilder hielten, weil „Kunst“ zu jener Zeit als detailgenaue Wiedergabe des Traditionellen verstanden wurde und nicht als subjektive Erfindung von Neuem. Deshalb sind die barocken Altarbilder und Figuren in Kirchen, die auf alten Kultplätzen stehen, außerordentlich vielsagend. In den späteren Zeiten bis heute macht sich dagegen der Verfall dieser Symbolik bemerkbar, denn nun gilt der individuelle Künstler mehr als das uralte Bild oder Symbol.
Damit ist der geschichtliche Weg angedeutet, auf dem die jungsteinzeitliche Göttinnen-Symbolik noch bis in unsere Gegenwart hinein fassbar wird. Wenn man ihre typischen Strukturen kennt, ebenso die typischen Veränderungen, denen sie zu den verschiedenen Zeiten ausgesetzt war, kann man ihre alten Muster wieder aufdecken. Sie gibt uns eine wertvolle Hilfe in die Hand, einen mehrfach überbauten Kultplatz und seine Bedeutung in der Landschaft wieder zu entziffern.6
Die Methodik der matriarchalen Landschaftsmythologie
Die matriarchale Landschaftsmythologie ist der matriarchalen Kunst der Landschaftsformung, wie ich sie oben angedeutet habe, auf der Spur und entdeckt sie wieder. Darin werden die Prinzipien dieser frühen Sichtweise erforscht, und diese dienen wiederum dazu, individuelle Landschaften in ihrem alten, heiligen Sinngehalt zu entschlüsseln. Dabei ist jede Landschaft ein individuelles Ganzes und wird als solches betrachtet, wobei die Forschenden sich der Sichtweise der jungsteinzeitlichen Menschen, die hier wohnten, anzunähern versuchen.
Die Methodik der matriarchalen Landschaftsmythologie, die ich hier kurz skizziere, hilft dabei. Ihre Tragfähigkeit zeigt sich schließlich an den in diesem Buch versammelten Beispielen, an denen man ihre Anwendung sehen kann.
Erste Methode: Begehen einer Landschaft
Die erste und elementare Methode ist, eine Landschaft zu erwandern. Sie immer wieder zu begehen ist die Voraussetzung für jede landschaftsmythologische Erkenntnis, denn auch die jungsteinzeitlichen Menschen gingen zu Fuß. Dabei braucht es einen offenen und weiten Blick und ein ebenso offenes Herz, um ihre Besonderheit und Weiblichkeit zu entdecken. Manchmal fallen einem spezielle Landschaftszüge wie „Schoßtäler“ und „Busenberge“ sofort auf, doch die Frage ist dann, worin diese eigentümlichen Formen eingebettet sind und was sie umgibt. Dieses Gehen und Schauen stimmt uns allmählich in eine Landschaft ein, was notwendig ist, um den symbolischen und ganzheitlichen Blick zu entwickeln, mit dem die Menschen der jungsteinzeitlichen Kulturepoche sie betrachtet haben. Dabei ändert sich unsere Sehweise allmählich, die an unzusammenhängende Einzelheiten gewöhnt ist und uns quasi „blind“ für eine Landschaft macht. Dieses Gehen und Schauen geschieht schweigend und meditativ, ohne Ablenkung und meist allein, bis eine Landschaft selbst „zu sprechen“ beginnt.
Dieser Prozess braucht viel Zeit. In der Regel erfasst man eine Landschaft keineswegs schon bei der ersten neugierigen Begehung, sondern es braucht zahlreiche Wiederholungen, bis sich die Zusammenhänge enthüllen. Oft vergehen sogar Jahre, in denen man immer wieder kommt, wandert und schaut und sich nach und nach in den verschiedenen Teilen einer Landschaft bewegt. Dabei werden stets neue Entdeckungen gemacht, und diese sind meist überraschend. So findet man Steinchen für Steinchen des Mosaiks, bis es sich zu einen Ganzen zusammenfügt, das allmählich das symbolische Bild der Landschaft erscheinen lässt. Dabei bleibt die Herausforderung bestehen, die moderne Zerstückelung von Landschaft durch Gebäude, Straßen und sonstige technische Anlagen zu „übersehen“.
Aus alledem geht hervor, dass man entweder in einer Landschaft wohnen muss, die man entdecken möchte, dort sozusagen „einheimisch“ ist, oder dass man oft wiederkehren muss. In keinem Fall offenbart sich eine Landschaft dem flüchtigen, touristischen Betrachten, das nicht mehr wahrnimmt als die Postkarten-Schönheit eines besonderen Berges oder hübschen Tales. Dieses punktuelle Wahrnehmen bleibt völlig äußerlich und kann keinen Zusammenhang erkennen.
Zweite Methode: Entdecken „Heiliger Hügel“ mit abgesenktem Horizont
Dem offenen Blick in die Landschaft fallen immer wieder Hügel auf, die frei stehend und von mittlerer Höhe sind. Sie sind in der Regel mit Kirchen, Kapellen, Klöstern, Burgen oder Schlössern besetzt, die ihren exponierten Charakter betonen. Sie ziehen beim Wandern oder Reisen durch die jeweilige Landschaft den Blick sofort an. Bei Kirchen und Kapellen dort oben fragt man sich, weshalb die Kirche nicht im Dorf geblieben ist, weil der Aufstieg für Gottesdienstbesucher keineswegs bequem sein dürfte. Bei Burgen und Schlössern denkt man eher an die „strategisch günstige“ Lage. Denn wenn man dort hinaufsteigt, hat man in der Regel eine bemerkenswerte Aussicht, die nur durch die Kapelle, Kirche, Burg oder Ruine gestört wird. Die Sicht geht weit in die Landschaft, trotz der mäßigen Höhe des Hügels, und wird oft als touristisch „schöner Blick“ angepriesen.
Die zweite Methode besteht darin, von einem solchen Hügel aus den Horizont zu prüfen. Die schöne Aussicht entsteht nämlich dadurch, dass der Horizont – obwohl nicht am Meer, sondern im Hügel- oder Bergland – sich scheinbar absenkt und nahezu eben wirkt. Dieser „abgesenkte Horizont“ kommt nur bei besonderen Hügeln in unebener Landschaft vor, und das ist jedes Mal erstaunlich. Der Blick kann in einem mehr oder weniger weiten Winkel über die Landschaft schweifen, manchmal sogar ringsum, weil er durch Hügelkuppen und Bergspitzen, die sich scheinbar ducken, nicht behindert wird. Der weite Winkel reicht meistens von Ost nach Süd nach West, zumindest aber von Ost nach Süd oder von Süd nach West. Der Norden ist nicht einbezogen, dort kann sich ein Hügel oder Berg erheben. Es sind genau jene Himmelsrichtungen, durch die alle Gestirne ihren Weg ziehen, denn die Wahl dieser besonderen Hügel mit dem abgesenkten Horizont galt der astronomischen Beobachtung. Es sind uralte „Heilige Hügel“, die den jungsteinzeitlichen Menschen zur Bestimmung ihres Kalenders dienten, denn nur bei einem ebenen Horizont kann man die zeitlich genauen Auf- und Untergänge der Gestirne beobachten. Deshalb besaßen diese Heiligen Hügel in jener frühen Epoche Steinsetzungen als aufrechte Peilsteine, mit deren Hilfe die exakten Gestirnsbewegungen gemessen werden konnten. Solche Steinsetzungen der Megalithkultur, wie Steinkreise, stehende Steine (Menhire) und Großsteingräber (Dolmen), sind überall in Mitteleuropa noch heute erhalten. Jede dieser Steinsetzungen war zugleich ein Heiligtum. Später wurden solche „heidnischen“ Tempel von den christlichen Missionaren rücksichtslos zerstört, indem sie Kirchen und Kapellen auf diese Hügel setzten. Ebenso gern wurden die Plätze wegen des „strategisch günstigen“ Blicks von späteren Burg- und Schlossherren benutzt, weil sie keinen anderen Blick mehr kannten.
Dritte Methode: Prüfen von Sichtlinien gemäß der Archäo-Astronomie
Hat man einen solchen jungsteinzeitlichen Heiligen Hügel entdeckt – was nicht allzu schwierig ist, denn es gibt sie häufig –, dann ist die dritte Methode, sich mit den Sichtlinien zu befassen. Das Land liegt bis zum Horizont den Betrachtenden zu Füßen und bietet sich dieser Nachprüfung offen dar. Nicht jede Sichtlinie ist allerdings eine besondere, es geht hier um die astronomisch wichtigen Linien: die Ost-West-Linie, die Süd-Nord-Linie, die Nordost-Südwest-Linie und die Südost-Nordwest-Linie. Sie lassen sich leicht durch einen Kompass herausfinden. Diese Linien dienten den jungsteinzeitlichen Menschen zur Bestimmung ihres Kalenders, denn es sind die Himmelsrichtungen der Auf- und Untergänge der Sonne zu Beginn der vier Jahreszeiten. Sie hatten außer ihrer praktischen Bedeutung auch eine mythologische, die für die symbolische Entzifferung der Landschaft von größtem Interesse ist. Beispielsweise galt der Osten als die Himmelsrichtung des Lichts und des Lebens, denn dort gehen die Gestirne auf, und der Westen als die der Dunkelheit und des Todes, denn dort gehen sie unter.
Außer den einfachen Sonnenbewegungen haben die frühesten Astronominnen und Kalenderbauer mithilfe von komplexen Anlagen auch die Bewegungen des Mondes studiert und in Mondlinien festgehalten, deren Winkel ebenfalls Sichtlinien ergeben. Alle anderen sonstigen Linien, die nicht mit den Himmelsrichtungen von Sonnenlinien oder Mondlinien (Kalenderlinien) übereinstimmen, sind ohne Bedeutung und keine relevanten Sichtlinien im hier genannten Sinn. Das heißt, die jungsteinzeitlichen Menschen blickten nicht irgendwie flüchtig und wirr in die Landschaft, sondern betrachteten sie sehr strukturiert. Auch diese Sehweise können wir wieder einüben.
Vierte Methode: Prüfen von Kultlinien und Kultwegen
Hat man eine exakte astronomische Sichtlinie von einem Heiligen Hügel aus gefunden, so ist es interessant nachzuprüfen, ob genau auf dieser Linie weitere Hügel mit Kirchen, Kapellen, Burgen usw. liegen. Das ist meist der Fall, und man sieht dann diese Bauten sich wie an einer Schnur auf dieser exakt geraden Linie aufreihen. Eine solche Entdeckung ist spannend, denn nun hat man eine Kultlinie gefunden. Das heißt, auf jedem dieser Hügel gab es in den frühen Kulturen eine Steinsetzung zur Gestirnsbeobachtung, und damit ist er ein Kultplatz, auf dem sich Menschen befanden. Auf diese Weise konnte die Fernkommunikation mithilfe von Feuer von einem Kultplatz zum nächsten großräumig durch die gesamte Landschaft erfolgen. Auf erhöhen Bergkämmen gibt es auch solche Plätze, von denen man sogar in zwei Landschaften schauen kann. Hier wurde die jungsteinzeitliche Telekommunikation über den Horizont hinweg in die benachbarte Landschaft weitergeführt.
Diese Kultplätze waren durch Wege verbunden. Lagen sie auf Hügeln entlang eines Flusses, so bewegten sich die Menschen auf diesem Wasserweg zu ihnen. Lagen sie hingegen auf Hügeln im Land, dann führten die frühesten Pfade schnurgerade durch die Landschaft von einem Kultplatz zum nächsten. Für diese ersten Wege über Land ist typisch, dass sie in ständigem Auf und Ab verlaufen, alle diese Hügel hinab und wieder hinauf. Die Hügel dienten dabei als Orientierungspunkte und, wenn man oben angekommen war, als Rastplätze. Außerdem verliefen die Wege, wenn möglich, auf Höhenrücken und nicht durch Täler. Die Niederungen von Bächen und Flüssen wurden gemieden, weil sie im Frühling bei der Schneeschmelze gefährlich anschwollen; ebenso unwegsam waren Täler und Senken, die häufig Sümpfe bildeten. Zudem ist der Weg den Höhenrücken entlang der kürzeste. Auf diese Weise entstanden die frühesten Handelswege über Land, die zugleich Pilgerwege von einer heiligen Stätte zur nächsten waren.
Fünfte Methode: archäologische Analyse
Ist man mit den Entdeckungen in der Landschaft so weit fortgeschritten, gilt es nun, sie durch mehrere interdisziplinäre Analysen zu untermauern, um zufällige Übereinstimmungen auszuschließen. Eine grundsätzliche Analyse ist die archäologische, die darüber Auskunft gibt, ob in dieser Landschaft überhaupt Relikte aus der Jungsteinzeit vorkommen. Man kann die schönsten „Busenberge“ und „Schoßtäler“ gefunden haben, was jedoch nichts nützt, wenn keine archäologischen Funde bestätigen, dass es dort jungsteinzeitliche Wege und Siedlungen gegeben hat. Sind dort aber keine frühen Menschen mit ihrem symbolischen Blick auf die Landschaft gewesen, dann hat unser eigener symbolischer Blick keine Grundlage. Allein die Archäologie liefert den Boden, ob wir mit der landschaftsmythologischen Betrachtungsweise in bestimmten Landschaften fortfahren können oder sie aufgeben müssen.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es in manchen Gegenden, die heute als „Provinz“ gelten, um die Archäologie oft schlecht bestellt ist. Sei es, dass für die Provinzen zu wenig finanzielle Mittel für archäologische Forschung bereitgestellt werden oder dass kein Interesse an der Jungsteinzeit besteht – man erforscht dort lieber die patriarchalen Römer, höchstens noch die kriegerischen Kelten, oder es gibt grundsätzlich ideologische Hindernisse, eine Kulturepoche zu erforschen, in der Göttinnen vorkamen. Hier stehen die Kirchenherren den Archäologen oft im Wege, weil für sie Kulturgeschichte definitiv mit dem Bau ihrer ersten Klöster beginnt. Oder die Bauern behindern die Archäologen, weil sie nicht wollen, dass bei Funden die Wissenschaftler in ihren Äckern zu graben beginnen; deshalb lassen sie die Funde lieber verschwinden. Daher ist, was die Archäologie betrifft, die menschliche Situation in dieser Wissenschaft und um sie herum ebenfalls relevant.
Für konkrete Landschaften sind dabei nicht die großen Werke berühmter Archäologen wichtig, sondern eher die kleinen Schriften lokaler Archäologen und rühriger Heimatforscher. Was sie zu ihrer heimischen Landschaft zu sagen haben, ist von größter Bedeutung, denn sie benennen die genauen Orte und Plätze.
Sechste Methode: linguistische Analyse
Sehr aufschlussreich sind Landschaftsnamen, seien es die Namen von Bergen, Hügeln, Seen, Flüssen, Tälern oder von Orten, Dörfern und Städten. Auch Flurnamen, das heißt, Bezeichnungen von Plätzen und Flurstücken sind wichtig, die volkstümlich bekannt sind oder vom entsprechenden Amt erfragt werden können. Die Namen von landschaftlichen Besonderheiten sind oft sehr alt, weil die Tradition an ihnen festhält, selbst wenn der Name nicht mehr verstanden wird. Manchmal gehen sie sprachgeschichtlich bis zu vor-indoeuropäischen Wurzeln zurück, und damit gelangen wir in die jungsteinzeit-bronzezeitliche Kulturschicht, die Jahrtausende vor den Indoeuropäern war. Durch Sprachforscher ist die Bedeutung von häufig vorkommenden vor-indoeuropäischen Wörtern erschlossen worden. Das ist sehr hilfreich, um die Sichtweise der vor-indoeuropäischen Bevölkerung auf eine Landschaft herauszufinden, insbesondere was deren Weiblichkeit und Göttlichkeit betrifft.
Ebenso aufschlussreich ist, dass manche auffallende Landschaftszüge während der verschiedenen kulturellen Überschichtungen immer wieder neu benannt wurden, jedoch im alten Sinne. Das ist dann der Fall, wenn in Bergen oder Flüssen eine Landschaftsgöttin gesehen wurde, welche die späteren Kulturen übernahmen. Ihr ältester Name wird dann zuerst keltisiert, dann romanisiert oder germanisiert, ein Vorgang, der auch in den Mythen zu beobachten ist.
Bei Orten, Dörfern und Städten kann man an bestimmten Eigenheiten, wie zum Beispiel Anfangs- oder Endsilben, ablesen, welches Volk sie gegründet hat, wobei auch hier die interessantesten jene sind, deren Namen ebenfalls auf die vor-indoeuropäischen Kulturen zurückgehen. Flurnamen oder Namen von alten Heiligen Hügeln können sehr symbolisch sein, wie die vielen lokalen Bezeichnungen mit dem Wort „Frau“ zeigen, zum Beispiel „Frauenberg“, „Frauenholz“, „Frauenau“, „Frauendorf“, „Frauenbrunnen“. Keineswegs ist damit immer die christliche Maria gemeint, die als „Unsere liebe Frau“ tituliert wird, denn dieser Titel bezog sich früher auf Göttinnen.
Siebte Methode: Kirchenforschung
Mit den Kirchen und Kapellen auf den alten Heiligen Hügeln wurde die christliche Symbolik auf viel ältere symbolische Vorstellungen daraufgesetzt. Wenn man frühere Kultstätten nicht zerstört hat, so wurden sie umfunktioniert, was insbesondere dann geschah, wenn die Verehrung der Bevölkerung an dem alten heiligen Platz festhielt. Das missionarische Prinzip, das dabei zur Anwendung kam, war, die vorchristliche Symbolik unmittelbar auf christliche Gestalten zu übertragen, doch den Sinn zu verdrehen, sodass die Bevölkerung quasi dasselbe, aber im christlichen Gewand vorfand. Da die einfachen Leute Bilder statt Schrift lasen, verstanden sie, dass alle Kräfte, die sie zuvor hier verehrt hatten, nun von christlichen Gestalten verkörpert wurden – falls sie das akzeptierten. Deshalb ist die Ikonografie in den Kirchen, das heißt die Bildlichkeit von Gemälden und Skulpturen mit ihrer offenen oder versteckten Symbolik, weitaus wichtiger als die christlichen Legenden dazu, die mit den Bildern häufig nicht übereinstimmen. Diese traditionelle Symbolik transportiert noch immer die vorchristlichen Bedeutungen.
Besonders auffällig sind in diesem Zusammenhang Marien-Wallfahrtskirchen. Sie befinden sich auf sehr wichtigen alten Kultplätzen der Göttin, was man anhand ihrer besonderen Lage leicht erkennt. War diese beispielsweise eine Himmelsgöttin, so erscheint Maria nun als Himmelsfrau; war die Göttin erdhaft und mütterlich, so findet sich die Betonung auf Maria in ihrer Mutterrolle; handelte es sich um eine Göttin der Unterwelt, so finden wir Maria als Alte Frau oder sogar als Schwarze Madonna wieder. Diese kurze Bemerkung mag zeigen, wie direkt die christliche Übernahme war, weshalb sie uns wirksame Hilfen bietet, den alten Sinngehalt des Kultplatzes aufzudecken. Um Kirchenforschung in diesem Sinne zu betreiben, muss man die christliche Symbolik ebenso gut kennen wie die hinter ihr stehende, matriarchale Symbolik. Erst vor dem Hintergrund der Letzteren wird durchsichtig, was mit der viel späteren christlichen Symbolik verdeckt werden soll.
Es ist dabei wesentlich, zugleich die Landschaft um den Kirchplatz zu studieren, denn eine Himmelsgöttin wurde an anderen Stellen verehrt als eine Muttergöttin oder Göttin der Unterwelt. Göttinnen waren im matriarchalen Denken keine abstrakten, transzendenten Wesen, sondern stets auf die konkreten Erscheinungen der Erde und des Himmels bezogen; sie waren Landschaftsgöttinnen und sagen deshalb außerordentlich viel über den symbolischen Sinn einer Landschaft aus.
Außerdem ist die Landschaftsgöttin als Berg, Hügel oder Fluss immer noch existent und nicht zu übersehen. Dies zwang die Missionare zu drastischen Aussagen in christlichen Legenden und Ikonografie, bis hin zur Dämonisierung der Landschaft, um den Blick der Menschen ausschließlich ins Innere der Kirchen zu lenken, sie sozusagen „blind“ für die umgebende Landschaft zu machen. Deshalb findet man häufig Namen mit „Teufel“ oder „Hexen“ für bestimmte Landschaftszüge, zum Beispiel „Teufelshörner“, „Teufelskopf“, „Hexenküche“, „Hexentanzplatz“ usw. Sie weisen gerade durch die spätere Dämonisierung darauf hin, dass diese Plätze vorher bedeutend waren und positiv verstanden wurden. Dämonisierte Landschaftszüge kehren manchmal auch als Teufels- oder Drachengestalten in den Kirchen wieder. In diesem Sinne sind Kirchen und Kapellen auf alten Heiligen Hügeln sehr aussagekräftig, wenn auch nicht im christlichen Sinne. Denn sie bewahren an diesen Plätzen eine sakrale Kultkontinuität, wenn auch keine Kontinuität der Kulturen.
Viel schlechter steht es um die Heiligen Hügel, die mit Burgen oder Schlössern besetzt wurden, denn die sakrale Symbolik verschwand unter den dicken, profanen Mauern, selbst wenn diese noch nicht zur Ruine zerfallen sind. Doch zum Glück knüpfen sich oft Sagen an Burgen, die uns weiteren Aufschluss geben können.
Achte Methode: Sagen- und Mythenforschung
Sagen- und Mythenforschung ist einer der wichtigsten Bereiche, um die Symbolik von Landschaften zu erkennen – nicht umsonst heißt es „Landschaftsmythologie“. Es geht dabei um die Erschließung des Weltbildes der frühen Kulturen, sozusagen um „geistige Archäologie“. Das ist jedoch nicht möglich in der Art und Weise, wie mit authentischen Sagen und Mythen noch heute umgegangen wird. Sie werden nicht unterschieden von Fabeln, Schwänken oder literarischen Erfindungen der Romantik, sondern wie diese als skurrile Fantasie-Gebilde abgetan. Dabei glauben die verschiedenen geistigen Strömungen, ihre neuzeitlichen Ansichten hineinlesen zu dürfen, wofür die grassierende psychologische Interpretation ein typisches Beispiel ist.
Gegen solche Vereinnahmung sperren sich jedoch nicht nur ihre spröden Inhalte und seltsam fremden Motive, sondern ebenfalls ihre immer wiederkehrende Struktur und die gleichbleibenden Handlungsabläufe.7 Solche Übereinstimmungen kann sich keine „Volksfantasie“ in den verschiedensten Gegenden Europas ausgedacht haben, sondern dahinter stehen weitreichende, sozialhistorische Vorgänge, die im Sagenkern in knappster Form enthalten sind. Diese Sagenkerne funktionierten wie eine Gedächtnisstütze für die mündliche Erzählung, denn über außerordentlich lange Zeiträume wurden Mythen und Sagen ausschließlich mündlich tradiert.
Ihre sinngemäßen Aussagen lassen sich nur vor dem Hintergrund des Weltbildes herausfinden, aus dem sie stammen, nämlich dem der matriarchalen Jungstein- und Bronzezeit. Das wird besonders deutlich in den weitverbreiteten Drei-Frauen-Sagen, die einen Abglanz der matriarchalen Dreifachen Göttin spiegeln. In der Regel werden diese mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestatteten Frauen in den Sagen dämonisiert oder zu Schuldigen und Erlösungsbedürftigen herabgewürdigt, was auf die spätere patriarchale und christliche Umdeutung des Sageninhaltes zurückgeht. Ähnlich wird mit den zahllosen Sagen von sogenannten „Zwergen“ verfahren, die sehr verbreitet sind und stets dieselben Muster aufweisen. Ihre Inhalte wurden der Lächerlichkeit oder Verniedlichung preisgegeben, falls diese seltsamen Wesen nicht schon als „böse Geister“ abgestempelt waren. Jede Art von Verteufelung und Dämonisierung sollte uns jedoch aufmerksam machen, weil sich dahinter die Umkehrung der Werte nicht nur gegen Erscheinungen der Natur verbirgt, sondern auch gegen die frühen Völker, welche die Natur seit uralter Zeit verehrten.
Solche fremdartigen Sageninhalte wurden zwar eifrig gesammelt und füllen heute Bücher über Bücher, aber sie werden noch immer in unverstandener Form wie ein wirrer Haufen von Kuriositäten präsentiert. Das ist ein beschämender Umgang mit den Resten einer sehr alten, kulturellen Tradition, die in solchen Mythen und Sagen steckt. Erst vor dem Hintergrund der Forschung zur matriarchalen Mythologie werden ihre Inhalte verständlich, denn damit werden sie in den Rahmen der eigenen Kultur zurückversetzt. Dabei kann man deutlich die späteren Zufügungen aus patriarchaler und christlicher Zeit erkennen und sie eliminieren.8
Das heißt, man muss in Mythen und Sagen auf diese ältesten Muster und Motive zurückgehen, denn keine Mythe oder Sage ist ein homogenes Gebilde, sondern aus verschiedenen Schichten aus den unterschiedlichen Kulturepochen zusammengesetzt. Hier geht die „geistige Archäologie“ in die Details, um den kostbaren geistigen Schatz sachangemessen heben zu können. Auf diese Weise werden die Sagen und Mythen in ihren Kernaussagen sehr klar und liefern viele Informationen aus den frühen Kulturepochen. Sie können uns mitteilen, auf welche Weise die damaligen Menschen ihr Leben und die Landschaft, in der sie wohnten, verstanden haben und dieses Verständnis in ihre eigentümliche Symbolsprache kleideten.
Neunte Methode: Folklore-Forschung
Sagen und Mythen als einst mündlich tradierte Erzählungen gehören zum weiten Bereich der Folklore, denn sie sind nicht von individuellen Autoren geschaffene Literatur, auch wenn individuelle Personen sie überliefert haben. Erst viel später wurden sie von Sagensammlern aufgeschrieben. Dasselbe gilt von anderen Bereichen der Folklore, wie Bräuche, Volkslieder und Tanzspiele, konventionelle Muster in Wandmalerei, Geweben und Gebäck, Volksfeste und sogenannte „heidnische“ Relikte noch in christlichen Festen. Sie wurden nie aufgeschrieben, werden aber noch immer – wenn auch unverstanden – praktiziert. Heute sind sie, wie die Sagen, meist zur touristischen Belustigung verkommen.
Der Bereich der Volkstraditionen ist umfangreich und zeigt von Region zu Region eine große Verschiedenheit. Wenn man deshalb eine bestimmte Gegend erforscht, gehört die Kenntnis der lokalen Bräuche dazu, denn sie beziehen sich in der Regel auf die umgebende Landschaft. In ihnen werden die Jahreszeiten gefeiert, wobei die Landschaft im Frühling, Sommer, Herbst und Winter verschiedene Gesichter zeigt. Oder es werden bestimmte, symbolisch verstandene Landschaftszüge, wie Teiche, Quellen und besondere Steine, in den Bräuchen geehrt. Dabei verraten uns ihre Handlungsabläufe genau, welche Symbolik man in dem jeweiligen Platz sieht.
Die uralten Aussagen solcher Bräuche können mithilfe der matriarchalen Mythologie erschlossen werden. Das heißt, auch Symbolik und Handlungsablauf in Bräuchen, Liedern usw. benötigen dieselbe genaue Entschlüsselung wie die Sagen und Mythen, damit ihr Bezug zur Landschaft sichtbar wird. Dabei zeigt sich, welcher Brauch noch einen authentischen Kern besitzt oder sich späterer, patriarchaler und christlicher Herkunft verdankt. Bei diesen Analysen darf man sich nicht davon irritieren lassen, dass Historiker und Kirchenherren die meisten dieser Bräuche zeitlich sehr spät ansetzen, denn sie richten sich nach der ersten Erwähnung des Brauches in Urkunden, in denen er meist verboten wird. Nun schafft nicht erst die schriftliche Urkunde einen solchen Brauch, und insbesondere das Verbot zeigt, dass er schon lange vorher existierte. Außerdem pflegte die Bevölkerung ihre alten, ererbten Brauchtümer nicht aufzuschreiben, sondern sie gehören zum großen Bereich mündlicher Tradition, eben zur Folklore.
Zehnte Methode: Erforschung von Rückzugsgebieten und kulturellen Nischen
Der weite Bereich der Folklore gedieh am besten in Rückzugsgebieten und kulturellen Nischen, die zu den verachteten „Provinzen“ wurden. Manche dieser Gegenden waren in den frühen Epochen kulturelle Zentren, bis zu ihrer Zerstörung, was die Archäologie ans Licht bringt. Danach dienten sie als Rückzugsgebiete, und hinzu kamen andere Gegenden, die schon damals am Rande der Zentren lagen. Diese Gebiete haben bestimmte Landschaftszüge, die einen Rückzug ermöglichten: große Wälder, weite Moore, hohe Gebirge mit einsamen Tälern und Seen, abgelegene Inseln, alles, was Mitteleuropa auch aufzuweisen hat.
Solche Rückzüge geschahen in der Regel nicht nur einmal. Wiederholt zogen sich dorthin frühere Völker vor späteren Eroberern zurück und wichen ihnen aus, wie die Alten Völker vor den hereinbrechenden Indoeuropäern, zum Beispiel die Räter vor den Kelten, wie später auch die Kelten vor den Germanen, wie zuletzt Gruppen von gesellschaftlich Ausgestoßenen vor dem Zugriff der Herrschenden.
Die Geschichtsschreibung kann hier die Archäologie ergänzen. Sie lässt uns wissen, wann bestimmte Gegenden zu Rückzugsgebieten wurden und zur abseits gelegenen Provinz herabsanken. Wir erfahren dabei auch, in welchem kulturellen Kontext sie zur Provinz wurden, denn das zeigt an, was ab jetzt konserviert und beharrlich als Tradition weitergeführt wird, unberührt von neueren und modernen Strömungen. In solchen Gebieten bleiben wesentlich ältere Traditionen erhalten als in Durchgangsgebieten oder Städten, sie werden zu einer kulturellen Nische. Diese älteren Traditionen reichen natürlich nicht mehr ungebrochen in die matriarchalen jungsteinzeit-bronzezeitlichen Epochen zurück. Aber matriarchale Reste bleiben darin trotz späterer Überschichtung und Verchristlichung besser erhalten, während sie in den sich rasch wandelnden städtischen Zentren längst erloschen sind.
Deshalb sind gerade diese Rückzugsgebiete und Provinzen einer näheren geschichtlichen Betrachtung wert, vor allem, weil sie sich in der Regel in den schönen und wilden Landschaften befinden, die in der Jungsteinzeit wegen ihrer Besonderheit verehrt wurden.
Heute werden sie von der matriarchalen Landschaftsmythologie in ihrer alten Bedeutung und Heiligkeit wiederentdeckt. Beide Male, sowohl in der Jungsteinzeit wie in der Gegenwart, handelt es sich um ein Anschauen und Erkennen mit den Augen und dem Herzen zugleich.
Mögen viele Menschen Freude daran finden, diese Landschaften nach dem hier gegebenen Leitfaden zu erwandern und sie in einem neuen Licht zu sehen und zu lieben!
Auf den Spuren von „Ötzis“ Göttin
Zur Kulturepoche der Jungsteinzeit in den Ötztaler Alpen9
Mit dem sensationellen Fund des Mannes aus dem Eis, populär „Ötzi“ genannt, am Tisenjoch in 3210 m Höhe, direkt am Übergang vom Ötztal ins Schnalstal, kommen wir in eine enorme historische Tiefe zurück. Die Datierung hat ergeben, dass er um 3350 bis 3100 v. u. Z. gelebt hat, also in der späten Jungsteinzeit (Spätneolithikum).10 In dieser Epoche war die Verarbeitung von Kupfer schon bekannt, weshalb sie auch als „Kupferzeit“ bezeichnet wird. Mit großer archäologischer und naturwissenschaftlicher Genauigkeit ist dieser Fund untersucht und ausgewertet worden, doch bis heute fehlt weitgehend eine Darstellung des kulturellen Hintergrundes.
Dabei gibt es genügend Möglichkeiten, den jungsteinzeitlichen Kulturhorizont zu erforschen. Allerdings müssen dazu die Grenzen der archäologischen Fachdisziplin überschritten werden und Gebiete wie Religionswissenschaft, Sprachforschung, Mythologie und Symbolforschung, Volkskunde, Kultplatzforschung zum Vergleich herangezogen werden und gelegentlich auch die Ethnologie. Das darf jedoch nicht derart vereinzelt und zufällig geschehen wie bisher, sondern muss systematisch unternommen werden. Dafür stellt die moderne Matriarchatsforschung als eine innovative Wissenschaft das philosophische Fundament und den systematisch-methodologischen Rahmen bereit. Außerdem ist sie als kulturgeschichtliche Grundlagenforschung von nicht zu unterschätzender Reichweite.11
Die moderne Matriarchatsforschung stellt eine neue Interpretation der Kulturgeschichte der Menschheit bereit und ist geeignet, die bisherige patriarchale Interpretation abzulösen. Obwohl die patriarchale Geschichtsschreibung eine lange Tradition hat, bewegt sie sich keinesfalls im Feld unumstößlicher Wahrheiten. Viele Dinge werden als „Fakten“ ausgegeben, die bereits gedeutete Befunde sind, und Widersprüche im eigenen Denksystem werden tunlichst versteckt. Sie ist nicht mehr als eine Interpretation aus patriarchaler Perspektive, und eine bestimmte Interpretation kann durch eine andere aufgehoben werden.
Nach philosophischen Grundsätzen ist diejenige Interpretation oder Theorie die bessere, die mehr wissenschaftliche Rätsel, Ungereimtheiten und Widersprüche auflösen kann als die vorige. In diesem Sinne hat die matriarchale Interpretation der Kulturgeschichte einige Vorzüge. Insbesondere kann sie uns für das Verständnis der frühen Geschichte der Menschheit, zu der die hier in Betracht kommende Epoche gehört, den Schlüssel liefern. Das gilt auch für den „Fall Ötzi“, zu dessen Tod es verschiedene Deutungen gibt, die jedoch unseres Erachtens den patriarchalen Denkrahmen nicht überschreiten.
„Ötzis“ Ökonomie und Sozialordnung: Jungsteinzeitliche Hirtenkultur
Hier taucht als erste Frage auf, was „jungsteinzeitliche Hirtenkultur“ eigentlich ist. Es ist erwiesen, dass es bereits zu „Ötzis“ Zeiten die Transhumanz der Almauftriebe mit Schafherden gab. Der Begriff „Transhumanz“ leitet sich von „transhumare“ ab, das „Hin- und Herwandern“ bedeutet und ein lokales, geregeltes Nomadentum meint. Diese Wanderungen der Hirten führten bereits in der Jungsteinzeit vom südlichen Vinschgau (Val Venosta) über vorgelagerte Pässe wie das Tascheljöchl ins obere Schnalstal (Val Senales) und von dort über die hohen Pässe Hochjoch, Niederjoch und Gurgler Eisjoch über den Alpenhauptkamm hinweg in das hintere Ötztal. Im Juni wurden die Schafherden über die Pässe und Gletscher auf die hoch gelegenen Sommerweiden bei Vent und Gurgl im hinteren Ötztal hinaufgeführt, und im September kamen sie wieder herunter. Diese Wanderungen blicken auf eine extrem lange Geschichte zurück, denn sie wurden vor mehr als 5000 Jahren genauso wie heute unternommen. Dabei gab es um 4000 – 3000 v. u. Z. eine warme Epoche mit weit zurückgezogenen Gletschern, eine geografische Situation, der wir uns heute mit dem sich rapide erwärmenden Klima wieder annähern. Aus diesem Grund taute „Ötzi“ aus seinem Eissarg wieder heraus, in dem er in den dazwischen liegenden 5000 Jahren unverweslich eingefroren war.12 Damals waren die genannten Pässe eisfrei und die Übergänge leichter als heute, was das hintere Ötztal mit der südlicher gelegenen Kultur verband. Von Süden her wurde es kultiviert und nicht von Norden her, denn von Norden ist der Zugang durch endlos lange Wege und schluchtartige Täler sehr schwierig. Außerdem zogen die Menschen in der Jungsteinzeit nicht durch von reißenden Gewässern und Steinschlag gefährdete Täler, sondern bewegten sich auf trockenen Höhenrücken und über lichte Pässe. Damit gehören kulturgeschichtlich das hintere Ötztal und Südtirol zusammen, ebenso ist das gesamte Dolomiten-Gebiet damit verbunden. Es ist das alte Gebiet der Räter und Ladiner und jener Völker, die noch vor ihnen da waren. Die früheste, sesshafte Bauernkultur, die in den breiten, sonnigen Gebirgstälern der Dolomiten und des Vinschgaus die ersten Dörfer und Städte schuf, kam aus der großen Ebene Norditaliens, das heißt aus dem Mittelmeerraum mit seinen hochentwickelten, matriarchalen Kulturen der Jungsteinzeit. Die Hirtenkultur in der oberen Zone der Alpen ist ein Ableger davon und überall mit diesen Bauernsiedlungen verbunden – genau so, wie es heute noch ist.
Nun scheint in der heutigen Sichtweise die jungsteinzeitliche Hirtenkultur, die mit gelegentlicher Jägerei verknüpft war, eine reine Männerangelegenheit gewesen zu sein. Nicht nur ist unser „Ötzi“, der mit Jagdgerät ausgestattet war, ein Mann, auch sonst ist nur von „Jägern und Hirten“ die Rede. Die Hirtenwirtschaft stellt man bedenkenlos genau so dar, wie sie heute ist, nämlich fest in Männerhand. Hier beginnen die ideologischen Probleme.
Im Widerspruch dazu stehen Sagenmotive, die etwas anderes zeigen: Hier ist zuerst das aus der Schweiz bekannte rätoromanische Margarethenlied bedeutsam, in dem es eine Hirtin ist, nämlich Margaretha, welche die Almwirtschaft ganz allein versieht. Sie hütet Schafe und Kühe, sie mäht die Wiesen, sie schneidet und mahlt den Roggen und Weizen, sie melkt und buttert, sie macht sich Kleidung aus feiner Schafwolle.13 Es ist von keinem einzigen Mann die Rede, der ihr dabei geholfen hätte. Ganz im Gegenteil: Als die Männer auf die Alm kommen, ereignet sich ein Kulturbruch, denn Margaretha wird vertrieben und nimmt ihre praktischen Künste, mitsamt ihrem Kräuter- und Heilwissen, mit sich fort. Ihr Name „Marga-Retha“ enthält außerdem den Namen „Reitia/Rätia/Rita“. Reitia war die Göttin der Räter, wobei „Räter“ ein Sammelbegriff für verschiedene Volksgruppen ist, die ursprünglich eine vor-indoeuropäische Sprache gesprochen haben.14 Zu ihnen gehören zum Beispiel Ligurer und Etrusker, die einst auch die Po-Ebene Norditaliens bewohnten und um 400 v. u. Z. durch frühpatriarchale, kriegerische Keltenstämme daraus vertrieben wurden. Viele von ihnen wichen nach Mittelitalien aus, andere zogen sich vor diesen Eroberern in die südlichen Alpentäler zurück. Von diesen „Rätern“ ist dokumentiert, dass sie in noch späterer Zeit aus ihren Alpentälern herabstiegen, um ihre Göttin Reitia in deren Heiligtum von Este, in der Nähe von Padua, zu verehren.15 Damit erfassen wir die mediterrane Herkunft dieser verschiedenen Volksgruppen, die von den Römern später, gemäß dem Namen ihrer Göttin, „Räter“ genannt wurden. Nach den Sprachforschern Brunner und Toth enthält die rätoromanische Sprache – eine Variante des Lateinischen – noch einzelne Wörter aus einer altorientalisch-mediterranen Sprache. So bedeutet der Name der Göttin Reitia „meine Hirtin“.16 Ist es nicht merkwürdig, dass eine angeblich reine Männer-Hirtenkultur ausgerechnet eine Göttin anbeten sollte? Dabei lebten die Räter noch erheblich später als die jungsteinzeitliche Kultur unseres „Ötzi“.
Auch andere Sagen weisen auf die Frau als früheste Hirtin hin, so eine Sage aus Südtirol, in der eine Hirtin allein auf der Alm wohnt und alle Arbeit verrichtet, obwohl die Alm angeblich einem Bauern gehört, der aber nie auftritt. Diese Hirtin ruht am Abend „auf dem steinernen Stuhl aus, der neben der Hütte im Unkraut steht“, worin wir unschwer einen Kultstein erkennen können.17 Ebenso verhält es sich mit der „steinernen Platte“, auf der Margaretha angeblich nur ausrutscht, jedoch eher ein altes Fruchtbarkeitsritual vollzieht, wie sie auf den Rutschsteinen, auch „Kindersteine/Chindlisteine“ genannt, üblich waren. Die Südtiroler Hirtin klagt über die Kriegshorden im Tal, die alles verwüstet haben, was auf gewaltsame Eroberung hinweist, der eine ältere Kultur zum Opfer fiel. Es begegnet ihr dann die Weiße Frau, die sich als Herrin vom Rosengarten herausstellt. Sie lehrt die junge Frau eine neue Kunst, das Brokatweben, was die Armut der Hirtin beendet.
Außerdem: Was sind die im ganzen Alpengebiet in den Sagen auftretenden „Saligen“ oder „Wildfrauen“ anderes als Hirtinnen, welche die Wildziegen, die Gämsen, zähmen und als ihre Tiere hüten? Sie verteidigen sie stets gegen andrängende Jäger und gelten deshalb als Schützerinnen der Tiere. Sie verstehen sich weitaus besser als die späteren Menschen auf die Verarbeitung der Milch und auf die Kräuterheilkunde, ebenso aufs Spinnen und Weben, und sie pflegen ihre schneeweiße Wäsche in der Höhe an Bergzinnen zu trocknen. Zudem sind sie wetterkundig, weshalb sie den Menschen hilfreich Rat erteilen. Heiratet eine Wildfrau sogar einen von diesen späteren Menschen, so weiß sie die Wirtschaft besser zu führen, als es auf den anderen Höfen der Fall ist. Der Hof dieses glücklichen Bauern blüht, aber nur so lange, bis er ein Versprechen, das er der Wildfrau gegeben hat, bricht.18
Alle diese Sagen weisen darauf hin, dass es vor der Männerwirtschaft eine ältere Kultur gegeben hat, die von Frauen getragen wurde. Sie waren die Bäuerinnen in den Tälern und in den Hochlagen der Alpen die Hirtinnen. Diese alteuropäische Kultur blühte in den Alpen seit der Jungsteinzeit und zog sich wegen der späteren Eroberungen auch der Alpentäler durch die Kelten und Germanen in die hohen, verborgenen Zonen der Gebirge zurück. Um 15 v. u. Z. eroberten die Römer den Alpenraum, der zur Provinz „Rätien“ des Römischen Reiches wurde, und sie romanisierten die dort alteingesessene Bevölkerung. Doch in den verborgenen Rückzugsgebieten der Berge erhielten sich alte Sitten und Weltanschauungen auf der Grundlage des Hirtinnentums noch lange, bis in christliche Zeiten hinein.
Darauf weist auch die Sage von dem Mädchen Sadra und der Göttin Alpina in Rätien hin, in der die Göttin höchstpersönlich als Alpenkönigin mit einer Krone aus Bergkristall und Edelweiß auftritt und die kranke Sadra heilt. Auffallend ist, dass hier – obwohl schon Männer aus der Familie Sadras auf der Alm mitwirken – die Verarbeitung der Milch und die Zubereitung der Nahrung ausschließlich in den Händen der Frau liegt. Dabei ist Sadra keine Magd, sondern die Erbtochter mit ausgeprägt eigenem Willen, der ihr jüngerer Bruder selbstlos dient. Bei der späteren patriarchalen Hirtenkultur ist es aber festes Gesetz, dass für die Verarbeitung der Milch nur der erwachsene Mann, der Senn oder Senner, zuständig ist.19 Die Sage lässt sich daher nur auf dem Boden einer vorangegangenen Hirtinnen-Kultur verstehen. Sie stellt einen Übergang dar, bei dem bereits eine gemischte Gesellschaft auf der Alm arbeitet, das wichtigste Recht aber noch in der Hand der Frau liegt. Es zeigt, dass nicht die Männer, sondern dass sie die Besitzerin der Lebensmittel und damit die Ernährerin ist.
Nun besteht die allgemeine Auffassung, die auch in wissenschaftlichen Standardwerken vertreten wird, dass Hirtenkultur in der Frühgeschichte immer männlich geprägt und patriarchal gewesen sei, während matriarchale Muster – wenn überhaupt – nur bei den Pflanzerkulturen im exotischen Asien, also möglichst weit weg, vorgekommen seien. Es kann hier nicht auf die massive Ideologie eingegangen werden, die in dieser Auffassung steckt, dazu ist hier nicht der Raum. Jedoch sei auf die Verwechslung hingewiesen, die dieser Auffassung zugrunde liegt, von einer Gelehrtengeneration zur nächsten weitergetragen wird und damit unser Geschichtsbild verzerrt. Es ist die Verwechslung der späteren Hirtenkrieger-Kulturen mit der frühen Hirtenkultur, die als Transhumanz mit dem frühesten Ackerbau verknüpft war. Die Hirtenkrieger-Kulturen tauchten ein paar Jahrtausende später in den südrussischen Steppen auf und beunruhigten die alten Ackerbaukulturen im Vorderen Orient und in Süd- und Osteuropa. Die Hirtenkrieger stellen keine unabhängige Kulturstufe dar, wie behauptet wird, sondern sie existierten parasitär von den älteren Ackerbaugesellschaften, die sie überfielen und ihrer agrarischen Produkte beraubten, ohne die Menschen nicht leben können. Jahrtausende vor diesem Aufeinanderprallen feindlicher Völker gab es bereits die friedliche Verbindung von Ackerbau und Hirtentum, und zwar innerhalb ein und desselben Volkes, das zugleich von Ackerbau und Herdenhaltung lebte. Das wurde besonders in den Gebirgen praktiziert, wo der Boden für den Ackerbau knapp ist, und es hat sich seit der Jungsteinzeit bis heute in diesen Regionen erhalten.
Die frühe Ackerbaukultur der Jungsteinzeit war überall von der matriarchalen Sozialordnung geprägt, die der patriarchalen vorausging. Diese Ackerbaukultur ist die Grundlage der mit ihr verbundenen Hirtenkultur, sodass auch diese als matriarchal zu gelten hat. Dafür haben wir heute noch Beispiele von Gesellschaften außerhalb Europas, deren Wurzeln bis in die Jungsteinzeit zurückreichen: die traditionelle tibetische Kultur20 und die traditionelle Kultur der Tuareg, der berberischen Hirtennomaden in der Sahara.21 Die Tuareg als uraltes Hirtenvolk, das zusätzlich Ackerbau in den Oasen betreibt, verbanden in ihrer traditionellen Gesellschaft bis an den Rand der Gegenwart eine matriarchale Sozialordnung mit Hirtenkultur. Nach ihren alten Regeln gehören die Herden den Frauen, sowohl die Ziegenherden wie die Kamelherden. Die Männer hüten die Kamele im Auftrag der Frauen, führen sie auf die Weiden und unternehmen mit ihnen Handelszüge in Karawanen. Die Ziegenherden bleiben bei den Frauen, mit denen sie sich und die Kinder in der Wüste ernähren. Sind die Kamelherden bei den Zelten der Frauen, dann werden sie zwar von den Männern gemolken, aber jeder Tropfen Milch wird in die Hände der Frauen gegeben. Weil die Tiere den Frauen gehören, gehören ihnen auch die Lebensmittel. Die älteste Frau jedes Zeltes, die Mutter eines matriarchalen Clans und „Herrin des Zeltes“, empfängt die Milch und ordnet an, was weiterverarbeitet und was zum Verzehr verteilt wird, was sie eigenhändig besorgt. Aus ihrer Hand als Ernährerin empfangen ihre Töchter, Söhne und Enkelkinder die tägliche Nahrung.
Dies ist ein ethnologisches Beispiel, mit dem wir noch in der Gegenwart die Muster ältester matriarchaler Hirtenkultur erfassen können. Es gibt auch mythologische Beispiele aus der Frühgeschichte, die dasselbe besagen. So erwählte Inanna, die Große Göttin von Sumer, den Hirten Dumuzi als ihren Geliebten und Heiligen König.22 Dabei war sie die Repräsentantin der matriarchalen Ackerbaukultur des Zweistromlandes an Euphrat und Tigris, und er war der Repräsentant der Hirtenkultur der Steppe. Von dieser frühen Hirtenkultur erfahren wir, dass Dumuzi in der Sippe seiner Mutter und Schwester lebte und dass diese Frauen ihn beauftragten, ihre Herden zu hüten. Die Sozialordnung war also matrilinear und matrilokal, und die Schaf- und Ziegenherden gehörten ebenfalls den Frauen. Die Heirat zwischen Inanna von Sumer und Dumuzi aus der Steppe stellt symbolisch die friedliche Verbindung zweier Völker und Kulturen dar, die beide matriarchal gewesen sind. Sonst wäre es wohl kaum so konfliktfrei verlaufen!
Betrachten wir mit diesem Hintergrundswissen nun das Umfeld von „Ötzi“: Er war höchstwahrscheinlich das Mitglied einer matriarchal geprägten Ackerbaukultur aus dem Vinschgau, die Tochtersiedlungen in den höheren Alpentälern hatte. Eine Hirtenkultur als sommerliche Weidewirtschaft war diesen Ackerbausiedlungen angegliedert. Denn in der Jungsteinzeit gab es noch kein Patriarchat, ebenso wenig in der Kupferzeit. Die Weidewirtschaft wurde entweder von Hirtinnen allein betrieben oder von Hirtinnen und Hirten gemeinsam, wobei die Männer als Brüder den Frauen, ihren Schwestern, halfen. Die Milch der Tiere kam dabei, wie üblich, in die Hände der Frauen, die sie als Besitzerinnen der Herden verarbeiteten oder in ihrem Clan verteilten. Die Männer gingen außerdem gelegentlich auf Jagd, obwohl die Jagd keine Wirtschaftsgrundlage mehr war. Auch „Ötzi“ war auf der Jagd, aber sein gesellschaftlicher Hintergrund war keine Jägerkultur mehr; diese war seit der Altsteinzeit vergangen. So können wir es uns vorstellen, und das würde die oben erwähnten Sagen vollständig erklären.
„Ötzis“ Weltbild und Religion: Jungsteinzeitliche Göttinkultur
Um die Sache konkreter zu machen, widmen wir uns hier der Frage nach „Ötzis“ Muttersippe und nach seiner Göttin. Denn jungsteinzeitliche Religion war grundsätzlich Göttinnen-Religion. Wie hießen diese, und wer waren sie? Der historische Kern, der in Sagen und Mythen steckt, kann uns den Weg zu den Antworten weisen.
Als die Warmzeit um 4000 – 3000 v. u. Z. zu Ende ging, hörten die paradiesischen Verhältnisse in den Alpen auf, die eisfreie Pässe und Siedlungsmöglichkeiten auf saftigen Wiesen bis hoch hinauf an den Rand der Felsen geboten hatten. Schneestürme tobten, Gletscher stießen rasch vorwärts und bedeckten ehemals blühende alpine Almen, auch die Hochtäler wurden rau und kahl. Dieser Klimawechsel ist offenbar nicht langsam, sondern abrupt vor sich gegangen. Die Fülle der Sagen aus dem gesamten Alpenraum, die sich auf das Thema der Vergletscherung beziehen, belegt, dass der Wechsel schlagartig und überraschend kam.
Immer ist dabei auch von Problemen in der Gesellschaft die Rede und die Vereisung deshalb von Warnungen und Verfluchungen begleitet. Die Menschen der matriarchalen Kultur müssen diesen Klimawechsel als Strafe der Göttin wegen eines gewissen Verfalls ihrer traditionellen Sitten in der Kupferzeit empfunden haben, denn darauf weisen die mit den Untergangssagen verbundenen moralisierenden Motive hin: Eine alte Mutter wurde zu wenig geachtet, kostbare Lebensmittel wurden verschwendet, ein Fremder oder eine Familie erhielt keine Gastfreundschaft. Die Achtung vor der ältesten Frau, die Heilighaltung der Lebensmittel, die bedingungslose Gastfreundschaft sind allesamt matriarchale Werte. Daher ist die verfluchende Person in den meisten Fällen die alte Mutter selbst oder eine andere, die traditionellen Werte anmahnende Person. Später wurden dieser Sagengruppe patriarchale Moralvorstellungen untergeschoben wie zum Beispiel Mangel an Keuschheit und Demut bei den Frauen, deren „lasterhaftes“ Leben oder versäumter Kirchgang bestraft wird, und ausufernder Stolz, verbunden mit Habgier oder Geiz bei den Männern.
Was das hintere Ötztal und das Schnalstal betrifft, so sind die Ortsnamen, die in den dortigen Untergangssagen auftauchen, verblüffend. Diese hoch gelegenen, durch plötzlichen Kälteeinbruch untergegangenen Städte tragen die Namen „Tanneneh“, die unter dem Großen Gurgler Ferner oder Grafferner liegen soll („Ferner“ heißt „Gletscher“), oder „Onanä“ unter dem Langtauferer Ferner oder sogar „Dananä“ unter dem Vernagtferner.23 Alle diese großen Gletscherfelder liegen unmittelbar nördlich vom Schnalstal auf der dem Ötztal zugewandten Seite des Alpenhauptkammes. In der Sage von Dananä ist es sogar die Göttin selbst, die im Getöse des Schneesturmes und von Blitzen erhellt als riesige Gestalt sichtbar wird und die Verfluchung ausruft: „Dananä! Dananä! Weh dir, weh! Schneib zu – und aper nimmermeh!“ („Dananä, Dananä! Weh dir, weh! Schneie zu – und taue nie mehr auf!“)24
Nun gibt es nicht weit davon entfernt in den Dolomiten die Sage von „Tanna“, der Königin der Crodères, den Felsriesen vom Dolomiten-Bergstock Marmaròles.25 Tanna sitzt oben auf dem ewigen Eis, und ihrer Macht nach zu urteilen ist sie eine Göttin wie Alpina, denn sie kann Lawinen und Bergstürze sowie reißende Wildwasser anhalten oder auf die Menschen niedergehen lassen. Hier erscheint die Göttin nicht nur als Verfluchende, sondern selbst als Handelnde und unmittelbar Strafende. Im Namen der Stadt „Tanneneh“ steckt der Name dieser Göttin, denn der Kulturkreis ist derselbe. Man kann ihn daher übersetzen mit „Stadt der Göttin Tanna“.
Hinter Tanna steht eine frühe, mediterrane Göttin, deren Name durch die allmähliche Ausbreitung der jungsteinzeitlichen Mittelmeerkultur auf dem ganzen Kontinent überall in Europa vorkommt. Es ist „Danaë“, die Muttergöttin des neolithischen Kreta, und sie selbst verkörpert das Land. Das Wort ist kretisch und gehört damit zu einer uralten, vor-indoeuropäischen Sprachschicht. Auf dem Seeweg verbreitete sich die matriarchal geprägte, jungsteinzeitliche Mittelmeerkultur nach Frankreich und den Britischen Inseln, wo eins der Einwanderervölker sich „Túatha Dé Danaan“ nannte, das „Volk der Göttin Dana“. Zwei gleichförmige Hügel in Irland heißen „Paps Danu“, das heißt „die Brüste der Dana“. Auch Skandinavien wurde erreicht, wovon das Wort „Dänemark“ als „Land der Dana“ noch heute zeugt. Auch auf dem Weg über die großen Ströme ging die Ausbreitung nach Mitteleuropa hinein, wie der Name des Flusses Donau (lat. Danuvius) zeigt, was „Aue/Fluss der Dana“ heißt. Der einst in ganz Europa verbreitete Diana-Kult weist ebenfalls darauf hin, denn „Di-ana“ ist die „Göttin Dana/Ana“. Die Diana-Verehrung überdauerte in Europa noch das Mittelalter und erlosch erst zu Beginn der Neuzeit während der lang anhaltenden Pogrome gegen Frauen, der sogenannten „Hexen-Verfolgung“. Alle weiteren Bezeichnungen mit „Ana/Anu/En“ gehören ebenfalls zum Umfeld dieser uralten Muttergöttin. Sie kehrt noch in verchristlichter Form als „Heilige Anna“, die Großmutter des Jesuskindes, wieder.26
Wie wir schon sagten, wanderten von der Adria über die Po-Ebene matriarchal geprägte Völker mit mediterraner Kultur von Süden in die Alpen ein, in sehr früher Zeit freiwillig und später unfreiwillig. Sie besiedelten die sonnigen Dolomitentäler, gelangten in den Vinschgau, ins Schnalstal und ins hintere Ötztal als einem nördlichen Ausläufer ihrer Kultur jenseits des Alpenhauptkammes. Das ist der Grund, weshalb wir den kretischen Göttin-Namen „Danaë“ in dem Stadtnamen „Dananä“ wiederfinden und in lautlicher Abwandlung auch in „Onanä“ und „Tanneneh“. Ebenso ist der Name der Alpengöttin „Tanna“ von Dana abgeleitet. Nun wissen wir, wie „Ötzis“ Göttin geheißen hat.
Doch wie hieß seine Muttersippe, sein Clan? Die aus Südtirol stammende Forscherin Claire French-Wieser hat darauf aufmerksam gemacht, dass in dieser Region der Sippenname „Daney“ oder „Thanai“, auch „Donay“ oder „Thonay“ sehr häufig vorkommt, so in Naturns, Meran und Andrian, aber auch nördlich des Brennerpasses.27