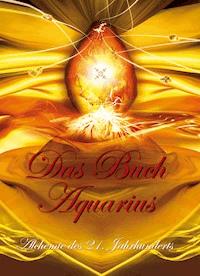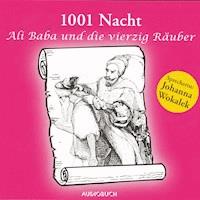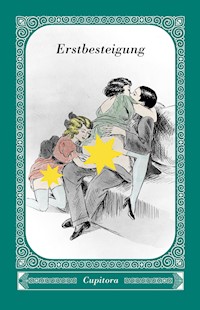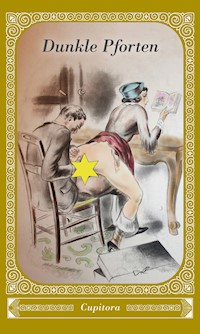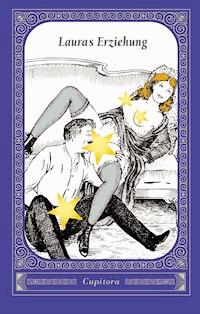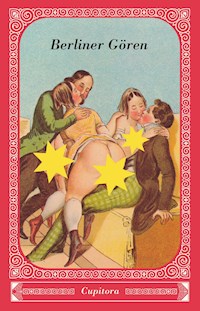
Eine garantiert anstößige Aneinanderreihung ungemein kesser Szenen aus dem Berlin der 1920er Jahre, angereichert mit zehn pikanten Zeichnungen Eine garantiert anstößige Aneinanderreihung ungemein kesser Szenen aus dem Berlin der 1920er Jahre, angereichert mit zehn pikanten Zeichnungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berliner Gören
Eine garantiert anstößige Aneinanderreihung ungemein kesser Szenen aus dem Berlin der 1920er Jahre, angereichert mit zehn pikanten Zeichnungen
eISBN 978-3-95841-753-3
© by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
I.
Wenn das so weitergeht, tu ich mir was an. Trübsinnig werde ich vor Langeweile oder begehe einen dummen Streich. Oder werde am Ende gar vernünftig. Entsetzlicher Gedanke: Vernünftig! So ein Leben zu führen wie ein braver Staatsbürger, wie so ein Herdenmensch, so eine Nummer! I Gift – –!
Bedrohliche Anzeichen sind genug dafür vorhanden. Ich fange an über mein Leben nachzudenken. Versuche mich zu analysieren. Und spitze sogar den Gänsekiel, um über mich zu schreiben! Aber mit irgendetwas muss der Mensch doch seine Zeit totschlagen. Bis jetzt habe ich immer meinen Stolz darein gesetzt, alle so genannte Vernunft, alles Bedenken, alles überlegen aus meinem Leben auszuschalten. Wollte mein Leben genießen, wie es die Minute vor mich hinwirft. Und habe nie gezögert, es anzupacken und festzuhalten, wo und wann es sich mir bot. Besonders wenn es sich in Gestalt eines warmen Frauenleibs bot.
Da bin ich am Kern! Die Frau!
Die Frau war bisher mein Leben. Die Frau ist schuld daran, dass ich aus meinem schönen, meinem geliebten Berlin fort musste. Die Frau ist schuld daran, dass ich jetzt hier unten in dem sterbensfaden Ospedaletti hocke. Die Frau ist schuld daran, dass ich über mich nachdenke. Die Frau ist schuld daran, dass ich mit einem Male so viel Tinte konsumiere.
Die Frau ist an allem schuld! Die Frau nicht als der große pathetische Lebensinhalt überspannter Gefühlsathleten. Nicht als die Verkörperung des Bösen nach Ansicht etlicher Philosophieidioten. Nicht als Genussmittel, nicht als Kindererzeugungsmaschine Und nicht die Frau als Göttin, als Idol. Das am allerwenigsten.
Nein, die Frau als – die Frau. Als Begriff – Gott sei Dank als kein hypothetischer – die Frau, nach der es den Mann drängt, er mag es zugestehen oder nicht. Die Frau, um deretwillen Hunderte von Kriegen geführt, um deretwillen hundertmal hundertmal hundert Morde begangen wurden und begangen werden. Die Frau, die uns in den Schlamm wirft und uns in den Himmel hebt. Die Frau, die die Sünde erfunden hat. Und Herrgott ist die Sünde schön!
So habe ich für und durch die Frau gelebt. Und werde es weiter halten bis an mein selig Ende. Es gibt solche Ungeheuer von Männern, die ohne die Frau auskommen Entweder bemitleidenswerte Kranke, Perverse, oder gefühllose Stockfische, die sich auf der Straße so ein Stück Fleisch kaufen, wenn sie gut aufgelegt sind. Oder solche, die mit der Frau nur Kinder machen wollen. Diese Gesellen verdienen nicht, dass die Frau geschaffen wurde. Sie sollten in Erdhöhlen hausen und ihren überschüssigen Samen meinetwegen auf Flaschen ziehen.
Es gibt Männer, die bei jedem Unterrock erotische Krämpfe bekommen. Die gleich trunkenen Satyren sich auf jeden Frauenleib stürzen, gleichviel ob er in Seide oder in Barchent gehüllt ist. Gleichviel ob er duftet wie die Rosen von Schiras oder starrt von Schmutz. Männer, die eine Frau genießen, wie man eine Zigarette raucht. Wenn man genug hat, wirft man sie weg und tritt sie womöglich noch aus.
Zur ersten Kategorie gehören nur Idioten, Halbtiere, zur zweiten nur Halunken. Leider bilden beide zusammen im männlichen Geschlechte die überwiegende Majorität.
Wohl möglich, dass mich viele meiner Bekannten, selbst solche, die mir näher stehen, zu den Halunken rechnen werden. Denn ich bin nach landläufigen Begriffen ein Wüstling. Ich habe Jungfrauen verführt, habe Ehemänner betrogen, habe mich in allen Lasterhöhlen herumgetrieben. Habe Geld und Zeit vertan. Habe beinah meine Jugendkraft vergeudet. Der Frau wegen.
Ich will mich nicht besser machen als ich bin. Ich bin eine außerordentlich sinnliche Natur. Ich habe geschlechtlich exzediert, um mit meinem Medizinalrat zu sprechen. Nirgends fühle ich meine unersättliche Sinnlichkeit stärker als hier, wo ich auf allerstrengste Fasten gesetzt bin. Wo ich meinem geschwächten Körper Ruhe gönnen soll. Wo ich die Sünde, die mich geschwächt, aus dem Wege gehen soll. Mein Blut kocht, mein Trieb bäumt sich wie ein wild gewordenes Pferd. In der Nacht habe ich Fieberträume, in denen mich nackte Frauenleiber wie auf einem Hexensabbat umtanzen.
So bin ich! Wäre ich anders, säße ich nicht hier, hätte nicht die Pistolenkugel, die mir den Rest gegeben, in die Brust bekommen.
Auf einer Pastorenversammlung würden sie mich ans Kreuz nageln. Und doch ist ein Unterschied zwischen mir und jenen. Für mich sitzt das Wesen der Frau nicht nur zwischen den Schenkeln. Sie ist nicht nur ein mehr oder minder schönes Gefäß, in das sich tierische Brunst ergießt. Ebenso wie ich den Platonismus, diese Notlüge perverser und impotenter Halbmänner verachte, ebenso hasse ich das Andere.
Ein beliebter Gemeinplatz ist: Die Frau ist die Krone der Schöpfung. Ich sage anders: Die Frau ist die Krone der Kultur. Sie ist ihr Anfang und ihr letztes Ziel. An der Stellung, der Bildung, dem Charakter, vor allem an der Schönheit der Frau eines Landes, erkennt man dessen Zivilisation.
Ich bin ein Mensch der raffiniertesten Kultur. Als solcher muss ich die Frau lieben, muss ich den Genuss mit ihr erstreben. Denn ohne sie ist kein Genuss, ist überhaupt nichts. Wenn die Frau oder vielmehr ihr Geschlecht nicht wäre, hausten wir heute noch als Protoplasmakügelchen auf dem Meeresgrunde.
Darum liebe ich die Frau. Kann ich es anders beweisen, als dass ich die Frauen liebe? Allerdings, vielleicht dächte ich anders, wenn ich weniger erotisch veranlagt wäre. Aber wie soll man eine Frau verehren, wenn man nicht den einen einzigen Wunsch kennt, immer und immer an ihrem Altar zu opfern? Zumal das Opfern noch dazu so herrlich schön ist?
Ich habe mich beinahe ganz geopfert.
***
Es nutzt nichts. Ich bin heute an der Meeresküste bis Bordighera gelaufen. Ich bin, um ganz ehrlich zu sein, meinen Sinnen davongelaufen. Meine Natur, die sich nicht in die veränderte Lebensweise finden kann, rebelliert. Seit mehr als sechs Wochen habe ich kein Weib angerührt. Vier davon bin ich in Berlin im Sanatorium gelegen, und die anderen zwei vegetiere ich nun hier in dem »Paradies«. Schönes Paradies, in dem es keine Frauen gibt!
Die Saison ist tot! Das Kasino ist leer, die frischen kleinen Villen auf den grünen Hügeln stehen verlassen; auf den Straßen hört man nur italienisch reden. Am Strand sitzt von früh bis spät so ein Malweib und schmiert die Leinwand voll. Diese Abart des Weibes stammt aus Insterburg – nähere Beschreibung daher unnötig. Von Zeit zu Zeit tauchen drei amerikanische Misses mit ihrer Gouvernante und ihren Kodaks auf. Mich haben sie schon siebenundneunzigmal geknipst. Schöner sind sie dadurch nicht geworden. Da wären mir beinahe noch die Italienerinnen lieber. Besonders eine ist darunter. Wenn sie an mir vorübergeht, tanzen ihre großen Brüste unter dem Hemd, dass mir die Augen übergehen. Aber einmal habe ich einen Horror vor allen nackten Füßen, deren Zehen mit Erde verklebt sind; die ungewaschene, ungekämmte Natur erweckt gewisse Angstgefühle in mir – und dann habe ich in Berlin den beiden Frauen, die mich am meisten lieben, die sich wirklich um mein Wohl und Wehe sorgen, mein Ehrenwort gegeben, mich peinlich streng nach den Vorschriften des Medizinalrates zu richten. Wenn nicht der geliebten Frau, wem denn soll man ein Ehrenwort halten? Aber es fällt mir verdammt schwer. Immer schwerer! So oft ich den tanzenden Brüsten begegne, packt mich eine satanische Lust, unter das zumeist schmierige Hemd zu fahren und sie für ein paar Minuten festzupressen. Das Weibstück lacht mich mit seinen schwarzen Augen auch immer frecher, immer herausfordernder an. Neulich, ich kam von einem Spaziergang von San Remo, begegne ich ihr außerhalb des Ortes. Es war schon ziemlich spät und auf dem schmalen Waldwege kein Mensch zu erblicken. Ich sah sie schon von weitem daherkommen und ihre nackten Füße, ihr weißes Kopftuch leuchteten mir entgegen. Als sie bei mir war, blieb sie stehen und lachte mich an. Zähne zeigte sie dabei, groß und weiß wie persische Perlen. Meine Augen brannten auf ihrer Brust, die von dem schnellen Gang wieder wie wahnsinnig tanzte, und unwillkürlich trat ich einen, zwei Schritte näher. Sie wich nicht zurück, sie schien zu warten.
»Wohin gehen Sie da?«, fragte ich sie.
Sie wies mit dem Kopf nach unten.
»Nach Haus.«
»Sind Sie verheiratet?«
»Ja, mein Mann arbeitet auf unserm Feld; ich gehe in die Stadt waschen.«
»Warum bleiben Sie da stehen?«
»Weil mich der Herr immer so ansieht.«
Dabei lacht sie und ihre schwarzen Augen funkeln. Wenn ich sie jetzt anpacke, liegt sie auch schon auf dem Rücken – –
Aber ich beherrsche mich. Ich beherrsche mich! Einmal spüre ich plötzlich einen intensiven Seifengeruch. Und dann fällt mir mein Ehrenwort ein. Ich gebe der ganz verdutzten Person eine Lire und lasse die Brüste unangetastet. Also entging der brave Feldarbeiter dem Schicksal so vieler vornehmerer Herren, gehörnt zu werden.
Mir jedoch hat diese heroische Enthaltsamkeit nichts genützt, sondern nur geschadet. Als ich ins Hotel kam, schlich ich mich in meine Zimmer, nur um nicht dem Stubenmädchen zu begegnen. Ich fürchtete, ich würde ein Attentat auf seine Tugend unternehmen. Ich war so erregt, dass mich schwindelte, und es blieb mir nichts übrig, als zu meiner Abkühlung eine frische Dusche zu nehmen
Das half. Ich verbrachte wenigstens eine ruhige Nacht. Aber irgendetwas muss da geschehen. Sonst werde ich in den zwei Monaten, zu denen ich noch verdammt, wenn nicht aus Langeweile trübsinnig, auf jeden Fall aus steter unbefriedigter Aufregung tobsüchtig.
Was nutzen mir da alle meine schönen Betrachtungen über meine Art des Frauenkultus. Fazit, das nackte Fazit ist, ich kann ohne die Frau nicht leben. Ich kann nicht ohne Erotik leben. Was für vornehme Worte man doch für so gemeine Dinge erfunden hat! Erotik! Früher hieß das anders. Ich komme mir beinahe vor wie der geile Affe Napoleon, der des Nachts seinen Polizeiminister und Oberkuppler Fouché in Paris herumjagte:
Ich muss ein Weib haben.
Aber Gott sei Dank, ich erinnere mich noch rechtzeitig, dass ich ein paar Seiten vorher mit Emphase behauptet habe: Ich bin eine Ausnahme, ich bin ein Mensch der raffiniertesten Kultur. Ich werde also meine Brunst bezwingen, ich werde sie mir von der Seele, will sagen aus dem Leib herausschreiben.
Auf der schiefen Bahn bin ich nun einmal. Die Langeweile ist meine Muse, und wenn meine Memoiren auch gerade so wenig eine zwingende Notwendigkeit für die Menschheit sind wie alle, alle die anderen, mit denen in letzter Zeit die Welt beglückt wurde – mir werden sie den Zweck erfüllen. In ihnen werde ich genießen, werde wieder genießen, woran ich mich bereits erfreut; Stunde um Stunde will ich mir wieder heraufbeschwören, in denen ich glücklich, selig und berauscht war. Alle die Frauen, die ich geliebt, die ich liebe, werden zu mir kommen; ich werde wieder in ihren Reizen schwelgen, werde wieder – opfern. Wenn auch nur im Geiste.
Was tut’s! Ehe ich mir und meinem Leben untreu werde? Die Illusion muss mich eben über die paar Wochen hinwegtäuschen, bis ich wieder nach Berlin zurück darf. Nach Berlin! Und dann: Ich werde sogar moralisch, ich bekomme Verantwortungsgefühle. Vielleicht habe ich einmal einen Sohn. Dann mag er aus diesen Memoiren lernen, wie man ein Leben lebt, das nur der Schönheit des Genusses, der Quintessenz gleichsam des Genießens gewidmet ist. Des Genießens durch die Frau und mit der Frau.
***
Ich bin ein waschechtes Berliner Kind. Ich glaube, das muss man sofort an der Arroganz merken, mit der ich von meiner eigenen werten Person rede. Der Westen ist das engste Viertel meiner engeren Heimat, denn in der Bülowstraße hielt ich meinen Einzug in die Welt. Damals bestanden Kaiserallee und Kurfürstendamm nur noch auf den Plänen spekulativer Baumeister, und der Zoologische Garten war ein Sonntagnachmittagsausflug.
Viel weiß ich von der Stätte meiner ersten Kindheit nicht mehr. Es war wohl die typische Berliner elegante Wohnung mit Erker, Balkon und dem in stetem mystischen Halbdunkel liegenden Speisezimmer, in der ich mich während der ersten Jahre meines Daseins unter der Aufsicht einer zaundürren englischen Miss mit meiner um ein Jahr älteren Schwester Else herumtrieb. Von meinen Eltern hörte und sah ich damals nicht viel. Es war in den Jahren nach dem französischen Kriege, da der Milliardensegen von, der Seine die bis dahin so bescheidenen Gestade der Spree überschwemmte und aus Spreesparta ein Spreeathen zu machen begann. Man fühlte sich mit einmal in Berlin als Weltstädter, und das Leben, das bis dahin ein »Innenleben« gewesen, ward nun ein »Außenleben«. Der beinah über Nacht hereingeregnete Reichtum wollte genossen sein. Man reiste, man lief in die Theater, gab und besuchte Gesellschaften – kurz man regelte nach Pariser und Wiener Vorbild seine Existenz nach den Geboten der »Saison«.
Das alles kann man viel besser in manchen anderen Büchern nachlesen, die es sich zur Aufgabe stellen, die Historie des Berlin der damaligen Zeit aufzuzeichnen. Ich berühre das nur, damit man versteht, warum ich meine Eltern oft tagelang nicht zu Gesicht bekam. Mein Vater war überhaupt eine Zeit lang nur so was wie eine mythische Persönlichkeit für mich. Er war ein froher, genussfreudiger Mann, der vermöge seiner Stellung als Chef des Bankhauses R. H. Grunert und Comp. und vermöge seines großen Reichtums in der Berliner Gesellschaft eine der ersten Geigen spielte. Um uns Kinder hatte er wenig Zeit sich zu kümmern, und daher kommt es, dass ich offen gestanden nicht übermäßig viel für ihn übrig habe. Heute ist er ein immer noch lebenslustiger alter Herr, der sich aber auch zur Stunde über seine Vaterschaft nicht allzu viel Kopfzerbrechen macht. Meine skrupellose Genussfreude ist wohl sein Erbteil.
Meine Mutter war eine ziemlich ernste, stille Frau, die ihren Jugendbildern nach einmal eine Schönheit ersten Ranges gewesen sein muss. Ich habe sie in meiner Erinnerung als eine blasse Frau, die für uns Kinder immer einen zärtlichen Blick, ein liebes Wort übrig hatte. Leider war sie schwer leidend und verbrachte die meiste Zeit, wenn mein Vater sie in seinem rücksichtslosen Frohsinn nicht von einem Vergnügen zum andern schleppte, oder ihre Freundinnen sie besuchten, müd und matt in ihrem Zimmer. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass meine Kindheit eine düstere oder gar eine traurige gewesen ist. Im Gegenteil. Ich war ein fester, starker Bengel, der recht bald wusste, dass er der einzige Sohn eines steinreichen Vaters war, und sich seine Lebensmaximen dementsprechend zurechtlegte. Das englische Knochengerüst, dem die Sorge für mein körperliches und geistiges Wachstum anvertraut war, imponierte mir ganz und gar nicht, und ich war in lobenswerter Konsequenz stets darauf bedacht, es durch irgend eine Dummheit zu ärgern. Das gelbe Gesicht wurde dann grün, und die lange Nase so spitz, dass man einen Hut daran aufhängen konnte. Ich verriet schon als Kind meine späteren Anlagen und Neigungen. Alles Hässliche war mir antipathisch, flößte mir einen direkten Hass ein, besonders eine hässliche Frau.
Dagegen vertrug ich mich mit meiner Schwester Elsa ausgezeichnet. Sie war ein zierliches, bildhübsches Persönchen, das bereits als Achtjährige seine graziösen Beinchen so kokett zu setzen wusste wie eine Achtzehnjährige. Ich küsste sie und drückte sie an mich, so oft ich konnte. Es bereitete mir ein köstliches Vergnügen und Wohlgefühl. Und ihr augenscheinlich auch. Eh ich noch wusste, wie grundverschieden Mann und Frau von einander sind, hatte ich schon heraus, dass jede Berührung mit einem Frauenkörper etwas sehr Angenehmes und daher stets Wünschenswertes war. Ich war eben ein Haken, der sich rechtzeitig krümmte.
Wenn ich im Tiergarten mit anderem Kindern spielte, suchte ich immer die kleinen Mädchen anzugreifen und zu drücken. Hatte ich eins mal zu stark in den Fingern, schrie es wohl, aber im großen und ganzen merkte ich schon damals, dass die holde Weiblichkeit sich der männlichen Kraft nicht allzu ungern überlässt. Einmal erwischte ich die kleine Erna May beim Verstecken spielen hinter einem dichten Busch, wo uns kein Mensch sehen konnte. Erna war ein feuriges, schwarzhaariges Ding, auf das ich es schon lange scharf hatte. Bis dahin war sie meinen Liebkosungen entglitten, nun aber, da ich wie ein Wilder über sie herfiel, stand sie merkwürdig still. Ich hielt sie mit dem linken Arm an mich gepresst, während ich mit der Rechten sie am ganzen Körper abtätschelte. Wusste selber nicht recht, was ich wollte und was ich tat, aber die Gaschielite bereitete mir eine unbekannte, so wohlige Erregung, dass ich fast gar nicht von Erna ablassen wollte. Ich küsste sie übers ganze Gesicht, und schließlich fiel ich vor ihr nieder und presste meine Lippen auf ihre nackten runden Wädchen. Erna blieb nichts schuldig. Ihre kleinen runden Arme schlang sie um meinen Hals und presste sich an mich, dass ich ganz deutlich an meinem Leib ihren weichen, sanft gewölbten Bauch spürte. Als wir einander losließen, waren wir zerzaust und glühten wie zwei elektrische Lampen. Sie mit echt weiblicher Schlauheit, trotz ihrer sechs Lenze, zupfte sich sorgfältig zurecht, damit niemand etwas merken sollte. Ich stand daneben und schnappte Luft, so erregt war ich immer noch. »Ich bin deine Braut, Jay«, sagte sie dann feierlich.
»Und ich dein Bräutigam. Wir werden uns heiraten.«
***
Dieser »selige Zustand der süßen Brautzeit« hinderte mich nicht, für meine weitere Ausbildung Sorge zu tragen. Unbewusst, nur von meinem überstarken Instinkt getrieben, drängte ich mich, wo ich nur konnte, an Frauen und Mädchen heran. Wenn ich durch den Rock die Wärme ihrer Glieder spürte, lief immer so ein wohliges Prickeln durch meinen ganzen Körper, mit dem ich kein anderes Gefühl der Erregung oder der Freude vergleichen konnte. Niemand war sicher vor mir, außer unserer englischen Miss, die ich nach wie vor mit meiner Antipathie beehrte, und unserer alten, dicken Köchin. Meine Mutter selbstverständlich auch, vor der mich immer eine gewisse ehrfürchtige Scheu zurückhielt. Sonst machte ich mich skrupellos an jedes weibliche Wesen heran, das in meinen Bereich kam.
Heut noch erinnere ich mich mit einem gewissen spitzbübischen Behagen an die erstaunten Gesichter, welche die Besucherinnen meiner Mutter machten, wenn sie mich plötzlich, während sie plauderten und ihren Tee schlürften, zu ihren Füßen sitzen sahen und fühlten, wie ich mich gegen ihre Beine presste. Ich hatte so eine harmlose, unschuldige Art … War artig und stille, nicht wie andere Kinder, die fortwährend die Gespräche der Erwachsenen stören. Schmeichlerisch, schüchtern schob ich mich an mein Opfer heran und wartete darauf, dass mir die Betreffende irgend ein freundliches Wort oder eine Liebkosung zu teil werden ließe. Die eine oder die andere zog mich auch wohl an sich heran und gab mir einen wohl wollenden Kuss. Sie küssten mich alle gerne, denn ich hörte es oft genug, dass ich ein bildhübscher kleiner Kerl sei. Und ich ließ mich ebenso gerne küssen!
So ein Kuss von ein paar weichen Lippen ist doch etwas Wundervolles! Die Lippen sind das Tor zur Seele, der Eingang zur Liebe der Frau. Sie küsst nur den Mann, den sie liebt. Ihren Körper überlässt sie oft Männern, die ihrem Herzen fern stehen. Um Geld, unter dem Druck irgend welcher Verhältnisse; aus reiner Sinnenglut öffnet sie ihnen ihre Schenkel – aber die Süße ihrer Lippen bewahrt sie nur dem Geliebten. Ich habe später gar manche Dirne getroffen, die für lumpige zwanzig, für zehn Mark sich zum Spielball der launischen Gelüste ihrer Käufer machte, aber so sie einer küssen wollte, wandte sie den Kopf weg. …
Also ich ließ mich küssen, und ich küsste wieder. Tat immer unschuldig dabei, und suchte mir immer die rotesten und vollsten Lippen aus. O, ich wusste schon ganz gut zwischen Kuss und Kuss zu unterscheiden. Bei dem Kuss meiner Mutter blieb ich kühl, aber schon wenn ich meine Schwester oder meine »Braut« Fräulein Erna küsste, geriet ich in ein gelindes Feuer. Wie heiß war mir aber erst, wenn eine der großen, schönen und eleganten Frauen ihre Lippen auf meine Wangen oder gar auf meinen Mund pressten! Eher wäre ich auf der Stelle gestorben, als einen Kuss schuldig geblieben! Gar manche, die mich in aller Harmlosigkeit beim Kopf nahm, mag sich über die Glut gewundert haben, die der sechsjährige Bengel in seine Küsse legte.
Sie duldeten mich auch alle zu ihren Füßen. Ich tat ja auch nicht viel, allerdings, weil ich damals nicht viel wusste. Ich presste mich an die Beine an, indem ich wie eine schmeichelnde Katze den Kopf auf den Schoß legte; ließ mich tätscheln und streicheln, und wenn ich schon einmal viel riskierte, fuhr ich wie von ungefähr mit der Hand über das Kleid.
Nur bei einer wagte ich mehr, und wie ich dazu gekommen, weiß ich heute noch nicht. Eine Baronin war’s, nicht mehr ganz jung, aber, so viel ich mich erinnern kann, eine Schönheit ersten Ranges. Sie muss sehr schön gewesen sein, denn die anderen Damen ließen kein gutes Haar an ihr. Damals kapierte ich nicht, was sie über die Baronin redeten, nur das war mir klar, dass sie sobald sie ihnen den Rücken kehrte, einstimmig über sie herfielen, und nur meine Mutter in ihrer Güte sie verteidigte. Heute weiß ich, dass sie damals ihren guten Ruf zerfetzten. Und wie sich hinterher herausstellte, nicht mit Unrecht.
Eines Tages saß sie mit mehreren anderen in dem kleinen Salon meiner Mutter. Diese arme Märtyrerin, die damals schon ziemlich schwach war und ihre Tage nur mehr im Rollstuhle verbrachte. Ich glaube, es waren so an die fünf, sechs Damen versammelt, die eifrig Schokolade schlürften, Petits Fours knabberten und so nebenher die gute Gesellschaft Berlins nach allen Regeln der Kunst durchhechelten. Meine Baronin saß nicht eigentlich in dem Kreise, der sich um meine Mutter gebildet hatte, sondern am Kamin, wohin das Licht der zwei Stehlampen nicht mehr recht hinreichte. Als ich eintrat, wurde ich wie üblich als Dessert den Anwesenden herumgereicht und da sie am weitesten entfernt saß, kam ich zu ihr zuletzt. Sie küsste mich, ich küsste sie wieder, und ich glaube heute noch die Wonne zu spüren, die ich empfand, als ich dabei mit meinem Gesicht ihre volle, straffe Brust streifte.
Von der Schönheit des weiblichen Busens und ihrer Wirksamkeit auf die Wollust des Mannes hatte ich damals noch keine Ahnung. Ich suchte mein Vergnügen nur noch im Parterregeschoss. So auch hier. Nachdem ich die Seligkeit des Kusses und der Berührung zur Genüge genossen, fragte ich sie leise, ob ich mich zu ihren Füßen setzen dürfte. Sie antwortete nichts, aber sie sah mich mit einem Blick an – mit einem Blick! Ich weiß nicht, ich schämte mich beinah und wäre am liebsten retiriert. Aber sie lächelte mich an und legte mir liebkosend die weiche Hand auf den Kopf. Ich glaube – ich glaube, sie selbst hat mich niedergedrückt. Da saß ich nun und rieb meinen Rücken wollüstig an der leise knisternden Seide, unter der ich deutlich ihre runden Waden spürte. Dann drehte ich mich allmählich herum, bis ich schließlich mit meinem Mund ihre Knie berührte. Da hielt ich inne und war erstaunt, erschrocken über meine eigene Frechheit. Jetzt und jetzt, fürchtete ich, kriege ich eine Ohrfeige.
Aber nichts dergleichen geschah. Ich bin sicher, dass sie meine Frechheiten wohl merkte, denn ich wurde im Laufe der Begebenheiten zu deutlich. Allein sie rührte sich nicht und beteiligte sich im Gegenteil nur noch lebhafter an der allgemeinen Unterhaltung. Die anderen achteten nicht auf mich, zumal ich im Halbdunkel saß und auch noch durch den Rock der Baronin halb und halb gedeckt wurde. Die Umstände machten mich kühn. Was ich noch nie bei einer Frau gewagt, woran ich überhaupt noch nie gedacht – ich streichelte ihren kleinen Fuß, der in einem Pariser Chevreauxschuh steckte. Ich streichelte und streichelte, und mein Instinkt trieb mich höher. Mit einmal fühlte ich oberhalb des Schuhes den seidenen Strumpf.
Zum ersten Mal berührte ich die Waden einer Frau. Meine Finger zuckten wie elektrisiert um das straffe, warme Fleisch, und meinen Körper durchrieselten vom Scheitel bis zur Zehe wollüstige Schauer. War das eine Wonne, an diesen runden, festen Säulen auf- und abzugleiten, sie bald fester, bald zarter zu drücken! Ich sah ihr dabei ins Gesicht. Sie schaute über mich weg und lachte über einen in der Gesellschaft gefallenen Witz. Dieses Gewährenlassen war mir unheimlich, ich zog meine kecken Hände zurück und begnügte mich nur damit, von Zeit zu Zeit meinen Kopf an ihre Knie zu pressen.
Aber nach einigen Minuten gewann ich wieder Mut und begann das alte Spiel. Wieder schmeichelte ich mich über den Schuh an den Waden empor, diesmal aber gleich bis zu den Knien. Und nun geschah etwas, was mich vollkommen darüber beruhigte, dass mein Unternehmen begünstigt wurde. Da ich nicht so recht an die Knie herankonnte, ohne meine Lage in auffallender Weise zu ändern, kam sie mir entgegen, indem sie die Beine etwas ausstreckte.
Nun konnte ich nach Belieben schalten und walten. Ich drückte und presste an diesen weichen, wohlgerundeten Knien herum, bis mir selber der Atem ausging. Von unten mit den Händen, über dem Kleid mit meinen Lippen. Ich befand mich in einer Aufregung wie noch nie in meinem Leben. Die Episode mit Erna im Tiergarten, die sich ja später oft wiederholt hatte, was das Glimmen eines Zündholzes dagegen. Ich wühlte und wühlte wie ein Besessener in den überlassenen Schätzen.
Plötzlich stoße ich an einen feinen Spitzensaum, den ihrer Hose. Neugierig tastet sich meine Hand näher – ich schiebe sie unter die Spitze, wie ein heftiger elektrischer Schlag durchzuckt’s mich – ich habe ihr nacktes Fleisch berührt! Das üppige, wollüstige nackte Fleisch einer schönen Frau! Tausend, tausend Ekstasen habe ich ihm später zu danken, hier erlebte ich die erste. Ich glaube, ich habe das Weib in dem Moment durch das Kleid hindurch gebissen.
Aber auch sie war gepackt. Deutlich nahm ich wahr, wie auch durch ihren Leib ein Zucken und Beben lief. Ihre Knie öffneten sich weit, sodass ich mich ganz zwischen ihre bereitwilligen Beine schmiegen konnte. Sie drückte mich mehrmals zusammen, als wollte sie mich ersticken. Ich aber hielt mit meinen beiden Händen, die unter die Hose geschlüpft waren, ihre heißen prallen Schenkel.
So saßen wir wohl an eine Stunde, in Gegenwart meiner Mutter und der anderen Frauen! Und nicht eine Sekunde lang verriet sie, was unter ihren Röcken vorging; sie plauderte, lachte, ja eine Zeit lang führte sie die Unterhaltung ganz allein. Ich habe mir einige Worte, die sie damals sprach, gut gemerkt:
»Ach, die Johansen ist nicht viel wert«, meinte sie zu meiner Mutter. »Weißt du, sie soll sich sogar mit ihrem Kutscher abgeben. Eine horrible Person!«
Und dabei saß ich, der Sohn der Frau, deren Gast sie war, zwischen ihren Beinen und berauschte mich an ihrem nackten Fleisch!
Als sie sich verabschiedete, gab sie mir noch einen Kuss, nicht länger und feuriger als die andern auch. Aber dabei sagt sie so en passant zu meiner Mutter:
»Lina, weißt du, der Junge ist entzückend! Wenn du erlaubst, soll er öfters zu mir kommen und mit meinem Hugo spielen.«
»Sehr freundlich von dir, Hertha«, erwiderte mein harmloses Mütterchen. »Er wird gewiss sehr gern kommen.«
Ich stand dabei! Das Blut schoss mir ins Gesicht – aber wie ich der Baronin Hertha die Hand küsste, konnte mir kein Mensch die Erregung anmerken. Sie streichelte nochmals meinen Kopf, dann ging sie. – – – – – – – – – – – – – – –
Ist es da zu verwundern, dass, ich ein in Grund und Boden hinein verdorbener Wüstling wurde?
***
Selbstverständlich drängte ich darauf, sobald als möglich meinen Besuch bei der Baronin zu machen. Gleich am nächsten Tage bat ich meine Mutter um die Erlaubnis, am Nachmittag hingehen zu dürfen.
»Grüße sie recht schön von mir«, sagte die gute Frau, »und sei hübsch artig!«
Unser Diener begleitete mich zu dem eleganten kleinen Palais in der Tiergartenstraße und führte mich bis in das Zimmer, in dem mich die Baronin in Empfang nahm.
»Die Frau Direktor lässt sich bestens empfehlen«, sagte er, »und fragen, wann ich Herrn James wieder abholen soll.«
Die schöne Frau maß mich mit einem Blick, der mir das Blut in die Wangen jagte und mich in eine merkwürdige, fiebernde Erregung versetzte. Heiß und kalt wurde mir unter diesem Blick, und ich empfand beinahe Furcht davor. »Er soll mit meinem Sohne zu Abend essen. Also wenn es der Frau Direktor passt, so nach sieben«, gab sie Ludwig den Bescheid.
Der machte seine Verbeugung und verschwand – wir blieben allein.
Ich hatte damals noch keine rechte Abschätzung für die Schönheit der Frauen. Leicht begreiflich, nicht wahr? Aber heute noch erinnere ich mich, dass die Baronin eine der schönsten Frauen war, mit denen ich je zu tun gehabt habe. Sie mochte zu jener Zeit wohl so Anfang der Dreißiger sein, war nicht groß an Figur, aber von jener schlanken Fülle, die ich später – allzu lang hat’s ja nicht gedauert – besonders an den Frauen schätzen lernte. Mit ihrer schweren goldblonden Haarkrone, die sie nach damaliger Haarmode à la Defregger trug, erinnerte sie mich an ein altes Madonnenbild, das ich einmal irgendwo in einer Auslage gesehen. Ihre Augen waren tiefdunkelblau, und wenn sie mich mit einem ihrer seltsamen Blicke streifte, schienen sie mir schwarz wie die Nacht zu sein. Damals verstand ich diese Blicke nicht; ich empfand nur trotz der Glut, in die sie mich setzten, ein leises Grauen vor ihnen. Heute weiß ich, dass sie voll Lüsternheit waren, der grausamen Lüsternheit einer gewissenlosen perversen Messaline.
Als Ludwig und ich eintraten, lag sie auf der Chaiselongue und las. Solange der Diener im Zimmer war, blieb sie sitzend auf ihrem Platze. Nun, da wir allein waren, erhob sie sich und kam auf mich zu, der schüchtern an der Türe stehen geblieben war.
»Nun, kleiner Freund«, redete sie mich mit ihrer weichen, süßen Stimme an, »willst du mir nicht guten Tag sagen?«
Ihre ganze stolze Erscheinung, deren Schönheit durch das weite und faltige blauseidene Hauskleid noch erhöht wurde, verwirrte mich. Ihre schwarzen Augen ängstigten mich – ich begann zu zittern, und die Stimme blieb mir in der Kehle stecken. Am liebsten wäre ich wieder umgekehrt und schleunigst davongelaufen.
Aber da steht sie auch schon vor mir. Hebt mir mit der Hand das Kinn in die Höhe und sagt:
»Na, Jay, heut auf einmal so schüchtern?«
Ich fühlte, ich muss etwas zur Rettung meiner arg gefährdeten Manneswürde sagen, allein die Stimme klebt mir eben in der Kehle, eigentlich noch tiefer, und will und will nicht heraus.
Sie lacht und nimmt mich bei der Hand. Und zieht mich zur Chaiselongue. Und nimmt mich auf ihren Schoß. Und packt plötzlich meinen Kopf und küsst mich wild und gierig. Ihre Küsse fachen meine Angst zu hellen Flammen an. Ich beginne mich zu wehren und will von, ihrem Schoß herunter.
Da merkt sie wohl, dass sie zu rasch vorgegangen ist. Sie lässt mich sanft niedergleiten: und stellt mich zwischen ihre Beine.
»Ich hab dich gar zu gern«, lacht sie und ihre Augen funkeln. »Du bist ein zu hübscher Bengel und schon so prächtig verdorben!« Langsam finde ich mich zurück. Ohne zu wissen warum, stimme ich in ihr Lachen ein und presse mich Test und fester an ihren Leib, den ich fast nackt unter dem papierdünnen Lyrastoff spüre. Meine Hände fahren in scheuer Liebkosung an ihren Schenkeln auf und nieder.
»Weißt du eigentlich was du tust, du kleiner Wüstling?«, fragte sie.
Ich schau ihr grad ins Gesicht, und aus meinem Blick mag sie wohl sehen, dass ich die Frage nicht verstehe. Sie wartet auch keine Antwort ab, sondern legt sich auf die Chaiselongue und zieht mich neben sich. Ihr voller weißer Arm, von dem der Ärmel zurückgeglitten ist, hält mich fest umschlungen, und mit ihrer freien rechten Hand streichelt sie mein glühendes Gesicht. Sie legt sich gar keinen Zwang mehr auf; sie behandelt mich wie einen Geliebten – d. h. wie ein Spielzeug.
»Wer hat dich das eigentlich gelehrt?«
»Was?«
»Du weißt schon. Was du mir gestern bei deiner Mama gemacht hast.«
»Niemand. Aber es ist so angenehm, so – so – – – ganz komisch angenehm, die Frauen und Mädchen so zu streicheln. Aber am angenehmsten bei Ihnen, Frau Baronin.«
»So? Danke für das Kompliment. Hast du das denn Schon bei vielen probiert?«
»Nein, so noch nicht. – – Sind – – sind Sie mir darum böse, Frau Baronin? Sie haben die schönsten Beine.«
Sie lacht und hebt ihr rechtes Bein senkrecht in die Höhe. Mit leisem Rauschen sinkt der leichte Stoff zurück, und ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben den Schenkel einer Frau in seiner ganzen Pracht. Sie hat keine Hose an, und blendend, sinnverwirrend steigt wie eine weiße Säule das Bein aus dem bis über die Knie reichenden schwarzen Seidenstrumpf auf.
Ich stürze mich darauf, drücke meine Lippen auf das wundervolle Fleisch, wie toll küsse ich mich vom Strumpf bis hinauf. Hier halte ich erschrocken inne. Mund und Nase sind mir in ein dichtes, seidenweiches Haarvließ geraten.
Das ist etwas, das ich noch nicht kenne. Die Verschiedenheit des weiblichen Körpers vom männlichen offenbart sich mir, und verwundert richte ich mich auf, um mir den Ort der Offenbarung näher anzusehen. Das ist so ganz anders wie bei mir – – –
»Was hast du?«
Meine Entdeckung hat mich ganz konfus gemacht.
»Frau Baronin – Sie – – Sie haben – nicht so was wie ich da – – da unten?«
Sie lacht hell heraus.
»O dummer, kleiner Bub! Das hast du also noch nicht gewusst? Nun pass mal auf!«
Ehe ich recht weiß, was sie will, hat sich ihre Hand in meine Hose verirrt und fördert die Attribute meiner Männlichkeit ans Licht des Tages. Die Berührung ihrer kühlen, weichen Hand verursacht mir unaussprechliches Wohlbehagen, und obgleich ich mich in einem ersten Gefühl der Scham ihr entziehen will, halte ich dennoch still. Zugleich bin ich sehr erstaunt, das gewisse kleine Stückchen Fleisch – für mich war’s ja damals nichts anderes – größer und stärker zu sehen als gewöhnlich. Es zuckte auf und nieder, und je länger sie es in der Hand hält, desto wohler, desto durchdringender wird mir das Gefühl ihrer Berührung.
»Siehst du«, sagte sie, indem sie es leise streichelt und dann zwischen ihren beiden Händen reibt, »so sind die Männer gebaut. Du bist ja jetzt nur ein kleiner Mann und das Ding da auch. Aber später wird es groß und stark und dick sein, und dann wird es den Frauen recht viel Vergnügen bereiten. Es ist heute schon außerordentlich schön entwickelt und verspricht die schönsten Aussichten für die Zukunft. Wird ja bei deinen Talenten nicht lange mehr dauern, und du wirst es gebrauchen.«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Der Gebrauch, den ich bis jetzt davon gemacht hatte, imponierte mir nicht sonderlich. Ich drückte ihr meine Zweifel aus.
Die Tränen kamen ihr, so lachte sie.
»Du bist der putzigste Kerl, den ich bis jetzt gehabt habe. Da schau mal her!« Und die Beine weit auseinanderspreizend, drückte sie mir den Kopf hinunter, sodass ich in das Tal der Liebe blicken musste, ob ich wollte oder nicht. Mein Erstaunen wuchs immer mehr und überwog noch die Erregung. Leise zog ich mit meinen Fingern die mit leichtem Flaum bedeckten Zugänge zu dem mir unbekannten Mysterium auseinander – ich erschaute unter dem kleinen rosigen Wächter, der grad und senkrecht stand, den Eingang zu der heiligen Grotte. Deren volle, hellrote Ränder zuckten und zuckten – – – der zarte Duft, der daraus emporstieg, berauschte mich, nahm mir die Besinnung – –
»Siehst du«, rief sie und legte ihren Finger dorthin, »siehst du dieses kleine rote Loch? Das ist dazu bestimmt, deinen kleinen Amor in sich aufzunehmen, wenn er größer und fester sein wird. Aber was machst du denn – Jay – – Junge – –?«
Ich hatte mit einemmal begriffen. Ich warf mich über sie und versuchte die Wahrheit ihrer Worte. Eine gierige, besinnungslose Wut kochte in mir; ich wollte und wollte hinein, und sie halb lachend, halb aufgeregt half mir – – es war umsonst. Ich war noch zu jung und könnte mich noch nicht der – Festigkeit des Charakters rühmen, die für den Mann in sothanen Lagen unerlässlich ist.
Keuchend, beschämt, verwirrt ließ ich endlich von ihr ab und wollte mich in meiner Beschämung ganz von dem Paradies verziehen, dessen Eingang mir noch verschlossen war. Allein sie hielt mich fest und schlang ihre Beine um meinen Hals, sodass ich gefangen war und mich nicht rühren konnte. Sie war augenscheinlich riesig aufgeregt; ihr Atem flog, höher riss sie ihre Röcke und presste meinen Kopf mit ihren Händen ganz zwischen ihre Schenkel.
»Küsse mich – küsse mich – – –«
Meine Lippen saugten sich an dem duftenden, rosigen Fleisch fest. Sie begann sich wild zu werfen und zu drehen – –
»Deine Zunge – Bubi – – deine Zunge – –« Ich verstand sie auch diesmal sofort. In abgerissenen, halb erstickten Tönen beorderte sie Zunge bald hierher, bald dorthin – – – sie gab ihr den Marschtakt an – –
»Mehr oben – – hier – nein wei – weiter unten – – nicht so schnell – – la – langsam – – jetzt – jetzt fester – fester – – hinein, ganz hin – – nein – – ah – – fest – – schneller – –«
Der Atem ging mir aus, aber meine wahnsinnige Aufregung ließ mich nicht Halt machen. Das schöne, stolze Weib war aufgelöst, ächzte, wand sich wie im Krampf – ihre Schenkel strangulierten mich; ihre Finger verkrallten sich in meinem Haar – – –
Mit einemmal schrie sie laut auf:
»Jetzt – jetzt – ah – Bubi – Süßes – – fest – lass mich nicht im – Stich – – fest –« Meine Erregung war am Siedepunkt – ich biss zu– – –
Einen Moment lang lag sie wie eine Ohnmächtige. Ihre Beine und Arme gaben mich frei, sanken schlaff herunter, sodass ich mich aus meiner Lage erheben konnte. Ich erschrak nicht schlecht, als ich ihren Zustand sah, und dachte, ich hätte das mit meinem Beißen verschuldet. »Frau Baronin, um Gottes willen Frau Baronin – – –«
Langsam richtete sie sich auf und zog mich an sich heran.
»Du bist wirklich ein Prachtjunge. Es war herrlich. Und zum Schluss dieser Biss – – –. Wer in aller Welt hat dir das beigebracht? Das kannst du doch unmöglich aus dir selbst haben?«
Ich war ordentlich stolz über ihren Zweifel.
»Niemand hat mir das beigebracht. Niemand. War das denn angenehm? Ich habe gemeint, ich hätte Ihnen so weh getan?«
»Dummchen. Das war gerade das Schönste. Das hab ja ich selber noch nicht gewusst. Du bist ein Genie, Jay. Du bist ein Napoleon der Liebe.«
Eigentlich sagte sie nicht Liebe, sondern ein ganz anderes, ein hundsordinäres Wort, das ich damals noch nicht verstand. Ich fragte sie danach, und sie zögerte keine Minute, mich darüber aufzuklären.
Dann zog sie mich in das anstoßende Ankleidezimmer, wo sie mir eigenhändig den Mund wusch. Nachdem ich auch sonst meine etwas derangierte Toilette in Ordnung gebracht, kehrten wir zu unserer Chaiselongue zurück.
Ich fühlte mich wie zerschlagen. Das Kreuz schmerzte mich von der ungewöhnlichen Haltung; die Aufregung zitterte noch durch alle meine Glieder, schwerfällig ließ ich mich zu ihren Füßen auf den weichen Teppich sinken. Sie streichelte mein Haar und drückte mich sanft gegen sich. Heute, nach zwanzig Jahren, verstehe ich vollkommen dieses Weib, diese Szene – d. h. ich verstand es ja schon früher – Nun legte sie sich nicht den geringsten Zwang mehr auf.
»Siehst du, Süßer«, sprach sie, »ich hab solche liebe Jungens wie du riesig gerne. Wenn Ihr erst mal erwachsene Männer seid, dann seid ihr nicht halb so nett mehr. Dann seid ihr brutal, roh und gemein. Jetzt seid ihr zart, weich und dankbar – –«
Um sie von meiner Dankbarkeit zu überzeugen, bedeckte ich ihre Hände mit innigen Küssen. »Ich – ich darf das wieder so – machen – – zwischen Ihren Beinen – ja? Ich werde auch immer brav sein und tun, was Sie verlangen, Frau Baronin!«
Sie presste einen langen Kuss auf meinen Mund. Ihre Zunge schob sie dabei zwischen meine Lippen, was mich wieder schrecklich zu erregen begann.
»Ob du darfst, Liebling«, erwiderte sie dann. »Du musst recht oft zu mir kommen. Du hast ein herrliches Talent! Aber du darfst zu keinem Menschen etwas davon sagen, zu keinem Menschen, hörst du?«
Ich antwortete nur mit einem Blick, der sie entrüstet fragte, wofür sie mich denn eigentlich hielt. Sie lachte und küsste mich.
»Du wirst einmal ein Don Juan par excellence!« Meine Hände blieben derweil nicht müßig. Langsam schmeichelten sie sich ihr unter den Rock, den Strumpf hinauf, liebkosten die üppigen Schenkel und flüchteten sich schließlich in jenes sonderbare Vlies.
»Du Schlingel, fängst du schon wieder an?«
Sie gab mir einen scherzhaften Klaps und schob die Beine weit auseinander – –
»Frau Baronin – –«
»Was denn, Liebling?«
»Darf – darf ich mir das – das – – bei Ihnen noch einmal ansehen?«
»Bist du auf den Geschmack gekommen? Da!« Lächelnd hob sie den Rock hoch und gab mir unverhüllt die Herrlichkeit preis. Bis an den Nabel enthüllte sie die Landschaft des Paradieses. Ich schaute und schaute und ward nicht satt. Diese runden Waden in dem schwarzen Strumpf, diese weißen, vollen Schenkel, zwischen denen sich der dunkle Haarwald bis über den halben Bauch emporschob – – – Damals begriff ich, ich der siebenjährige Bengel, dass Gott auf der Welt nichts Schöneres erschaffen als das Weib. – Dann warf ich mich zwischen ihre Beine nieder und suchte mit meinen Lippen den heiligsten Platz. Tief aufatmend sank sie zurück; meine Zunge begann ihren Hexentanz – – –
Plötzlich fühle ich mich jäh zurückgestoßen. Mit einem Ruck richtet sie sich auf und reißt sich den Rock herunter.
»Setz dich auf den Sessel und iss!«
Sie drückte mir ein Bonbon in die Hand und legte die Hand auf ihren Mund. Erschrocken, verwirrt tat ich fast mechanisch, was sie befahl. Mir scheint, ich habe das Bonbon mit samt seiner Staniolhülle aufgegessen.
Die Türe ging auf und Hugo, ihr einziger Sohn, kam mit seiner Französin herein. Sie begrüßte ihn als zärtliche Mutter, küsste ihn und sagte ihm, dass ich zu ihm gekommen sei, um mit ihm zu spielen, und schon lang auf ihn warte.
Während sie mit ihm sprach, hatte ich Zeit mich zu sammeln. In dieser einen Minute wurde ich um zehn Jahre älter. Ich hörte auf, Kind zu sein.
***
Als ich nach Hause kam, merkte mir kein Mensch an, mit welcher Art von Spielen ich den größten Teil des Nachmittags hingebracht. Ich erzählte meiner Mutter und meiner aufhorchenden Schwester ein Langes und Breites über die schönen Spielsachen, die mein neuer Freund Hugo besaß, und ging artig und zufrieden, wie ein gut erzogenes Kind soll, zu Bett. Ich schloss die Augen, drehte mich tief atmend herum und schien zu schlafen.
Schien! In mir brannte noch immer das Feuer, das die seltsame Frau angefacht, und ich war froh, allein zu sein, um über all das Erlebte nachdenken zu können. Ich vergegenwärtigte mir immer und immer wieder die Süßigkeit der genossenen Stunden, und vor allem bewegte mich eins, der körperliche Unterschied der Frauen von den Männern, über den ich heute auf so angenehme Weise unterrichtet worden war. Die Sache schien mir jedoch zu ungeheuerlich, als dass ich der Baronin so ohne weiteres glauben konnte, alle Mitglieder des weiblichen Geschlechts seien so gebaut wie sie. Ich musste mich überzeugen. Ich stand auf und schlich mich in das anstoßende Zimmer hinüber, in dem Elsa mit der Miss schlief. Wie eine Katze kroch ich an das Bett, in dem meine Schwester, die eine unruhige Schläferin wie alle Kinder war, vollständig aufgedeckt und freigestrampelt dalag. Bei dem matten Schein der kleinen Nachtlampe sah ich, dass sie ganz genau gebaut war wie die Baronin; zwischen die runden Schenkel, die sie fest geschlossen hielt, konnte ich zwar nicht sehen, aber deutlich nahm ich den Anfang der Spalte wahr, die in das Tal des Paradieses führte. Wenn auch nicht so fanatisch aufreizend wie bei der Baronin – der Anblick, den ich mir stahl, war doch süß und lieblich! Dennoch achtete ich kaum darauf: eine neue Frage sprang mir ins Gesicht. Elsas kleiner weißer Bauch war nicht mit einem so köstlichen Vliese bedeckt wie der der Baronin. Warum hatte diese Haare und sie nicht?
Ich schielte nach dem keuschen Lager der Miss hinüber. Es grauste mir zwar vor ihr schon von weitem, wie ich sie liegen sah, die spindeldürren Arme sittiglich auf der Decke gefaltet, die spitze Nase wie einen Ventilator in die Luft gereckt. Allein was tut man nicht der Wissenschaft halber? Ich schlich mich also hin, hob zaghaft die Decke empor, und – sah einen faltigen Bauch, der ganz unten mit wirren Büscheln semmelblonder Haare besetzt war. Ich war so erstaunt über dieses Resultat, dass ich beinahe vergaß, den Schleier wieder über die keuschen Glieder zu senken. Die Miss, die wohl instinktiv irgend eine für ihre Tugend bedrohliche Gefahr witterte, stieß plötzlich einen leichten Schrei aus und sauste in die Höhe. Ich hatte gerade noch Zeit genug, mich hinter dem Fußende des Bettes zu verbergen, bis sich der Schrecken der Ärmsten gelegt und sie ihren tugendhaften Schlummer fortsetzte. Ich dankte Gott, als ich mit heiler Haut wieder in meinem eigenen Bette lag. Die Angst aber klebte mir noch so in den Gliedern, dass ich darauf verzichtete, mein großes Problem noch heute Nacht zu lösen, sondern mich endlich dem Onkel Morpheus überließ. – – – – – – – – – – –
Am nächsten Tag jedoch fand ich bereits jemanden, der mir Aufschluss gab, die Tochter unseres Portiers. Fräulein Meta zählte zehn Jahre und war ein lang aufgeschossenes, eckiges Ding, das ich nie, trotz aller Versuche ihrerseits sich mir zu nähern, einer intimeren Bekanntschaft gewürdigt hatte. Einerseits bin ich von Natur aus ziemlich hochmütig und gebe mich nicht gern mit Leuten ab, die unter mir stehen; andererseits – und das war wohl der Hauptgrund – war sie mir nicht hübsch genug. Aber als ich am nächsten Vormittag ihr im Hausflur begegnete, fiel mir plötzlich ein, ich könnte mich ja auch bei ihr einmal über den Bau des weiblichen Körpers erkundigen.
Ich winkte sie zu mir heran und hielt ihr einen Groschen hin. Ihre listigen braunen Augen funkelten gierig nach dem Geldstück und mit einem Satz war sie bei mir.
»Wat willste?«
Ich sah mich scheu um, ob uns kein Mensch belauschte und flüsterte ihr zu:
»Ich – ich möchte mal sehen, wie du gebaut bist.«
Die junge Dame war auch nicht weiter entrüstet über den Antrag, den ich ihr stellte. Sie war eben so ein richtiges Berliner Sumpfgewächs, das schon über alle Geheimnisse aufgeklärt ist, bevor es noch ordentlich laufen kann. Ihre einzige Sorge war nur, ob ich sie nicht etwa prellen wollte.
»Jiebste mir ooch den Jroschen?«
»Ich geb ihn dir gleich und nachher noch einen«, versicherte ich ihr. Ich stand nicht ungestraft in der Nähe eines fremden weiblichen Körpers; ich begann aufgeregt zu werden, und griff gierig an ihr herum.
Sie wehrte mich kalt ab und überlegte.
»Kannste nich warten? Hier uff’n Flur, wo jeden Moment eins kommen kann! Komm zu uns in die Stube rin. Vater is in die Destille jegangen und ick soll derweile uffs Haus uffpassen. Da sind wir janz alleene und können ’n bisken spielen.«
Gesagt, getan. Wir schlüpften in die Portierloge, die im Souterrain lag, und versteckten uns in dem rückwärts gelegenen Zimmer.