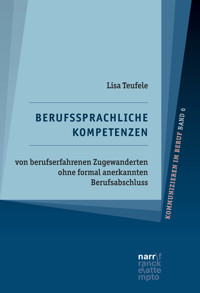
Berufssprachliche Kompetenzen von berufserfahrenen Zugewanderten ohne formal anerkannten Berufsabschluss E-Book
Lisa Teufele
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kommunizieren im Beruf
- Sprache: Deutsch
Ziel des vorliegenden Bandes ist es, die berufskommunikativen Kompetenzen berufserfahrener Zugewanderter zu erfassen und somit einen vornehmlich wissenschaftlichen, aber auch praxisrelevanten Beitrag zur beruflichen Integration von Zugewanderten zu leisten. Im Zuge dessen wurden anhand qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden zwei Berufssprachtests entwickelt, die auf den berufskommunikativen Kompetenzprofilen der beiden Berufe basieren. Des Weiteren wurden die Testdaten der berufserfahrenen Zugewanderten ausgewertet anhand derer die sprachlich-kommunikativen Kompetenzen der Zielgruppe evaluiert und der berufsbezogene Sprachaneignungsprozess nachvollzogen werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Teufele
Berufssprachliche Kompetenzen von berufserfahrenen Zugewanderten ohne formal anerkannten Berufsabschluss
Zugl.: Berlin, Technische Universität, Diss., 2024
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381129423
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2699-3252
ISBN 978-3-381-12941-6 (Print)
ISBN 978-3-381-12943-0 (ePub)
Inhalt
1Einleitung
„Wenn sein Deutsch besser ist, können wir ihm eine Ausbildung anbieten“. Diesen Satz hörte ich während der Begleitung von mehr als hundert Zugewanderten in Arbeitstätigkeit und Ausbildung oft. Der erfolgreiche Übergang von der Schule in den Beruf scheiterte dabei zumeist nicht an unterschiedlichen kulturellen Gewohnheiten wie vermeintlicher Unpünktlichkeit, sondern es lag sehr oft ganz profan daran, dass meine Schüler:innen1 sich auf Deutsch nicht gut genug ausdrücken konnten, um das kommunikative Arbeitsleben meistern zu können. Dieser Satz traf nicht nur mich als Lehrkraft in den Berufsintegrationsklassen2, sondern insbesondere meine Schüler:innen, die nach Deutschland gekommen waren, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen und ein besseres Leben zu haben, als sie es bisher hatten.
Die aktuellen Zahlen zur Erwerbstätigenquote von Syrerinnen und Syrern sowie Afghaninnen und Afghanen, die einen Großteil meiner Schülerschaft ausmachten, scheinen meine subjektiven Erfahrungen zu bestärken. Während die Erwerbstätigenquote von den 15- bis unter 65-Jährigen aus östlichen EU-Staaten im Jahr 2021 vergleichsweise hoch war (78 % bei Polinnen und Polen sowie 75 % bei aus Bulgarien stammenden Personen) lag die Erwerbstätigenquote von Personen aus Syrien bei 35 % und bei Afghaninnen und Afghanen bei 45 %. Die Ergebnisse dieses aktuellen Mikrozensus deuten darauf hin, dass der Bildungshintergrund der Zugewanderten bei der Arbeitsmarktintegration eine wichtige Rolle spielt (vgl. Statistisches Bundesamt o. J.).
Gleichzeitig scheint es naheliegend, dass nicht nur die Lernerfahrung und der allgemeine Bildungshintergrund den beruflichen Integrationsprozess beeinflussen, sondern auch die damit verbundene Kompetenz der (berufsbezogenen) Sprachaneignung. Ausgehend von der Tatsache, dass Deutschland einem Sequenzmodell folgt, indem durch eine explizite Festlegung von zu erreichenden Sprachkompetenzniveaustufen sowohl der Eintritt als auch die Partizipation am Arbeitsmarkt festgelegt wird (vgl. Teufele 2022a), ist zu vermuten, dass viele bildungsunerfahrene Zugewanderte aus Syrien oder Afghanistan im Unterschied zu Migrantinnen und Migranten aus östlichen EU-Staaten länger in Deutschkursen verharren, bevor es zu einer gelungenen Arbeitsmarktintegration kommt. Des Weiteren ist anzunehmen, dass die fehlende Differenzierung nach Geschlecht, Herkunftssprachen, Bildungsgrad oder auch Zielberuf in Verbindung mit der aktuellen Schwerpunktsetzung auf allgemeine und berufsübergreifende Themen der berufsbezogenen Deutschförderung nicht zu einer raschen und gelungenen Arbeitsmarktintegration beiträgt (vgl. Teufele 2022b, S. 212).
Unabhängig von ihrer Bildungserfahrung bringt der Großteil der Zugewanderten jedoch informell erworbene berufliche Kompetenzen und Kenntnisse mit. Von den befragten Geflüchteten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung3 gaben beispielsweise 73 % an, Berufserfahrung zu besitzen, und 84 % der Befragten, die bereits Berufserfahrung gesammelt hatten, waren in ihren Heimatländern als Fachkräfte tätig gewesen (vgl. Brücker et al. 2020, S. 22; Babka von Gostomski et al. 2016, S. 57 und 64). Ausgehend von diesen Daten ist anzunehmen, dass viele Neuzugewanderten zwar Berufserfahrung besitzen, aber nicht über die im Beruf relevanten kommunikativen Kompetenzen verfügen und bestehende berufsbezogene Deutschkursformate nicht Erfolg versprechend sind. Abgesehen davon ist festzustellen, dass Zugewanderte im Gegensatz zu Nichtzugewanderten im Durchschnitt sowohl niedrigere Löhne als auch höhere Arbeitslosenquoten aufweisen und häufig einer nicht qualifikationsadäquaten Beschäftigung nachgehen (vgl. Mayer und Clemens 2021, S. 7). Diese Tatsache ist angesichts des eklatanten Fachkräftemangels problematisch, denn Deutschland benötigt in nahezu allen Branchen (ausländische) Fachkräfte: Diese sichern Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. In Politik und Wirtschaft herrscht mittlerweile einvernehmlicher Konsens, dass der Fachkräftemangel eines der größten Probleme bzw. eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte darstellt (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2023).
Aus der tiefen Überzeugung, dass Wissenschaft dafür da ist, Probleme mit gesellschaftlicher Relevanz zu lösen, fragte ich mich sowohl als Berufsintegrationslehrkraft als auch knapp acht Jahre später, wie wir in Deutschland dafür sorgen können, dass nicht nur Sicherheit und Wohlstand für uns und zukünftige Generationen gesichert sind, sondern auch eine diversitätsoffene und integrative Gesellschaft entsteht, die es zugewanderten Fachkräften ermöglicht, einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung nachzugehen. Ausgehend von dieser Problemstellung entwickelte ich in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Handwerkskammertag (WHKT) im Rahmen meiner Dissertation den Berufssprachtest Friseur:in (BTF) und den Berufssprachtest Anlagenmechaniker:in für Sanitär Heizung und Klima4 (BTA)5, die ersten digitalen, video- und szenarienbasierten Berufssprachprüfungen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. BTA und BTF testen und verifizieren hierbei die (informell) erworben berufskommunikativen Kompetenzen der Zugewanderten.
Während der intensiven dreijährigen Forschungsarbeiten und der Einarbeitung in die Themenbereiche der beruflichen Integration, der (berufsbezogenen) Sprachtestentwicklung, der Erfassung berufskommunikativer Anforderungen und der Übersetzung dieser Anforderungen in ein Testformat offenbarten sich zahlreiche Desiderate der DaF-/DaZ-Forschung, an die diese Arbeit anknüpft. Aus methodischer Perspektive ist beispielsweise bis dato ungeklärt, wie mittels eines validen Testverfahrens berufskommunikative Kompetenzen berufserfahrener Zugewanderter abgebildet werden können, welche Unterschiede zwischen einem berufskommunikativen und einem allgemeinsprachlichen Testverfahren bestehen und wie Testrahmenbedingungen, Testinhalte, Format und Bewertungskriterien eines berufskommunikativen Testverfahrens festzulegen sind. Auf inhaltlicher Ebene wird in dieser Arbeit die Frage thematisiert, welche Charakteristika das berufskommunikative Kompetenzprofil des Berufs Anlagenmechaniker:in sowie des Berufs Friseur:in aufweist, über welche berufskommunikativen Kompetenzen zugewanderte Fachkräfte verfügen und wie berufliche und sprachliche Sozialisationsfaktoren und Erfahrungen das Testergebnis des BTA/BTF und somit das berufskommunikative Kompetenzniveau beeinflussen.
Nach Darstellung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, des Erkenntnisinteresses und der Zielsetzung der Arbeit wird der theoretische Rahmen dieser Forschungsarbeit dargelegt, indem (berufsbezogene) Sprachaneignungsprozesse im Kontext beruflicher und sprachlicher Sozialisation verortet, der konstruktivistische Kompetenzentwicklungsprozess aufgezeigt und testtheoretische Grundlagen dargelegt werden. Anschließend werden das Forschungsdesign und methodische Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfragen vorgestellt, was als Mixed-Methods-Ansatz (MM) beschrieben werden kann. Darauffolgend werden die Datenanalyse und deren Ergebnisse thematisiert, bevor neben einer Zusammenfassung die Befunde dieser Forschungsarbeit kritisch diskutiert und in den Forschungskontext eingeordnet werden. Des Weiteren sind vor einem abschließenden Resümee Implikationen der Ergebnisse für den berufsbezogenen Sprachaneignungsprozess berufserfahrener Zugewanderter Gegenstand der Auseinandersetzung.
1.1Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Die Zielgruppe dieser Forschungsarbeit, die als berufserfahrene Zugewanderte beschrieben werden kann, zeigt nicht nur die gesellschaftlichen Relevanz, sondern auch die Komplexität und Interdisziplinarität dieser Arbeit auf, bei welcher Sprache, Beruf, Migration und Gesellschaft eng miteinander verknüpft sind. Ausgehend von dieser Verbindung wird im Folgenden die migrationsgeschichtliche Entwicklung der (berufsbezogenen) Sprachförderung dargelegt, während in Kapitel 1.1.2 auf Instrumentarien zur Anerkennung und Feststellung beruflicher und berufskommunikativer Kompetenzen eingegangen wird.
1.1.1Migrationsgeschichtliche Entwicklung der (berufsbezogenen) Sprachförderung
Ausgehend von der Tatsache, dass Deutsch für den Beruf (DfB) an Relevanz und Popularität gewinnt, beschäftigen sich auch vermehrt DaF-/DaZ-Forschende mit dieser Thematik. Aufgrund der Verschränkung von DfB mit weiteren wissenschaftlichen Disziplinen und gesellschaftlichen Fragestellungen existieren unterschiedliche Zugänge zum Themenfeld. Während Niederhaus (2022) das Themenfeld nach Zielgruppen, Lernzielen, Lernorten und Lernzeitpunkten strukturiert, betrachtet Daase (2018) die historische Entwicklung des Themenfelds.
Im Folgenden wird in Anlehnung an Daase (2018) ein kurzer Überblick über staatlich-institutionelle Angebote der Aneignung der Zweitsprache Deutsch (für den Beruf) aus historischer Perspektive gegeben, um das aktuelle Spektrum der formellen und informellen1 berufsbezogenen Sprachförderung sowie dessen Ausrichtung und Ausgestaltung nachvollziehen zu können. Zunächst ist einleitend festzustellen, dass das Jahr 2005 mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes und der Einführung der Integrationskurse einen symbolischen Neubeginn der institutionellen Sprachförderung markiert, obwohl es sich hierbei eher um eine Fortführung bzw. Weiterentwicklung bestehender Kursformate als um eine Neugestaltung handelte (vgl. Daase 2018, S. 48). Ziel der Einrichtung der Integrationskurse, die 600 Stunden Deutschunterricht und 30 Stunden Orientierungskurse vorsehen, war es, mehr Einheitlichkeit im Sprachkursangebot für Zugewanderte zu schaffen (vgl. Schroeder 2007).
Integration durch Sprache lautete das Credo der symbolisch behandelten Integrationspolitik, welche nicht nur eine Aufwertung von Sprache beinhaltet, sondern im Rahmen derer auch die Integrationsverantwortung in Form unrealistischer Vorstellungen der Sprachaneignung bei den Zugewanderten verortet wurde (vgl. Daase 2018, S. 48). Seit Einführung der Kurse steigt die Anzahl der Teilnehmenden2 kontinuierlich (vgl. Mediendienst Integration 2022). Im Jahr 2022 besuchten beispielsweise rund 340 000 Kursteilnehmende einen Integrationskurs. Auffallend ist hierbei, dass sich im Jahr 2022 die Zahl der Kursteilnehmenden aus Afghanistan verdreifachte und die Gesamtanzahl der Teilnehmenden den Höchststand von 2016 erreichte (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2023). Versucht man den Erfolg bzw. Misserfolg der Integrationskurse zu evaluieren, so zeigen sich ambivalente Ergebnisse. Etwa die Hälfte der Kursteilnehmenden erreicht innerhalb von 600 Stunden die Niveaustufe B1. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass sowohl ein höheres Bildungsniveau als auch bereits vorhandene Deutschkenntnisse mit einer erfolgreichen Teilnahme an einem Integrationskurs korrelieren (vgl. Schroeder 2007, S. 9 f.). Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass insbesondere die Gruppe der Zugewanderten, die die Kurse am meisten benötigen, da sie als lernungewohnte Teilnehmende wenig Erfahrung mit institutionalisierten Bildungsangeboten sammeln konnten, am wenigsten von den Kursen profitieren. Schroeder (2007, S. 10) fordert demnach aus nachvollziehbaren Gründen, zielgruppenorientierte Kurse für Teilnehmende mit spezifischem Förderbedarf einzurichten.
Abgesehen von dieser Problematik scheint der Besuch eines Integrationskurses auch nur bedingt einen Beitrag zur beruflichen und sozialen Integration der Teilnehmenden zu leisten. Im Rahmen der vom Bundesministerium des Inneren veröffentlichten Evaluation der Integrationskurse (vgl. BAMF 2006, S. 59) geben zwar rund 40 % der Teilnehmenden an, sich infolge des Kurses eher zu trauen, Deutsch zu sprechen, aber nur knapp 15 % sind der Meinung, dass ihnen die verbesserten Deutschkenntnisse bei der Suche nach einem Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz geholfen hätten. Des Weiteren ist festzustellen, dass bisher keine empirischen Studien zur Wirksamkeit der Integrationskurse vorliegen. Das bedeutet, dass bis dato keine (empirisch) fundierten Aussagen darüber getroffen werden können, inwiefern das Ziel der Integrationskurse im Sinne der Verbesserung der Teilhabechancen Zugewanderter am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben tatsächlich erreicht wird (vgl. Schroeder 2007, S. 10).
Während sowohl Österreich als auch die Schweiz Integrationskurse gesetzlich verankert haben, aber keine berufsspezifischen staatlichen Sprachförderkurse anbieten, existieren in Deutschland zusätzlich zur allgemeinen Sprachförderung berufsbezogene Deutschsprachkurse, welche 2015 in das Aufenthaltsgesetz übernommen wurden (vgl. Gamper und Schroeder 2021, S. 72). Im Rahmen dieser Kurse sollen Zugewanderte auf die Arbeitswelt in Deutschland vorbereitet werden (vgl. BAMF o. J.). Aus integrationspolitischer Perspektive wird hierbei eine sequenzorientierte Sprachpolitik forciert: Arbeitsmarktintegration wird erst durch den Nachweis zertifizierter Sprachkenntnisse ermöglicht – ein Mechanismus, der als Language Gatekeeeping am Arbeitsmarkt beschrieben werden kann (vgl. Teufele 2022a). Integrationserfolg, auch im Sinne der beruflichen Integration und Teilhabe, ist somit unwiderruflich mit den individuellen Kompetenzen der Zugewanderten sowie der vermeintlichen Messbarkeit von Sprachbeherrschung verknüpft (vgl. Schroeder 2007), welche als unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme am wirtschaftlichen Leben festgesetzt wird.
Eine solche Engführung der Integrationsdebatte missachtet laut Daase (2021a) die Komplexität von Zweitsprachaneignung und -verwendung im Beruf, welche auch als Zugang zur Mitspielfähigkeit verstanden werden kann. Trotz steigender Angebote zu berufsbezogenem Deutsch und der Einführung der Berufssprachkurse ist ebenfalls festzustellen, dass in aktuellen Kursformaten Sprache zumeist institutionalisiert und fernab des Arbeitsplatzes gelehrt und gelernt wird. Zu einer festen Verankerung von DfB-Angeboten am Arbeitsplatz, in Ausbildung und Betrieb ist der Weg laut Daase (2018, S. 77) deshalb noch sehr weit. Angesichts dieser Problematik sprechen sich nicht nur zahlreiche Forschende (z. B. Efing und Sander 2021a) für die Einbindung von Sprache in konkrete Arbeitskontexte aus, sondern auch internationale Institutionen wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese fordert beispielsweise sowohl die flexible Gestaltung von Sprachkursen, um Arbeitssuche, Beschäftigung und Bildung vereinbar zu machen, als auch die Integration von Sprachkursen in die berufliche Bildung und die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern (vgl. OECD 2021, S. 5).
Neben den Berufssprachkursen existieren im Arbeits- und Themenfeld DfB viele weitere Angebote berufsbezogener Deutschförderung, die angesichts verschiedener Zielgruppen sowohl im In- als auch Ausland sowie unterschiedlicher Lernorte, Lernziele und Ausrichtungen auch unterschiedlich ausgestaltet sind und anhand dessen auch voneinander unterschieden werden können (vgl. Niederhaus 2022, S. 15). Angesichts dieser Vielzahl an Sprachkursformaten bestand im Fachdiskurs lange keine Einigkeit darüber, was unter DfB-Angeboten bzw. einem berufsbezogenen Deutschunterricht zu verstehen ist. An diese Problematik anknüpfend setzte sich Funk (2010, S. 1145) mit Konzepten zum DfB-Unterricht auseinander und befürwortet die Verwendung des Begriffs des berufsorientierten (oder berufsbezogenen) Deutschunterrichts, den er folgendermaßen definiert:
„Berufsorientierter (oder berufsbezogener) Deutschunterricht bezeichnet eine Zielperspektive, die weder an ein bestimmtes Sprachniveau noch an eine bestimmte Schul- oder Unterrichtsform gebunden ist. Das gemeinsame Merkmal aller Formen des berufsorientierten Deutschunterrichts ist, dass er darauf abzielt, Lernende auf die kommunikativen Anforderungen ihres fremdsprachlichen Handelns in beruflichen Kontexten vorzubereiten.“
Basierend auf dieser Definition können laut Funk (1999, S. 344) berufsbezogene Deutschkursformate bzw. berufsbezogener Fremdsprachenunterricht in drei Kategorien eingeteilt werden, welche sich auf den Zeitpunkt der berufsbezogenen Sprachaneignung beziehen. Demnach unterscheidet Funk zwischen dem berufsvorbereitenden, berufsbegleitenden oder berufsqualifizierenden berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht. Neben anderen Systematiken der Klassifizierung und Abgrenzung berufsbezogenen Deutschunterrichts, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird, da sie für den thematischen Fokus dieser Forschungsarbeit nur bedingt relevant sind, wird im Folgenden kurz auf die Unterscheidung zwischen DfB und Deutsch am Arbeitsplatz eingegangen. Deutsch für den Arbeitsplatz kann hierbei als ein Teilbereich von DfB angesehen werden, welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass berufsorientierter Deutschunterricht im Betrieb stattfindet und diesen als Lernort nutzt (vgl. Efing und Sander 2021a; Niederhaus 2022, S. 22).
Abgesehen von dieser Differenzierung existieren im Themenfeld DfB unterschiedliche (empirische) Forschungsarbeiten und -ansätze, die sich beispielsweise auf die Sprachdiagnostik oder Ansätze zur Erhebung, Ermittlung und Analyse des sprachlichen Bedarfs im Arbeitsfeld DfB beziehen und auf die in Kapitel 1.2.2 näher eingegangen wird. Des Weiteren ist festzuhalten, dass im Kontext von DfB auch besondere Ansätze der Sprachvermittlung wie beispielsweise das integrierte Fach- und Sprachlernen (IFSL), die Szenariendidaktik, das Teamteaching oder auch das Sprachcoaching von Relevanz sind (vgl. Niederhaus 2022). Da es sich bei dieser Forschungsarbeit jedochum keine didaktische Arbeit handelt, wird aus theoretischer Perspektive nicht näher auf die eben erwähnten Ansätze eingegangen. Ungeachtet dessen werden im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 Bezüge zu den eben genannten Ansätzen hergestellt.
Zusammenfassend kann für das Themenfeld DfB aus migrationsgeschichtlicher Perspektive konstatiert werden, dass das Jahr 2005 mit der Einführung der Integrationskurse einen Neubeginn der institutionellen Sprachförderung markiert, der durch das Credo Integration durch Sprache gekennzeichnet ist. Trotz stets steigender Teilnehmendenzahlen ist festzustellen, dass neben unrealistischen Vorstellungen der Sprachaneignung der Erfolg bzw. die Wirksamkeit der Integrationskurse als ambivalent einzustufen ist. Ein Meilenstein der berufsbezogenen institutionellen Sprachförderung stellt das Jahr 2015 und die Übernahme der berufsbezogenen Sprachkurse in das Aufenthaltsgesetz dar – auch wenn diese Kurse bis dato nicht in ihrer Wirksamkeit überprüft wurden und die fehlende Einbettung der Sprachvermittlung in berufliche Kontexte kritisiert wird. Unabhängig davon ist im Rahmen von DfB ebenfalls festzustellen, dass abgesehen von den Berufssprachkursen des BAMF kein flächendeckendes Angebot der berufsbezogenen und insbesondere der berufsspezifischen Deutschförderung zur Verfügung steht, aber zahlreiche weitere Angebote des berufsorientierten Deutschunterrichts existieren, welche nach Funk (vgl. 1990, S. 344) dahingehend unterschieden werden können, ob der berufsbezogene Fremdsprachenunterricht berufsvorbereitend, berufsbegleitend oder berufsqualifizierend stattfindet.
1.1.2Anerkennung1 und Feststellung beruflicher und berufskommunikativer Kompetenzen
In Bezug auf die Zielgruppe dieser Forschungsarbeit, die als berufserfahrene Zugewanderte beschrieben werden kann und sich demnach auf Erwachsene mit eigener Migrations- und Berufserfahrung, die im Herkunfts-, Drittland oder auch in Deutschland erworben wurde, bezieht, ist festzustellen, dass dies die größte Gruppe der nach Deutschland zugewanderten Menschen ausmacht. Denn die Mehrheit der Zugewanderten befindet sich bei Einreise nach Deutschland im erwerbsfähigen Alter: Im Jahr 2000 waren beispielsweise 23,2 % der Eingereisten zwischen 18 und 25 Jahre alt und 43,3 % zwischen 25 und 65 Jahren (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2022). Des Weiteren ist festzustellen, dass viele der Neuzugewanderten über formelle und sehr häufig auch informell erworbene berufliche Kompetenzen und Kenntnisse2 verfügen. Basierend auf dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, welche berufskommunikativen und formell sowie informell erworbenen berufsfachlichen Kompetenzen Neuzugewanderte mitbringen und welche Verfahren zur Feststellung dieser Kompetenzen existieren.
Das Problem der Anerkennung informell erworbener beruflicher Kompetenzen ist in Deutschland erst im Zuge der Fluchtmigration im Jahr 2015/2016 in den Blickwinkel der Politik gerückt, obwohl diese Thematik bereits 2012 auf europäischer Ebene aufgegriffen und die Mitgliedsstaaten zur nationalen Umsetzung von Validierungsmaßnahmen informellen Lernens aufgerufen wurden (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2018; ValiKom Projektpartner o. J.). Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern wie beispielsweise Frankreich, welches das Recht auf Validierung informell erworbener Kompetenzen bereits seit 2002 für Personen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung gesetzlich verankert hat, schreiten Maßnahmen und Initiativen zur Anerkennung informell erworbener beruflicher Kompetenzen in Deutschland nur sehr langsam voran (vgl. ValiKom Projektpartner o. J., S. 8 f.). Nichtsdestotrotz wurden für die Erfassung und Einschätzung der beruflichen Handlungsfähigkeit von Zugewanderten in den letzten Jahren und insbesondere im Hinblick auf die fluchtbedingte Zunahme der Einwanderungszahlen seit 2015 bereits bestehende Verfahren ausgeweitet und teilweise migrationssensibel angepasst sowie zahlreiche berufliche Kompetenzfeststellungsverfahren neu entwickelt (vgl. Teufele 2023, S. 274). Aufgrund ihrer Reichweite und lokalen Prominenz sei an dieser Stelle auf folgende berufliche Kompetenzfeststellungsverfahren hingewiesen:
check.work, eine Onlineanwendung, die von der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern entwickelt wurde und sich an Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte sowie Unternehmen wendet, um berufliche Erfahrungen und Potenziale Geflüchteter und Menschen mit Migrationshintergrund zu erkennen (vgl. check.work o. J.),
MySkills, ein computerbasierter Test, den Arbeitsagenturen und Jobcenter für 30 Berufe in jeweils 12 Sprachen anbieten, der die beruflichen Kompetenzen Geflüchteter und Migrantinnen und Migranten durch bild- und videobasierte Fragetypen erkennen und zeigen soll (vgl. Bertelsmann Stiftung o. J.) und
das vom BMBF geförderte Projekt „Abschlussbezogene Validierung non-formaler und informell erworbener Kompetenzen“ (ValiKom) (BMBF 2018, S. 3 f.), bei welchem unter der Leitung des WHKT berufliche Kompetenzen, die außerhalb des formalenBerufsbildungssystems erworben wurden, erfasst und in Bezug auf einen anerkannten Berufsabschluss bewertet und zertifiziert werden (vgl. Validierungsverfahren o. J.).
Obwohl sich die von MySkills und check.work erfassten Berufe unterscheiden, ist beiden Tests gemein, dass sie online durchgeführt werden und größtenteils aus Multiple-Choice-Fragen bestehen, die fachspezifische Kenntnisse abfragen. Trotz Fokussierung der Tests auf Zugewanderte beschränkt sich die sprach- bzw. migrationssensible Anpassung der beiden Testformate auf eine Übersetzung der Testfragen in migrationsrelevante Sprachen sowie auf die Verwendung von vermeintlich interkulturell verständlichen, bildgestützten Inhalten. Bezugnehmend auf die breite und sehr diversifizierte Zielgruppe der potenziellen Testteilnehmenden deutet sich hier bereits die grundlegende Problematik dieser Kompetenzfeststellungsverfahren an. Denn ausgehend von der Heterogenität der Zielgruppe als auch der Ausklammerung berufskommunikativer Kompetenzen stellt sich die Frage, inwieweit diese Testverfahren tatsächlich berufliche Handlungskompetenz sichtbar machen (vgl. Teufele 2023, S. 274 f.).
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Fragen meist um Wissensabfragen handelt, die sich an den Ausbildungsinhalten der jeweiligen Berufe orientieren, kann gemutmaßt werden, dass neben Medien- und Lesekompetenz auch die Qualität und interkulturelle Verständlichkeit der Übersetzungen einen großen Einfluss auf das Testergebnis haben. Beispielhaft sei hier der IdA KompetenzCheck erwähnt, der formell und informell erworbene Kompetenzen in Bezug auf deutsche Referenzberufe auswertet. In den Ausführungen zur Validität des Testverfahrens wird beispielsweise angemerkt, dass bei der Übersetzung von Fachbegriffen Schwierigkeiten auftreten können, wenn kein (sprachliches) Äquivalent in der Zielsprache vorhanden ist. Eine weitere Ausführung dieser Beobachtung bleibt jedoch aus und die als Beispiel genannte Übersetzung des Fachbegriffs Geogitter ins Arabische stellt kein Wort, sondern lediglich eine Anreihung von Buchstaben dar (vgl. Fischer et al. 2019, S. 122; Teufele 2023, S. 275). Unabhängig von diesen Defiziten ist festzustellen, dass Sprache und Kommunikation als essenzielle Voraussetzung und Bestandteil beruflicher Handlungsfähigkeit sowohl bei check.work als auch bei MySkills unberücksichtigt bleiben.
Der fehlende Einbezug berufskommunikativer Arbeitshandlungen trifft auch auf ValiKom zu. Dennoch gibt es einige Unterschiede, auf die im Folgenden eingegangen wird. ValiKom ist beispielsweise nicht als ein computergestützter Test konzipiert, sondern es soll mittels praktisch durchgeführter Arbeitsproben und authentischer, arbeitsrelevanter Fachgespräche aus der Praxis die vollständige oder teilweise Gleichwertigkeit von informell erworbenen berufsspezifischen Kompetenzen im Abgleich mit deutschen Referenzberufen festgestellt werden (vgl. BMBF 2018, S. 3 f.). Ziel des standardisierten Validierungsverfahrens ist es, berufliche Kompetenzen von Menschen, die außerhalb des formalen Berufsbildungssystems erworben wurden, zu erfassen und in Bezug auf einen anerkannten Berufsabschluss zu bewerten und zu zertifizieren. Neben 11 Handwerkskammern und 17 IHKs sind auch 2 Landwirtschaftskammern am Projekt beteiligt, um ein flächendeckendes Angebot zur Validierung von informell erworbenen Kompetenzen von 32 Berufen in Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft anbieten zu können. Die Projektleitung liegt beim WHKT, dem Dachverband der 7 Handwerkskammern Nordrhein-Westfalens (vgl. Validierungsverfahren o. J.). Obwohl sich ValiKom zunächst an geringqualifizierte Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit richtete, wurde im Zuge der ansteigenden Migrationszahlen im Jahr 2015/2016 die Zielgruppe auf Geflüchtete und andere Gruppen von Zugewanderten ausgeweitet (vgl. Windisch 2020, S. 9). Ungeachtet der Tatsache, dass auch dieses Verfahren sprachliche Handlungskompetenz als essenziellen Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz unberücksichtigt lässt, ist dennoch anzunehmen, dass aufgrund der eingesetzten Bewertungsinstrumentarien wie Arbeitsproben im Unterschied zu den anderen Verfahren auch die tatsächliche berufliche Handlungskompetenz im Vordergrund steht.
Neben der Überprüfung des rein berufsfachlichen Handlungswissens und der -kompetenz stellt sich jedoch auch bei ValiKom die Frage nach der Überprüfung der (berufs-)kommunikativen Kompetenzen als essenzieller Bestandteil beruflicher Handlungsfähigkeit. Das bisherige Verfahren überprüft und bewertet zum aktuellen Zeitpunkt keine sprachlichen Aspekte. Verfügen die Testteilnehmenden jedoch über sehr geringe (berufs-)kommunikative Kompetenzen, sodass die fachlichen Inhalte aufgrund der mangelnden fach- und allgemeinsprachlichen Kenntnisse nicht überprüft werden können, so wird Sprache durchaus berücksichtigt bzw. bewertet. Der WHKT sieht in diesem Punkt Optimierungsbedarf und bestätigt, dass aufgrund der fehlenden (berufs-)sprachlichen Bestandsaufnahme der Testteilnehmenden Schwierigkeiten bei der Durchführung des Verfahrens auftreten. So passiert es laut WHKT häufig, dass ValiKom-Verfahren für Teilnehmende geplant und durchgeführt werden, in deren Verlauf dann aber festgestellt wird, dass die geringe sprachliche Kompetenz der Teilnehmenden dazu führt, dass Arbeitsanweisungen nicht verstanden werden und somit auch das Verfahren an sich nicht weiter durchgeführt werden kann. Angesichts dieser Problematik begrüßte der WHKT die Entwicklung eines berufskommunikativen Kompetenzfeststellungsverfahrens3.
Zusammenfassend zeigt sich an dieser Stelle die grundlegende Problematik von ValiKom, check.work, MySkills sowie zahlreichen weiteren beruflichen Kompetenzfeststellungsverfahren, die darin besteht, dass die Feststellung und Überprüfung berufskommunikativer Kompetenzen als essenzieller Bestandteil beruflicher Handlungsfähigkeit unberücksichtigt bleibt, während die fachliche Validierung oder auch das Testdesign an sich voraussetzen, dass die Teilnehmenden den teilweise komplizierten sprachlichen Anweisungen zur Durchführung des Verfahrens folgen können (vgl. auch Windisch 2020, S. 9). Die Übersetzung der Testinhalte in herkunftsrelevante Sprachen führt hierbei nicht zur vollständigen Abbildung der berufskommunikativen Kompetenzen der berufserfahrenen Zugewanderten, denn das ValiKom-Verfahren zielt darauf ab, dass die zugewanderten Fachkräfte nach der Testung eine Arbeitstätigkeit im deutschsprachigen Raum aufnehmen und somit über berufsrelevante Deutschsprachkenntnisse verfügen müssen. Bezugnehmend auf die Entwicklung einer authentischen validen beruflichen Kompetenzfeststellung wäre demnach zunächst eine Bestandsaufnahme sowohl der fachlichen als auch sprachlich-kommunikativen Handlungen im Beruf erforderlich, welche dann in ein Testformat überführt werden könnten.
Neben berufsfachlichen Kompetenzfeststellungsverfahren werden auch immer mehr berufsbezogene Sprachtests entwickelt. Ausgehend von der Einbindung des beruflichen Kontextes können berufsbezogene Sprachtests anhand ihrer berufsspezifischen oder berufsübergreifenden Ausrichtung näher beschrieben und klassifiziert werden. Gleichzeitig kann unterschieden werden, ob es sich um sogenannte High- oder Low-Stakes-Tests handelt. Aufgrund der Tatsache, dass das Bestehen der Fachsprachenprüfung Medizin als Voraussetzung zur Erteilung einer ärztlichen Berufszulassung gilt (vgl. Jehle 2021a, S. 154 f.), fällt diese Prüfung z. B. in die Kategorie eines High-Stakes-Test. Beim Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf hingegen handelt es sich um einen Low-Stakes-Test, da mit dem Testergebnis keine rechtsverbindlichen Konsequenzen verbunden sind. Neben den Fachsprachenprüfungen sowie dem Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf wird im Folgenden auch auf den Deutsch-Test für den Beruf eingegangen. Diese neu entwickelte Zertifikatsprüfung schließt die vom Bund geförderten Berufssprachkurse nach DeuFöV4 ab.5 Im Hinblick auf die Ausrichtung der berufsbezogenen sprachlichen Testverfahren ist festzustellen, dass mehr berufsübergreifende als berufsspezifische Sprachtests existieren. Es wird vermutet, dass insbesondere finanziell-wirtschaftliche Gründe dafür verantwortlich sind, dass weniger berufsspezifische Deutschkurse und auch Sprachtests entwickelt werden.
Der Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf kann als berufsübergreifender Sprachtest klassifiziert werden, der sich sowohl an Zugewanderte als auch an Unternehmen wendet, um die Hör- und Lesekompetenz am Arbeitsplatz zu ermitteln. Der Test ist computerbasiert und soll in 60 bis 90 Minuten den individuellen Sprachstand, angelehnt an den GER, feststellen. Im Hinblick auf das Testkonstrukt ist feststellbar, dass leider keine Informationen darüber vorliegen, um welchen Arbeitsplatz es sich genau handelt. Bezieht man sich sowohl auf das einführende Video zum Goethe-Test PRO als auch auf die Demoversion kann vermutet werden, dass es sich um einen Arbeitsplatz am Computer/Laptop handelt (vgl. Goethe-Institut o. J.). Außerdem ist festzustellen, dass die Demoversion des Tests lediglich Aufgabenstellungen einschließt, die die rezeptiven Fertigkeiten (Lesen und Schreiben) der Testteilnehmenden abprüfen (vgl. Lernplattform Goethe-Institut o. J.; Teufele 2022b, S. 547).
Setzt man sich nach Darstellung des Testverfahrens mit der Frage auseinander, inwiefern der Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf authentische berufliche Kommunikation abbildet, so ist festzuhalten, dass zum einen unklar ist, um welchen Arbeitsplatz es sich handelt bzw. welche(r) Beruf(e) abgebildet werden soll(en). Zum anderen ist zu hinterfragen, inwiefern ein Test, der lediglich rezeptive Fertigkeiten inkludiert, tatsächlich dafür geeignet ist, die berufskommunikativen Kompetenzen vollumfänglich widerzuspiegeln. Es ist zu vermuten, dass berufskommunikative Kompetenzen sowohl rezeptive als auch produktive Fertigkeiten einschließen. Obwohl davon ausgegangen wird, dass sich berufskommunikative Arbeitshandlungen6 berufsspezifisch und somit auch fertigkeitsbezogen stark unterscheiden, ist der Ausschluss der produktiven Fertigkeiten ohne Verweis auf das zu überprüfende Testkonstrukt nicht nachvollziehbar. Es bleibt somit anzuzweifeln, dass dieser Test von Goethe dafür geeignet ist, authentische berufsspezifische Kommunikation abzubilden. Stattdessen scheint es sich eher um einen allgemeinsprachlichen Test zu handeln, dessen thematischer Rahmen einen allgemeinen Berufskontext aufweist und der Hör- und Lesekompetenzen in Anlehnung an den GER überprüft.
Neben dem Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf handelt es sich beim Deutsch-Test für den Beruf auch um eine berufsübergreifende Prüfung. Diese Testform existiert auf den GER- Stufen A2, B1, B2 und C1 und wurde von telc entwickelt. Das Prüfungshandbuch gibt einen Überblick sowohl zu den Testinhalten als auch zu den Prüfungszielen dieser neu entwickelten Zertifikatsprüfung, welche die vom Bund geförderten Berufssprachkurse abschließt (vgl. Plassmann et al. 2021). Als Prüfungsziele werden unter anderem folgende genannt: allgemein berufsbezogene Sprachkompetenz messen, authentische Sprachverwendung aufgreifen und in den GER-Stufen A2–C2 verankert sein (vgl. Plassmann et al. 2021, S. 27). Bezugnehmend auf die zu überprüfenden Fertigkeiten ist festzuhalten, dass alle vier Fertigkeiten, die auch im GER genannt werden, überprüft werden: Rezeption, Interaktion, Produktion und Mediation. Diese Fertigkeiten werden in den Tests sowohl schriftlich als auch mündlich überprüft (vgl. Plassmann et al. 2021, S. 49). Vergleicht man diese Testform mit dem Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf fällt positiv auf, dass sowohl rezeptive als auch produktive Fertigkeiten abgeprüft werden. Gleichzeitig ist einschränkend zu erwähnen, dass unklar bleibt, was unter einer allgemein berufsbezogenen Sprachkompetenz zu verstehen ist und inwiefern diese Sprachkompetenz einer authentischen Sprachverwendung (im Beruf / am Arbeitsplatz) entspricht. In Anlehnung an die Feststellung, dass sich berufskommunikative Arbeitshandlungen und Kompetenzen berufsabhängig unterscheiden (vgl. Teufele im Erscheinen; Settelmeyer 2013, S. 2) ist infolgedessen auch im Kontext des Deutsch-Test für den Beruf in Zweifel zu ziehen, dass die sprachlich-kommunikativen Kompetenzen der Testteilnehmenden authentisch und berufsbezogen abgebildet werden.
Im Unterschied zu diesen beiden berufsübergreifenden Sprachtests handelt es sich bei den Fachsprachentests um berufsspezifische Sprachtests. Anlässlich der 87. Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2014 wurde festgelegt, dass von internationalen Ärztinnen und Ärzten neben allgemeinen Sprachkenntnissen auf B2-Niveau auch fachspezifische Sprachkenntnisse auf C1-Niveau nachzuweisen sind (vgl. Jehle 2021a, S. 154 f.). Inhalte der Fachsprachenprüfung und somit auch die des Testkonstrukts sind durch diese rechtliche Bestimmung festgelegt. Der Sprachtest umfasst dabei ein simuliertes Gespräch zwischen behandelnder und behandelter Person, das Anfertigen eines in der ärztlichen Berufsausübung üblicherweise vorkommenden Schriftstücks (z. B. eines Entlassungsbriefs) und ein Gespräch mit einer anderen ärztlichen Fachperson (vgl. Bayerische Landesärztekammer 2020, S. 3 f.). Durch diese inhaltliche Vorgabe bzw. vordefinierte Aufgabenstellung der Fachsprachenprüfung können Testentwickler:innen das Testformat nicht auf Basis der sprachlich-kommunikativen Anforderungen des Berufs erstellen, sondern müssen sich an diese rechtsverbindlichen Bestimmungen halten. Abgesehen von diesen Rahmenbedingungen stellt sich auch die Frage, weshalb Lesekompetenz nicht Bestandteil der berufsbezogenen Sprachkompetenz von ärztlichem Fachpersonal zu sein scheint, da diese Kompetenz im Test unberücksichtigt bleibt. Des Weiteren ist festzustellen, dass trotz der allgemeinen Aufgabenvorgaben die länderspezifisch angebotenen Fachsprachenprüfungen nicht nur erheblich unterschiedliche Prüfungsgebühren aufweisen (zwischen 300 und 650 Euro), sondern sich auch inhaltlich stark unterscheiden, weshalb es in der Folge zu einem regelrechten innerdeutschen Prüfungstourismus kommt (vgl. Jehle 2021b, S. 193; Teufele 2022b, S. 549).
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sowohl Testverfahren zur Feststellung berufsbezogener sprachlicher Handlungskompetenz als auch berufliche Kompetenzfeststellungsverfahren nur bedingt dafür geeignet sind, berufliche und berufskommunikative Kompetenzen abzubilden. Die Analyse berufsbezogener Sprachtests zeigte, dass bei vielen Testverfahren zwar Sprache und Kommunikation im Vordergrund stehen, aber der Berufsbezug und die authentische Sprachverwendung im Beruf und am Arbeitsplatz nur unzureichend berücksichtigt werden. Ähnliches konnte im Rahmen der Analyse beruflicher Kompetenzfeststellungsverfahren festgestellt werden. Während diese Verfahren zwar berufsfachliche Kompetenzen abprüfen, werden jedoch Sprache und Kommunikation als wichtige Elemente beruflicher Handlungen nicht in das Testkonstrukt einbezogen. Weiterführend wirft die Analyse auch Fragen hinsichtlich der Konstruktvalidität beruflicher und sprachlicher Testverfahren auf. Aus methodischer Perspektive stellt sich beispielsweise die Frage, wie ein Testverfahren zur Feststellung berufskommunikativer Kompetenzen aufgebaut sein müsste, welche Inhalte überprüft werden sollten, um authentische berufliche Kommunikation abzubilden oder auch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem berufskommunikativen und einem allgemeinsprachlichen Testverfahren bestehen. Zusammenfassend veranschaulicht die folgende Abbildung (1) die im Rahmen dieses Kapitels vorgestellten Kompetenzfeststellungsverfahren.
Testverfahren zur Feststellung berufssbezogener sprachlicher und fachlicher Handlungskompetenz
1.2Erkenntnisinteresse und Zielsetzung der Arbeit
Ausgehend vom Bedarf sowie der Notwendigkeit der Feststellung von im Berufskontext relevanten sprachlich-kommunikativen Kompetenzen werden im folgenden Kapitel die in dieser Dissertation adressierten Forschungsfragen vorgestellt. Des Weiteren werden in Kapitel 1.2.2 weitere Themenfelder der Forschung zu Sprache und Kommunikation im Beruf vorgestellt, die einen Bezug zur thematischen Ausrichtung dieser Forschungsarbeit aufweisen.
1.2.1Forschungsfragen
Im Hinblick auf die Tatsache, dass berufsbezogene Sprachtests häufig methodische und inhaltliche Mängel aufweisen, wird in dieser Forschungsarbeit das methodische Vorgehen zur Entwicklung eines validen berufskommunikativen Testverfahrens adressiert. Hierbei steht die Frage, wie die berufskommunikativen Kompetenzen in einem validen Testverfahren abgebildet werden können, im Mittelpunkt. Abgesehen davon werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen berufskommunikativen und allgemeinsprachlichen Testverfahren thematisiert. Im weiteren Verlauf wird die Frage beantwortet, wie Testrahmenbedingungen, Testinhalte, Format und Bewertungskriterien eines berufskommunikativen Testverfahrens festgelegt werden können.
Angesichts der Tatsache, dass zwar zahlreiche berufliche Kompetenzfeststellungsverfahren existieren, im Rahmen derer jedoch keine sprachlichen Kompetenzen überprüft werden, sowie im Hinblick auf den Umstand, dass der WHKT die Überprüfung berufskommunikativer Kompetenzen im Rahmen von ValiKom als relevant und wichtig erachtet, entwickelte die Forscherin mit Unterstützung des WHKT den Berufssprachtest Anlagenmechaniker:in und den Berufssprachtest Friseur:in.1 Neben der Vermittlung von Testteilnehmenden initiierte der WHKT den Kontakt zu Berufsfachkräften, die bei der Erstellung, Überarbeitung und Evaluierung der Testinhalte mitwirkten. Im Gegenzug bot die Forscherin den Testteilnehmenden sowohl eine kostenfreie Testauswertung und ein Zertifikat als auch ein Evaluierungsgespräch an, im Rahmen dessen Optionen der weiteren berufsbezogenen Deutschförderung thematisiert wurden. In Kooperation mit dem WHKT wurden sowohl der Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker:in für Sanitär, Heizung und Klima als auch der Beruf Friseur:in ausgewählt, da es sich hierbei zum einen um im ValiKom-Verfahren repräsentierte Berufe und zum anderen um vom Fachkräftemangel betroffene Berufe handelt.
Neben den methodischen Forschungsfragen wird in dieser Arbeit auch die inhaltliche Ebene der berufskommunikativen Arbeitshandlungen adressiert. Ausgehend vom Desiderat der Auseinandersetzung mit sprachlichen Anforderungen im Beruf2 wird der Frage nachgegangen, welche Charakteristika das berufskommunikative Kompetenzprofil dieser beiden Handwerksberufe aufweist. Des Weiteren wird das Testergebnis der BTA-/BTF- Testteilnehmenden analysiert, um feststellen zu können, über welches berufskommunikative Kompetenzprofil zugewanderte Fachkräfte in diesen beiden Berufen verfügen. Abschließend wird ebenfalls die Frage beantwortet, wie berufliche und sprachliche Sozialisationsfaktoren und Erfahrungen das berufskommunikative Kompetenzniveau beeinflussen. Diese Frage ist insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und Ausgestaltung berufsbezogener Deutschfördermaßnahmen von essenzieller Bedeutung. Folgende Abbildung fasst die in dieser Forschungsarbeit adressierten Fragestellungen zusammen:
Forschungsfragen
1.2.2Forschungsstand zu Kommunikation und Sprache im Beruf
Im Hinblick auf die erste Forschungsfrage, die sich auf die methodische Vorgehensweise zur Entwicklung eines validen berufsbezogenen Sprachtests bezieht, ist vorab festzuhalten, dass Sprachdiagnostik auch bzw. unter Umständen sogar insbesondere für das Themenfeld DfB von Relevanz ist, da eine evidenzbasierte Einschätzung der Sprachkompetenzen von Lernenden Voraussetzung für eine zielgerichtete Sprachförderung darstellt (vgl. Settinieri und Jeuk 2019, S. 3). Des Weiteren stellt sich für den Bereich der Sprachdiagnostik im Themenfeld DfB die besondere Herausforderung, geeignete Indikatoren für die Erfassung jener Sprachkompetenzen zu identifizieren. Dies bedeutet, dass im Zusammenhang mit der Entwicklung eines validen berufsbezogenen Sprachkompetenztests geklärt werden muss, was Berufsdeutsch ist bzw. welche Sprache(n) denn am Arbeitsplatz von Relevanz sind und inwiefern berufsspezifische Unterschiede auszumachen sind (vgl. Teufele im Erscheinen; Niederhaus 2022, S. 211). Auch wenn bis dato kein spezielles Verfahren zur Entwicklung berufsbezogener Sprachtests existiert, so werden im Arbeitsfeld DfB neben den erwähnten berufsbezogenen Sprachtests auch (förderdiagnostische) Verfahren für den Einsatz in der beruflichen Bildung, Screenings, Profilanalysen und auch Beobachtungsverfahren angewandt (vgl. Niederhaus 2022, S. 9 f.).1
Abgesehen von der Darstellung des Forschungsstandes zur Sprachdiagnostik im Arbeitsfeld DfB werden im Folgenden Daten zum berufskommunikativen Kompetenzniveau berufserfahrener Zugewanderter vorgestellt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse empirischer Arbeiten zu Faktoren der erfolgreichen sprachlichen (und beruflichen) Sozialisation präsentiert, bevor abschließend auf Ansätze der Erhebung, Ermittlung und Analyse sprachlicher Bedarfe und kommunikativer Praktiken im Arbeitsfeld Deutsch für den Beruf eingegangen wird.
Zunächst kann allgemein festgehalten werden, dass sich die sprachlichen Kompetenzen Zugewanderter durch den Besuch diverser Sprachkurse sowie mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland verbessern (vgl. Bernhard et al. 2021, S. 1). Die vorliegenden Zahlen scheinen dies zu bestätigen. Beispielsweise schätzten 44 % Prozent der zwischen 2013 und 2016 eingereisten Geflüchteten im Jahr 2018 ihre Deutschkenntnisse als gut bis sehr gut ein. Demgegenüber gibt es jedoch auch einen beachtlichen Anteil von 15 %, die angaben, bis zum Jahr 2018 noch an keinerlei sprachlichen Maßnahmen teilgenommen zu haben (vgl. Lareiro et al. 2020, S. 1). Auch wenn die aktuelle Analyse des BAMF eine positive Entwicklung aufzeigt, da 90 % der Männer und 79 % der Frauen zwischen 2016 und 2019 an mindestens einem Sprachkurs teilnahmen und auch ihre Deutschkenntnisse häufig als gut bis sehr gut einschätzen, so ist gleichzeitig einschränkend festzuhalten, dass ältere Geflüchtete, Geflüchtete mit niedrigem Bildungsniveau und geflüchtete Mütter mit Kindern ihre Deutschkenntnisse schlechter einschätzen als Männer mit oder ohne Kinder(n) (vgl. Niehues et al. 2021, S. 4).
In Bezug auf die berufsbezogenen Kompetenzen und Sprachaneignungsprozesse berufserfahrener Zugewanderter liegen keinerlei Daten vor. Angesichts des überschaubaren Angebots an berufssprachlichen Kursen und Maßnahmen sowie der erst im Juli 2016 eingeführten Berufssprachkurse kann jedoch vermutet werden, dass die befragten Geflüchteten nur eingeschränkt über berufskommunikative Kompetenzen verfügen. Im Rahmen einer Befragung zu Erfahrungen mit potenziellen Teilnehmenden am ValiKom-Verfahren gaben beispielsweise 30 % der 173 interviewten Expertinnen und Experten aus acht Handwerkskammern an, dass die Zielgruppe Sprachprobleme2 aufweist. Selbst innerhalb der Gruppe von Personen mit Berufsabschluss, die aber in einem anderen als ihrem Ausbildungsberuf tätig sind, werden von 18 % der befragten Bildungs- und Karriereberaterinnen und -beratern Sprachbarrieren gesehen (vgl. ValiKom Projektpartner, S. 3). Zusammenfassend kann somit konstatiert werden, dass Geflüchtete mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland oft auch ihre Sprachkenntnisse als gut bis sehr gut einschätzen. Offen bleibt jedoch die Frage der Relevanz dieser allgemeinsprachlichen Deutschkenntnisse für die berufliche Handlungsfähigkeit in einem speziellen Berufsfeld sowie die Frage nach den Deutschkenntnissen von Zugewanderten, die keinerlei verpflichtende oder bezahlte Deutschkurse angeboten bekommen oder aufgrund familiärer oder beruflicher Verpflichtungen keine Sprachkurse besuchen.
Neben der Auseinandersetzung mit den berufskommunikativen Kompetenzen berufserfahrener Zugewanderter ist der individuelle berufliche und sprachliche Lernweg der berufserfahrenen Zugewanderten, welcher in dieser Arbeit im Kontext der beruflichen und sprachlichen Sozialisation verortet wird, von ebenso großer Bedeutung, wenn es darum geht, das Gesamtkonstrukt der berufsbezogenen Sprachaneignung und der Ausbildung von berufskommunikativen Kompetenzen analysieren zu wollen. Während in Kapitel 2.1 weitere Hinweise zum Begriffsverständnis der beruflichen und sprachlichen Sozialisation im Kontext dieser Forschungsarbeit gegeben werden, wird im Folgenden kurz auf den Forschungsstand zu den Einflussfaktoren des (berufsbezogenen) Sprachaneignungsprozesses von erwachsenen Zugewanderten eingegangen.
Ausgehend von der Tatsache, dass verschiedene Institutionen, Rahmenbedingungen und individuelle Voraussetzungen und Fähigkeiten beim Prozess der (berufsbezogenen) Sprachaneignung von Relevanz sind, lässt sich erklären, dass sich Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen wie Psychologie, Pädagogik oder auch Soziologie mit dem Themenfeld der Sozialisationsfaktoren im Kontext von Sprache beschäftigen. Ungeachtet dessen ist auch feststellbar, dass bis dato wenig belastbare Befunde zu Bedingungen eines erfolgreichen Sprachaneignungsprozesses vorliegen. Auch wenn Haug (2005, S. 263) beispielsweise feststellt, dass Personen mit niedrigerem Einwanderungsalter sowie Zugewanderte mit einem höheren Bildungsabschluss eine höhere Chance haben, gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse zu erwerben, so zeigt eine Analyse von 314 Veröffentlichungen zum Spracherwerb in organisierten Lehr-Lern-Prozessen, dass nahezu keine allgemeingültigen Rückschlüsse auf erfolgreiche didaktische, mediale, professionelle und individuelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Spracherwerbs gezogen werden können (vgl. Strahlender und Schrader 2017, S. 275).
Abschließend sei an dieser Stelle neben der Erläuterung zu Faktoren des erfolgreichen berufskommunikativen Sprachaneignungsprozesses auf den Forschungsstand zur Erhebung, Ermittlung und Analyse sprachlicher Bedarfe und kommunikativer Praktiken im Arbeitsfeld Deutsch für den Beruf verwiesen (vgl. Niederhaus 2022, S. 5 f.). Dieser ist sowohl im Hinblick auf die Entwicklung des BTA und BTF als auch im Zusammenhang mit der Forschungsfrage nach den Charakteristika des berufskommunikativen Kompetenzprofils der beiden Handwerksberufe von Relevanz. Allgemein lässt sich zunächst feststellen, dass diverse theoretische Ansätze zur Ermittlung sprachlicher Anforderungen im Beruf existieren. Beispielhaft kann an dieser Stelle auf Weissenbergs (2010) Konzeption der sprachlich- kommunikativen Handlungsfelder im Beruf sowie Efing und Kiefers (2018) Methode zur Erhebung, Analyse und Beschreibung kommunikativer Anforderungen, Praktiken und Verhaltensweisen sowohl in beruflichen als auch in ausbildungsorientierten Kontexten hingewiesen werden.
Es handelt sich hierbei vornehmlich um theoretische Konzepte, bei denen keine umfassende empirische Validierung vorgenommen wurde. Ungeachtet dessen existieren Untersuchungen und Analysen der sprachlich-kommunikativen Anforderungen in bestimmten Berufen, die unter Rückgriff auf theoretische Modelle von Sprache und Kommunikation im Beruf durchgeführt wurden. So beschäftigte sich Seyfarth (2013) zum Beispiel mit den sprachlichen Bedarfen von Reiseleiterinnen und -leitern oder Granato und Settelmeyer (2017) mit den sprachlich- kommunikativen Anforderungen in der Ausbildung zur oder zum medizinischen Fachangestellten. Unabhängig von der Tatsache, dass es sich hierbei um für das Arbeits- und Forschungsfeld DfB wichtige und relevante Studien und Analysen handelt, ist gleichzeitig festzustellen, dass innerhalb des Fachdiskurses keine vergleichenden Untersuchungen und empirische Überprüfungen der theoretischen Modelle zur Erfassung der sprachlich-kommunikativen Anforderung eines Berufs bzw. Berufsfelds vorliegen.
Auch im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit im Kontext der Analyse des berufskommunikativen Kompetenzniveaus von zugewanderten Fachkräften sowie unter dem Gesichtspunkt der Erfassung der sprachlich-kommunikativen Anforderungen dieser beiden Handwerksberufe, überschreitet eine empirische fundierte Auseinandersetzung mit diesen theoretischen Modelle den Rahmen dieser Forschungsarbeit. Unabhängig davon wird in Kapitel 3.3 aus theoretischer und empirischer Perspektive das dieser Arbeit zugrunde liegende Konstrukt und Vorgehen zur Erfassung der sprachlich-kommunikativen Anforderungen der beiden Berufe theoretisch begründet und empirisch angewandt. Des Weiteren ist festzustellen, dass das Forschungsdesiderat der theoretischen Erfassung und empirischen Überprüfung von sprachlich-kommunikativen Anforderungen im Beruf auch auf den geringen Bestand an authentischen berufsspezifischen Dokumenten und Materialien sowie Korpora der beruflichen Kommunikation zutrifft.
In Bezug auf den Forschungsstand zu Sprache und Kommunikation im Beruf lässt sich zusammenfassend feststellen, dass der Bereich der Sprachdiagnostik in Themenfeld DfB besondere Hausforderungen an Sprachtestentwickler:innen stellt, die von der Forschung bisher nur unzureichend adressiert werden. Im Hinblick auf die Aneignung und Feststellung der berufskommunikativen Kompetenzen berufserfahrener Zugewanderter liegen zwar Studien aus benachbarten Disziplinen vor, die aber auch nur wenig belastbare Befunde zu Erfolgsfaktoren des (berufsbezogenen) Zweitspracherwerbs liefern. Abschließend wurden diesem Kapitel theoretische Ansätze der Erhebung, Ermittlung und Analyse sprachlicher Bedarfe im Beruf vorgestellt, welche in der DaF-/DaZ-Forschung und -Praxis zwar durchaus angewandt werden, aber einer fundierten empirischen Überprüfung bedürfen.
2Theoretischer Zugang
Bezugnehmend auf die thematische Einordnung dieser Arbeit in den Forschungskontext wird im Folgenden unter Rückgriff auf theoretische Modelle der Sprachaneignung im Kontext beruflicher und sprachlicher Sozialisation der Forschungsstand zum berufskommunikativen Sprachaneignungsprozess sowie zur Entwicklung berufskommunikativer Testverfahren vorgestellt. Des Weiteren werden sowohl das dem dieser Forschungsarbeit zugrunde liegende Begriffs- und Prozessverständnis der berufsbezogenen Sprachaneignung als auch das Testkonstrukt des BTA und BTF erläutert.
In Kapitel 2.1 wird zunächst der Aneignungsprozess berufsbezogener Sprachkompetenz in Verbindung mit soziokulturellen Ansätzen der Sprachaneignung dargelegt. Dies bedeutet u. a., dass davon ausgegangen wird, dass der berufsbezogene Spracherwerb im Kontext der beruflichen und sprachlichen Sozialisation stattfindet. Die zugewanderten Fachkräfte werden hierbei als hybride und historisch-biografisch situiert Handelnde aufgefasst, die eine aktive Rolle im Sprachaneignungsprozess einnehmen. Neben der Darstellung des theoretischen Rahmens werden empirische Vorarbeiten, die sich mit den berufskommunikativen Kompetenzen berufserfahrener Zugewanderter beschäftigen, vorgestellt und den verschiedenen theoretischen Ansätzen bzw. Modellen zugeordnet. Im Anschluss daran werden in Kapitel 2.3 die testtheoretischen Grundlagen zur Entwicklung des BTA und BTF thematisiert, indem theoretische Modelle beruflicher Kommunikation beschrieben werden und der Forschungsstand zu berufskommunikative Testverfahren beschrieben wird. Der theoretische Testentwicklungsprozess ist Gegenstand des abschließenden Kapitels.
2.1Sprachaneignung im Kontext beruflicher und sprachlicher Sozialisation
Im Hinblick auf den Prozess der Sprachaneignung im Kontext beruflicher und sprachlicher Sozialisation wird zunächst auf soziokulturelle Ansätze der Sprachaneignung (vgl. Daase 2018; Lantolf 2000; Ohm 2007) eingegangen, welche Grundlage des teilhabeorientierten Spracherwerbs bilden. Des Weiteren werden berufserfahrene Zugewanderte im Rahmen dieser Forschungsarbeit als historisch-biografisch situiert Handelnde beschrieben und die berufsbezogene Sprachaneignung als Teilhabeprozess an sozialen Praktiken verstanden. Neben der Darstellung einzelner theoretischer Modelle findet in diesem Kapitel auch eine Einordnung in den Forschungsstand statt.
2.1.1Soziokulturelle Ansätze der Sprachaneignung
Ausgehend von der Kritik und den zunächst vornehmlich linguistischen Forschungszugängen und -arbeiten zur Zweitspracherwerbsforschung, bei welchen insbesondere das Gehirn bzw. der Verstand fokussiert, und der soziale Kontext ausgeschlossen wurde, entwickelten sich spätestens ab den 1990er Jahren Ansätze der Zweitspracherwerbsforschung, bei welchen weniger kognitive, sondern insbesondere soziale Gesichtspunkte des Spracherwerbs in den Mittelpunkt gerückt wurden (vgl. Daase 2018, S. 83 f.). Diese Entwicklung ist im anglo-amerikanischen Raum unter dem Begriff des social turn der Zweitspracherwerbsforschung bekannt (vgl. Block 2003). Seitdem hat sich der Forschungsbereich der soziokulturellen Ansätze der Zweitsprachenerwerbsforschung stark entwickelt und differenziert. Lantolf, welcher den Grundstein der soziokulturellen Theorie im Kontext der Zweitspracherwerbsforschung legte, vertritt beispielsweise ein enges Begriffsverständnis, indem eine Anbindung an Vygotskij1 bzw. die Tradition der russischen kulturhistorischen Schule als Voraussetzung für Ansätze der soziokulturellen Zweitspracherwerbsforschung angesehen wird (vgl. Daase 2018, S. 87; Lantolf 2000, S. 1).
Allgemein wird im Rahmen der soziokulturellen Theorien der Zweitspracherwerbsforschung zwischen vier Ansätzen unterschieden, die auf teilweise unterschiedlichen theoretischen Grundlagen basieren und sich in ihren Konzepten unterscheiden können (vgl. Daase 2018, S. 87). Basierend auf der Tatsache, dass die soziokulturelle Theorie der Sprachaneignung lediglich den inhaltlichen Rahmen des Begriffsverständnisses zum berufsbezogenen Sprachaneignungsprozesses dieser Arbeit umfasst, ist es an dieser Stelle nicht notwendig und gegenstandsangemessen, auf die verschiedenen Strömungen innerhalb der Theorie der soziokulturellen Sprachaneignung einzugehen. Des Weiteren ist festzustellen, dass den Ansätzen ein grundsätzliches Begriffsverständnis gemein ist, welches auch als Grundlage für diese Forschungsarbeit dient:
„Bei allen Unterschieden, welche die verschiedenen Ansätze und Richtungen aufweisen, verbindet sie eine Sicht auf Sprache, die diese nicht nur als ein abstraktes linguistisches System von Zeichen und Symbolen zur Weitergabe von Informationen und Vermittlung von Wissen zwischen Individuen versteht, sondern als eine komplexe soziale Praxis sowie ein soziokulturell und historisch geformtes Artefakt, mit welchem Individuen am sozialen Leben teilhaben und sich positionieren, soziale Identitäten aushandeln und auf ihre Umwelt Einfluss nehmen“ (Daase 2018, S. 84).
Unter dem Blickwinkel des Forschungsinteresses dieser Arbeit, welches u. a. darin liegt, nachvollziehen zu können, wie der Aneignungsprozess berufskommunikativer Kompetenzen abläuft, erscheint der Rückgriff auf soziokulturelle Ansätze der Sprachaneignung besonders geeignet. Basierend sowohl auf der migrationsgeschichtlichen Entwicklung der (berufsbezogenen) Sprachförderung, welche vernachlässigt wurde und stark fragmentiert ist, als auch ausgehend vom aktuellen Forschungsstand zur beruflichen und sprachlichen Sozialisation von Zugewanderten (vgl. Daase 2018, S. 368 f.), ist davon auszugehen, dass die zu untersuchende Zielgruppe in vielerlei Hinsicht durch große Heterogenität gekennzeichnet ist. Dieser Heterogenität im Spracherwerbs- und -lernprozess widmen sich insbesondere soziokulturelle Ansätze der Spracherwerbsforschung. Sprache ist im Rahmen dieser Ansätze mit der Aneignung kultureller Artefakte und Praktiken verbunden, die in einen Transformationsprozess eingebettet sind, welcher die Lernenden selbst, die Artefakte und die Handlungssituation betrifft (vgl. Ohm 2007, S. 26–39). Im Kontext dieser Transformation kommt es laut Wells (1999, S. 137) zunächst zur Veränderung der Lernenden, welche sich darin äußert, dass deren Sichtweise und Interpretation der Welt einem kontinuierlichen Wandel ausgesetzt ist. Im Anschluss daran erfolgt die Transformation der kulturellen Artefakte, deren Gebrauch von den Lernenden und deren Rekonstruktion der sozialen Realität abhängt. Am Ende dieses Prozesses kommt es dann durch die Verwendung des Artefakts zu einer weiteren Transformation der Situation, in welcher die Lernenden handeln, und dadurch zu einer Veränderung der sozialen Praxis an sich, die sich darauf bezieht, wie das Artefakt verstanden wird.
Abgesehen von diesem Transformationsprozess werden Lernende im Kontext soziokultureller Ansätze der Sprachaneignung als historisch und sozial situiert Handelnde wahrgenommen, die selbst eine aktive Rolle im Erwerbs- und Lernprozess einnehmen. Demzufolge konzentrieren sich soziokulturelle Ansätze auf den Lernweg der Einzelnen: Es geht somit darum, zu erforschen, welche Wege Lernende finden, um an der zielsprachlichen Gemeinschaft partizipieren zu können, warum sie dabei Erfolge oder auch Misserfolge verzeichnen und wie sich Lern- und Erwerbsprozesse zu einer Lerngeschichte zusammenfügen (vgl. Ohm 2007, S. 27–29). Während sich das Erkenntnisinteresse der soziokulturellen Spracherwerbsforschung vornehmlich auf Aspekte der sprachlichen Sozialisation bezieht, sind im Rahmen der Untersuchung der berufskommunikativen Kompetenzen berufserfahrener Zugewanderter nicht nur Faktoren sprachlicher, sondern auch beruflicher Sozialisation von Relevanz. Denn im Kontext dieser Forschungsarbeit wird von einem konstitutiven Verhältnis der Aneignung von Fachwissen bzw. beruflicher Handlungskompetenz und der (berufsbezogenen) Sprachaneignung und -entwicklung ausgegangen. Auf Basis dieser Verschränkung zwischen beruflicher Handlungskompetenz und dem berufsbezogenen Sprachaneignungsprozess erscheinen insbesondere soziokulturelle Ansätze des Spracherwerbs geeignet, den berufsbezogenen Sprachaneignungsprozess berufserfahrener Zugewanderter abzubilden, da sowohl gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die jeweilige individuelle Migrationsgeschichte als auch das fachliche bzw. berufliche und sprachliche Lernen und Handeln berücksichtigt werden können.





























