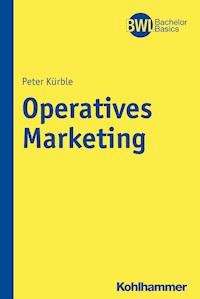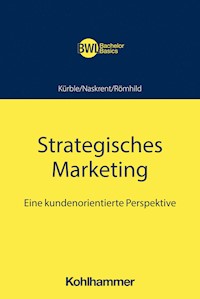23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Lehrbuch leistet die Zusammenführung der bislang lediglich getrennt voneinander wahrgenommenen betriebswirtschaftlichen Disziplinen Beschaffung, Produktion und Marketing - und ist damit einzigartig auf dem deutschen Markt. Sein Mehrwert liegt in der klaren Darstellung der Interdependenzen und Einflüsse, welche diese ökonomischen Teilbereiche aufeinander ausüben. Wissenschaftlich anspruchsvoll, zugleich jedoch nachvollziehbar und kompakt folgt der Aufbau des Werks damit einer dezidiert anwendungsorientierten Konzeption. Praktische Relevanz steht hier im Vordergrund, wobei die konkreten Erfahrungen der Autoren aus Industrie und Wirtschaft verknüpft werden mit den theoretischen Aspekten von Beschaffung, Produktion und Marketing, was eine prägnante und verständliche Darstellung der Inhalte ermöglicht. Interessant ist dieses Lehrbuch insbesondere für Studierende sowie für PraxiseinsteigerInnen in den Bereichen Beschaffung, Produktion oder Marketing. Das umfassende Literaturverzeichnis animiert zur weiteren Beschäftigung mit den einzelnen Inhalten, zahlreiche Beispiele machen die vermittelte Theorie transparent und anwendbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Peter Kürble
Marc Helmold
Olaf H. Bode
Ulrich Scholz
Beschaffung, Produktion, Marketing
Peter Kürble
Marc Helmold
Olaf H. Bode
Ulrich Scholz
Beschaffung, Produktion, Marketing
Tectum Verlag
Peter Kürble, Marc Helmold, Olaf H. Bode, Ulrich Scholz
Beschaffung, Produktion, Marketing.
© Tectum Verlag Marburg, 2016
ISBN: 978-3-8288-6350-7
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3627-3 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung:istockphoto.com Jamie Farrant
Umschlaggestaltung und Satz: Norman Rinkenberger | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
VORWORT
Dieses Lehrbuch Beschaffung, Produktion und Marketing ist entstanden aus der Zusammenarbeit von Akademikern und Praktikern in den jeweiligen Bereichen. Anlass des Lehrbuches war der Bedarf von Studierenden und Praktikern ein integriertes Gesamtwerk aus praktischen und theoretischen Elementen innerhalb der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM) anzubieten. Das Buch verfolgt die grundsätzliche Idee der unternehmensinternen Wertschöpfungskette nach Porter und ist damit in dieser Kombination einzigartig im deutschen Markt. Die Einflüsse, welche die ökonomischen Teilbereiche aufeinander ausüben, sind insbesondere vor dem Hintergrund einer marktorientierten Unternehmensführung allgegenwärtig. Auch wenn den betriebswirtschaftlichen Bereichen der besseren Orientierung wegen jeweils einzelne Kapitel zugeordnet sind, so wird an vielen Stellen des Buches die Verzahnung der verschiedenen Disziplinen immer wieder deutlich. In Übergangskapiteln wird zusätzlich explizit auf die Verknüpfung eingegangen.
Die Herausgeber, Prof. Dr. Dr. Peter Kürble, Dr. Marc Helmold (M.B.A.), Olaf H. Bode und Dr. Ulrich Scholz, haben ihre Erfahrungen aus der Industrie und Wirtschaft mit theoretischen Aspekten aus den Bereichen Beschaffung, Produktion und Marketing verknüpft und dabei der realen Entwicklung Rechnung getragen, die eine getrennte Betrachtung der drei wirtschaftlichen Fachbereiche nicht mehr als sinnvoll erscheinen lässt. So fokussiert dieses Buch eher auf die praktische Relevanz denn auf die theoretische Tiefe. Manche Aspekte müssen deswegen aus akademischer Sicht zu kurz kommen oder ganz entfallen, die Konzentration auf die herausgearbeiteten Punkte ist sicherlich subjektiv und kann mitunter kritisiert werden. Sie verfolgt aber das Ziel eines Übersichtswerkes, die für alle Bereiche aus Sicht der Autoren entscheidenden Elemente herauszugreifen und so darzustellen, dass der Leser in der Lage ist, die Zusammenhänge zu verstehen und in der realen Umgebung umzusetzen.
Die Autoren danken all den Personen, die weder Zeit noch Mühe gescheut haben indirekt an der Erstellung des Buches beteiligt zu sein. Alle Fehler gehen natürlich zu Lasten der Autoren und Kritik ist an dieser Stelle explizit erwünscht.
Zielgruppen sind Studierende der unteren Semester sowie Praxiseinsteiger, die in den Bereichen Beschaffung, Produktion oder Marketing tätig sind und einen ersten fundierten Einstieg zur Orientierung benötigen. Das umfassende Literaturverzeichnis dient somit bei stärkerem Interesse der weiteren akademischen Befassung mit den einzelnen Bereichen.
INHALT
Vorwort
Olaf H. Bode und Ulrich Scholz
Teil 1: Beschaffung
1.1Klassische Funktionen der Beschaffung
1.1.1Sourcing-Strategien
1.1.1.1Make-or-Buy-Entscheidung
1.1.1.2Outsourcing-Strategien
1.1.2Bedarfsermittlung
1.1.2.1Bedarfssortimentsplanung und Bedarfsrationalisierung
1.1.2.2Laufende Bedarfsplanung
1.1.3Bestellung
1.2Unterstützende Aspekte der Beschaffung
1.2.1Beschaffungsmarktforschung
1.2.1.1Objekte und Methoden der Beschaffungsmarktforschung
1.2.1.2Beschaffungsmarktanalyse
1.2.1.3Lieferantenanalyse und -bewertung
1.2.2Beschaffungslogistik
1.3Neue Aspekte in der Beschaffung
1.3.1Supply-Chain-Management (SCM)
1.3.1.1Ziele des SCMs
1.3.1.2Kernbestandteile des SCMs
1.3.1.3Kanban-System
1.3.1.4Konfliktmanagement im SCM
1.3.1.5Perspektiven des SCMs
1.3.2Supplier Relationship Management (SRM)
1.3.2.1Lieferantenportfolio, -politik und -entwicklung im SRM
1.3.2.2Strategieimplementierung des SRMs
1.3.2.3Strategischer und operativer Beschaffungsprozess im SRM
1.3.2.4Varianten des Ausschreibungsprozesses
1.4Qualität in der Beschaffung
1.4.1Bedeutung der Qualität – Normen in der Beschaffung
1.4.2Entsorgungsstrategien und Beschaffung
Literatur
Beschaffung und Produktion
Marc Helmold
Teil 2: Produktion
1.Produktion als wertschöpfender Faktor
1.1Aufbauorganisation der Produktion
1.2Produktionsplanung und Produktionssteuerung
1.2.1Strategische Produktionsplanung und Steuerung
1.2.2Operative Produktionsplanung und -steuerung
1.3Ablauforganisation der Produktion
1.4Produktionslayoutplanung
2.Die schlanken Prinzipien der Produktion
2.1Chronik des Erfolgs von Toyota
2.1.1Die 1950er-Jahre: Das Geheimnis des Erfolges – Kaizen
2.1.2Die 1960er- bis 80er-Jahre: Die Modellpalette wächst und wächst
2.1.31980er-Jahre bis heute: Globalisierung – der Weg zum Weltmarktführer
2.2Fließprinzip
2.3Taktprinzip
2.4Ziehprinzip
2.5Einführung des Kanban-Systems
2.6Kanban-Karten
2.6.1Produktions-Kanban
2.6.2Transport-Kanban
2.6.3Kanban-Behälter
2.6.4Kanban-Tafeln
2.6.5Kanban-Tafeln mit Barcode
2.6.6Signal-Kanban für Pufferbestände
2.6.7Elektronischer Kanban
2.7Supermärkte
2.8Milkrun-Prinzip
2.9Null-Fehler-Prinzip
3.Produktion der Zukunft: virtuelle Produktionssysteme
4.Produktion in Japan: Erfolgsfaktoren aus dem Toyota- Produktionssystem
5.Produktion in China: Wie gehe ich mit chinesischen Lieferanten um?
6.Übertragung von Produktion und Wertschöpfungsanteilen auf die Lieferantenkette
6.1Gezielte und systematische Umsetzung als Schlüssel für die Zukunft
Literatur
Produktion und Marketing
Peter Kürble
Teil 3: Marketing
1.Einführung
2.Marketingforschung
2.1Methoden
2.2Der relevante Markt
2.3Instrumente
2.3.1Bedrohung durch neue Konkurrenten
2.3.2Verhandlungsmacht der Anbieter / Nachfrager
2.3.3Bedrohung durch Ersatzprodukte
2.3.4Rivalität zwischen den bestehenden Unternehmen
3.Marketingmix
3.1Produktpolitik
3.1.1Einleitende Betrachtungen
3.1.2Produktprogramm
3.1.3Zeitliche und sachliche Struktur
3.1.3.1Zeitliche Produktstruktur
3.1.3.2Sachliche Produktstruktur
3.2Kontrahierungspolitik
3.2.1Grundsätzliche Überlegungen
3.2.2Formen der Preisfindung
3.2.2.1Preiswahrnehmung
3.2.2.2Preislernen und Preiswissen
3.2.2.3Preisbeurteilung
3.2.2.4Preiserlebnis
3.2.2.5Preismotivation
3.2.2.6Preiseinstellung
3.3Vertriebspolitik
3.3.1Definition und Abgrenzung
3.3.2Vertriebssystem
3.3.3Verkaufspolitik
3.3.4Vetriebskanalpolitik
3.4Kommunikationspolitik
3.4.1Grundlegende Betrachtungen
3.4.2Werbung
3.4.2.1Werbeziele
3.4.2.2Budgetierung
3.4.2.3Copy-Strategie
3.4.3Verkaufsförderung
3.4.4Öffentlichkeitsarbeit
4.Zusammenfassende Betrachtung
Literatur
ABBILDUNGEN
Abbildung 1.1Beschaffung als Teilfunktion im Betriebsprozess
Abbildung 1.2Internationale Arbeitsteilung
Abbildung 1.3Wertkette nachPorter
Abbildung 1.4Beschaffungsfunktion im Unternehmensumfeld
Abbildung 1.5Sourcing-Strategien
Abbildung 1.6Strategieempfehlungen für fremdbezogene Leistungen 21
Abbildung 1.7 Einordnung des Outsourcings in das Markt-Hierarchie-Kontinuum
Abbildung 1.8Outsourcing-Formen 23
Abbildung 1.9Zulieferer unterschiedlicher Ränge
Abbildung 1.10Struktur von Lieferantennetzwerken
Abbildung 1.11KombinierteOutsourcing-Strategien
Abbildung 1.12Bedarfsermittlung und -planung
Abbildung 1.13Bedarfssortimentsplanung
Abbildung 1.14Ausprägungen der Standardisierung
Abbildung 1.15Verschiedene Geltungsbereiche von Normen
Abbildung 1.16Internationale und nationale Normen
Abbildung 1.17Unterschiedliche und kombinierte Normen
Abbildung 1.18 Beispiel einer klassifizierendenNummerung
Abbildung 1.19Vergabe einer zehnstelligen ISBN
Abbildung 1.20Beispiel einer Parallelverschlüsselung
Abbildung 1.21Lorenzkurve einerABC-Analyse mit idealtypischer Verteilung
Abbildung 1.22ABC-XYZ-Diagramm
Abbildung 1.23Bruttobedarfs-rechnung
Abbildung 1.24Gozintograph nachDispositionsstufen und nach Fertigungsstufen
Abbildung 1.25 Primärbedarf und abgeleiteter Bedarf imGozinto-Verfahren
Abbildung 1.26Direktbedarfs-matrix
Abbildung 1.27Gesamtbedarfs-matrix
Abbildung 1.28 Gesamtbedarfs-matrix, Primärbedarfsvektor undGesamtbedarfsvektor
Abbildung 1.29Input-Output-Matrix
Abbildung 1.30Exponentielle Glättung erster Ordnung
Abbildung 1.31Beispiel einerTrendextrapolation
Abbildung 1.32Bedarfsschätzung und Eintrittswahrscheinlichkeiten
Abbildung 1.33Kostenoptimale Bestellmenge
Abbildung 1.34KostenoptimalerServicegrad
Abbildung 1.35Bestellpunktverfahren ohneSicherheitsbestand
Abbildung 1.36Bestellpunktverfahren mitSicherheitsbestand
Abbildung 1.37Bestellpunktverfahren bei Verbrauchsschwankungen
Abbildung 1.38Bestellrhythmus-verfahren bei Verbrauchsschwankungen
Abbildung 1.39 Zusammenhang derBeschaffungsmarktforschung mit anderen Beschaffungsprozessen
Abbildung 1.40 Ziele derBeschaffungsmarktforschung
Abbildung 1.41 Aufgaben derBeschaffungsmarktforschung
Abbildung 1.42 Methoden derBeschaffungsmarktforschung
Abbildung 1.43 Branchenstruktur-analyse nachPorter
Abbildung 1.44Marktabgrenzung nachAbell
Abbildung 1.45 Trichtermodell nach Brodersen
Abbildung 1.46 Lieferanten-bewertung
Abbildung 1.47Lieferantenbeurteilung und -auswahl
Abbildung 1.48 Bestandteile der Unternehmenslogistik
Abbildung 1.49Prozess der Unternehmenslogistik
Abbildung 1.50Lagermotive und Lagerfunktionen
Abbildung 1.51 Beispielhafter Barcode
Abbildung 1.52 Projektorientierter Aufbau desSCOR-Modells
Abbildung 1.53 Funktion des beschaffenden Unternehmens in der gesamtenSupply Chain
Abbildung 1.54Beschaffungslogistik versus Produktionslogistik
Abbildung 1.55 Funktionsweise des Kanban-Systems
Abbildung 1.56 SCM – Entwicklungs- und Führungsaufgaben
Abbildung 1.57 Globale Trends im Wettbewerb
Abbildung 1.58Bullwhip-Effekt
Abbildung 1.59 Einflussfaktoren der Kooperationskultur
Abbildung 1.60 Kooperationszielsetzungen
Abbildung 1.61Beschaffungsgüter/Beschaffungsquellenportfolio
Abbildung 1.62 Merkmale von Supplier Relations beim operativenBeschaffungsprozess
Abbildung 1.63 Entwicklung des SRM-Prozesses von der Strategie zur operativen Umsetzung
Abbildung 1.64 Kommunikation im Rahmen derReverse Auktion
Abbildung 1.65 Kontinuierliche Verbesserungsprozess KVP
Abbildung 1.66Die acht Grundkonzepte des neuen EFQM-Modells
Abbildung 1.67 Die acht Grundkonzepte des neuen EFQM-Modells
Abbildung 2.1Begriff der Produktion-Leistungserstellung
Abbildung 2.2Produktion als Prozess der betrieblichen Leistungserstellung
Abbildung 2.3 Aufbau- undAblauforganisation der Produktion
Abbildung 2.4Hohe Reaktionsfähigkeit durch den Einsatz schlanker Methoden
Abbildung 2.5Die vier Prinzipien der schlanken Produktion
Abbildung 2.6Verlagerung von Produktionsanteilen an Zulieferer: Studie FAST 2015
Abbildung 2.7Wertschöpfung und Verschwendung
Abbildung 2.8Wertschöpfung, Verschwendung und Ersatz
Abbildung 2.9Die sieben Verschwendungsarten
Abbildung 2.10Aufbauorganisation undAblauforganisation der Produktion
Abbildung 2.11Komplexität der Aufbauorganisation in der Produktion
Abbildung 2.12Produktion in Verbindung mit externen Wertschöpfungsnetzwerken
Abbildung 2.13Einteilung der Aufbau-organisation vonWerkstattfertigung zur Massenfertigung
Abbildung 2.14Beispiel einer Hierarchieebene
Abbildung 2.15Aspekte der strategischen Planung und Steuerung
Abbildung 2.16PPS-Ansatz in der Produktion
Abbildung 2.17Probleme bei der PPS-Anwendung
Abbildung 2.18Teilaufgaben derProduktionsplanung und -steuerung
Abbildung 2.19Y-CIM-Modell nach Scheer.
Abbildung 2.20Teilaufgaben der Ablaufplanung
Abbildung 2.21Andler-Formel
Abbildung 2.22Kostenbestandteile derAndler-Formel
Abbildung 2.23Durchlaufterminierung in der Produktion
Abbildung 2.24Kapazitätsterminierung in der Produktion
Abbildung 2.25Layoutoptimierung in der Produktion
Abbildung 2.26Layoutoptimierung: Trennung von Produktion und Logistik
Abbildung 2.27Prinzipien des Just-in-time-Prinzips
Abbildung 2.28Jede Krise bedeutet auch eine Chance
Abbildung 2.29Fünf bzw. SechsR-Prinzip in der Produktion
Abbildung 2.30Kaizen und Entwicklungen des Just-in-time-Prinzips
Abbildung 2.31Just-in-time-Konzept in der Produktion
Abbildung 2.32Fließfertigung in der Produktion
Abbildung 2.33Fließfertigung mit Unterlieferanten
Abbildung 2.34Chaku-Chaku- Prinzip
Abbildung 2.35Kundentakt und Zykluszeiten
Abbildung 2.36Externes und internesZiehprinzip
Abbildung 2.37Ziehprinzip und Prozesse
Abbildung 2.38Supermärkte als Teil der schlanken Produktion
Abbildung 2.39Supermärkte und Kommissionierung
Abbildung 2.40Milkrun-Prinzip
Abbildung 2.415S-Konzept
Abbildung 2.42Ishikawa-Diagramm
Abbildung 2.43Beziehungen zwischen Elementen und Umwelt
Abbildung 2.44Beziehungsmatrix von Produktionssystemen
Abbildung 2.45Konventionelles vs. effizientes Vorgehen
Abbildung 2.46Entwicklung der Produktentstehung und Produktionsplanung
Abbildung 2.47Anwendungsbeispiele in der Industrie
Abbildung 2.48Muri,Muda und Mura
Abbildung 2.49Maturitätsstufen
Abbildung 2.50Kategorien der Standortbestimmung
Abbildung 2.51Lieferantenpyramide unter Berücksichtigung von externer Produktion
Abbildung 3.1Marketingplan
Abbildung 3.2Der relevante Markt nachAbell
Abbildung 3.3 Umfeld- undMarktanalyse
Abbildung 3.4 Die 4 Ps und ihre Zusammenhänge
Abbildung 3.5 Sachliche und zeitliche Struktur von Produkten
Abbildung 3.6Klassischer Innovationsprozess
Abbildung 3.7Der Adoptions-prozess
Abbildung 3.8 Top-Flop-Handy
Abbildung 3.9Produktkern
Abbildung 3.10 Produktdesign
Abbildung 3.11 Die sieben Ps
Abbildung 3.12 Wertschöpfungskette bei kontinuierlichen Dienst-leistungen
Abbildung 3.13 Preispolitische Struktur
Abbildung 3.14 Monetäre und nichtmonetäre Kosten
Abbildung 3.15 Das SOR-System der psychischen Variablen des Preisverhaltens
Abbildung 3.16 Elemente derVertriebspolitik
Abbildung 3.17 Determinanten derKundenzufriedenheit
Abbildung 3.18 Kundenzufriedenheitsmodell nach Homburg
Abbildung 3.19 Kennziffern zur Messung derKundenbindung
Abbildung 3.20Bruttowerbevolumen in den Above-the-Line-Medien 2014 (Angaben in 1.000 Euro)
Abbildung 3.21 Aufbau einer Werbekonzeption
Abbildung 3.22Profile der Fernsehsender: Beurteilung anhand ausgewählter Aussagen zur Informationsleistung
Abbildung 3.23 Verkaufsförderung
Olaf H. Bode und Ulrich Scholz
TEIL 1: BESCHAFFUNG
Die Beschaffung ist die erste Funktion im Betriebsprozess. Sie bildet somit die Schnittstelle des Unternehmens zu seinen Beschaffungsmärkten (s. Abbildung 1.1). Zudem verbindet sie die Produktion des eigenen Unternehmens mit der Absatzfunktion der Lieferanten, denn letztlich ist jeder Gütertausch sowohl Gegenstand der Absatzwirtschaft als auch der Beschaffungswirtschaft.
Abbildung 1.1Beschaffung als Teilfunktion im Betriebsprozess
Aufgabe der Beschaffung ist es, den Bedarf des Unternehmens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf Quantität und Qualität zum richtigen Zeitpunkt zu sichern. Dabei gibt es unterschiedlich weit gefasste Begriffe des Unternehmensbedarfs. Im weitesten Sinn wird hierunter jeglicher Bedarf des Unternehmens verstanden, dies bedeutet, dass neben dem Bedarf an originären Gütern auch der Finanzbedarf und der Personalbedarf Teil der Beschaffungsfunktion eines Unternehmens sind. Eine engere Begriffsverwendung beschränkt sich auf den Bedarf an originären Gütern, also den Bedarf an Einsatzgütern, an fremden Dienstleistungen und an Handelswaren. Eine noch enger gefasste Bedarfsdefinition beschränkt sich auf den Unternehmensbedarf von originären Einsatzgütern. Hierzu zählen Betriebsmittel und Werkstoffe. Die engste Begriffsverwendung ist die rein materialwirtschaftliche. Hier beschränkt sich der Bedarfsbegriff lediglich auf die Werkstoffe, d. h. auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie auf Zulieferteile. Die Deckung des materialwirtschaftlichen Unternehmensbedarfs liegt auch im Fokus dieses Kapitels.
Wie schon erwähnt, bildet die Beschaffungsfunktion die Schnittstelle des Unternehmens zu seinen vorgelagerten Märkten. Dabei nimmt das Unternehmen die Rolle eines Nachfragers ein, während die Zulieferer ihre Leistung vermarkten bzw. anbieten. Das Unternehmen steht somit mit den anderen Nachfragern auf einem Beschaffungsmarkt in einem nachfrageseitigen Wettbewerb. In der wettbewerbstheoretischen Literatur steht der angebotsseitige Wettbewerb auf Endkundenmärkten im Vordergrund. Zu berücksichtigen gilt, dass nicht alle Erkenntnisse eins zu eins auf einen nachfrageseitigen Wettbewerb übertragen werden können.
Ferner kann das Unternehmen auf den Beschaffungsmärkten auf andere Konkurrenten als auf den Absatzmärkten treffen. So tritt ein Fahrradhersteller, der verstärkt Karbonteile in seinen Fahrrädern verbauen möchte, nicht alleine in Konkurrenz zu anderen Fahrradherstellern, die das gleiche Vorhaben verfolgen. Konkurrenten auf den Beschaffungsmärkten sind auch Unternehmen anderer Branchen, die ebenfalls Karbon oder Karbonteile verbauen möchten. Dies können bspw. Hersteller von Badmintonschlägern, aber auch Systemlieferanten von Automobilherstellern sein. Somit ergeben sich auf den Beschaffungsmärkten zum Teil völlig abweichende Wettbewerbskonstellationen als auf den Absatzmärkten.
Auch die Erkenntnisse des Marketings, das in der Regel Absatzmarketing ist, können nicht uneingeschränkt übernommen werden. Absatzmarketing ist in der Regel auf den Bereich Business-to-Consumer (B2C) fokussiert. Beschaffungsmarketing wird aber von der Nachfrageseite her betrieben und findet im Bereich Business-to-Business (B2B) statt. Beschaffungsmarketing ist daher weniger emotional als Absatzmarketing. Zwei Hauptziele des Beschaffungsmarketings sind der Aufbau langfristiger partnerschaftlicher Beziehungen zu den Lieferanten und die Sicherung von Bezugsquellen. Wie relevant die Sicherung von Bezugsquellen sein kann, zeigt sich an der Tatsache, dass zehn wichtige deutsche Industrieunternehmen am 24. April 2012 die Rohstoffallianz GmbH gründeten. Zu den Gründungsmitgliedern zählen etwa die Bayer AG, BASF, Bosch und die ThyssenKrupp AG. Ziel ist es, durch Kooperation den Zugriff auf Rohstoffquellen abzusichern.
Hier zeigt sich, dass die Globalisierung auch ein wichtiger Aspekt für die Beschaffungsfunktion eines Unternehmens ist. Einerseits ergeben sich hierdurch neue Optionen und Chancen. Andererseits erhöht sich die Komplexität und es treten neue Konkurrenten bspw. aus den BRIC 1-Staaten auf. Ein gutes Beispiel, wie globalisiert und komplex die Beschaffung in der heutigen Zeit ist, ist die elektrische Zahnbürste Sonicare Elite 7000. Abbildung 1.2 zeigt, wie diese Weltbürste durch internationale Arbeitsteilung hergestellt wurde.
Abbildung 1.2 Internationale Arbeitsteilung
Quelle: In Anlehnung an Der Spiegel 26/2005, S. 109
Zwar findet die Bedarfsdeckung auf den Beschaffungsmärkten statt, trotzdem darf die Beschaffungsfunktion nicht losgelöst von der Produktion und der Absatzfunktion gesehen werden. Da die Beschaffung die unternehmenseigene Produktion mit den Beschaffungsmärkten verbindet, ist es leicht ersichtlich, dass die Produktionsweise sehr starken Einfluss auf den Bedarf, die Bedarfsermittlung und damit die Bedarfsdeckung hat. Eine Produktion, die dem Push-Prinzip folgt, hat daher andere Anforderungen an die Beschaffung als eine, die nach dem Pull-Prinzip aufgebaut ist.
Auch die Positionierung eines Unternehmens auf den Absatzmärkten sowie die Marktsituation auf diesen Märkten spielen für die Beschaffung eine bedeutende Rolle. Michael Porter sieht in seinem Wertkettenmodell die Beschaffung als eine von vier Unterstützungsaktivitäten (vgl. Abbildung 1.3).
Abbildung 1.3Wertkette nachPorter
Quelle: Porter 1999, S. 90
Porter unterteilt die Aktivitäten in einem Unternehmen in fünf Primäraktivitäten und vier Unterstützungsaktivitäten. Die fünf Primäraktivitäten sollen so ausgerichtet sein, dass das Unternehmen auf den Absatzmärkten einen größtmöglichen Erfolg erzielen kann. Damit werden diese Aktivitäten letztlich an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Die vier Unterstützungsaktivitäten, also auch die Beschaffung, sollen dazu beitragen, dass die Primäraktivitäten ihre Funktionen optimal erfüllen können.
Nach Porter ist die Beschaffung eine Unterstützungsfunktion, sie kann zu den Primärfunktionen auch in Konkurrenz treten. Letztlich können alle Unternehmensfunktionen ausgelagert werden. Dies gilt auch für die Produktion. So wurde „Hannen Alt“, ein Altbier der Hannen-Brauerei, die seit 1988 zur dänischen Carlsberg-Gruppe gehört, über Jahre vom Discountbier-Hersteller Oettinger produziert und abgefüllt, ohne dass es den Kunden bewusst war. 2006 wurde der Vertrag nicht verlängert, weil Oettinger die Kapazitäten für die eigenen Biere benötigte.
In einer Zeit, in der die Endkundenmärkte gesättigt sind, muss auch die Beschaffung die Endkundeninteressen mit einbeziehen. Abbildung 1.4 fasst die bisherigen Erkenntnisse zum Thema Beschaffung noch einmal zusammen. Sie stellt den Versuch dar, das Wertkettenkonzept von Porter mit seinem „Modell der fünf Wettbewerbskräfte“ aus Sicht der Unternehmensfunktion Beschaffung zu verbinden.
Abbildung 1.4Beschaffungsfunktion im Unternehmensumfeld
•Beschaffung ist die erste Funktion im Betriebsprozess und stellt die Schnittstelle zu den Beschaffungsmärkten her. Sie verbindet die Absatzfunktion der Lieferanten mit der eigenen Produktion.
•Auf den Beschaffungsmärkten nimmt das Unternehmen die Rolle eines Nachfragers ein. Es steht mit anderen Unternehmen als auf den Absatzmärkten in Konkurrenz. Die meisten Erkenntnisse aus der Wettbewerbstheorie und dem Marketing beziehen sich auf B2C-Bereiche und lassen sich für den Beschaffungsmarkt nicht eins zu eins übernehmen. Sie müssen entsprechend angepasst werden.
•Innerhalb der Wertkette nimmt die Beschaffung eine Unterstützungsfunktion ein. Da die Primäraktivitäten an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet werden sollen, spielen die Kundenbedürfnisse für die Beschaffung ebenfalls eine wichtige Rolle.
•Die Beschaffungsfunktion kann auch zu den anderen Funktionen in Konkurrenz treten. Dies geschieht immer dann, wenn ein Unternehmen sich fürOutsourcing entscheidet.
•Die konkrete Ausgestaltung der Wertkette – bspw. die Entscheidung für eine Produktion nach dem Pull- bzw. dem Push-Prinzip – hat Auswirkungen auf die Beschaffung. Die konkrete Ausgestaltung der Wertkette wird auch durch die jeweilige Wettbewerbssituation mitbestimmt. Hier spielen folgende Fragen eine Rolle: Welche Marktmacht haben die Lieferanten? Welche Marktmacht haben die Abnehmer? Welche Rivalitätsbeziehung liegt innerhalb der Branche vor? Gibt es eine Bedrohung durch potentielle Konkurrenten? Gibt es eine Bedrohung durch Substitute?
•Unter den vorher genannten Gesichtspunkten soll die Beschaffung den Bedarf des Unternehmens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf Quantität und Qualität zum richtigen Zeitpunkt sichern.
Im Kapitel Beschaffung werden zunächst die klassischen Funktionen der Beschaffung erläutert. Anschließend werden die unterstützenden Funktonen dargestellt. Im zweiten Teil des Kapitels wird auf neue Aspekte wie das Supply-Chain-Management und Supplier-Relationship-Management eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet der Aspekt Qualität.
1.1 Klassische Funktionen der Beschaffung
1.1.1 Sourcing-Strategien
Eine besondere Herausforderung für jedes Unternehmen ist es, die Komplexität der Beschaffung zu beherrschen. Es gilt für die Vielzahl der zu beschaffenden Güter und Dienstleistungen die jeweils beste Lösung unter mehreren Optionen zu finden. Dies erfordert heutzutage vernetztes Denken, wirtschaftliches Handeln unter Unsicherheit in einer komplexen Umwelt sowie die Suche und Realisierung von Synergieeffekten. So ist die Beziehung zu den Zulieferern oft ambivalent. Denn sie stellen einerseits die Marktgegenseite dar und können, wenn sie über eine große Verhandlungsmacht verfügen, eine Bedrohung für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg darstellen. Andererseits sind sie auch Partner innerhalb der Wertschöpfungskette und können so den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen.
Es ist völlig klar, dass die Optimierung in einem hoch komplexen Umfeld nicht für jeden konkreten Beschaffungsprozess gesondert bestimmt werden kann. Aus diesem Grund formulieren die Unternehmen längerfristig angelegte Strategien bzw. zweckgebundene Handlungsweisen, um die Versorgungsziele zu erreichen. Diese unterschiedlichen Sourcing-Strategien werden oft auch als Versorgungskonzepte oder als Beschaffungsformen bezeichnet. Sie bilden den Rahmen für die spätere operative Durchführung der jeweiligen Beschaffung.2
Die Sourcing-Strategien können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Üblich ist die Differenzierung, wie sie in Abbildung 1.5 dargestellt ist.
Abbildung 1.5Sourcing-Strategien
Quelle: In Anlehnung an Arnold 1997, S. 97f.
Von den vier Differenzierungsarten des Sourcings ist das Feld „Eigenfertigung/Fremdbezug“ aus zwei Gründen hervorgehoben. 1. Die erste Entscheidung, die getroffen werden muss, ist, ob die Inputfaktoren im eigenen Unternehmen erstellt oder von anderen Unternehmen bezogen werden sollen. Dies ist eine sog. „Make-or-Buy-Entscheidung“. 2. Die anderen Differenzierungsmöglichkeiten stellen lediglich unterschiedliche Outsourcing-Strategien dar und blenden das Insourcing aus. D. h. sie befassen sich mit der konkreten Ausgestaltung der Bezugsart, wenn die grundlegende Entscheidung für einen Fremdbezug gefallen ist.
1.1.1.1 Make-or-Buy-Entscheidung
Für die Make-or-Buy-Entscheidung, die im Grunde nichts anderes ist als die grundlegende Frage nach der optimalen Koordinationsform von (meist) geschäftlichen Beziehungen zwischen Marktteilnehmern, sind insbesondere die sog. Transaktionskosten relevant. Sie werden definiert als „...costs of running the economic system“3 und stellen Kosten dar, die mit der beabsichtigten Transaktion zusammenhängen. Dabei wird zwischen Kosten, die bei der Nutzung von Verwaltung entstehen (betriebsinterne Transaktionen, Insourcing) und Kosten, die bei der Nutzung des Marktes entstehen (marktliche Transaktionen, Outsourcing), differenziert. Die Transaktionskostentheorie (TKT) „untersucht 1. alternative Formen von Organisationen, die der Art nach verschieden sind (d. h. verschieden in Bezug auf spezifische Struktureigenheiten, nicht nur marginal verschieden); sie schreibt 2. den Wirtschaftssubjekten Weitsicht, nur nicht Hyperrationalität, zu und arbeitet mit Selektion der schwachen Form; und sie untersucht 3. nur realisierbare Organisationsformen, wobei die Wirksamkeit dieser Unternehmen vergleichend beurteilt wird …“4
Ohne auf die einzelnen Aspekte der Definition näher einzugehen,5 wird im Folgenden kurz erläutert, wann es aus transaktionskostentheoretischer Sicht sinnvoll sein kann, die Koordination dem Markt zu überlassen (buy), wann die Einbindung in ein Unternehmen angemessen ist (make) und wann Zwischenformen die effiziente Lösung sind?
„Bei einer durchschnittlichen Transaktionsmenge und einer gegebenen transaktionalen Umwelt wird jenes Organisationsdesign zur Koordination der Transaktionen auf dem Markt und im Unternehmen gewählt, das die geringstenTransaktionskosten verursacht, bei gleichen Produktionskosten.“6 Die TKT nennt fünf entscheidende Einflussfaktoren, welche die effiziente Lösung identifizieren:
1.dieSpezifität,
2.die Unsicherheit,
3.die Transaktionskostenatmosphäre,
4.die Transaktionshäufigkeit und
5.die Verfügbarkeit von Know-how und Kapital.
Die Spezifität von Leistungen schränkt die Transaktionspartner in ihrer Handlungsfreiheit durch einen Lock-in-Effekt ein und bewirkt eine ggf. beidseitige Abhängigkeit. In diesem Zusammenhang wird auch der Opportunismus zu einem Problem, wenn durch die Spezifität eine fundamentale Transformation stattfindet. Hiermit ist gemeint, dass beispielsweise einer der Transaktionspartner Investitionen in Maschinen tätigt, die nur zur Produktion von Gütern geeignet sind, die als Vorprodukte für den Vertragspartner nutzbar sind. In diesem Fall hätte dieser Vertragspartner als Abnehmer eine monopolartige Stellung und könnte diesen Vorteil ausnutzen.
Der Marktmechanismus wird weiter eingeschränkt, wenn zusätzlich zur Spezifität der Leistung auch noch eine gewisse Unsicherheit bzw. Komplexität hinzukommt. Da den Beteiligten in der Transaktionskostentheorie beschränkte Rationalität bescheinigt wird, würden Spezifität, Unsicherheit und Komplexität dazu führen, dass bei einer Koordination über den Markt hohe Informationskosten notwendig wären. In solchen Fällen ist dann eine andere Form der Koordination, im Allgemeinen als hierarchische Koordination bezeichnet, ggf. sinnvoller. Schließlich führt die Häufigkeit der potenziellen Leistung zusätzlich zur Kostensteigerung, so dass auch aus diesem Grund die Koordination in bestimmten Fällen ebenfalls verstärkt innerbetrieblich erfolgen würde und nicht über den Markt.
Aus transaktionskostentheoretischer Sicht ist der Markt also dann der effizientere Koordinationsmechanismus, wenn
•„die Umweltkomplexität/-unsicherheit – bei gegebener Verarbeitungskapazität – gering ist,
•das Problem der kleinen Zahl – bei gegebenem Ausmaß opportunistischen Verhaltens – wegen polypolistischer Angebots- bzw. Nachfragestruktur nicht auftritt,
•die vorzunehmenden bzw. vorgenommenen Investitionen nicht an bestimmte Transaktionen gebunden sind,
•die Informationsniveaus der beteiligten Transaktionspartner in etwa gleich sind und
•die Transaktionshäufigkeit und die Transaktionsatmosphäre einer Markttransaktion insgesamt förderlich sind und gegenseitiges Vertrauen unvollständige Verträge für Markttransaktionen als hinreichend erscheinen lässt.“7
Entsprechend gilt umgekehrt, dass nur bei sehr hoher Spezifität, großer Unsicherheit und häufig anfallenden Leistungen die Einbindung in ein Unternehmen bzw. die Eigenfertigung sinnvoll ist, da insbesondere hochspezifische Güter bei externer Produktion keine Kostenvorteile gegenüber interner Herstellung aufweisen, zusätzlich aber Transaktionskosten generieren.
Neben den beiden extremen Varianten des Make-or-Buy sind in der Realität viele verschiedene, sog. hybride, weil gemischte Formen der Koordination, wie bspw. das Joint-Venture, zu finden.
Gegenüber langfristigen Verträgen sind Joint Ventures aus Transaktionskostengesichtspunkten zum Beispiel dann zu bevorzugen, wenn einerseits große Unsicherheit darüber besteht, welche Ereignisse erzielt werden können, andererseits aber von vorneherein ein Einverständnis über die Führung der Gemeinschaftsunternehmung und die Verteilung überschüssiger Gewinne erzielt werden kann.
Kooperationen wie langfristige Lieferverträge und Lizenzen sind aus transaktionskostentheoretischer Sicht dann effizient, wenn z.B. die Spezifität zwar gering, die strategische Bedeutung der Leistungen aber hoch ist und bei häufig anfallenden und unsicheren Leistungen das unternehmensexterne Know-how deutlich überlegen ist.
Ergänzend kann auch berücksichtigt werden, dass bei einer Kooperation auch immer der Aspekt des Know-how-Transfers eine Rolle spielt. Abbildung 1.6 gibt einen Überblick über die entsprechenden Strategieempfehlungen.
Abbildung 1.6Strategieempfehlungen für fremdbezogene Leistungen
Quelle: In Anlehnung an Picot 1991, S. 350
1.1.1.2 Outsourcing-Strategien
Sollte ein Fremdbezug sinnvoll sein, so ergeben sich, wie bereits angesprochen, verschiedene Möglichkeiten der Koordination, wobei die Übergänge vom Insourcing zum Outsourcing fließend sind. Abbildung 1.7 gibt hier einen Überblick.
Abbildung 1.7Einordnung des Outsourcings in das Markt-Hierarchie-Kontinuum
Quelle: In Anlehnung an Kürble und Wörmann, S. 43
Die Grundannahme ist, dass, wird von Transaktionskosten abgesehen, ein Unternehmen (Outsourcing-Kunde) seine Aktivitäten auf externe Anbieter (Outsourcing-Anbieter) verlagert, wenn der Marktpreis der ausgelagerten Aktivitäten niedriger ist, als die internen Grenzkosten dieser Aktivitäten. Die Kostenersparnis soll durch das der Eigenerstellung gegenüber aufgrund von Größenvorteilen und geringeren Löhnen günstigere Angebot des Anbieters erzielt werden, der darüber hinaus durch seine inhaltliche Fokussierung und dem damit erhofften Aufbau von Know-how dieses günstigere Angebot idealerweise mit einer vergleichsweise besseren Qualität erfüllen kann. Schließlich wird als drittes Argument oft der Ausgleich von Produktionsschwankungen genannt.
Neben der Frage der betroffenen Unternehmensbereiche spielt auch die Form des Outsourcings eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für oder gegen Outsourcing (vgl. Abbildung 1.8).
Abbildung 1.8Outsourcing-Formen
Quelle: In Anlehnung an Kürble und Wörmann, S. 44
Das partielleOutsourcing steht eher für Outtasking, also die Fremdvergabe von Teilaufgaben oder Teilbereichen. Die Grundidee und -annahme besteht darin, eine Gesamtaufgabe in Teilaufgaben bzw. Tasks zu unterteilen, da mitunter bei sehr komplexen Aufgaben eine Gesamtkompetenz eines Outsourcing-Anbieters eher angezweifelt wird. Das reineOutsourcing bezeichnet die vollständige Auslagerung einer Aufgabe oder eines Unternehmensbereichs an einen Outsourcing-Anbieter, wie dies etwa im Bereich des Mobilfunks in Bezug auf Callcenter zu beobachten ist. Beim reinen Outsourcing lassen sich verschiedene Fristigkeiten unterscheiden. Das kurzfristige reineOutsourcing bezieht sich auf die reine Markttransaktion, also die Leistungserstellung durch Externe und die Nachfrage dieser Leistung im Sinne einer klassischen Marktnachfrage. So kann es beispielsweise bei einer vorangegangenen Auslagerung von Kantinenleistungen im Rahmen eines besonderen Festaktes dazu kommen, dass eben dieser Outsourcing-Anbieter für den Festakt einen eigenständigen Gestaltungsauftrag erhält. Da der Outsourcing-Anbieter in diesem Moment aber mit anderen Anbietern im Markt konkurriert und die zu erbringende Leistung vertraglich unabhängig von der sonstigen Leistungserbringung im Rahmen der Kantinenleistungen sein kann, tritt hier der Markt als Koordinationsmechanismus auf.
Bei den mittelfristigen ebenso wie bei den langfristigen Formen des Outsourcings handelt es sich um verschiedene Möglichkeiten der vertraglich fixierten Zusammenarbeit. Denn obwohl Outsourcing in der Theorie gewöhnlich als langfristig ausgelegte Vereinbarung beschrieben wird, finden in der Realität oft kurz- und mittelfristige Auslagerungen statt. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass zum einen die Transaktionskosten einer Auslagerung häufig von den beteiligten Unternehmen unterschätzt sowie die Kosteneinsparungen nicht realisiert werden und damit Unternehmen die vormals ausgelagerte Leistung wieder in das Unternehmen verlagern, oder Unternehmen zum anderen Outsourcing nur betreiben, um Produktionsspitzen abzudecken bzw. die Kompetenz der Outsourcing-Anbieter und Qualität der gelieferten Leistungen hinter den Erwartungen zurückbleiben.8
Darüber hinaus erscheint es logisch, dass mit zunehmender Auslagerung von Prozessen und damit ggf. einer gestiegenen Effizienz, die Profit Margins aufgrund eines geringeren Anteils am Wertschöpfungsprozess sinken. Der eventuell erzielte Kostenvorteil muss also unter Umständen durch sinkende Profit Margins erkauft werden und ist dann nicht zwingend von langfristigem Wettbewerbsvorteil. Zudem kann der Wettbewerbsvorteil aufgrund von Imitation durch Wettbewerber von nur temporärer Natur sein.
Innerhalb des langfristigen reinen Outsourcings haben sich viele verschiedene Sourcing-Strategien herausgebildet. Diese Sourcing-Strategien bilden den Rahmen für die operativen Tätigkeiten im Beschaffungsprozess und werden im Folgenden näher erläutert.
Unter Single Sourcing wird die freiwillige Festlegung auf nur eine Bezugsquelle verstanden. Es ist daher vom sog. Sole Sourcing abzugrenzen. Auch hier liegt ein Einzelquellenbezug vor, der aber nicht freiwillig geschieht. Vielmehr hat hier ein Lieferant eine Monopolstellung.
Im Fokus des Single Sourcings stehen Kostensenkungspotentiale und die Möglichkeit, eine langfristige Beziehung zum Lieferanten aufzubauen. Die Kostensenkungspotentiale ergeben sich einerseits durch günstigere Preise wegen der Abnahme von Großmengen. Andererseits werden die Transaktionskosten erheblich gesenkt. Zudem ist es möglich, durch Rahmenverträge den Bezug von Materialien langfristig abzusichern. Ferner kann mit einer bevorzugten Behandlung bspw. bei Sonderanfertigungen oder Lieferengpässen gerechnet werden, da das eigene Unternehmen aus Sicht des Lieferanten ein wertiger Kunde ist.
Diesen Vorteilen stehen aber auch gewisse Nachteile gegenüber. So ist die Abhängigkeit von der einzigen Bezugsquelle sehr groß. Hat der Lieferant Probleme, die bestellten Materialien in der gewünschten Quantität, Qualität und/oder Zeit zur Verfügung zu stellen, hat dies direkte Auswirkungen auf die eigene Situation. Ein schnelles Ausweichen auf eine andere Bezugsquelle erweist sich besonders dann als schwierig, wenn wegen der engen Geschäftsbindung zum Lieferanten die Beschaffungsmarktforschung vernachlässigt worden ist.
Die Vernachlässigung der Beschaffungsmarktforschung aufgrund von Single Sourcing kann zudem dazu führen, dass ein Unternehmen nicht erkennt, dass trotz Preisnachlässen wegen großer Bestellmengen die Materialpreise zu hoch sind. Gleiches gilt bei qualitativen Materialeigenschaften oder bei der Servicequalität des Lieferanten.
Beim Multiplen Sourcing werden die Materialien bei unterschiedlichen Lieferanten bezogen. Sinn dieser Strategie ist es, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu vermeiden und so die Risiken des Single Sourcings auszuschalten. Ferner kann das eigene Unternehmen den Wettbewerb unter den Lieferanten ausnutzen. Der Lieferantenwettbewerb kann sich auf mehrere Parameter beziehen. Wettbewerbsparameter sind bspw. der Preis, die Lieferbedingungen, die Produktqualität, Garantien, der Service etc.
Als Nachteile des Multiple Sourcings können die schon genannten Vorteile des Single Sourcings angesehen werden. Die Möglichkeit z. B. von Mengenrabatten wird durch Multiple Sourcing stark eingeschränkt.
Beim Dual Sourcing werden die Materialien bei zwei Lieferanten bezogen. Die Art der Aufteilung zwischen den beiden Bezugsquellen kann auf unterschiedlichste Art und Weise erfolgen. Möglich wären fallweise Entscheidungen, das Bilden von Quoten oder das Aufteilen der Bestellungen nach Regionen. Letzteres wird häufig durchgeführt, wenn das Unternehmen mehrere Produktionsstandorte hat.
Das Dual Sourcing stellt den Versuch dar, die Vorteile von Single Sourcing und Multiple Sourcing zu verbinden. So bestehen weiterhin die Möglichkeiten durch Großmengen günstige Preise zu erzielen, die Transaktionskosten zu senken und eine partnerschaftliche Beziehung zu den beiden Lieferanten aufzubauen. Zudem wird die hohe Lieferantenabhängigkeit reduziert. Hat ein Lieferant Lieferprobleme, ist es möglich auf den anderen Lieferanten umzusteigen. Auch ein gewisser Wettbewerb bleibt zwischen den Lieferanten bestehen.
Die Arealstrategien unterscheiden sich nach der räumlichen Ausdehnung der Beschaffungsaktivitäten. Die größte räumliche Ausdehnung hat das Global Sourcing. Die wachsende Globalisierung der Wirtschaft, fallende Handelsbeschränkungen und die Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnologien machen das Global Sourcing heutzutage auch für kleine und mittelständische Unternehmen interessant.
Der Begriff „Globalisierung“ wird in den Medien und in politischen Diskussionen meist auf Aspekte der Kostensenkung reduziert. Dies ist ein Hauptgrund, weshalb dieser Begriff negativ belegt ist. Auch Global Sourcing beschränkt sich nicht nur auf die Kostensituation. Trotzdem spielt die Kostensenkung häufig eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, den Inputbedarf auf dem Weltmarkt zu decken. In diesem Fall wird auch von Low CostCountry Sourcing gesprochen.9
Weiter gefasst ist das Best CostCountry Sourcing, das im Sinne eines Total-Cost-Ansatzes neben dem Bezugspreis fünf weitere Aspekte berücksichtigt. Diese Aspekte sind: Qualität, Koordinationsaufwand, Innovationskosten, Kundensensibilität und auch der Know-how-Schutz.10 Noch weiter geht das Best ValueCountry Sourcing. Es trägt auch ethischen Aspekten, der Flexibilität, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften und dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung.11
Die Vorteile des Global Sourcings liegen auf der Hand. Das eigene Unternehmen ist so in der Lage, die meisten Optionen zu nutzen, um den eigenen Bedarf optimal zu befriedigen, wobei hier nochmals darauf hingewiesen werden soll, dass optimale Bedarfsbefriedigung nicht mit der bloßen Kostenreduktion gleichzusetzen ist. Allerdings ergeben sich beim Global Sourcing auch eine Reihe von Nachteilen und Risiken. Beispielhaft seinen genannt: hoher Informationsbedarf und damit steigende Informationskosten, gesteigerter Koordinierungsaufwand, kulturelle Verständigungsprobleme, Rechtsunsicherheit (auch beim Schutz von geistigem Eigentum) und Währungsrisiken. Zudem ist Global Sourcing für eine Just-in-time-Produktion nicht geeignet.
Das Gegenteil zu Global Sourcing ist das Local Sourcing. Hier liegen die Beschaffungsquellen in räumlicher Nähe zum eigenen Unternehmen. Allerdings ist die Bezeichnung „in räumlicher Nähe“ nicht definiert, so dass mitunter recht unterschiedliche räumliche Beschaffungsformen als „Local Sourcing“ bezeichnet werden. Gemeint können eine Beschaffung in der unmittelbaren Nähe (bspw. in sog. Lieferantenparks), in der Region oder auf dem nationalen Heimatmarkt sein. Letztere Variante wird auch als Domestic Sourcing bezeichnet.12
Local Sourcing ist für eine JIT-Anlieferung und JIT-Produktion sehr gut geeignet, so dass schon die Art der Produktion die Art des Sourcing vorwegnehmen kann. Weitere Aspekte, die für diese Art der Beschaffung sprechen, sind Logistikkosten, die im Verhältnis zum reinen Materialwert sehr hoch sind, eine hohe Lieferantenflexibilität aufgrund von schlecht kalkulierbarem Bedarf, eine Risikoreduktion aufgrund von höherer Rechtssicherheit und der Wegfall von Währungsrisiken.13
Daneben spielen auch Imagegründe und Kundensensibilität eine Rolle. Ein Unternehmen, das mit der Herkunftsbezeichnung und dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ wirbt, setzt seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel, würde es Global Sourcing betreiben. Auch wegen Nachhaltigkeitsaspekten und aus ökologischen Gründen kann die Wahl bewusst auf Bezugsquellen in räumlicher Nähe fallen.14
Euro Sourcing ist eine Zwischenform von Global Sourcing und Local Sourcing. Der EU-Binnenmarkt stellt quasi eine Globalisierung im europäischen Rahmen dar, wobei die Integration der nationalen Märkte sehr weit fortgeschritten ist und die Rechtssicherheit im Vergleich zur Rechtsicherheit auf dem globalen Markt wesentlich höher ist. Im Euroraum ist zudem das Wechselkursrisiko ausgeschlossen. Die Optionen zur Bedarfsoptimierung sind im Vergleich zum Local Sourcing um ein Vielfaches höher.
Bezogen auf den Funktionsumfang der Lieferanten wird zwischen Unit, System und Modular Sourcing unterschieden. Unter Funktionsumfang wird die Wertschöpfungsleistung verstanden, die ein Unternehmen auf seine Lieferanten überträgt.15
Die Lieferanten im Unit Sourcing haben den geringsten Funktionsumfang. Sie liefern einfache Teile und Komponenten mit geringem Komplexitätsgrad. Meist handelt es sich hier um Standardprodukte. Somit haben diese Lieferanten nur geringe Differenzierungspotenziale und sind häufig Sublieferanten von System- oder Modullieferanten.16
Die Differenzierung zwischen Systemlieferant und Modullieferant ist in der Literatur nicht einheitlich. Die Begriffe Systeme und Module werden teilweise synonym verwendet, zum Teil werden Systeme als komplexer angesehen als Module, meist ist es aber genau entgegengesetzt. Im Folgenden werden Module als vormontierte, komplexe und einbaufertige Einheiten definiert. Beispiele für Module sind die Instrumententafel eines Autos und die Nasszellen beim Bau eines Hotels. Systeme bestehen hingegen aus mehreren Teilen. Sie sind häufig physisch zusammenhängend und oft vormontiert (bspw. Fahrradbremsen), stehen in einem funktional-logischen Zusammenhang (bspw. unterschiedliche Korrosionsschutzmittel) oder stellen eine Kombination aus physischen und funktionalen Zusammenhängen dar.17
Abbildung 1.9 Zulieferer unterschiedlicher Ränge
In den Produktionsprozess eines Original Equipment Manufacturer (= OEM18) sind die 1st-Tier-Lieferanten am tiefsten integriert vgl. Abbildung 1.9). Es wird hier von der verlängerten Werkbank gesprochen. Vorteile für den OEM sind die geringe Produktionstiefe und die Nutzung von Kompetenzen und des Know-hows der Modullieferanten. Nachteilig sind der hohe Koordinationsaufwand, das Risiko des Know-how-Transfers zum Lieferanten und die gegenseitige Abhängigkeit.19
Arbeitet ein OEM in der Regel mit relativ wenigen 1st-Tier-Lieferanten zusammen, erhöht sich die Zahl der Zulieferer in den folgenden Rangstufen deutlich. Als Ergebnis entwickeln sich ganze Lieferantennetzwerke (s. Abbildung 1.10). Bei den Lieferantennetzwerken übernahm die Automobilindustrie eine Pionierfunktion. In den 1990er-Jahren wurde die Zahl der direkten Zulieferer von 30.000 auf 8.000 reduziert.20
Abbildung 1.10 Struktur von Lieferantennetzwerken
Es sei darauf hingewiesen, dass die beschriebenenSourcing-Strategien zu einem gewissen Grad kombinierbar sind.Abbildung 1.11 stellt zwei unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten exemplarisch dar. So ist es denkbar, dass ein Unternehmen Multiple, Unit undEuro Sourcing zu einer Strategie für bestimmte Materialien zusammenführt.
Abbildung 1.11Kombinierte Outsourcing-Strategien
1.1.2 Bedarfsermittlung
Im vorherigen Kapitel standen die Sourcing-Strategien im Mittelpunkt der Betrachtung. Nun liegt der Fokus auf dem Aspekt der Bedarfsermittlung auf der Basis einer gegebenen Sourcing-Strategie. Die Bedarfsermittlung erfolgt nicht nur hinsichtlich quantitativer und qualitativer Gesichtspunkte der zu beschaffenden Inputfaktoren, Güter und Dienstleistungen, auch die Bedarfsterminierung ist von Belang.
Unproblematisch gestaltet sich die Bedarfsermittlung bei einem Unternehmen mit konstanten Ausbringungs- und Abverkaufsmengen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Versorgung just in time organisiert ist. Weichen die Gegebenheiten aber davon ab, sind zum Teil sehr umfangreiche Berechnungen nötig, um den Bedarf zu ermitteln und zu planen. Erfolgt die Fertigung nach dem Push-Prinzip, dies bedeutet, dass die Nachfrage vorausberechnet bzw. geschätzt wird, sind auch die Bedarfsermittlung und -planung von der Güte des angewandten Schätzverfahrens abhängig. Hier kann es durchaus zu einer Über- oder Unterversorgung des Unternehmens kommen.
Unabhängig davon ob der Bedarf exakt ermittelt oder geschätzt wird, der Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung ist der Primärbedarf. Unter dem Primärbedarf werden bei der Pull-Produktion die Kundenaufträge und bei der Push-Produktion die vorausberechneten Absatzmengen verstanden. Dieser Primärbedarf wird in Sekundärbedarf, das ist der abgeleitete Bedarf an Rohstoffen, Zulieferteilen, Zwischenprodukten etc., und in Tertiärbedarf, das ist der abgeleitete Bedarf an Hilfs- und Betriebsstoffen, umgerechnet. Zudem wird noch zwischen dem Bruttobedarf und dem Nettobedarf differenziert. Der Bruttobedarf stellt den Gesamtbedarf dar, der nötig ist, um den Primärbedarf zu decken. Dagegen ist der Nettobedarf der Bedarf, der tatsächlich noch bei den Lieferanten beschafft werden muss. Lagerbestände, aber auch auf dem Weg befindliche Lieferungen werden in die Nettobetrachtung mit einbezogen.
Ferner wird die Bedarfsplanung in die laufende Bedarfsplanung und die Planung des Bedarfssortiments unterteilt (vgl. Abbildung 1.12). Dabei ist die Planung des Bedarfssortiments längerfristig angelegt. Sie kann sich unter dem Gesichtspunkt gegebener Produktionsverfahren auf die generelle Ausgestaltung des Bedarfs nach Qualität und Quantität beziehen, wobei vom konkreten, aktuellen Geschehen im Unternehmen abstrahiert wird. Die Bedarfssortimentsplanung kann sich aber auch mit der Frage auseinandersetzen, wie sich das Bedarfssortiment verändert, wenn auf andere Produktionsverfahren umgestellt wird bzw. weitere Produktionsverfahren eingeführt werden.
Die Bedarfssortimentsplanung schafft somit den Rahmen für die laufende Bedarfsplanung. Hier wird die laufende, konkrete Bedarfsermittlung nach quantitativen, qualitativen und zeitlichen Gesichtspunkten übernommen.
Abbildung 1.12Bedarfsermittlung und -planung
1.1.2.1 Bedarfssortimentsplanung und Bedarfsrationalisierung
Ausgangspunkt der Überlegungen sind die Abnehmergruppen, die ein Unternehmen bedient. Ziel ist es, jene Inputfaktoren zu beschaffen, mit denen einerseits die Bedürfnisse dieser Abnehmer befriedigt werden können, andererseits soll die Beschaffung kostengünstig sein und auch den Gegebenheiten im Unternehmen Rechnung tragen. Somit umfasst die Bedarfssortimentsplanung sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat sich eine Reihe von Instrumenten herausgebildet, die im Folgenden näher erläutert werden (s. Abbildung 1.13).
Abbildung 1.13Bedarfssortimentsplanung
1.1.2.1.1Konstruktion undBedarfsstandardisierung
Bei der Konstruktion wird ein Produkt eines Unternehmens designt. Dabei fließen gesetzliche Vorgaben, Kundenwünsche, technische Vorgaben, finanzielle Aspekte, Gesichtspunkte bzgl. Lagerung und Logistik etc. mit ein. Die Konstruktion beinhaltet das größte Potenzial, Inputfaktoren effizient und kostengünstig einzusetzen.
Neben den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen an ein Produkt werden auch ökologische Gesichtspunkte immer wichtiger und werden bereits bei der Konstruktion aufgenommen. Sie beziehen sich auf die Produktionsweise, auf die eingesetzten Materialien sowie auf die spätere Recycelbarkeit des Produkts. Der gesellschaftliche ökologische Megatrend zwingt die Hersteller geradezu, nachhaltig und ressourcenschonend zu produzieren. Aber auch der Gesetzgeber wird hier aktiv. So wurde mit der Richtlinie über Altfahrzeuge (2000/53/EG) vom 18. September 2000 die Grundlage für EU-einheitliche Bedingungen zur Verwertung von Altfahrzeugen geschaffen. Diese Richtlinie verpflichtete die Automobilhersteller bspw. zum Aufbau von Systemen zur Rücknahme, Behandlung und Verwertung von Altfahrzeugen.
Die Nutzung von Standards hilft, die wirtschaftlichen Potenziale, die sich schon bei der Konstruktion ergeben, auszuschöpfen. Standardisierung bedeutet, die Vielfalt von Möglichkeiten zu reduzieren und zu strukturieren. Es werden Normen und Typen geschaffen, wobei sich die Normung auf den Produktionsbereich bezieht, während die Typung die Standardisierung von Fertigprodukten beinhaltet (vgl. Abbildung 1.14). Sowohl durch die Normung als auch durch die Typung konnten in der Wirtschaft erhebliche Einsparungspotentiale erschlossen werden.
Abbildung 1.14 Ausprägungen der Standardisierung
Neben ihren positiven Effekten auf die Konstruktion hat die Normung positiven Einfluss auf die Beschaffung, die Lagerhaltung und die Materialdistribution:
•Die Beschaffung wird vereinfacht, beschleunigt und vergünstigt.
•Materialeingang und Lagerhaltung können, da die Eigenschaften der Materialien genau bekannt sind, effizienter ausgestaltet werden.
•Die unternehmensübergreifende und die innerbetriebliche Materialdistribution werden erleichtert und verbilligt.
Die in einem Unternehmen verwendeten Normen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Geltungsbereiche. Grundsätzlich werden die Geltungsbereiche wie in Abbildung 1.15 dargestellt unterschieden.
Abbildung 1.15 Verschiedene Geltungsbereiche von Normen
Quelle: In Anlehnung an Oeldorf und Olfert 2008, S. 92
Internationale Normen dienen dazu, den globalisierten Handel zu erleichtern. Die bedeutendste Institution, die sich mit diesem Anliegen befasst, ist die International Organization for Standardization (ISO). Die ISO hat ihren Ursprung im Jahre 1946, als sich Delegierte aus 25 Staaten in London trafen, um eine Institution zu gründen, die die internationale Vereinheitlichung industrieller Standards koordinieren sollte. Am 23. Februar 1947 nahm die ISO ihre Tätigkeit auf. Ihren Sitz hat sie in Genf. 1951 trat Deutschland der ISO bei. Vertreten wird Deutschland durch das Deutsche Institut für Normung (DIN). Ausführliche Informationen zur ISO können unter http://www.iso.org abgerufen werden.
Die europäische Norm (EN) wird gleich von drei Institutionen vergeben. Diese drei Institutionen sind das Europäische Komitee für Normung (CEN), das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) und das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI), wobei das CEN das größte dieser drei Organisationen ist. Stand Juli 2014 sind 33 europäische Staaten Mitglied im CEN. Das CEN trat 1991 seinerseits der ISO bei. Mehr Informationen zur EN sind unter http://www.cen.eu erhältlich (s. auch Abbildung 1.16).
Die wirtschaftliche Bedeutung von Normen wurde in Deutschland schon früh erkannt, noch während des Ersten Weltkriegs wurde am 22. Dezember 1917 in Berlin der Normenausschuss der deutschen Industrie (NADI) ins Leben gerufen. 1926 wurde der Name in Deutscher Normenausschuss (DNA) und im Mai 1975 in DINDeutsches Institut für Normunge.V. geändert. Die Organisation wird seitdem in der Rechtsform eines privaten, gemeinnützigen Vereins geführt. Stand Juli 2014 hat das DIN 1.978 Mitglieder, wobei Fachverbände, Unternehmen und Einzelpersonen Vereinsmitglied werden können. Weitere Informationen zum DIN sind unter http://www.din.de abrufbar.
Die wohl bekannteste Norm ist sicherlich die DIN-Norm 476 für Papierformate, aber auch die DIN 15 146 hat unter ihrer Bezeichnung Europalette einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Die DIN-Norm DIN 820 ist eine Norm zur Erstellung von Normen. Diese Norm formuliert Grundsätze, die bei der Normenarbeit beachtet werden müssen. Dabei werden auch unterschiedliche Arten von Normen unterschieden. Die DIN 820 differenziert Normen nach ihrem Inhalt (Abmessungsnormen, Liefernormen, Verhaltensnormen etc.), ihrer Reichweite (Grund- und Fachnormen) und ihrem Grad (Normenbreite, -tiefe und -umfang).
Die reinen DIN-Bezeichnungen werden wegen der zunehmenden internationalen Verflechtung der nationalen Märkte und dem globalen Handel zunehmend durch DIN EN ISO ersetzt. So wurde in Deutschland für eine lange Zeit die DIN 1904 zur Klassifizierung der Lichtempfindlichkeit von Filmen benutzt. In den USA galt hingegen eine Norm der American Standards Association (ASA). Beide Standards benutzten zur Klassifikation allerdings vollkommen unterschiedliche Skalen. In Deutschland wurde ein Film, der eine Lichtempfindlichkeit nach der DIN 1904 von 21 aufwies, der Einfachheit halber mit der Kennzeichnung ‚21 DIN‘ versehen. Ein Film mit der Kennzeichnung ‚24 DIN‘ war entsprechend lichtempfindlicher. In den USA wären diese Filme mit ‚ASA 100‘ (beim 21-DIN-Film) und mit ‚ASA 200‘ (beim 24-DIN-Film) gekennzeichnet worden. Heute sind beide in eine ISO überführt worden. So steht die ISO 200/24° für einen Film, der eine Lichtempfindlichkeit von 24 nach der DIN 1904 und von 200 nach der entsprechenden US-amerikanischen Norm aufweist.
Abbildung 1.16 Internationale und nationale Normen
Der Verband Deutscher Ingenieure (VDI), der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) und der Verband der Automobilindustrie (VDA) haben jeweils verbandseigene Normen entwickelt. Auch bei Privatpersonen weithin bekannt ist das VDE-Prüfsiegel. Der hohe Bekanntheitsgrad des Prüfsiegels und das hohe Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, führen dazu, dass die VDE-Normen für die Hersteller de facto bindend sind. Um die Normung und die Normengebung im Elektrotechnikbereich deutschlandweit zu vereinheitlichen, gründeten der VDE und das DIN die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE). Die von der DKE erarbeiteten Normen tragen die Bezeichnung DIN-VDE. VDE und VDI unterhalten zudem eine Vielzahl von gemeinsamen Arbeitsgruppen. Ein Praxisbeispiel unterschiedlicher und kombinierter Normen ist in Abbildung 1.17 zu sehen.
Abbildung 1.17 Unterschiedliche und kombinierte Normen
Mit freundlicher Genehmigung der NYROSTEN Korrosionsschutzmittel GmbH + Co.
Die Werksnormen werden in abgeleitete und ursprüngliche unterteilt. Bei den abgeleiteten Werksnormen werden internationale, nationale oder verbandseigene Normen an die speziellen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst. Solchen adaptierten Normen stehen die ursprünglichen Werksnormen gegenüber. Sie sind in einem Unternehmen eigens entwickelt worden. Die Gründe hierfür können vielfältiger Art sein. Beispielsweise könnte es sein, dass es für bestimmte Bereiche (noch) keine allgemeineren Normen gibt, dass die bestehenden, allgemeinen Normen für ein Unternehmen nicht zweckdienlich sind oder, dass aus Marketinggründen bewusst von einer Norm abgewichen wird. Letzteres ist etwa bei der Apple Inc. der Fall, die anstelle des MP3-Formats für Musikdateien das eigene M4P-Format nutzt.
Bezieht sich die Normung auf Einzelteile, die verbaut werden, so stellt die Typung die Standardisierung des Angebotsprogramms dar. Die Straffung des Angebotsprogramms kann wie die Normung von Einzelteilen zu enormen Kosteneinsparungen führen. Dabei wird zwischen innerbetrieblichen und überbetrieblichen Typen differenziert. Heutzutage sehen sich die Produzenten mit dem Kundenwunsch der individuellen Bedürfnisbefriedigung konfrontiert. Die Kundenwünsche stehen somit konträr zu dem Bestreben der Unternehmen, standardisierte Produkte anzubieten. Um den Kundenwünschen entsprechen zu können und trotzdem Kostendegressionseffekte zu realisieren, wurden in vielen Bereichen sog. Baukastensysteme entwickelt.
Ein sehr bekanntes Beispiel für ein Baukastensystem ist die Plattform PQ35/A5 von Volkswagen. Ziel war es, eine Stückkostendegression über mehrere Modelle verschiedener Konzernmarken zu generieren. Folgende PKW basierten auf dieser Plattform: VW Golf (fünfte Generation), VW Jetta (fünfte Generation), Audi A3 (zweite Generation), Škoda Octavia (zweite Generation), Seat León (zweite Generation), Seat Toledo (dritte Generation) und Seat Altea. Derartige Baukastensysteme werden heutzutage von allen Automobilkonzernen, die Massenhersteller sind, verwendet.21 Das Baukastensystem, das 2014 vom VW-Konzern genutzt wird, heißt MQK (Modularer Querbaukasten). Zur gleichen Zeit setzt Toyota das TNGA-System (Toyota New Global Architecture) ein. Die Plattform TNGA-C wird bspw. sowohl bei Toyota-Modellen Corolla, Prius und Auris als auch beim Lexus CT 200h verbaut.
Dieser Ansatz wurde zum sog. „Komponenten-Sharing“ weiterentwickelt, das konzernübergreifend praktiziert wird. Dies ist bei der Kooperation zwischen Toyota und dem PSA-Konzern der Fall. Diese beiden Automobilkonzerne gründeten 2002 ein Gemeinschaftsunternehmen, das in Kolín (Tschechien) die baugleichen Kleinwagen Toyota Aygo, Peugeot 107 und Citroën C1 produzierte.22 Ab Sommer 2014 läuft in Kolín die zweite Generation der technischen Drillinge vom Band, wobei der Toyota und der Citroën ihre Bezeichnungen beibehielten, während das Peugeot-Modell nun Peugeot 108 heißt.
Die großen Rückrufaktionen von Toyota in den Jahren 2009 und 2010 wegen ungewollter Beschleunigung bzw. wegen klemmender Gaspedale zeigen die Gefahren solcher Rationalisierungen durch Typung und Normung zur Kostenreduzierung auf. Da das Gaspedal, das ein fehlerhaftes Teil des US-amerikanischen Zulieferers CTS enthielt, in mehrere Modelle verbaut worden war, waren eine Vielzahl von PKW von dem Problem potenziell klemmender Gaspedale betroffen. Insgesamt musste Toyota bis zu 9,5 Millionen Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus zurückrufen. Zudem ruhte in den USA zeitweise die Produktion.23
Passat bringt VW auf Sparkurs voran
Von Guido Reinking, Hamburg
17.02.05
Autohersteller vermeidet Entwicklungskosten in Höhe von 100 Mio. Euro • Vorstandschef Pischetsrieder bleibt Absatzprognose schuldig
Volkswagen hat bei der Entwicklung des neuen Passat einen dreistelligen Millionenbetrag eingespart. „Hätten wir das Modell wie den Vorgänger entwickelt“, sagte VW-Vorstandschef Bernd Pischetsrieder am Rande der Passat-Präsentation der FTD, „wären die Entwicklungskosten um zehn Prozent höher gewesen.“ Während der alte Passat auf teurer Audi-Technik basiert, verwendet der Nachfolger zahlreiche Bauteile, die bereits für den kleineren Golf entwickelt wurden – zum Beispiel dessen Hinterachse.
Da die Entwicklungskosten für ein neues Auto gemeinhin im Bereich von 1 Mrd. Euro liegen, hat VW allein dadurch rund 100 Mio. Euro eingespart. Der Passat, nach dem Golf zweitwichtigstes Modell für VW, bringt das Unternehmen auf seinem Sparkurs einen großen Schritt weiter. Weil Komponenten wie Elektronik, Motoren und Getriebe ebenfalls größtenteils vom Golf der fünften Generation stammen, intern PQ35 genannt, spart VW zudem im Einkauf. „Wir bauen auf der PQ35-Plattform drei Millionen Autos im Jahr“, sagte Pischetsrieder. Ein Volumen, das nun auch dem Passat hilft, von dem in Spitzenzeiten in Europa knapp 500 000 Stück produziert wurden.
Ob der neue Passat diese Stückzahlen jemals erreichen wird, ist eher unwahrscheinlich. „Wir nennen keine Absatzziele mehr“, sagte ein VW-Sprecher. Aus guten Grund: Beim Golf V hatte VW noch ein Ziel von 600 000 Stück pro Jahr genannt und verfehlt.
VW hat dem nun deutlich dynamischer wirkenden Passat zwar mehr Platz und Ausstattung mitgegeben. Auch der Einstiegspreis bleibt mit 21 800 Euro unverändert. Dennoch dürfte es das Auto schwer haben, an die Erfolge der Vorgänger anzuknüpfen. Denn das Segment, in dem der Passat gegen Konkurrenten von Opel, Ford und Toyota um Kunden kämpft, schrumpft seit Jahren: Gehörten 1993 in Westeuropa noch 32,5 Prozent aller Neuwagen zur oberen Mittelklasse, waren es zehn Jahre später nur noch 13,7 Prozent. Wurden in der Passat-Klasse hier einmal 3,6 Millionen Autos im Jahr verkauft, sind es nun keine zwei Millionen mehr.
Ein Grund: Immer mehr Kunden, die für Familie oder Geschäft den Platz eines Mittelklasse-Autos brauchen, greifen auf Kompaktvans wie VW Touran oder Großraumlimousinen wie Renault Espace zurück. Zwischen diesen Segmenten wird die klassische Mittelklasse-Limousine aufgerieben. Ein Phänomen, das schon Opel mit dem Vectra erleben musste. Der Absatz der jüngsten Generation des Passat-Konkurrenten aus Rüsselsheim blieb 40 Prozent hinter den Erwartungen zurück.
„Ich bin zuversichtlich, die Produktionskapazitäten in Emden und Mosel auslasten zu können“, sagte VW-Personalvorstand Peter Hartz. Das musser auch, denn ein Personalabbau, wie ihn Opel wegen der schwachen Vectra-Nachfrage in Rüsselsheim vornimmt, geht bei VW nicht. Hartz hat der Belegschaft mit dem neuen Tarifvertrag eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2011 gegeben. Vorteil für VW: Durch die Verwendung der Golf-Teile kann der Passat auch in geringeren Stückzahlen profitabel gebaut werden. Er sei sogar deutlich profitabler als das Vorgängermodell, hieß es bei VW.
Zudem kommt der Konzern mit seinem Einsparungsprogramm „Formotion“ schneller voran als erwartet: Eigentlich wollte Volkswagen bis Ende dieses Jahres dadurch den Ertrag um rund 4 Mrd. Euro steigern. Weil 2004 jedoch bereits 1,6 Mrd. Euro eingefahren wurden, 600 Mio. Euro mehr als geplant, wird das Ziel voraussichtlich übererfüllt. „2005 soll Formotion nochmals 3,1 Mrd. Euro bringen“, sagte VW-Finanzchef Hans Dieter Pötsch. Damit hätte das Programm am Ende 4,7 Mrd. Euro eingespart. Pötsch kündigte an, den Sparkurs 2006 mit einem neuen Programm fortzusetzen: „Langfristig wollen wir eine Unternehmenskultur, in der jeder Manager das Sparen verinnerlicht hat.“ Sparprogramme würden dann überflüssig.
Quelle: Reinking 2005, S. 8
1.1.2.1.2Nummerung
Die Namen der zu beschaffenden Faktoren sind nicht immer eindeutig. Auf der einen Seite führt ein Zulieferer für sein Angebot eigene Bezeichnungen, so dass derselbe Inputfaktor bei unterschiedlichen Lieferanten unterschiedlich benannt wird. Auf der anderen Seite kommt es aber auch vor, dass die gleiche Bezeichnung für unterschiedliche Inputfaktoren verwandt wird, so dass Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden können. Um die Unzulänglichkeiten dieser Namen und Bezeichnungen zu vermeiden, kreieren Unternehmen Nummernsysteme.
Der Begriff der Nummerung umfasst das Entwickeln, Zuteilen, Führen, Pflegen, Handhaben und Managen von Nummern und Nummernsystemen. Die primäre Aufgabe der Nummerung innerhalb der Beschaffung ist es, Inputfaktoren eindeutig identifizierbar zu machen. Eindeutig zugewiesene Nummern sind sog. „Identnummern“. Die Aufgabe, ein solches Nummernsystem zu konzipieren, erscheint zunächst als trivial. In der Praxis gestaltet sich dies aber als sehr komplex, was an der Vielzahl von unterschiedlichen Inputfaktoren, die für die Beschaffung exakt bestimmbar sein müssen, liegt. In der Regel soll neben der reinen Identifizierung zudem eine Klassifizierung des Inputs nach bestimmten Merkmalen möglich sein.
Ein klassifizierendes Nummernsystem erleichtert den beteiligten Mitarbeitern den täglichen Umgang mit den Inputfaktoren, bietet darüber hinaus aber auch weitere Vorteile etwa bei der Bereinigung und Straffung des Beschaffungssortiments. Eine simple Durchnummerierung des Inputs erlaubt zwar eine zweifelsfreie Identifizierbarkeit, läuft dem Bestreben nach einer Klassifizierung aber zuwider.
Ein klassifizierendes Nummernsystem, so wie es in Abbildung 1.18 vorgegeben ist, ermöglicht einem Unternehmen eine Vielzahl von Analysen durchzuführen. Das jeweilige System muss dabei an den speziellen Anforderungen der Unternehmung ausgerichtet werden. Eine Blaupause im Sinne eines „one fits all“ kann es daher nicht geben. Die vergebenen Nummern können, so wie im Beispiel dargestellt, nur aus Ziffern gebildet werden (= numerischeNummerung), Kombinationen aus Ziffern und Buchstaben sind auch möglich (= alphanumerischeNummerung).
Abbildung 1.18 Beispiel einer klassifizierenden Nummerung
Eine Spielart der alphanumerischen Nummerung sind Systeme mit sog. „sprechenden Nummern“. Sprechende Schlüssel enthalten mindestens eine verständliche Information. Die Fontys International Business School in Venlo benutzt einen solchen Schlüssel, um Unterrichtseinheiten und die entsprechenden Klausuren zu klassifizieren. So steht die Bezeichnung „P05MD14-A“ für folgende Klausur:
Sehr komplexe Nummernsysteme bergen auch immer die Gefahr, dass eine Nummer falsch erfasst wird. Eingabefehler, manuelle und maschinelle Lesefehler führen zu falschen Objektdaten und entsprechenden Folgefehlern, wie Fehlmengen und Überbeständen. Prüfziffern, die den Nummern angehängt werden, helfen, die genannten Fehler zu vermeiden. Prüfziffern werden in der Literatur als „Modulo“ bezeichnet. Die Modulo-11-Verfahren sind in der Praxis weit verbreitet, um eine Prüfziffer zu kreieren.
Ein Beispiel für eine Prüfziffer, die mittels eines Modulo-11-Verfahrens vergeben wurde, sind die alten zehnstelligen ISBN (vgl. Abbildung 1.19).
Abbildung 1.19 Vergabe einer zehnstelligen ISBN
Zunächst werden die ersten 9 Ziffern vergeben und im Anschluss die Prüfziffer ermittelt. Im vorangegangenen Beispiel sind die ersten neun Ziffern 382882565. Diesen Ziffern wird ein Gewichtungsfaktor zugewiesen. Die linke Ziffer erhält den Gewichtungsfaktor 1, die zweite den Gewichtungsfaktor 2, die dritte den Gewichtungsfaktor 3 usw. Danach wird jede Ziffer mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert. Werden die Produkte aus Ziffer und Gewichtungsfaktor addiert, ergibt sich der Wert 237. Zu der Zahl 237 wird nun der zehnfache Wert einer Prüfziffer addiert, so dass das Resultat glatt durch elf teilbar ist. Im obigen Fall ist dies die Prüfziffer 6, da gilt: