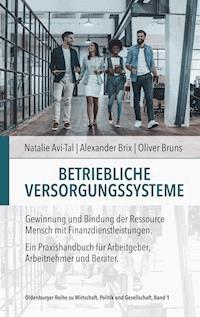
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Wo vor Jahren noch die Unternehmen Auswahlverfahren anstrengten um aus der großen Masse an Bewerberinnen und Bewerbern auszuwählen, da sind es heute die Mitarbeiter, die sich die Stellen aussuchen können. Der Mensch ist zu einer wertvollen Ressource geworden. Und längst lassen sich Unternehmen etwas einfallen, um gute Leute zu finden und zu binden. Wie kann die Finanzdienstleistung dabei helfen? Nun, ganz einfach: mit System. Mit "Betriebliche Versorgungssysteme" legen Natalie Avi-Tal, Alexander Brix und Oliver Bruns, allesamt Praktiker mit jahrelanger Erfahrung in der Finanzdienstleistung, ein Praxishandbuch vor. Sie beschreiben nicht nur die Rahmenbedingungen für Unternehmen, sondern erläutern, was alles geht und vor allem, worauf zu achten ist. Dabei wird der Schwerpunkt auf die betriebliche Altersvorsorge und die betriebliche Krankenversicherung gelegt, aber auch viele weitere Aspekte benannt. Ein Praxishandbuch für jeden Arbeitgeber, Arbeitnehmer und jeden Berater.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil 1: Vorüberlegungen
01 Notwendigkeit ergänzender Altersvorsorge
02 Notwendigkeit ergänzender Gesundheitsvorsorge
03 Ausgangssituation demographischer Wandel
04 Generation Y
05 Fluktuation
06 Präsentismus und Absentismus
07 Mitarbeiterleistung und Motivation
08 Mitarbeiterbindung
Teil 2: Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
09 Definition, Historie und grundsätzlicher Aufbau
10 Die 5 Durchführungswege und ihre Produkte
11 Vorteile für Arbeitgeber und Personalmanager
12 Vorteile für Arbeitnehmer und Betriebsrat
13 Vorteile für den Berater
14 Arbeitsrecht und bAV
15 Steuerrecht und bAV
16 Lohnbuchhaltung und bAV
17 Private Altersvorsorge und bAV
18 Biometrie und bAV
19 Veränderungen in Elternzeit und Mutterschutz
20 Veränderungen bei Arbeitsunfähigkeit
21 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
22 Versorgung von Familienangehörigen
23 Workflow
24 CTA-Modelle
Teil 3: Betriebliche Krankenversicherung (bKV)
25 Grundsätzlicher Aufbau
26 Produkte
27 Vorteile für Arbeitgeber und Personaler
28 Vorteile für Arbeitnehmer und Betriebsräte
29 Vorteile für den Berater
30 Arbeitsrecht und bKV
31 Steuerrecht und bKV
32 Lohnbuchhaltung und bKV
33 Private Krankenversicherung und bKV
34 Betriebliches Gesundheitsmanagment und bKV
35 Veränderung in Elternzeit und Mutterschutz
36 Veränderung bei Arbeitsunfähigkeit
37 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
38 Versorgung von Familienangehörigen
39 Workflow
Teil 4: Satelliten
40 Betriebliche Versorgungssysteme in der Praxis
Anhang
Literaturverzeichnis
Die Autoren
Hinweis: in diesem Buch, insbesondere in den Kapiteln 14, 15, 30 und 31 werden allgemeine steuerliche und rechtliche Aussagen getroffen. Diese stellen keine Steuer- und/oder Rechtsberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Beratung. Bitte ziehen Sie in Ihrem speziellen Fall als Privatperson und/oder Unternehmen einen Steuer- und/oder Rechtsberater Ihres Vertrauens hinzu.
Vorwort
„Wir suchen Mitarbeiter!“
Wer mit offenen Augen durch seine Stadt oder Gemeinde geht, der wird diesen Hilferuf zunehmend wahrnehmen. Auf Dienstfahrzeugen und Lastern. Auf Plakatwänden oder Bussen. Der Arbeitsmarkt hat sich radikal gewandelt und wird es weiter tun. Die Zeiten, wo sich Unternehmen die neuen Kollegen aus einer Unmenge von Bewerbern aussuchen konnten, sind in vielen Branchen vorbei. Eine Folge des demographischen Wandels.
Die Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem Spiel. Unternehmen müssen sich etwas einfallen lassen, um im Kampf um die Ressource Mensch die Nase vorn zu haben.
Selbstverständlich spielt auch in Zukunft die Qualifikation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine große Rolle. Aber Unternehmen müssen sich fragen: Was ist meine Story als Arbeitgeber? Warum sollten Bewerber bei mir anfangen und nicht bei der Konkurrenz? Was biete ich, um meine (guten) Leute zu halten? Welchen Beitrag die Finanzdienstleistung leisten kann um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, damit beschäftigt sich das vorliegende Buch.
Es heißt Praxishandbuch, weil es sich auf die wesentlichen Zusammenhänge beschränkt und sich am Alltag der am Prozess der Betrieblichen Versorgungssysteme Beteiligten orientiert. Es will ganz bewusst nicht mit vertiefender Fachliteratur konkurrieren. Und so halten die Autoren stets alle Zielgruppen im Auge: den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer und auch Berater.
Im ersten Teil werden grundlegende Fragen, Voraussetzungen und Zusammenhänge erläutert, die zu den folgenden Teilen hinführen.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Dabei handelt es sich um deutlich mehr als nur eine Pflichtübung. Und es gilt eine Menge Details zu beachten. Die wichtigsten werden angesprochen und erläutert. Auch außergewöhnliche Details kommen zu Wort. Der dritte Teil hat die Betriebliche Krankenversicherung (bKV) zum Thema. Ein Bereich, der bisher nur Experten bekannt war und somit eine ganze Reihe Chancen bietet, sich abzusetzen und etwas Besonderes zu bieten. Parallelen bei der Kapiteleinteilung sind erwünscht um das vergleichende Lesen der einzelnen Abschnitte zum vorangegangenen Teil der bAV zu erleichtern.
Der vierte Teil beschäftigt sich mit den Satelliten rund um die beiden vorgenannten Themen, die aus einzelnen Produktwelten letztlich ein System machen. Ein angehängtes Literaturverzeichnis bietet für den interessierten Leser, der das eine oder andere Thema vertiefen möchte, wertvolle Hinweise.
Mein Dank gilt Natalie Avi-Tal und Alexander Brix. Sie haben nicht nur ihre jahrelangen Praxiserfahrungen eingebracht, sondern sich das Projekt von Beginn zu Eigen gemacht.
Dieses Buch „Betriebliche Versorgungssysteme“ ist Band 1 in der „Oldenburger Reihe zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“.
Oldenburg (Oldb.) im September 2018
Oliver Bruns
Herausgeber
Teil 1: Vorüberlegungen
01 Notwendigkeit ergänzender Altersvorsorge
In der Bundesrepublik Deutschland sorgt ein umfangreiches Sozialsystem für die Absicherung der Bürger. Sowohl bei verschiedenen Wechselfällen des Lebens als auch bei der Altersversorgung. Allerdings kommen die Leistungen der Sozialversicherungen über eine Absicherung des Notwendigen nicht hinaus.
In der gesetzlichen Rente spielt vor allem die Bevölkerungsentwicklung eine große Rolle. Sie wurde 1957 nach dem Umlageverfahren eingeführt.1 Der junge, arbeitende Teil der Bevölkerung brachte zusammen mit dem Arbeitgeber die Beiträge auf, die auf die Leistungsempfänger der Altersrente, sowie der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente umgelegt wurden. Der Vorteil war, dass der Staat sofort Geld hatte, um Renten auszuzahlen und selbst keine Kapitalbildung betreiben musste. Der viel zitierte Satz vom ehemaligen Bundesminister Norbert Blüm „Die Renten sind sicher“ zielt auf dieses System. Solange volkswirtschaftlich etwas erwirtschaftet wird, Löhne gezahlt und damit eine Beitragszahlung erfolgt, können auch Renten gezahlt werden. Allerdings hat sich Norbert Blüm auch nicht zur Höhe der Renten geäußert.
Das Umlagesystem würde begünstigt, wenn sich jede Generation „reproduziert“, also in etwa so viele Nachkommen zur Welt und später in Lohn und Brot bringt, wie die davor. Nur ist das nicht geschehen. Während in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in beiden deutschen Staaten noch regelmäßig deutlich über eine Million Kinder zur Welt kamen, sank die Zahl zwischenzeitlich auf unter 700.000 um sich inzwischen wieder leicht zu erholen. 2016 kamen etwas über 790.000 Kinder in der Bundesrepublik zur Welt. Die Gründe sind vielfältig. Auf alle Fälle bedeutet dieser Umstand, dass sukzessive den Rentenempfängern zu wenig Beitragszahler gegenüberstehen. Die jetzt älter werdende Generation hat, mit einem Augenzwinkern formuliert, nicht ganz ihre Pflicht erfüllt, was das Umlageverfahren angeht. Es hätte mehr Kinder gebraucht. Nämlich 21 Nachkommen auf zehn Männer, beziehungsweise zehn Frauen. Derzeit liegt die Rate bei etwa 1,4 pro Paar. Deutschland schrumpft.
Eine zweite für die Rente gewichtige Entwicklung ist die gestiegene Lebenserwartung. Dadurch hat sich die Zahl der Rentenbezugsjahre erhöht. Lag die Rentenbezugsdauer 1960 in den alten Ländern bei rund 10 Jahren,2 so stieg sie auf rund 20 Jahre im Jahr 2015.3 Tendenz steigend. Zusammengefasst: weniger Beitragszahler sollen viele Rentenempfänger finanzieren, die dann auch noch doppelt so lange Rente brauchen werden wie früher. Um einen weiteren Anstieg der Beitragssätze zu verhindern oder diese wenigstens zu drosseln, wurde unter anderem das Rentenniveau gesenkt. Wer 2030 als sogenannter „Eck-Rentner“ mit 45 Beitragsjahren in Rente geht, kann mit 44,3% netto vor Steuern seines letzten Gehalts rechnen.4
Dieser Umstand führt dazu, dass jeder Arbeitnehmer notwendigerweise ergänzende Altersvorsorge betreiben muss. Neben den zahlreichen privaten Möglichkeiten nimmt die betriebliche Altersvorsorge in dieser Frage einen großen Raum ein. Insbesondere deswegen, weil sie vom Gesetzgeber in besonderer Weise gefördert wird. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Lösungen anzubieten. Er kann über die Pflicht hinaus weitere Angebote machen. Beide Parteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, können in der Ansparzeit Steuern und Sozialabgaben sparen.
02 Notwendigkeit ergänzender Gesundheitsversorgung
Das deutsche Gesundheitssystem besteht aus der gesetzlichen Kasse (GKV), bei der rund 90% der Bevölkerung versichert sind, und privater Versicherung (PKV), bei der die restlichen 10% Schutz genießen. Während sich Mitglieder der PKV vor Vertragsabschluss aus einer ganzen Reihe von Angeboten ihre Leistungen aussuchen können, ist der Leistungsumfang der GKV im Wesentlichen gesetzlich vorgeschrieben - und zwar im Sozialgesetzbuch V. Darüber hinaus steht es den Kassen frei weitere, ergänzende Leistungen über ihre Satzung anzubieten. Die GKV erhebt dabei den Anspruch einen umfassenden Leistungskatalog anzubieten. Während aber der PKV-Kunde einen privatrechtlichen Vertrag mit einem lebenslangen Leistungsversprechen erhält, muss der GKV-Versicherte damit leben, dass Leistungen von der Politik gestrichen werden können. Das Sozialgesetzbuch V ist, wie der Name schon sagt, ein Gesetzbuch. Und selbiges kann durch entsprechende Mehrheiten im Deutschen Bundestag geändert werden. In der Vergangenheit hat es von der solche Korrekturen bereits des Öfteren gegeben. Es gibt keinerlei Garantien für das Leistungspaket. Der Kostendruck, der auch unter dem demographischen Wandel leidenden Gesundheitsversorgung hat dazu beigetragen. Auch für die Zukunft kann von weiteren Kürzungen ausgegangen werden. Bekannteste Leistungslücken sind zum Beispiel
keine Zuschüsse für Sehhilfen (außer Sehbehinderte)
höhere Eigenbeteiligungen beim Zahnersatz durch Festzuschüsse,
Kürzungen beim Krankentagegeld,
begrenzte Vorsorgeuntersuchungen,
Eigenbeteiligung bei abweichender Krankenhauswahl
Selbstbeteiligung bei Medikamenten, Anwendungen, etc.
und dergleichen mehr. Wenn also ein Patient auf genau diese Leistungen angewiesen ist, dann muss er die Kosten aus eigener Tasche bestreiten. Außerdem unterliegen die Leistungen der GKV sämtlich dem Wirtschaftlichkeitsgebot.5 Demnach müssen „die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.“
Wer das nicht kann oder will, interessiert sich für private Zusatzversicherungen. Laut PKV-Verband gab es 2017 bereits über 25 Millionen Zusatzpolicen. Solche Einzelverträge, insbesondere die mit umfangreicheren Leistungen, wie zum Beispiel Krankenhaus-Tarife oder hochwertige Zahnersatzpolicen, bedürfen immer einer Gesundheitsprüfung. Zu diesem Zweck haben der Antragsteller/die Antragstellerin entsprechende Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Der Versicherung steht es frei, in Kenntnis der Antworten, Zuschläge zu verlangen, Leistungsausschlüsse zu formulieren oder einen Antrag sogar komplett abzulehnen. Es steht also zu vermuten, dass es eine ganze Reihe von Interessenten gibt, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Disposition nicht in den Genuss ergänzender Krankenversicherungen kommen, obwohl sie es gerne wollten. Später werden wir sehen, dass betriebliche Lösungen diesen Punkt aufgreifen. Denn sie funktionieren weitestgehend ohne Gesundheitsprüfung.
03 Ausgangssituation demographischer Wandel6
Es dürfte einer der am meisten strapaziertesten Termini der letzten Jahre sein: der demographische Wandel. Doch was steckt hinter dem Begriff? Und war bedeutet er für unser Thema? Im Einzelnen sind damit eine ganze Reihe Symptome in der Bevölkerungsentwicklung gemeint. Dem Grunde nach bedeutet „demographischer Wandel“ zum einen, dass sich das Verhältnis der Alterskohorten ändert. Das heißt, dass es deutlich mehr ältere Menschen im Verhältnis zu den jüngeren gibt.
Eigene Grafik7
Zum Zweiten bedeutet der Begriff, dass die Älteren sich auch noch an mehr Lebenszeit erfreuen dürfen. Sprich: die durchschnittliche Lebenserwartung ist gestiegen.
Unserem Thema entsprechend beleuchten wir die weitreichenden Folgen für die Sozialversicherung und für die Unternehmen.
Das Umlageverfahren, das unserer Sozialversicherung zu Grunde liegt, benötigt eine Altersverteilung der Bevölkerung, die einem Tannenbaum gleicht. Es braucht wesentlich mehr junge, arbeitende und in die Sozialversicherung einzahlende Menschen als im Ruhestand befindliche.
Seit Ende der Sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich das Verhältnis allerdings dramatisch verändert.8 Gab es in den 1960er-Jahren noch Geburtenzahlen von bis zu 1,3 Millionen in beiden deutschen Staaten pro Jahr, so sind diese kontinuierlich gesunken. Tiefpunkt war das Jahr 2011 mit rund 662.000 Lebendgeburten. Man spricht vom sogenannten „Pillenknick“, wobei die Markteinführung der Anti-Baby-Pille sicher nur ein Aspekt von Vielen war. Der Rückgang konnte auch durch Wanderungssalden (= Differenz zwischen Zu- und Abwanderung) nicht ausgeglichen werden. Inzwischen nähert sich die Zahl wieder der 800.000-Marke pro Jahr im wiedervereinigten Deutschland. Wo junge Menschen fehlen, wird der Wettbewerb um sie als zukünftige Auszubildende und spätere Mitarbeiter, Fachkräfte und Angestellte größer werden. Und er ist bereits im vollen Gange.
Durch die genannten Entwicklungen, sind nicht nur weniger junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt, sondern die Bevölkerung sinkt auch insgesamt. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass Deutschland im Jahre 2060 nun noch 65-70 Millionen Einwohner hat.9
Dem Arbeitsmarkt fehlen die Arbeitskräfte und der Sozialversicherung fehlen die Beitragszahler, die die Renten der im Ruhestand Befindlichen aufbringen sollen. Neben der Veränderung der Alterskohorten kommt es zu einem stetigen Anstieg der Lebensjahre insgesamt. So erfreulich die Entwicklung, das sich der Einzelne auf mehr Lebensjahre freuen kann, ist: insbesondere für die Gesetzliche Rentenversicherung ist Langlebigkeit ein großes Problem. Auf den Punkt gebracht müssen immer weniger junge Arbeitnehmer mit ihren Beiträgen immer mehr Rentner finanzieren, die auch noch länger leben. Die Rentenbezugsdauer lag in Westdeutschland 1960 noch bei 9,9 Jahren. Im Jahre 2016 in Gesamtdeutschland bereits bei 19,9 Jahren. Dadurch stellt sich die drängende Frage nach der Finanzierbarkeit des Ruhestandes. Das Renteneintrittsalter ist derzeit bei 67 Jahren und es ist denkbar, dass das Eintrittsalter auf 70 Jahre steigt. Zum einen, weil Arbeitskräfte fehlen, und zum anderen, weil damit die Bezugsdauer wieder verkürzt wird.
Für Unternehmer bedeutet das: sie müssen sich auf eine Veränderung der Altersstruktur in ihrem Unternehmen einstellen. Die Belegschaften werden im Durchschnitt älter. Es wird schwieriger Mitarbeiter und Auszubildende zu finden. Es erhöht sich daher die Notwendigkeit, Demographie als ein hartes Kriterium weitsichtiger Unternehmensführung zu etablieren.
Der Vorteil an älteren Mitarbeitern ist zweifelsohne ihre Erfahrung. Ein Unternehmen muss allerdings auch mit steigenden Ausfallzeiten rechnen, die die Produktivität eines Unternehmens in schwere Bedrängnis bringen können.
Die folgende Grafik beschreibt die Beziehung zwischen Alter und Krankheitstagen. Die Balken beschreiben die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage pro 100 Versichertenjahre. Und die Linie die Anzahl der Ausfalltage pro Fall. Nun lässt sich folgendes aus der Grafik ablesen:
Aus dem Gesundheitsreport 2017 der DAK10:
Ältere Mitarbeiter sind zwar nicht häufiger krank, benötigen aber mehr Zeit für die Genesung. Wenn also das Durchschnittsalter steigt, besteht das Risiko steigender Ausfallzeiten mit allen Konsequenzen für die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem Grund werden Aspekte der Gesundheitsversorgung, der Prävention und Gesundheitsförderung an Bedeutung gewinnen. Es kann einem Unternehmen nicht mehr egal sein, wie es um die Gesundheit der Mitarbeiterschaft bestellt ist. Zu groß sind die Risiken im Hinblick auf Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Dazu können Elemente der betrieblichen Versorgungssysteme einen wertvollen Beitrag leisten, wie wir mit diesem Praxishandbuch zeigen werden.
04 Generation Y
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. „Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen.“11 Nichts ist so konstant wie der stetige Wandel. Für unser Thema bedeutet das: die Arbeitnehmerschaft hat sich im Lauf der Zeit nachhaltig verändert. Man unterscheidet zwischen der
Generation X - die Kinder der 1960er und 1970er Jahre. Sie rebellierten zwar und stellten Traditionen und Werte der Eltern in Frage, mündeten allerdings in einen gleichmäßigen Lebensrhythmus.12
Generation Y - die Kinder, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Y wird wie englisch „why“ ausgesprochen. Ein bewusstes Wortspiel, das für die Charakteristik der Gruppe steht. Sie gilt als diejenige, die hinterfragt. Außerdem ist sie die Gruppe, die wie selbstverständlich mit dem Internet und dem Smartphone, also mobiler Kommunikation, aufgewachsen ist.
Generation Z - die Kinder, die nach dem Millennium geboren wurden.
Natürlich kann diese Einteilung nicht starr gesehen werden. Und sie ist auch nicht unumstritten. Nehmen wir aber die oben genannte Einteilung als gegeben an, so kann festgestellt werden, dass es durchaus Unterschiede zu anderen Generationen von Arbeitnehmern gibt. Die Generation Y ist bereit, Leistung zu bringen, wenn sie den Sinn in der Arbeit sieht. Und: sie weiß die Demographie auf ihrer Seite. Es ist gewissermaßen ihr strategischer Vorteil. Sie weiß, dass der Arbeitsmarkt knapp ist und dass damit, je nach Branche und offener Stelle, ihr Wert hoch ist. Sie kann bisweilen sogar Wünsche äußern und Forderungen stellen. Und damit tut diese Generation etwas, was Vorherige auch gerne getan hätten. Die hatten aber nicht die Chance dazu.13





























