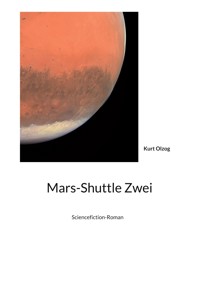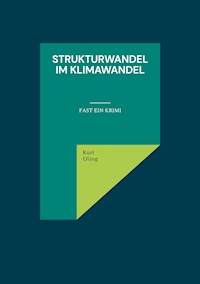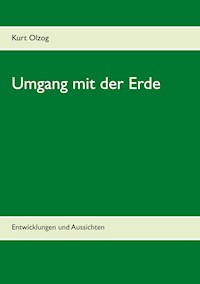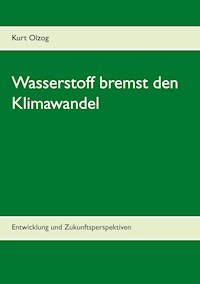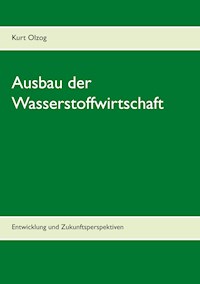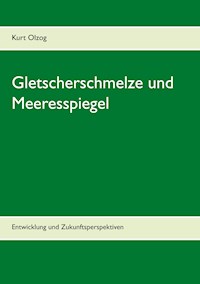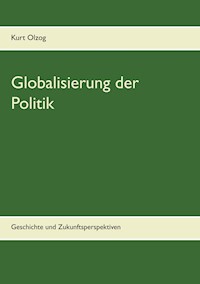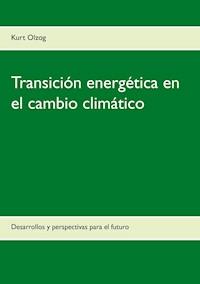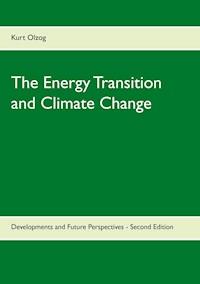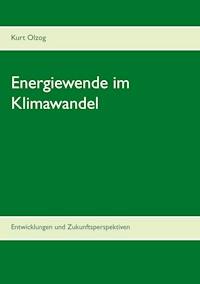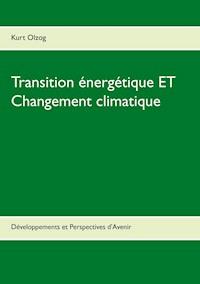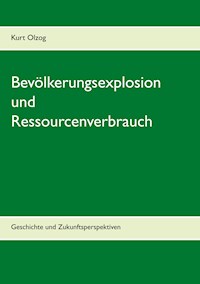
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schauen wir uns den Werdegang der Menschheit in einem kurzen Überblick an und ihre Vermehrung, besonders in Afrika. Der Ressourcenverbrauch ist enorm und wird weiter wachsen. Die Zukunftsaussichten sind nicht ohne Reiz, verlangen aber aktiven Gestaltungswillen, was die Geburtenkontrolle und die weiterhin steigende Sucht nach Ressourcen angeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Werke des Autors „Energiewende im Klimawandel“, „Der Mond – Rohstoffquelle und Weltraumbasis“ und „Globalisierung der Politik – Geschichte und Zukunftsperspektiven“ sind inzwischen herausgekommen, das erste in mehreren Sprachen. Nun nimmt der Autor sich des Themas „Bevölkerungsexplosion und Ressourcenverbrauch“ an und beleuchtet die Geschichte der sich über die Erde ausdehnenden Menschheit und ihre Vermehrung auf einer immer „enger“ werdenden Erde. Die Enge unseres Planeten wird dadurch spürbar, dass die Anzahl der Erdenbürger zunimmt, aber die Ressourcen, von denen diese Menschen leben, begrenzt sind.
Schauen wir uns den Werdegang der Menschheit in einem kurzen Überblick an und ihre Vermehrung, besonders in Afrika. Der Ressourcenverbrauch ist enorm und wird weiter wachsen. Die Zukunftsaussichten sind nicht ohne Reiz, verlangen aber aktiven Gestaltungswillen, was die Geburtenkontrolle und die weiterhin steigende Sucht nach Ressourcen angeht.
Inhalt
Erste Besiedlungswellen über den Globus
Die Entwicklung Eurasiens
Pest, Amerika, Kriege
Die industrielle Revolution
Die medizinische Entwicklung
Der wachsende Ressourcenverbrauch
Zukunftsperspektiven
Literaturverzeichnis
1. Erste Besiedlungswellen über den Globus
Die Dinosaurier waren längst ausgestorben. Es gab noch Nachfahren wie Vögel und Echsen. Säugetiere breiteten sich aus und eroberten die Kontinente des Erdballs. Im Laufe von Millionen Jahren entwickelte sich ein Säuger mit etwas größerem Gehirn im Vergleich zu seinen Vorfahren. Dieses Gehirn verlangte größere Mengen an hochwertiger Nahrung, so dass die Jagd auf Beute und das Sammeln von Früchten und Wurzeln intensiviert werden musste.
Es wurden Jagdwaffen entwickelt und Werkzeuge zum Zerteilen der Beute und zum Zerkleinern der Wurzelgemüse. So entstanden Holz- und Steinwerkzeuge, und auch der Feuerstein blieb nicht unentdeckt. Diese Spezies wurde später als frühe Menschenart bekannt, als Homo erectus, aufrecht gehender Mensch. Wir können heute das Alter von Knochenfunden bestimmen und gewinnen dadurch eine Vorstellung davon, wie die unterschiedlichen Menschenarten im Laufe der Jahrmillionen sich über die grenzenlose Erde verbreitet haben.
„Die Geschichte der menschlichen Kulturen wurde von drei großen Revolutionen geprägt. Die kognitive Revolution vor etwa 70 000 Jahren brachte die Geschichte überhaupt erst in Gang. Die landwirtschaftliche Revolution vor rund 12 000 Jahren beschleunigte sie. Und die wissenschaftliche Revolution, die vor knapp 500 Jahren ihren Anfang nahm, könnte das Ende der Geschichte und der Beginn von etwas völlig neuem sein.“1 Bisher wird Afrika als die Wiege der Menschheit betrachtet. Von hier aus machten sich die Vorfahren seit zwei Millionen Jahren auf den Weg nach Nordafrika, Europa und Asien, wobei immer weiter entwickelte Hominiden hinterher kamen. Das größer werdende Gehirn forderte seinen Tribut: Überall, wo die Menschenartigen hinkamen, dezimierten sie die Herden der Großtiere, wie beispielsweise die Mammuts und Wollnashörner, und ließen auch die Säbelzahntiger als Nahrungskonkurrenten nicht unbehelligt. Je weiter die Vorfahren nach Norden und Osten vorrückten, desto mehr mussten sie sich vor der Kälte schützen, und so ergab es sich, dass Tierfelle recht begehrt waren und das Geberhandwerk allmählich Form annahm. In den Zeiten globaler Kälte, den so genannten Eiszeiten, zahlte es sich aus, dass warme Bekleidung vorhanden war, so dass einige Menschenartigen über die Beringstraße während der Eiszeiten, als viel Wasser oberirdisch in Eis gebunden war und die Beringstraße trocken lag, Alaska erreichten und Amerika besiedelten.3
Die Vorfahren des Menschen (Homo habilis) vor etwa 2 Millionen Jahren: Eine Jägergruppe verjagt in der ostafrikanischen Savanne Hyänen von ihrer Beute, dem inzwischen ausgestorbenen Dinotherium. Die Zeichnung von Sarah Landry findet sich in Edward O. Wilsons Buch „Sociobiology“.2
Dabei wurden sicher nicht wenige Mammuts verspeist.Wo auch immer die Menschenartigen hingelangten, fanden sie ausreichend Nahrung vor. Leicht zu fangende Beute wurde gerne ausgenommen und gebraten. Die Menschenartigen konnten sich dadurch gut vermehren und weiteres Land besiedeln. Etliche Tierarten wurden dezimiert oder gar ausgerottet. Die Menschenart Homo sapiens spielte dabei eine herausragende Rolle: „wo immer sie auftauchten, verschwanden die einheimischen Menschenarten. Die letzten Angehörigen des Homo soloensis segneten vor 50 000 Jahren das Zeitliche, der Homo denisova folgte 10 000 Jahre später. Die letzten Neandertaler verabschiedeten sich vor rund 30 000 Jahren, und die Zwergmenschen von der Insel Flores gingen vor 12 000 Jahren dahin. Zurück blieben ein paar Knochen und Steinwerkzeuge, eine Handvoll Gene in unserem Genom und eine Menge unbeantworteter Fragen. Einige Wissenschaftler hegen die Hoffnung, sie könnten eines Tages in den unberührten Tiefen des indonesischen Urwalds auf eine Gruppe von Liliputanern treffen. Leider sind wir dazu einige zehntausend Jahre zu spät dran. Was war das Erfolgsgeheimnis des Sapiens? Wie gelang es uns, so schnell so unterschiedliche und räumlich so weit auseinander liegende Lebensräume zu besiedeln? Wie haben wir es geschafft, alle anderen Menschenarten zu verdrängen? Warum überlebte nicht einmal der muskulöse, intelligente und kälteresistente Neandertaler unseren Ansturm? Die Debatte darüber verläuft hitzig. Die wahrscheinlichste Antwort ist jedoch genau das Instrument, mit dem diese Debatte geführt wird: Wenn der Homo sapiens die Welt eroberte, dann vor allem dank seiner einmaligen Sprache.“4Überall, wo Homo sapiens auftauchte, bediente er sich zur Ernährung der vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt, und er lebte nicht schlecht. Er vermehrte sich entsprechend stetig, und wenn auch einige Hungersnöte und Seuchen zu überstehen waren, ging nach etlichen Verlusten die Vermehrung wieder weiter. Allerdings war die Jagd nach größeren Tieren und das Sammeln von Früchten und Wurzeln immer mit Gefahren verbunden, man denke nur an Raubtiere und Schlangen, so dass die Lebenserwartung der Menschen recht begrenzt war. Nur wenige von ihnen erreichten ein Alter von mehr als fünfzig Jahren, und diese Menschen wurden geachtet und verehrt, solange sie gesund blieben.
Es gab immer einzelne Individuen, die sich als Schamanen oder geistliche Ansprechpartner hervortaten. In einigen Weltregionen entwickelten sich Bräuche, neben Tieren auch Menschen zu essen, die in mehr oder weniger entfernten Nachbardörfern wohnten. Man hat noch im letzten Jahrhundert in Papua-Neuguinea Stämme entdeckt, in denen es üblich war, die geschrumpften Köpfe besiegter Menschen am Gürtel zu tragen. Die Lachkrankheit war dort verbreitet, da man auch das eiweißreiche Gehirn der Besiegten zu sich nahm, denn man konnte den Erreger der Lachkrankheit noch nicht kennen. Aus Mittel- und Südamerika ist überliefert, dass es dort regelmäßige Menschenopfer gab. Insbesondere in Trockenzeiten sollten die Götter gnädig gestimmt werden und es regnen lassen. Die Europäer eroberten relativ dünn besiedelte Gebiete in Amerika und erlebten die Gegenwehr der sogenannten Indianer, die ihnen bei Gelegenheit den Haarschopf, den „Skalp“, vom Kopf schnitten. Auch heute sind noch Überreste von Menschenverstümmlungen üblich, hauptsächlich in arabischen Ländern, beispielsweise das Abhacken einer Hand, nachdem der Delinquent gestohlen hatte und sich dabei erwischen ließ. Todesurteile sind in arabischen Ländern, in den USA, in China und in etlichen weiteren Ländern noch an der Tagesordnung.
Allerdings wurden im Bereich der Abrahamitischen Religionen Menschenopfer nicht mehr gefordert, was natürlich nicht heißt, dass es dort keine Todesurteile gäbe. Immerhin hat die Verbreitung des Homo sapiens über den Globus dafür gesorgt, dass die großen Tiere seinem Appetit zum Opfer fielen: Viele der großen Säugetiere sind ausgestorben. Diese Entwicklung setzt sich bis heute fort.
Es begann etwa vor 70 Jahrtausenden, dass Homo sapiens sich von Afrika aus auf weitere Kontinente ausbreitete. Sie vertrieben die anderen Menschenarten, „und zwar nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern vom gesamten Planeten. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Sapiens bis nach Europa und Ostasien aus. Vor rund 45 000 Jahren gelang es ihnen irgendwie, das offene Meer zu überqueren und bis nach Australien vorzudringen – einen Kontinent, auf den bis dahin noch kein Mensch seinen Fuß gesetzt hatte. Sie erfanden Boote, Öllampen, Pfeil und Bogen und sogar Nadeln (mit denen sie sich warme Kleider nähen konnten). Die ersten Gegenstände, die man als Kunst und Schmuck bezeichnen kann, stammen aus dieser Zeit, genau wie die ersten Hinweise auf Religion, Handel und gesellschaftliche Schichten.“5
Es ist nicht bekannt, ob es eine Mutation im Gehirn war oder ob neue Areale im Gehirn erschlossen wurden. Jedenfalls fiel in diese Zeit von vor 70 000 bis vor 30 000 Jahren der Prozess, der heute kognitive Revolution genannt wird. Die Sprache und das Denken verfeinerten sich. Dadurch konnte sich Sapiens ein größeres Nahrungsangebot erschließen und weitere Eroberungen durchführen.
Die Weiterentwicklung der Sprache ermöglichte es den Sapiens außerdem, ihr Sozialgefüge zu verbessern. Es konnten größere Gruppen gebildet werden. Die bessere Sprachkompetenz führte dazu, dass herausragende Persönlichkeiten als Führungskräfte anerkannt wurden. Stämme bildeten sich und Rangordnungen konnten mit Hilfe der Sprache geregelt werden.
„Legenden, Mythen, Götter und Religionen tauchen erstmals mit der kognitiven Revolution auf. Viele Tier- und Menschenarten konnten „Vorsicht Löwe!“ rufen. Aber dank der kognitiven Revolution konnte nur der Sapiens sagen: „Der Löwe ist der Schutzgeist unseres Stammes.“ Nur mit der menschlichen Sprache lassen sich Dinge erfinden und weitererzählen. Man könnte sie deshalb als „fiktive Sprache“ bezeichnen.
Nur der Mensch kann über etwas sprechen, das gar nicht existiert, und noch vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge glauben. Einen Affen würden Sie jedenfalls nie im Leben dazu bringen, Ihnen eine Banane abzugeben, indem Sie ihm einen Affenhimmel ausmalen und grenzenlose Bananenschätze nach dem Tod versprechen. Auf so einen Handel lassen sich nur Sapiens ein. Aber warum ist diese fiktive Sprache dann so wichtig? Sind Fantasiegeschichten nicht gefährlich und irreführend? Ist es nicht pure Zeitverschwendung, sich Legenden über Einhörner auszudenken, und würden wir unsere Zeit mit Jagen, Kämpfen und Vögeln nicht viel besser nutzen? Gefährdet es nicht sogar unser Überleben, wenn wir uns den Kopf mit Märchen füllen?
Aber mit der fiktiven Sprache können wir uns nicht nur Dinge ausmalen – wir können sie uns vor allem gemeinsam vorstellen. Wir können Mythen erfinden, wie die Schöpfungsgeschichte der Bibel, die Traumzeit der Aborigines oder die nationalistischen Mythen der modernen Nationalstaaten. Diese und andere Mythen verleihen dem Sapiens die beispiellose Fähigkeit, flexibel und in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. Ameisen und Bienen arbeiten zwar auch in großen Gruppen zusammen, doch sie spulen starre Programme ab und kooperieren nur mit ihren Geschwistern. Schimpansen sind flexibler als Ameisen, doch auch sie arbeiten nur mit einigen wenigen Artgenossen zusammen, die sie gut kennen. Sapiens sind dagegen ausgesprochen flexibel und können mit einer großen Zahl von wildfremden Menschen kooperieren. Und genau deshalb beherrschen die Sapiens die Welt, während Ameisen unsere Essensreste verzehren und Schimpansen in unseren Zoos und Forschungslabors herumhocken.“6
1 Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit. München 2013, S. 11
2 Olzog, Kurt: Globalisierung der Politik. Norderstedt 2018, S. 6. Bild aus: Zimmer, Dieter E.: Unsere alte Natur. In: Die Zeit Nr. 41, Hamburg 1978, S. 33
3 Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit. München 2013, vgl. S. 24ff, mit Abbildung aus S. 24
4 Ebenda, S. 30f
5 Ebenda, vgl. S. 32f
6 Ebenda, vgl. S. 37f
2. Die Entwicklung Eurasiens
„Nach den Jahrmillionen der menschlichen Evolution entstanden ganz am Ende, nach der letzten Eiszeit und als der Neandertaler längst ausgestorben war, nachdem er uns einen Teil seiner Gene vererbt hatte, die ersten größeren politischen Einheiten.
Als Beginn ihrer Geschichte galt den Alten Ägyptern die Vereinigung der beiden Länder Ober- und Unterägypten. Sie schrieben diese Tat dem König Menes zu.“7