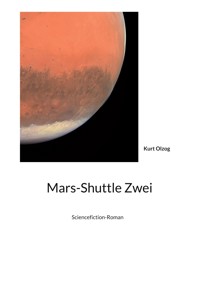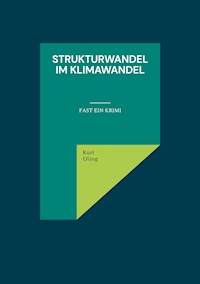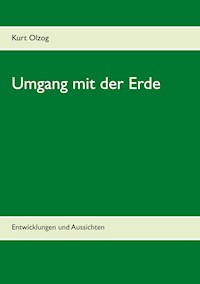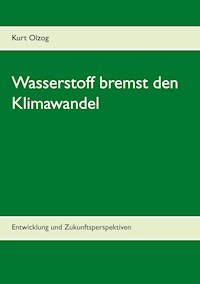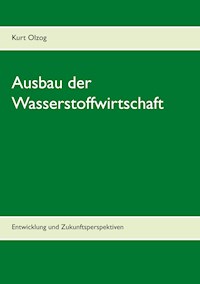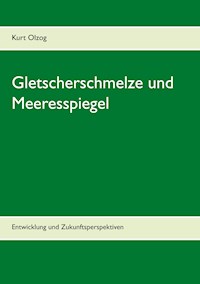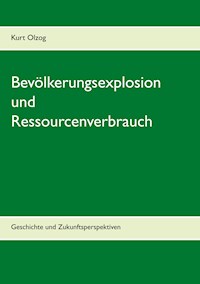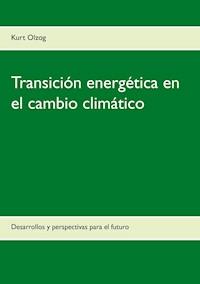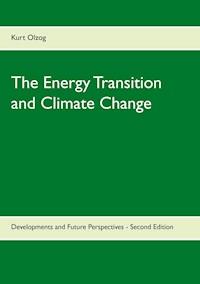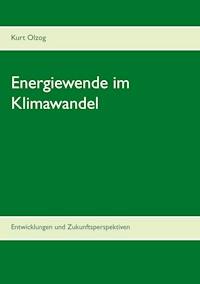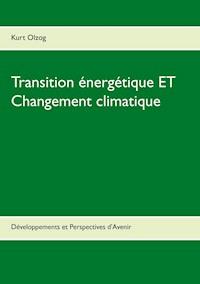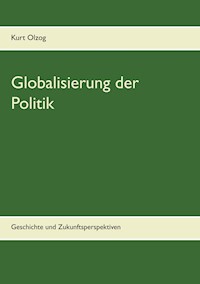
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Werke des Autors "Energiewende im Klimawandel" und "Der Mond - Rohstoffquelle und Weltraumbasis" sind inzwischen herausgekommen, das erste in mehreren Sprachen. Nun nimmt der Autor sich des Themas "Globalisierung der Politik" an und beleuchtet die Geschichte der reifenden und kriegerischen Menschheit und ihre Entwicklung auf einer immer "enger" werdenden Erde. Die Enge unseres Planeten wird dadurch spürbar, dass die Anzahl der Erdenbürger zunimmt, aber die Ressourcen, von denen diese Menschen leben, begrenzt sind. Schauen wir uns den Werdegang der Menschheit in einem kurzen Überblick an und ihre Versuche, die Gesellschaften in immer größeren Gebieten zu verwalten. Diese Geschichte ist voller Kriege, Niederlagen und Siege und zuweilen friedlicher Zeiten. In einer relativ friedlichen Zeit leben wir jetzt und können im Rückblick die Entwicklungsgeschichte studieren und daraus für unsere Zukunft lernen. Die Zukunftsaussichten sind nicht ohne Reiz, verlangen aber aktiven Gestaltungswillen von vielen Menschen, die alle ihren eigenen Kopf haben, also eigene Vorstellungen, wie das Leben auf unserem kleinen Planeten weitergehen soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Werke des Autors „Energiewende im Klimawandel“ und „Der Mond – Rohstoffquelle und Weltraumbasis“ sind inzwischen herausgekommen, das erste in mehreren Sprachen. Nun nimmt der Autor sich des Themas „Globalisierung der Politik“ an und beleuchtet die Geschichte der reifenden und kriegerischen Menschheit und ihre Entwicklung auf einer immer „enger“ werdenden Erde. Die Enge unseres Planeten wird dadurch spürbar, dass die Anzahl der Erdenbürger zunimmt, aber die Ressourcen, von denen diese Menschen leben, begrenzt sind.
Schauen wir uns den Werdegang der Menschheit in einem kurzen Überblick an und ihre Versuche, die Gesellschaften in immer größeren Gebieten zu verwalten. Diese Geschichte ist voller Kriege, Niederlagen und Siege und zuweilen friedlicher Zeiten. In einer relativ friedlichen Zeit leben wir jetzt und können im Rückblick die Entwicklungsgeschichte studieren und daraus für unsere Zukunft lernen. Die Zukunftsaussichten sind nicht ohne Reiz, verlangen aber aktiven Gestaltungswillen von vielen Menschen, die alle ihren eigenen Kopf haben, also eigene Vorstellungen, wie das Leben auf unserem kleinen Planeten weiter gehen soll.
Inhalt
Die lange Entwicklung zum Homo Sapiens
Die Entwicklung Ägyptens und Asiens
Das Reich Alexanders des Großen
Die römische Weltherrschaft
Das Europa des Großen Karl
Die Entdeckung und Besiedlung Amerikas
Die Weltkriege und ihre Folgen
Zukunftsperspektiven
Literaturverzeichnis
1. Die lange Entwicklung zum Homo Sapiens
Natürlich stammen wir Menschen nicht vom Affen ab! Vor mehr als zehn Millionen Jahren trennten sich die Wege von gemeinsamen Vorfahren in die Äste der heutigen Affen und Menschen. Am 6. Oktober 1978 brachte die Wochenzeitung „DIE ZEIT“ auf Seite 33 einen Beitrag von Dieter E. Zimmer: „Unsere alte Natur“.1
Die Vorfahren des Menschen (Homo habilis) vor etwa 2 Millionen Jahren: Eine Jägergruppe verjagt in der ostafrikanischen Savanne Hyänen von ihrer Beute, dem inzwischen ausgestorbenen Dinotherium. Die Zeichnung von Sarah Landry findet sich in Edward O. Wilsons Buch „Sociobiology“.
Im Untertitel heißt es: „Was uns die evolutionsbiologische Perspektive über uns selber verrät“.2
Im einbändigen Werk „Weltgeschichte. Von der Urzeit bis zur Gegenwart“, herausgegeben von Dr. Uwe K. Paschke,3 finden wir auf Seite 8 dazu die folgende Abbildung:
Zeitmaße und Gliederung der Urgeschichte: Das Trickbild zeigt den Zeitablauf wie einen Rückblick auf einen Serpentinenweg, bei dem jeder Zug 20.000 Jahre darstellt.
Auf Seite 15 finden wir dann das folgende Schaubild mit Bezug auf geologische Zeiträume:4
Diese Entwicklung über Jahrmillionen erzeugte Hominiden mit immer größeren Gehirnen, so dass deren Verbreitung eine Erfolgsgeschichte sondergleichen wurde. Offensichtlich war die Vergrößerung der Gehirne das Erfolgsrezept, denn dadurch wuchs die Fähigkeit, die Lauterzeugung zu verfeinern und bei der Nahrungssuche strategisch vorzugehen.
„Insgesamt stehen die „Australopithecinen“ den heutigen Menschen näher als den heutigen lebenden Menschenaffen, und das sowohl quantitativ, d. h. nach der Länge der Verbindungslinien der Entwicklung (also hinunter zum gemeinsamen Vorfahren und wieder hinauf zu den heutigen Verwandten: vgl. Abb. S. 15), als auch qualitativ, d. h. nach ihren biologischen-anatomischen Eigenarten. Wenn man die Entwicklung als umfassende Erscheinung versteht, müssen daraus auch Folgerungen für die Beurteilung der geistig-seelischen Aspekte gezogen werden: Der Forschungsstand legt nahe, den Frühmenschen eher vom Menschen her und als wirklichen Menschen zu verstehen als durch den Menschenaffen oder andere Tiere. Das zeigen bereits die wichtigsten Züge jenes „Werkzeugverhaltens“, das aus den ältesten uns bekannten Steinwerkzeugen spricht: Sie lassen uns auch den frühesten erfaßbaren Hersteller von Steinwerkzeugen als einen prinzipiell vollwertigen Menschen ansehen (wiewohl zuzugeben ist, daß Worte wie „prinzipiell“ oder „grundsätzlich“ hier unscharf bleiben müssen).
Indes bleibt offen, ob und inwieweit es innerhalb des „grundsätzlich Menschlichen“ nicht doch Abstufungen gegeben hat. Es ist nicht ohne weiteres möglich zu behaupten, daß der Frühmensch schon in allen Richtungen voll entfaltet war und nicht noch weitere Entwicklungen stattgefunden hätten; aber es ist außerordentlich fraglich, ob man in einer Übertreibung und Ausweitung des Entwicklungsgedankens so weit gehen kann, dem Frühmenschen wesentliche menschliche Eigenarten abzusprechen und ihn als ein mehr oder weniger tierisches Wesen zu verstehen (wie etwa im Schlagwort vom „Affenmenschen“). Dennoch darf nicht überspielt oder verkannt werden, daß auch im Bereich der Kulturgeschichte einige Erscheinungen objektiv festzustellen sind, auf die eine solche Ansicht sich stützen zu können glaubt. Sie stehen fast alle mehr oder weniger im Zusammenhang mit den Zeitmaßen des Ablaufs der Urgeschichte, und zu diesen müssen deshalb noch einige Worte gesagt werden.
Die erkennbare technische Entwicklung ist in den ältesten Zeiten zweifellos außerordentlich gering. Vor etwa einer halben Million Jahren setzt zwar eine technische Verfeinerung und gewisse Differenzierung der Steinwerkzeuge ein; aber aufs Ganze will sie in keinem rechten Verhältnis zu dem Zeitmaß stehen. Eine Veränderung von wirklich epochalem Charakter ist erst vor rund 30.000 Jahren zu erkennen in den entfalteten und differenzierten Jäger- und Sammlerkulturen mit der ältesten bekannten Bildkunst von sogleich großartigem Charakter.
Dieses Mißverhältnis in der unterschiedlichen Dauer der Epochen kann zweifellos erschrecken. Auf den ersten Blick liegt es nahe, dafür als entscheidende Ursache eine entsprechende Entwicklung des Gehirns und der zugehörigen Fähigkeiten zu sehen; aber zumindest für die „Fortschritte“ seit etwa 30.000 Jahren oder gar in den letzten Jahrhunderten wird man so nicht argumentieren können. Erfinden, Lernen und dergleichen sind ebenfalls unbezweifelbare Faktoren, die zu berücksichtigen sind, und bei denen zu prüfen ist, ob sie nicht eine ausreichende Erklärung bieten.
Zunächst ist zu beachten, daß die ersten Erfindungen gewiß immer die schwierigsten waren und deshalb auch besonders hoch einzuschätzen sind: Auf einmal errungenen Fortschritten läßt sich leichter weiterbauen; entwickelte Kultur kann sich leichter auf dem gegebenen Nährboden immer wieder selbst befruchten und entfalten, weil die einzelnen Kulturelemente, Errungenschaften und Erfindungen, je vielfältiger und komplizierter sie sind, auch um so mannigfaltigere Verbindungen und Kombinationen erlauben und entsprechend anregend und steigernd wirken können. Verglichen mit dem Zusammenfließen zerstreuter Kenntnisse und einzelner Entdeckungen, wie es sich immer mehr verstärkt hat bis zu dem breiten Kommunikationsfluß unserer Tage, kann die Langsamkeit wirtschaftlicher und technischer Entfaltung bei Menschen einer einfachen Jäger- und Sammlerkultur eigentlich wenig verwundern: Geschlossenheit und selbstgenügsame Einfachheit der Kultur und damit der geringe Anreiz zur Veränderung sind sicherlich eine wichtige Wurzel der so offensichtlichen Beharrungstendenz. Außerdem ist bei kleinen Menschengruppen, die innerhalb größerer Räume verhältnismäßig abgesondert leben, weniger Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und Erfindungen. Gemeinschaften von durchweg wenigen Dutzend Köpfen bieten auch weniger Möglichkeiten zu sozialer Differenzierung, die ihrerseits Sonderbegabungen fördert. Das alles kann die anfängliche Langsamkeit und spätere Beschleunigung wohl hinreichend verständlich machen.“5
Negative Handabdrücke in roter und schwarzer Farbe auf den Seitenwänden der Höhle Gargas, Com. Aventignan (Dép. Hautes-Pyrénées). Die Farbe wurde um die auf die Wand aufgelegte Hand aufgeblasen.
Die ältesten auffindbaren gestalterischen oder künstlerischen Zeugnisse unserer Vorfahren sind rund 30.000 Jahre alt. Warum keine älteren künstlerischen Erzeugnisse gefunden wurden, ist noch unbekannt. „Zunächst ist zu bedenken, daß mit dem Fehlen einer bildenden Kunst ja noch nicht jede künstlerische Betätigung ausgeschlossen ist, sondern andere Ausdrucksformen wie etwa Mimik und Tanz ihre Rolle gespielt haben können. Vor allem aber ist nicht aus dem Auge zu verlieren, daß nicht schlechthin dort, wo jene kulturelle Umformung sich bemerkbar macht und wo die neue Menschenform auftritt, sogleich auch bildende Kunst erblüht. Weite Bereiche bleiben davon zunächst unberührt; andere kommen erst später hinzu, und auch heute gibt es Gruppen von Menschen, die der bildenden Kunst entbehren. Die Frage erweist sich bei näherem Zusehen als ungemein kompliziert: Offenbar haben wir es bei der bildenden Kunst mit einer Erscheinung zu tun, die wir zwar gewöhnlich leichthin als „allgemein-menschlich“ bezeichnen, als in der Natur des Menschen begründet und in allen Gruppen von Menschen geübt; aber in Wirklichkeit dürfte sie erst in einem längeren Prozeß weite Teile der Menschheit erfaßt haben und schließlich annähernd zu einem Gemeingut der Menschheit geworden sein.“6
In Schwarz und braun ausgeführte Malerei eines Wildpferdes und eines Stieres aus der Höhle von Lascaux, Frankreich, um 25 000-20 000 v. Chr. In der im Jahre 1940 entdeckten Höhle, deren Malereien sich erstaunlich gut erhalten haben, weisen Wände und Decke die verschiedensten Tierdarstellungen auf, neben Wildpferden vor allem Wisente, Steinböcke und Hirsche.7
Erst allmählich wurde auch die Bedeutung des Neandertalers in der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen erkannt „und ist noch heute nicht restlos geklärt. Der während der letzten großen Kaltzeit lebende Homo sapiens neanderthalensis errichtete zeltartige Wohnbauten mit Feuerstellen, stellte Kleidung her und ernährte sich von der Jagd“.8
„Zahlreiche Fundstätten in Afrika, Europa und Asien dokumentieren die Anfänge der über 4 Mio. Jahre alten Geschichte der Menschheit.“9
In der Infobox auf Seite 59 wird auf den Zusammenhang zwischen Sprache und Evolution hingewiesen:
„In Bilzingsleben wurden Knochenartefakte entdeckt, in deren Oberflächen regelmäßige, sich rhythmisch wiederholende Strichgruppen eingraviert sind. Sie stellen auf symbolhaft-abstrakte Weise optisch wirksame Übermittlungen von Gedanken dar und können damit als Beweis für die Existenz einer menschlichen Sprache dienen, die sich zur Übermittlung abstrakter Vorstellungen der Sprachsymbole bedient. Die Herausbildung der Sprache als Kommunikationsmittel und zur Übermittlung von Denkprozessen auf zunehmend abstrakter Ebene läuft von Beginn an parallel zur Evolution des Menschen.“10
1 Zimmer, Dieter E.: Unsere alte Natur. In: DIE ZEIT Nr. 41, Hamburg 1978, S. 33ff mit Abbildung
2 Ebenda
3 Paschke, Uwe K. (Hg.): Weltgeschichte, Erlangen 1994, Abbildung S. 8
4 Ebenda, S. 15, Grafik mit Beschreibung auf der folgenden Seite
5 Ebenda, S. 16f mit Abbildung (Ausschnitt) auf der nächsten Seite
6 Ebenda, S. 16-17
7 Ebenda, S. 19, Bild einer Höhlenmalerei mit Beschreibung
8 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Kg (Hg.): Welt- und Kulturgeschichte. Epochen, Fakten, Hintergründe in 20 Bänden, Band 01, S. 36f, mit Abbildung: Modell im Field Museum in Chicago (Ausschnitt).
9 Ebenda, S. 38, mit Karte
10 Ebenda, S. 59
2. Die Entwicklung Ägyptens und Asiens
Nach den Jahrmillionen der menschlichen Evolution entstanden ganz am Ende, nach der letzten Eiszeit und als der Neandertaler längst ausgestorben war, nachdem er uns einen Teil seiner Gene vererbt hatte, die ersten größeren politischen Einheiten.
Als Beginn ihrer Geschichte galt den Alten Ägyptern die Vereinigung der beiden Länder Ober- und Unterägypten. Sie schrieben diese Tat dem König Menes zu.
„Die Wissenschaft der Ägyptologie, die Geschichte und Kultur des Alten Ägypten erforscht, hat sich diesen Blickwinkel in gewisser Weise zu eigen gemacht, indem sie mit ihrer Forschungstätigkeit um die Zeit der Entstehung des ägyptischen Staates etwa 3100 v. Chr. mit der Dynastie 0 (Null) einsetzt. Dies ist auch deshalb berechtigt, da um diesen Zeitpunkt herum die ersten schriftlichen Quellen erscheinen. Die schriftlose Zeit davor rechnet zur Vorgeschichte; sie wird in der Regel vom Fach der Vor- und Frühgeschichte abgedeckt.
Mit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen (332 v. Chr.) tritt das pharaonische Ägypten in eine Zeit über, in der die Kultur unter den ptolemäischen und römischen Herrschern zunehmend unter fremde Einflüsse gelangt. Für die Erforschung dieser Epoche ist die Ägyptologie nur noch zuständig, soweit es sich um in ägyptischer Schrift und Sprache abgefasste Texte oder um traditionell geprägte Denkmäler handelt. Dabei ist sie auf die Zusammenarbeit mit der Alten Geschichte, den Klassischen Altertumswissenschaften und der Papyrologie, der Wissenschaft von den griechischen und lateinischen Papyri, angewiesen. Mit der letzten Hieroglypheninschrift am Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. hört dann allerdings ihre Zuständigkeit insgesamt auf.
Geographisch gehört zum Alten Ägypten das Gebiet zwischen dem ersten Nilkatarakt im Süden und dem Mittelmeer. Allerdings werden auch Gebiete Nubiens am mittleren Nillauf von der Ägyptologie mit behandelt, da Ägypten mit diesen Gebieten seit der Vorgeschichte in Verbindung stand und sie seit der Zeit des Alten Reiches zu beherrschen trachtete; im Neuen Reich unterwarf Ägypten das Gebiet bis zum vierten Katarakt beim Djebel Barkal als Kolonie – der ersten der Menschheitsgeschichte. Es errichtete dort zahlreiche Tempel und ägyptisierte die einheimische Bevölkerung zum Teil vollständig. Im 9. Jahrhundert v. Chr. entstand dann ein weiterhin von der altägyptischen Kultur stark beeinflusstes einheimisches nubisches Reich, dessen Könige als 25. Dynastie (Kuschiten oder „Äthiopen“) sogar das ehemalige Mutterland kurzfristig beherrschten; als Reich von Meroë bestand es bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. weiter. Vorderasien hingegen, ebenfalls Ziel expansionistischer Bestrebungen Ägyptens, ist allein im Zusammenhang mit den betreffenden geschichtlichen Ereignissen und den sie beschreibenden ägyptischen Zeugnissen Thema der Ägyptologie.“11
In der Infobox auf S. 264 wird der Name „Ägypten“ folgendermaßen beschrieben: „Der Name Ägypten leitet sich vermutlich ab von „Chikuptach“, dem Namen des Haupttempels von Memphis und – ab dem neuen Reich – auch der Bezeichnung von Memphis selbst. In der griechischen Überlieferung ist die Be zeichnung erstmals bezeugt als „aigýptios“ („Ägypter“) im 9. Gesang der „Ilias“ Homers. Der alte einheimi sche Name Ägyptens war dagegen Kemt, „das Schwarze“ nach der Farbe des Nilschlamms.“12
„Für Jean François Champollion (1790 – 1832), dem Entzifferer der Hieroglyphen, wurde 1831 der erste ägyptologische Lehrstuhl am Collège de France in Paris gegründet (Gemälde von Léon Cogniet, 1831, Paris, Louvre):“13
„Die Bildhaftigkeit der Hieroglyphen erstreckte sich auf ihre Farbgebung; auch bei dieser Wandmalerei folgt die Blickrichtung der Schriftzeichen den Personen, auf die sie sich beziehen (Theben, Grab der Königin Nefertari; 13. Jh. v. Chr.).“14
„Ägypten – das war und ist ein lang gestrecktes Rechteck mit dem Nil in der Mitte und Wüstengebieten rechts und links davon. Der eigentliche Lebensbereich des Ägypters war so das Niltal. Er wird im Norden vom Mittelmeer und im Westen und Osten durch die Wüstengebiete klar eingegrenzt. Im Süden dagegen bildet zwar der erste Nilkatarakt, eine granitene Felsbarriere im Fluss, einen gewissen Grenzpunkt, doch setzt sich die Flusslandschaft im Prinzip nach Süden hin in den nubischen und sudanischen Raum fort. Innerhalb Ägyptens besteht ein Gegensatz zwischen der schmalen Niltaloase Oberägyptens und dem weiträumigen Delta Unterägyptens, das die beiden Hauptarme des Nils formen, die heute bei Rosette im Westen und Damiette im Osten in das Mittelmeer fließen.
Beide Regionen unterscheiden sich sowohl klimatisch als auch landschaftlich. Das Delta gehört zum Einflussbereich des mediterranen Klimas, während Oberägypten zur saharischen Zone zählt, die kaum Niederschläge kennt. Allerdings reichen auch die Niederschläge des Deltas nicht für einen Regenfeldbau aus. Bei einer derart lang gestreckten Region von 950 Kilometer Länge zeigt auch die Temperatur Unterschiede in Nord-Süd-Abstufung: In Alexandria beträgt sie im Jahresdurchschnitt 20,2 Grad Celsius, in Assuan im Süden 25,8 Grad Celsius.“15
Der Nil ermöglichte den Ägyptern, zu leben und einen gewissen Wohlstand zu erreichen. Jede Hochflut brachte schwarze Erde mit, die sich auf den Feldern verteilte und sie auf diese Weise fruchtbar machte. Diese Hochfluten traten erst seit etwa 90 000 Jahren vor unserer Zeit auf und brachten Schlammablagerungen aus dem äthiopischen Raum mit sich. In Oberägypten bestanden die Ablagerungen aus gröberen Sedimenten, und erst weiter im Norden wurden die feineren tonigen Bestandteile abgesetzt. Das Schwemmlandgebiet des Deltas hingegen „ist von den hügeligen Resten gröberer Ablagerungen durchsetzt, die sich vorzüglich als Siedlungsplätze eigneten.
Zur Zeit der Herausbildung des altägyptischen Staates bis tief in das Alte Reich hat man sich das Klima feuchter als heute vorzustellen. Die seichten Nilufer waren mit Papyrus bewachsen, und auf den natürlichen Aufschüttungen des Nildammes gab es Sträucher und Gebüsche, während das Niltal selbst einen reichen Baumbestand aufwies. An tiefer gelegenen Stellen des Niltales fanden sich Dauersümpfe, und das Delta zeigt einen reichen Gras- und Krautwuchs, der sich vorzüglich als Weide eignete. Die heutigen Wüstengebiete im Westen und Osten bedeckte eine Savannenvegetation. Der große Artenreichtum der hier lebenden Tiere, zu denen mit Nashorn, Elefant, Löwe und Giraffe auch Großwild gehörte, wurde durch die zunehmende Trockenheit, vor allem aber durch die Aktivitäten des Menschen mit seinem Ackerbau und der Viehzucht zunehmend eingeschränkt. Allerdings darf man sich diese Entwicklung nicht zu geradlinig vorstellen, denn Amenophis III. beispielsweise konnte noch Ende des 14. Jahrhunderts v. Chr. eine Herde von 174 Wildrindern jagen, und zur Zeit von Ptolemaios I. gab es noch immer unbebautes Land in Ägypten.
Die regelmäßige Bewässerung durch die Nilhochflut und der dadurch angeschwemmte Nilschlamm machten den Ackerboden fruchtbar und ermöglichten solch gute Ernten, dass Ägypten einen beträchtlichen Überschuss erwirtschaften konnte. Verschiedene Getreidearten, Körner- und Hülsenfrüchte, Gemüse- und Obstsorten sowie Öle sind als Grundnahrungsmittel bekannt. Auch Futter für das Nutzvieh wurde angebaut oder fand sich auf weiträumigen Weiden, vor allem im Delta. Zum Nutzvieh gehörten Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Geflügel sowie der Esel als Transporttier – das Kamel finden wir erst um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. in dieser Rolle.
Alle für das tägliche Leben und für das Handwerk notwendigen Rohstoffe gab es im Land, sodass die Befriedigung aller Grundbedürfnisse der Menschen sichergestellt war. Darüber hinaus war Ägypten reich an Baumaterialien und den verschiedensten Gesteinssorten, an Halbedelsteinen und vor allem an Gold. Bei den grundlegenden Rohstoffen ist allein ein Mangel an Holz festzustellen, der aber auf den Menschen selbst zurückzuführen ist. Dieser dezimierte nämlich den Baumbestand, als er das Niltal in eine Kulturlandschaft umwandelte. Kupfer, ein anderer wichtiger Rohstoff, kam zwar in der Ostwüste vor, wurde dort aber aus unbekannten Gründen erst während der 12. Dynastie abgebaut. So wurde es seit alters aus dem Sinai und aus Nubien beschafft.
Die Gestalt des Landes machte den Nil zur Hauptverkehrsstraße im überregionalen Verkehr. Für die Verbindung vom Nil ins Innere des Niltales wurden schon früh Kanäle angelegt. Meist lief dieser Verkehr aber als Lokalverkehr über Straßen. Für der Fernverkehr existierten eine Anzahl von Karawanenstraßen nach Vorderasien, ans Rote Meer oder Richtung Süden nach Nubien, sofern er nicht über den Seeweg oder den Nil abgewickelt wurde.“16
Für uns ist es verwunderlich, wie wenige Menschen damals in Ägypten lebten und all die Leistungen erbrachten, die Ägypten bekannt gemacht haben. Volkszählungen sind nicht überliefert, so dass man versucht hat, „die Bevölkerungszahl für die einzelnen Perioden anhand der Anbaufläche, der Produktivität des Bodens unter den damaligen Bedingungen sowie der Steuerveranlagungen zu schätzen. Man kommt dabei auf eine Bevölkerungszahl von 1,6 Millionen für das Alte Reich (2500 v. Chr.), auf 2 Millionen für das Mittlere Reich (1800 v. Chr.) und 2,9 Millionen für das Neue Reich (1250 v. Chr.) sowie auf 4,9 Millionen für die hellenistische Zeit (150 v. Chr.). Dass diese Zahlen nur mutmaßliche sind, versteht sich angesichts des Berechnungsverfahrens und seiner Grundlagen von selbst. Zum Vergleich seien aber die Bevölkerungszahlen von 4,5 Millionen unter den Mamelucken (1250-1517) und von 2,5 Millionen zur Zeit der ägyptischen Expedition Napoléon Bonapartes (1798-1801) angeführt, die einen gewissen Rahmen für die für das Alte Ägypten berechneten Zahlen abgeben.“17
„Das alte Ägypten war eine hoch entwickelte und sozial differenzierte Agrargesellschaft. Die Wandmalerei aus dem Grab des „Ackervorstehers des Amun“ Menena in Theben-West (um 1400 v. Chr.) zeigt einen Landvermesser beim Vermessen eines Kornfeldes.“18
Im Allgemeinen wird Menes als Begründer der alten ägyptischen Dynastien angesehen (3000-2700 v. Chr.), der die Dynastie 0 anführte. In der ersten Dynastie folgen Aha, Djer und andere. Insgesamt acht Könige haben 175 Jahre regiert.
Die zweite Dynastie beginnt mit Chasechemui und weiteren Königen. Die Zeitspanne dieser Dynastie war kürzer als die der ersten. Die dritte Dynastie bringt enorme Fortschritte in der Entwicklung und im Gebrauch der Schrift, das Konzept des göttlichen Königtums wird festgeschrieben. Die Einrichtung eines Kalenders fällt in diese Zeit. „Da die Nilüberschwemmung regelmäßig alle Jahre ungefähr im Abstand von 365 Tagen eintrat, führte der Rhythmus in ihrem Ablauf und den damit verbundenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu einem natürlichen Kalender auf der Basis von Mondmonaten mit der Einteilung des Jahres in drei Jahreszeiten, nämlich der „Überschwemmung“, ägyptisch achet, dem „Herauskommen (der Saat)“, ägyptisch peret, sowie der „Hitze“ oder „Trockenheit“, ägyptisch schemu.