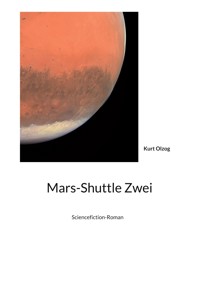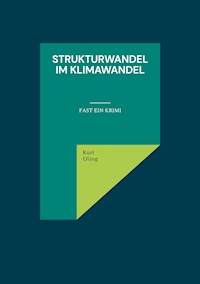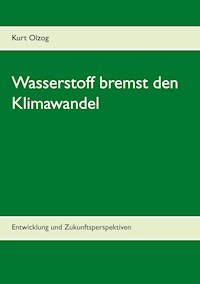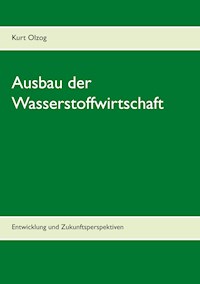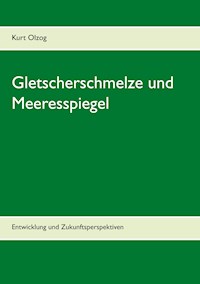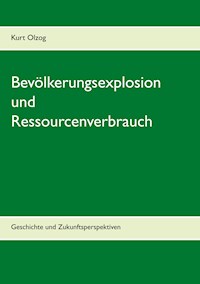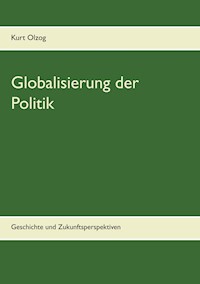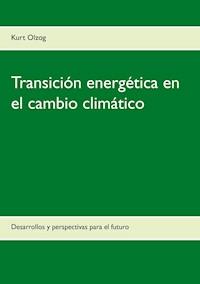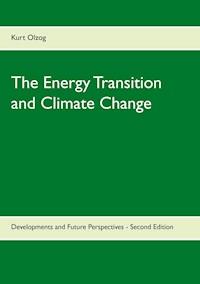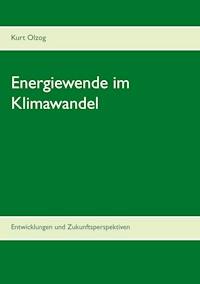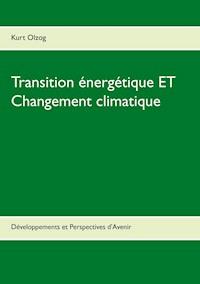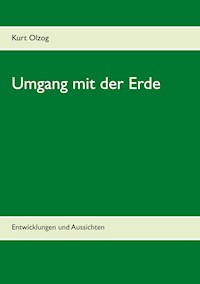
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Umgang mit unserem Heimatplaneten Erde ist gekennzeichnet durch eine rasante Bevölkerungsentwicklung und damit verbunden durch Erderwärmung und Artenschwund anderer Lebewesen. Inzwischen hat sich die Menschheit Zielvorgaben erarbeitet, um das Überleben auf der Erde für Menschen erträglich zu gestalten. Dazu gehört die Nutzung von grünem Wasserstoff, der nur durch erneuerbare Energie erstellt wird, und eine Konsolidierung einer Wasserstoffwirtschaft rund um den Globus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Werke des Autors „Energiewende im Klimawandel“, „Der Mond – Rohstoffquelle und Weltraumbasis“, „Globalisierung der Politik – Geschichte und Zukunftsperspektiven“, „Bevölkerungsexplosion und Ressourcenverbrauch“, „Gletscherschmelze und Meeresspiegel“, „Ausbau der Wasserstoffwirtschaft“ und „Wasserstoff bremst den Klimawandel“ sind inzwischen herausgekommen, das erste in mehreren Sprachen. Nun nimmt der Autor sich des Themas „Umgang mit der Erde“ an und beleuchtet die Möglichkeiten, die uns Menschen zur Verfügung stehen, um mit Erderwärmung und Artensterben zurechtzukommen.
Inhalt
Bestandsaufnahme
Bevölkerungsentwicklung
Erderwärmung und Artenschwund
Erarbeitung von Zielvorgaben
Nutzung von grünem Wasserstoff
Konsolidierung der Wasserstoffwirtschaft
Aussichten
Literaturverzeichnis
1. Bestandsaufnahme
Die Erde ist schon alt. Vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstand sie zusammen mit dem gesamten Sonnensystem aus Sternenstaub, der aus mindestens einer vorangegangenen Supernova stammte. Seit dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren sind fortwährend Sterne explodiert in Form von Supernovae, nachdem sie ihren Wasserstoffvorrat zu Helium verschmolzen hatten, danach das Helium zu Kohlenstoff. Nachdem der Gasdruck im inneren des Sterns zu sehr abgenommen hatte, fiel der Stern durch übermächtig werdende Gravitation in sich zusammen und stieß die äußere Gashülle ab. Durch diesen Prozess entstanden noch schwerere Elemente. Der Erdkern besteht aus festem bis flüssigem Eisen, vermengt mit Nickel und Einsprengseln von noch schwereren Elementen wie Gold, Blei und Uran, bedeckt von einem Mantel aus leichterem zähflüssigen Gestein und von einer nur bis zu 100 km dünnen Kruste aus leichterem Material. Alle diese Materialien sind Erzeugnisse vergangener Sternexplosionen.
Mit etwas Glück kann die Erde noch einige Milliarden Jahre überdauern, bis unsere Sonne ebenfalls ihr Alter erreicht hat und sich beim Kohlenstoffbrennen soweit ausdehnt, dass sie die inneren Planeten in sich aufnimmt. Bis dahin sind allerdings alle Lebewesen verschmort. Uns bleibt nur zu hoffen, dass unsere Nachfahren in der Zwischenzeit eine neue Wohnstatt gefunden haben werden oder auch mehrere davon. Platz genug hätte unsere Galaxis doch. Es waren inzwischen mehrere Menschen auf dem Mond, und Chinesen und Russen überlegen bereits, dort eine Forschungsstation zu errichten, die auch anderen Nationen offen stehen soll. Wie hat sich unsere Erde denn in der Vergangenheit entwickelt?
„Ohne ein gewisses Maß an Treibhausgasen läge die bodennahe Weltmitteltemperatur bei -18 Grad Celsius, so dass ein großer Teil des Globus vereist wäre. Als sich vor vier Milliarden Jahren die Erde allmählich abkühlte, entwickelte sich eine Atmosphäre mit hohem Methangehalt, hervorgerufen durch den damals sehr verbreiteten Vulkanismus.
In diese Zeit fiel auch die Kollision der Erde mit einem etwa Mars-großen Planeten oder mehreren Teilen davon, aus der sich der Erdmond bildete:
Das obige Bild stammt aus einem Beitrag von G. Jeffrey Taylor: „Ursprung und Entwicklung des Mondes“, erschienen in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft, September 1994, Seiten 59-61.1
In der Folge dieses bisher größten Einschlags konnte die Erde sich wieder erholen. Es gab immer wieder Einschläge von größeren oder kleineren Asteroiden. Häufig verband sich Sauerstoff aus dem Gestein mit dem brennbaren Methan (CH4)2, so dass sich Wasser und Kohlenstoffdioxid bilden konnte. Während der Abkühlphase konnte immer häufiger Wasser aus dem Wasserdampf der Atmosphäre abregnen und dadurch kühlende Gewässer bilden.
Es bildeten sich Aminosäuren in den Gewässern, deren Ursprünge durchaus von Asteroiden stammen können. Daran forscht zur Zeit die Wissenschaft. Der Weg zum ersten einzelligen Lebewesen war wohl noch etliche Millionen Jahre weit.
Irgendwann gab es Einzeller, die Chlorophyll nutzten, um mit Hilfe der Sonnenenergie Kohlenstoffdioxid, kurz Kohlendioxid oder CO2, zu verwerten und Sauerstoff, kurz O2, abzugeben, und andere Einzeller, die O2 zur Energieerzeugung nutzten und CO2 abgaben. Ein Kreislauf bahnte sich an. Es entstanden verbundene Zellen, die zusammenarbeiteten, woraus mehrzellige Lebewesen wurden.
Die Mehrzeller schieden sich in CO2-Atmer wie beispielsweise Algen und Pflanzen, und O2-Atmer, wie einfache Polypen. Dazwischen siedelten sich Pilzartige an, die in Symbiose mit CO2- Atmern lebten.
In geologischen Zeiträumen eroberten Pflanzen und Tiere neben den Ozeanen auch das Festland. Im Archaikum und Proterozoikum ging die Entwicklung nur sehr schleppend voran. Es dauerte bis zum Kambrium, das vor 570 Millionen Jahren begann, bis die ersten Trilobiten auftauchten, später kamen kieferlose Fische hinzu, die Schwebstoffe aus dem Wasser filterten. Im Silur, vor 438 Millionen Jahren, gab es dann die ersten kiefertragenden Fische, und im darauffolgenden Devon und Karbon entwickelten sich Bärlapp- und Farngewächse und Koniferen in solchem Ausmaß, dass wir von der Steinkohle und dem Erdöl, die die Sonnenenergie uns damals besorgt hat, seit der Industriellen Revolution zehren können.
Es gab damals auch schon Eiszeiten, kurz vor dem Silur und im Karbon und Perm, in denen die damals üppige Biomasse unter einem Eismantel verdichtet und teilweise verflüssigt wurde. Das ist seit dem 19. Jahrhundert unser Reichtum an fossilen Energierohstoffen.3
Der Meeresspiegel schwankte über die Jahrmillionen sehr stark, abhängig von der Temperaturentwicklung beziehungsweise der Vereisung des Planeten. Die Schwankungen der Erdmitteltemperatur vollzog sich allerdings nur allmählich, außer bei Ereignissen wie zwischen dem Mesozoikum und dem Känozoikum, als ein Meteor die Erde traf und in der Folge viele Lebewesen einschließlich der Dinosaurier ausstarben.
Es entstand neues, widerstandsfähigeres Leben. Entsprechend blieb der Kreislauf der CO2-Moleküle erhalten. Mit Hilfe des Sonnenlichts und von Wasser nahmen die Pflanzen CO2 auf und bauten Kohlenwasserstoffe in die wachsenden Fasern ein. Übrig blieb der Sauerstoff als O2-Molekül und diente den Tieren zur Atmung. Im organischen Kohlenstoffzyklus entfernen Landpflanzen „durch Fotosynthese jährlich 60 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre, weitere 90 Milliarden Tonnen entziehen ihr Gas-Wasser-Austausch und Kleinstlebewesen im Ozean.“4 Dieser CO2-Kreislauf ist geschlossen, so dass in der Atmosphäre bis zum Jahr 1900 rund 280 ppm CO2 dafür sorgten, dass ein natürlicher Treibhauseffekt bestand. Dieser hielt die bodennahe Weltmitteltemperatur bei rund 14°C mit Ausschlägen in Warm- und Kaltzeiten nach oben und unten. „Zu diesem Effekt tragen Wasserdampf (61%), Kohlendioxid (CO2, 21%), bodennahes Ozon (O3, 7%) und andere Gase (11%) bei. Sowohl die atmosphärische Konzentration dieser Treibhausgase als auch die globale Mitteltemperatur sind natürlichen Schwankungen unterworfen. Dies wird zunehmend überlagert durch menschliche Aktivitäten, die zu einer Anreicherung der Treibhausgase und dadurch zu einer globalen Erwärmung führen (»anthropogener Treibhauseffekt«).
Der 5. Sachstandsbericht (Climate Change 2014) des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Internationale Organisationen) bilanzierte die Erkenntnisse der weltweiten Klimaforschung mit den Worten: »Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig, und die Veränderungen seit den 1950er Jahren haben über Jahrzehnte bis Jahrtausende nicht ihresgleichen. Die Atmosphäre und die Ozeane haben sich erwärmt, die Schnee- und Eisbedeckung ist zurückgegangen, der Meeresspiegel und die Konzentration der Treibhausgase ist gestiegen.«
Nach Angaben der Weltmeteorologie-Organisation (WMO) ist der Erwärmungstrend nach wie vor ungebrochen. 2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die globale Durchschnittstemperatur lag 1,1 °C über dem vorindustriellen Mittelwert und 0,06 °C über der des vormaligen Rekordjahres 2015. Außerdem wurde 2016 der Temperaturanstieg in den ersten Monaten noch durch den starken El Niño 2015/16 verstärkt. Dies führte auch in den Ozeanen zu den höchsten je gemessenen Temperaturen an der Meeresoberfläche. In den hohen Breiten stieg die Temperatur stärker als im globalen Durchschnitt; so lag die Jahresdurchschnittstemperatur auf Svalbard (Norwegen) mit –0,1 °C um 6,5 °C über dem Mittelwert von 1961–90.“5
Die Grafik „Klimawandel: Globale Durchschnittstemperatur“ zeigt die Temperaturveränderung seit 1950. Der Beginn des Temperaturanstiegs liegt allerdings im 19. Jahrhundert. Seitdem werden Eisenbahnen gebaut und zum Heizen Kohle und später Erdöl verfeuert.
„Durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe hat der Mensch den CO2-Anteil in der Atmosphäre etwa seit dem Jahr 1900 bereits von 280 ppm auf mehr als 400 ppm erhöht. Handeln wir nicht sofort, werden wir nach dem pessimistischsten Szenario des Weltklimarats (IPCC) im Jahr 2100 eine Erdatmosphäre mit 1000 und 100 Jahre später sogar mit 2000 ppm CO2 erleben. Gegen die Menge des CO2 wie auch die Geschwindigkeit, mit der sie steigt, werden die natürlichen Regulierungsmechanismen nicht schnell genug ankommen. Eine Erde, wie der Mensch sie nie gekannt hat, wird die Folge sein.
Die Enormität dieser Entwicklung wird vielleicht am deutlichsten, wenn man betrachtet, wie lange es dauern wird, bis die Erde den CO2-Gehalt auf das vorindustrielle Niveau zurückgebracht haben wird. Der Klimawissenschaftler David Archer von der University of Chicago und der Hamburger Klimamodellierer Victor Brovkin vom Max-Planck-Institut für Meteorologie haben das 2008 berechnet: Die Absorption von Kohlenstoffdioxid durch die Ozeane wird dessen Konzentration in der Atmosphäre in rund 3000 Jahren ausgehend von rund 1400 ppm auf 600 ppm reduziert haben. Nach 20000 Jahren wird die Verwitterung von Karbonatgestein den CO2-Anteil auf 450 ppm gesenkt haben, und erst nach 200000 bis 400000 Jahren wird die [...] Verwitterung von Silikatgestein das ursprüngliche Niveau von 280 ppm wiederhergestellt haben. Ohne Zweifel wäre es besser, wenn der Mensch schnellstmöglich die Finger von diesem unvorstellbaren Experiment ließe.“6
Die Verursacher dieses Klimawandels sind wir Menschen mit unserem Energiehunger bei gleichzeitiger Bevölkerungsexplosion. Um diesen Prozess aufhalten zu wollen, ist es zu spät. Er lässt sich allerdings verlangsamen. Wie bereits im in Paris 2015 beschlossenen Klimaabkommen vereinbart, will die Weltbevölkerung versuchen, die Erderwärmung auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dazu muss man sich klarmachen, welche Parameter sich dazu eignen. Man muss die Treibhausgasemissionen in recht kurzer Zeit stoppen, wie die folgende Grafik „CO2-Konzentration der Atmosphäre“ nahelegt.
Angenommen, es gelingt uns, den CO2-Ausstoß auf Null herunterzufahren, dann blieben die gut 400 ppm CO2 erst mal in der Atmosphäre und der Treibhauseffekt bliebe erhalten. Damit würden weiterhin Gletscher schmelzen und den Meeresspiegel erhöhen.“8
Zur Bestandsaufnahme unseres Umgangs mit unserem Heimatplaneten gehört auch die Betrachtung des Umgangs mit der Biodiversität, angefangen bei der Bodenkrume über die Ozeane bis zur Atmosphäre. Am Beispiel aus dem Meer gestiegener Vulkaninseln können wir die Bodenbildung verfolgen, zunächst die Zerkleinerung des Vulkangesteins durch Wind und Wetter, dann die Besiedelung mit ersten Pflanzen wie Meersenf und Strandhafer. Auf Surtsey, einem Vulkan 30 km vor Islands Küste, brüten inzwischen Eissturmvögel und verschiedene Möwenarten und düngen den Boden. Dadurch wird der Boden fruchtbarer, wobei kleine Organismen wie Mikroben oder etwa Springschwänze den Boden bearbeiten. „Sie werden 1975 erstmals auf Surtsey gefunden. Angelandet sind sie wohl mit Treibgut oder im Gefieder von Vögeln. Oder sie kamen übers Meer, denn sie können wochenlang im Salzwasser treiben. Kaum spült sie eine Welle an eine ungastliche Küste, fangen sie mit ihrer Pioniertätigkeit an. Wie Fallschirmjäger hinter feindlichen Linien. Nur dass die Springschwänze Leben bringen.