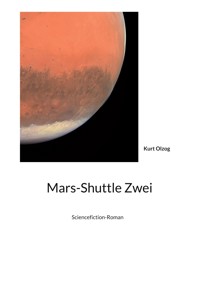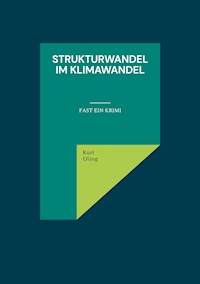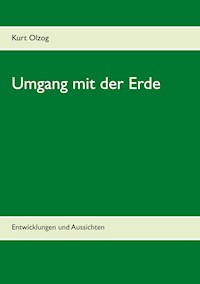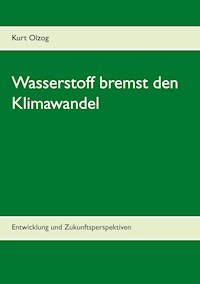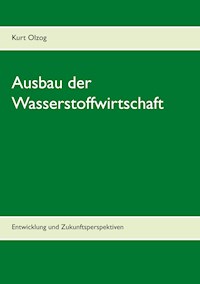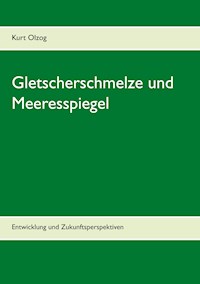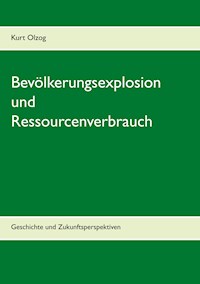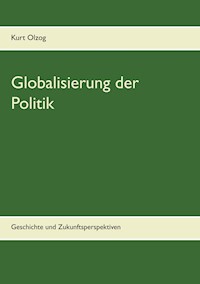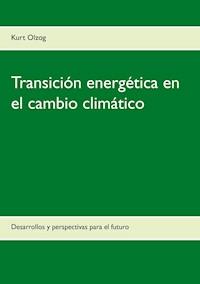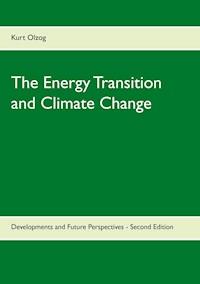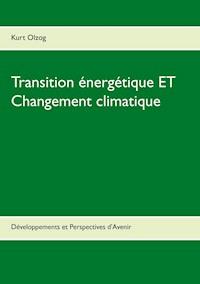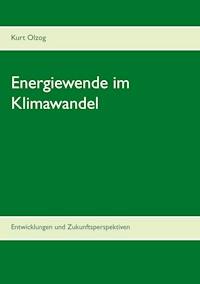
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Nach der ersten Auflage sind inzwischen fast zwei Jahre vergangen, und auf dem Gebiet des Klimaschutzes hat sich einiges getan. Der Pariser Gipfel bildete den Abschluss der ersten Auflage, und nun findet bereits der nächste Klimagipfel in Bonn statt. Darüber wird zu berichten sein. Darüber hinaus kommt ein Geo-Risikoforscher zu Wort, der beim Rückversicherer Munich Re arbeitet. Nach wie vor sorgen erratische politische Äußerungen und Entscheidungen dafür, dass beim Klimaschutz wenig Sicherheit herrscht und dass die Weltbevölkerung weiterhin auf das Prinzip Hoffnung setzen muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach der ersten Auflage sind inzwischen fast zwei Jahre vergangen, und auf dem Gebiet des Klimaschutzes hat sich einiges getan. Der Pariser Gipfel bildete den Abschluss der ersten Auflage, und nun findet bereits der nächste Klimagipfel in Bonn statt. Darüber wird zu berichten sein. Darüber hinaus kommt ein Geo-Risikoforscher zu Wort, der beim Rückversicherer Munich Re arbeitet. Nach wie vor sorgen erratische politische Äußerungen und Entscheidungen dafür, dass beim Klimaschutz wenig Sicherheit herrscht und dass die Weltbevölkerung weiterhin auf das Prinzip Hoffnung setzen muss.
Inhalt
Entwicklung der Energiewirtschaft
Entwicklung der Kernenergie
Entwicklung der erneuerbaren Energieträger
Klimaentwicklung im vergangenen Jahrhundert
Zukunftsperspektiven
Klimagipfel 2015 in Paris
Klimagipfel 2017 in Bonn
Literaturverzeichnis
1. Entwicklung der Energiewirtschaft
Fossile Energiequellen wurden seit der industriellen Revolution in zunehmendem Maße zur Wärme- und Stromerzeugung sowie zur Fortbewegung verwendet. Vor allem Erdöl entwickelte sich im vergangenen Jahrhundert zur wichtigsten Kraftquelle der Weltwirtschaft. So betrug sein Anteil am Weltenergieverbrauch im Jahr 1976 fast 45 %, auf alle festen Brennstoffe zusammen (Stein- und Braunkohle, Torf etc.) entfielen dagegen nur 30% und auf Erdgas nicht einmal 18 %.1
Seit Erdöl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts industriell gefördert wird (in den Vereinigten Staaten und Russland entstand die Erdölindustrie fast gleichzeitig), dehnte sich die Nachfrage nach diesem vielseitig verwendbaren und preiswerten Rohstoff immer schneller aus. Besonders in Nordamerika wurde das Erdöl zunehmend extensiver verbraucht, so dass die rasch steigende Nachfrage eine expandierende Erdölindustrie hervorbrachte. Vor allem der nach 1911 einsetzende Autoboom, durch den sich das Automobil zu einem Fortbewegungsmittel für Jedermann entwickelte, brachte den Erdölgesellschaften einen fortwährend expandierenden Absatzmarkt, so dass in den zwanziger und dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts die Erdölsuche sich über die ganze Erde auszuweiten begann.
Im Iran und Irak, in Venezuela und Indonesien wurde bald gefördert, und die Exploration geriet derweil immer intensiver.
Die USA galten allerdings zwischen den beiden Weltkriegen als das Ölland schlechthin, da sie einerseits über große Erdölreserven verfügten und andererseits wegen ihres extensiven Ölkonsums auch eine starke Ölindustrie besaßen. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war es dann auch in Kuwait und Saudi-Arabien soweit, dass die Ausbeutung der dort entdeckten riesigen Vorkommen beginnen konnte.
Der Zweite Weltkrieg unterbrach die vielversprechende Tätigkeit der Ölgesellschaften im Nahen Osten. Statt dessen wurden die amerikanischen Ölvorkommen derart ausgenutzt, dass der amerikanische Erdölexport allmählich eingestellt werden musste.
Nach Beendigung des Krieges erhielt dann die Erdölförderung in Nahost neuen Auftrieb, zumal Nordamerika sich immer mehr zu einem Zuschussgebiet entwickelte. So musste nicht nur der stark ansteigende westeuropäische Ölverbrauch, sondern auch die ebenfalls größer werdende Öleinfuhr des zu jener Zeit größten Förderlandes, der USA, durch Öl aus Venezuela und Nahost gedeckt werden.
In schneller Folge wurden riesige Ölvorkommen im Nahen Osten ausgemacht, so dass bereits Mitte der fünfziger Jahre der Anteil der nahöstlichen Erdölreserven an den in der gesamten Welt entdeckten Ölvorkommen mehr als sechzig Prozent betrug.
Die in den USA und Großbritannien aufgeblühten Ölkonzerne entwickelten bei ihrer Tätigkeit zunehmend selbstherrlichere Methoden, die ihren Anteil zur Irankrise (1951 – 1954) beisteuerten. Die erfolglosen Emanzipierungsversuche des Iran vermochten zunächst die übrigen Ölförderländer einzuschüchtern, jedoch relativierten zunehmende sowjetische Einflüsse im arabischen Raum die Macht der Industrieländer und der für sie tätigen Ölmultis (man erinnere sich nur an das Ägypten der fünfziger Jahre).
Die durch Gamal Abdel Nasser 1956 herbeigeführte Suez-Krise ist ein Beleg für die sich allmählich verändernden Machtverhältnisse: die ehemals in Nahost und Nordafrika etablierten Kolonialmächte England und Frankreich verloren zusehends an Bedeutung. Inzwischen entdeckten die Ölförderländer, dass sie durch gemeinsame Verfechtung ihrer Interessen weniger wehrlos gegen die Willkür der Industrieländer und ihrer Ölkonzerne waren als durch vereinzelte Widerstandsversuche.
So entstand schließlich 1960 die OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Die Ölländer benutzten dieses neue Instrument ihrer Organisation zunächst zur Durchsetzung stabiler Einkünfte gegen die Ölkonzerne. Später, unmittelbar nach dem Sechs-Tage-Krieg mit Israel im Jahr 1967, probten sie ihr erstes Ölembargo gegen die USA, Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland.
Doch trotz der drei Monate langen Dauer des Embargos bewirkte es wenig, zum einen wegen der damals von den betroffenen Ländern verfolgten Politik der Vorratshaltung, so dass das Embargo eine gewisse Zeit überbrückt werden konnte, zum anderen durch zusätzliche Beanspruchung der venezolanischen und iranischen Förderung, die um ein Vielfaches anstieg.2 Dadurch wurde dieses Ereignis in den westlichen Industrieländern eher als Randerscheinung des Nahost-Krieges gewertet, inszeniert von ohnmächtigen Arabern.
Vor allem dies hatte zur Folge, dass die Vorratspolitik aufgegeben wurde, da man annahm, dass die Ölländer sich des Mittels Embargo wegen dessen Unwirksamkeit und seiner Nachteile für die Ölländer selbst nicht mehr bedienen würden.
Anfang der siebziger Jahre begann die OPEC plötzlich, Aufmerksamkeit zu erregen: die Ölpreise stiegen. Dies wiederholte sich nun regelmäßig, was jedes mal eine Welle der Empörung in der Öffentlichkeit der westlichen Industrieländer provozierte. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung nach Ausbruch des vierten Nahost-Krieges, des Jom-Kippur-Kriegs am jüdischen Jom-Kippur-Tag, dem 6. Oktober 1973, in dem Ägypten einen großen Teil seiner im Sechs-Tage-Krieg verlorenen Sinai-Besitzungen einschließlich wichtiger Ölfelder zurück eroberte.3
Auch als zu Beginn der siebziger Jahre in der damaligen Sowjetunion umfangreiche Ölvorkommen in Westsibirien entdeckt wurden, sank der nahöstliche Anteil nicht unter 50 Prozent und stieg danach wieder geringfügig an. Bis heute ist der Nahe Osten das wichtigste Ölfördergebiet, was auch im Umfang der Förderung seinen Niederschlag findet.
Die Waffe Ölembargo setzte wieder ein und verursachte große Panik unter den Ölimportländern, zumal in den USA, Japan und Westeuropa der Ölverbrauch von 1,5 Milliarden Tonnen im Jahre 1967 auf mehr als 2,3 Milliarden Tonnen in 1973 gestiegen war.4 Die Ölländer taten ein Übriges: Zur Drosselung der Ölproduktion um 12 % gesellten sie in kurz aufeinander folgenden Konferenzen innerhalb dreier Monate eine stufenweise Ölpreiserhöhung von insgesamt 400 Prozent.5
Dies löste einen dermaßen ungeheuren Schock auf die Öffentlichkeit der westlichen Industrieländer aus, dass in der Folge politisch-wirtschaftliche Turbulenzen das Wirtschaftswachstum der Industrieländer ins Wanken brachten: „Handels- und Zahlungsbilanzen geraten in Unordnung, die Inflationsraten steigen an, wachsende Arbeitslosigkeit grassiert, die Bruttosozialprodukte der westlichen Industriestaaten weisen nur noch minimale Steigerungsraten auf, und jedes Mal, wenn die Kriegsgefahr im Nahen Osten erneut virulent wird, erheben sich die larmoyanten Stimmen der Politiker, der öffentlichen Medien sowie der als Energie-Verbraucher empfindlich getroffenen Bürger.“6
Während im Nahen Osten Friedensbemühungen in Gang kamen, machten sich die westlichen Industrieländer daran, die Ölkrise oder, wie sie zunehmend genannt wurde, die Energiekrise, ihre Ursachen und Folgen zu analysieren, um ähnlichen Entwicklungen in Zukunft besser begegnen zu können. Es entstand die Internationale Energie-Agentur (IEA), eine Unterorganisation der OECD.
Diese IEA sollte nun ein Instrument für die beteiligten Industriestaaten darstellen, um sowohl gegenüber Unbequemlichkeiten seitens der OPEC gesichert zu sein, als auch den Dialog mit den Ölländern zu suchen und weiter zu entwickeln, als auch drittens alternative Energiequellen gezielter als bisher zugunsten größerer Unabhängigkeit von der OPEC anzuwenden.
Ein Weiteres erreichte die Ölkrise: Die Zuwendung zu den rohstoffarmen Entwicklungsländern wurde intensiviert. Durch die immens gestiegenen Ölpreise waren gerade diese ärmsten unter den Entwicklungsländern so in Zahlungsschwierigkeiten geraten, dass ihre Kredite in extremer Weise in die Höhe schnellten, so dass sie zuweilen die Zinsen kaum bezahlen konnten. So versuchten OPEC und IEA mit allen Mitteln, diesen durch die negative Entwicklung der Weltwirtschaft und durch ihre eigene Apathie (und damit auch ihre massenhafte Unterernährung) schwer geschädigten und ohnehin hilfsbedürftigen Ländern notdürftig zu helfen.
Die energiewirtschaftlichen Interessenlagen der wichtigen Mitglieder der IEA sind seit jeher recht verschieden. So musste Japan seinen kompletten Mineralölverbrauch importieren, das waren 1974 immerhin mehr als 74 % des Jahresenergieverbrauchs.
Der Ausbau der Kernenergie stieß damals auf große Vorbehalte der japanischen Öffentlichkeit. Die traditionell wenig exportabhängige amerikanische Wirtschaft war und ist auf fremde Märkte längst nicht in dem Maße angewiesen wie die westeuropäische oder japanische. Im allgemeinpolitischen Bereich allerdings sind die Vereinigten Staaten als Führungsmacht der westlichen Welt besonders empfindlich für Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen Problemen und ihrer außenpolitischen Handlungsfreiheit. Daher motivieren nicht nur ökonomische, sondern fast mehr noch allgemeinpolitische Interessen die Vereinigten Staaten zur Zusammenarbeit innerhalb der Energieagentur.
Die westeuropäische Haltung zur IEA war recht differenziert. So wurden seit Ende der sechziger Jahre beträchtliche Ölvorkommen im Bereich der britischen und norwegischen Nordsee entdeckt. Überdies besitzen Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland mächtige Kohlevorkommen. Außerdem verfügen die Niederlande und in Maßen Großbritannien über Erdgasvorkommen, die den niederländischen Primärenergieverbrauch zu fast der Hälfte decken. Ausgesprochen arm an eigenen Ressourcen von Primärenergieträgern sind dagegen Frankreich und Italien, die einen erheblichen Teil ihres Primärenergieverbrauchs durch Importe decken müssen.
Die Rolle der Öl- und Gaskonzerne hat sich seit der Ölkrise sehr stark gewandelt. „Die Ölgesellschaften sind in den OPEC-Ländern nicht mehr Eigentümer des dort geförderten Rohöls. Sie wurden einerseits zu Rohölkäufern, wobei sie teilweise längerfristige Bezugsmöglichkeiten vertraglich sichern konnten; andererseits wurden sie Service-Anbieter, die – wiederum auf vertraglicher Basis – für die Ölländer Rohölförderung und Exploration betreiben.“7 Dass die Ölkonzerne die Preisdiktate der OPEC an die Käufer weitergaben, war schlechterdings eine Notwendigkeit.
Die Aufgaben der Exploration und Aufschließung neuer Erdölfelder, die zudem immer teurer wurden und immer aufwendigere Techniken erforderten, verlangten Riesensummen an Investitionskapital, so dass die Konzerne sich während der Krise nur konsequent verhielten, wenn sie sich ein wenig an den Preissteigerungen beteiligten. Nicht erst bei dieser Gelegenheit kamen auch alternative Energiequellen ins Gespräch, nicht nur die Kernenergie, die schon vor der Ölkrise zuweilen Unbehagen weckte. Die abzusehende Erschöpfung der Erdölvorkommen (bei konstanter Förderung von drei Milliarden Tonnen pro Jahr reichte das bis dahin entdeckte Erdöl noch für 30 Jahre)8 zwang zum Nachdenken über alternative Verfahren zur Energiegewinnung.
Vor allem war zunächst für eine effektivere Nutzung der Energie zu sorgen. Die seit jeher in Nordamerika übliche extensive Energieverschwendung war längst nicht mehr Vorbild für die westeuropäische Energiepolitik. Dennoch war auch hierzulande der Wirkungsgrad der Energieausnutzung zu niedrig. Diesen Wirkungsgrad galt es also zu erhöhen.
Mit Hilfe alternativer Energiequellen und effektiverer Energienutzung erzielte die Weltwirtschaft im Verlauf der Jahre von 1975 bis 1985 eine Reduzierung des Erdölverbrauchs. Mit dem Rückgang der Förderung war eine anhaltende Umstrukturierung der Welterdölgewinnung verbunden. In Westeuropa, Nordamerika und Afrika nahm die Förderung zu, während sie im Nahen Osten stark reduziert wurde, hauptsächlich, um den Ölpreis stabil zu halten. Hier nahm die Förderung von knapp 970 Millionen Tonnen auf rund 506 Millionen Tonnen ab.9
„Der Anteil der OPEC-Länder … an der Welt-Erdölförderung betrug 1985 nur noch 29 % (1973 dagegen 54 %). Dies entsprach weniger als der Hälfte der Förderkapazität dieser Länder und lag noch unter der Fördermenge, die festgelegt worden war, um den Preis durch die Verhinderung weiteren Überangebots zu stabilisieren.“10 Der Erdölmarkt war zum Käufermarkt mit Angebotsüberschüssen geworden.
„Der Weltverbrauch von Primärenergie stieg 1970-80 um 34,5 %, 1980-90 um 21,7 %. Diese Verlangsamung des Verbrauchsanstiegs setzte sich in den 90er Jahren fort; der Verbrauch erhöht sich derzeit jährlich um rd. 1 % und liegt damit wesentlich unter dem globalen Wirtschaftswachstum sowie unter der weltweiten Bevölkerungszunahme.
Der wichtigste Energieträger ist – global gesehen – mit großem Abstand das Erdöl (1993: 36,8 %).“11
Der Erdgasverbrauch stieg seit den 70er Jahren wesentlich stärker an als die gesamte Zunahme des Energieverbrauchs. Sein Anteil stieg von 19,5 % im Jahr 1970 auf 24,0 % in 1993.
Der Anteil der festen Energierohstoffe Stein- und Braunkohle (zweitwichtigster Energieträger) sank von 32,9 % in 1970 auf 28,9 % in 1993.
„Die höchsten Zuwachsraten verzeichnete der Einsatz der Kernenergie, v. a. bis Mitte der 80er Jahre (1970: 0,1 %; 1980: 1,2 %; 1985: 5,5 %; 1990: 6,8 %). In den letzten Jahren stagnierte der Anteil bei 7,2 %.“12
Über die folgenden zehn Jahre ergibt sich eine erneute Verbrauchserhöhung um etwa 11 %, in der die Bedeutung des Erdöls durch den Zuwachs an Erdgas abnimmt auf 34,3 % im Jahr 2002. Erdgas und Stadtgas haben nun mit Kohle (Stein- und Braunkohle) an Bedeutung fast gleichgezogen mit etwas mehr als 27 % des Gesamtverbrauchs.13