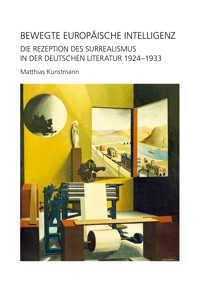
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Surrealistische Bilder faszinieren immer wieder ein großes Publikum. In der bildenden Kunst wird der Surrealismus seit nunmehr über hundert Jahren bewusst fortgeführt, kaum eine andere künstlerische Strömung ist so dauerhaft. Das Wort »surreal« wird, von solchen Bildern abgeleitet, oft für Situationen und Erlebnisse im Alltag gebraucht. Meist wird aber nicht daran gedacht, dass der Surrealismus von Schriftstellern ausgerufen worden ist und seitdem einen höheren Anspruch hat, als neue, seltsam bekannte Bilder zu erzeugen. Es ging von Anfang an auch nicht einfach um Kunst. Das Vorhaben war, das Verhältnis der Menschen zur Welt zu ändern, inmitten von Zivilisationskrisen und darüber hinaus. Ein bestimmtes Wahrnehmen sollte Möglichkeiten entdecken und entsprechendes Handeln veranlassen, das befreiend, belebend und gestaltend wirkt. Das Buch präsentiert die Reaktionen auf die Pariser Surrealistischen Manifeste von 1924 und 1930 in Deutschland, in den letzten zehn Jahren der Weimarer Republik. Diese erste deutsche Demokratie hat sich besonders durch ihr intensives und vielfältiges kulturelles Leben ausgezeichnet. Dabei ist der Surrealismus zwar nicht als Bewegung aufgetreten, aber er wirkte sich bewegend aus. Wie hier in der Mitte Europas damals Intellektuelle sich mit den Anregungen des Surrealismus auseinandersetzten, sich auf verwandte deutsche Traditionen bezogen, an dieser und anderen Bewegungen teilnahmen oder davon auf Abstand gingen, wie Literaten über Grenzen hinweg Themen der Kultur, Politik, Philosophie, Ästhetik und Ethik diskutierten, die langfristig wichtig waren, wie sie einander kritisierten oder bestärkten, wie sie schrieben und handelten, vergegenwärtigt das Buch mit zahlreichen aussagekräftigen Zitaten, mit Analysen, Interpretationen und aktuellen Schlussfolgerungen. Eine nachhaltig wirkende ästhetische, philosophische und politische Bewegung wird aus diesen Reaktionen, Kommentaren oder Diagnosen besser verständlich und neu wahrnehmbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Matthias Kunstmann, Jahrgang 1958, hat ein Redaktionsvolontariat beim Sonntagsblatt (Evangelische Wochenzeitung für Bayern), beim Evangelischen Pressedienst und bei der Tageszeitung Augsburger Allgemeine absolviert. Das Studium der Germanistik, Romanistik und Neueren Geschichte an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Heidelberg und Bordeaux hat er als Magister Artium abgeschlossen. Er arbeitet als freiberuflicher Journalist für Presse, Rundfunk und Internet in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Politik und war von 1992 bis 2010 Redakteur für aktuelle Politik beim Südwestrundfunk im Kulturprogramm SWR2. Seit 2007 betreut er als freier Lektor ADB (Zertifikat der Akademie des Deutschen Buchhandels, jetzt Akademie der Deutschen Medien) Sachbücher und Belletristik verschiedener Verlage wie Beltz (Weinheim), RETAP (Düsseldorf), Silberburg (Tübingen).
Inhalt
Vorwort
PASSAGE
POLITIK
GESELLSCHAFTLICHE STANDORTE DER LITERATEN
Zwischen Engagement und Rückzug
ZEITGEIST DER NEUEN GENERATION
Brüche und Kontinuität
NATIONALE MENTALITÄTEN
Vermittlungen, Möglichkeiten der Rezeption
AM ENDE DER MODERNE?
Kultur und Zivilisation, anders interpretiert
FORTSCHRITT
STADT
KUNST INS LEBEN
Das literarische Vorgehen
ÄSTHETIK
DIE UNBEKANNTE WELT DER OBJEKTE
IN FRAGMENTEN
ALLTAG
ZUFALL
MONTAGE
METAPHER
WÖRTER IN FREIHEIT
BILDER, RUHIG UND BEWEGT
BILDENDE KUNST
FOTOGRAFIE
AUGENBLICK
KINO
THEATER
TAG- UND NACHTTRÄUME
VISIONEN
MYSTIK
DIE KRÄFTE DES RAUSCHES
DER ENTMYTHOLOGISIERTE WAHNSINN
Erfahrung im existenziellen Grenzbereich
SUBVERSION DES GEDÄCHTNISSES
...
und die historische Arbeit des Erinnerns
SENSIBILITÄT, INTUITION, FANTASIE, INSPIRATION, SPIRITUALITÄT
Subjektive Bedingungen surrealistischen Wahrnehmens
ASSOZIATION – SUGGESTION
Mechanismen und Methoden des Wahrnehmens
ZEICHEN, SYMBOLE, BEDEUTUNGEN
Zur Interpretation des Wahrgenommenen
WUNDER
PHILOSOPHIE
WIRKLICHKEITEN
MATERIALISMUS
Sinn fürs Konkrete
RELATIVISMUS
Verlorene Atome, komplexe Dunkelheit
STRUKTURALISMUS
Andere Zusammenhänge
VERNUNFT, ERKENNTNIS, ERFAHRUNG
PSYCHOANALYSE
OKKULTISMUS
FREIHEIT, POETIK, ETHIK
MYTHOLOGIE
SPIEL
LIEBE
UTOPIE
Literaturverzeichnis
Vorwort
Surrealistische Bilder faszinieren immer wieder ein großes Publikum. In der bildenden Kunst wird der Surrealismus seit nunmehr über hundert Jahren bewusst fortgeführt, kaum eine andere künstlerische Strömung ist so dauerhaft. Das Wort »surreal« wird, von solchen Bildern abgeleitet, oft für Situationen und Erlebnisse im Alltag gebraucht. Meist wird aber nicht daran gedacht, dass der Surrealismus von Schriftstellern ausgerufen worden ist und seitdem einen höheren Anspruch hat, als neue, seltsam bekannte Bilder zu erzeugen. Es ging von Anfang an auch nicht einfach um Kunst. Das Vorhaben war, das Verhältnis der Menschen zur Welt zu ändern, inmitten von Zivilisationskrisen und darüber hinaus. Ein bestimmtes Wahrnehmen sollte Möglichkeiten entdecken und entsprechendes Handeln veranlassen, das befreiend, belebend und gestaltend wirkt.
Der Surrealismus als derart ambitionierte Bewegung hat in Frankreich seine erste Form erhalten, in einer Gruppe, in der viele Beteiligte aus anderen europäischen Ländern stammten. Während die Wortführer sehr genau auf das Programm achteten, entwickelten sich surrealistische Weltanschauung und Verhaltensweise auch abweichend und unterschiedlich außerhalb dieser Gruppe. Insgesamt strahlte die Bewegung mit Worten, Bildern und Aktionen bald weltweit aus.
Das Buch präsentiert die Reaktionen auf die Surrealistischen Manifeste von 1924 und 1930 in Deutschland, in den letzten zehn Jahren der Weimarer Republik. Diese erste deutsche Demokratie hat sich besonders durch ihr intensives und vielfältiges kulturelles Leben ausgezeichnet. Dabei ist der Surrealismus zwar nicht als Bewegung aufgetreten, aber er wirkte sich bewegend aus. Wie hier in der Mitte Europas damals Intellektuelle sich mit den Anregungen des Surrealismus auseinandersetzten, sich auf verwandte deutsche Traditionen bezogen, an dieser und anderen Bewegungen teilnahmen oder davon auf Abstand gingen, wie Literaten über Grenzen hinweg Themen der Kultur, Politik, Philosophie, Ästhetik und Ethik diskutierten, die langfristig wichtig waren, wie sie einander kritisierten oder bestärkten, wie sie schrieben und handelten, vergegenwärtigt das Buch mit zahlreichen aussagekräftigen Zitaten, mit Analysen, Interpretationen und aktuellen Schlussfolgerungen.
Das dargestellte Gebiet war bisher kaum erforscht. Eine internationale wissenschaftliche Tagung »Surrealismus in der deutschsprachigen Literatur« hat noch 2008 den Untersuchungsbedarf bestätigt. 2016 zeigte eine Sammlung interdisziplinärer Studien »Surrealismus in Deutschland (?)« mit dem Fragezeichen im Titel die anhaltenden Zweifel. Für einen großen und entscheidenden Teil des Gebiets bringt das vorliegende Buch erstmals detaillierte und umfassende Erkenntnisse.
Diese Untersuchung entwickelt aus dem französischen Surrealismus dessen theoretische Konzeption, befasst sich mit Empfänglichkeiten und Hindernissen für deren Verständnis in Deutschland und wendet die erschlossenen Kriterien auf mögliche Entsprechungen in der fiktionalen deutschen Literatur der Zeit an. Dabei werden auch frühere Texte, ihre Tendenzen und Zusammenhänge beachtet. In den Blick kommen Werke von Walter Benjamin, Iwan Goll, Claire Goll, Hermann Hesse, Paul Gurk, Gottfried Benn, Alfred Döblin, Hans Henny Jahnn, Franz Kafka, Alfred Kubin, Gustav Meyrink, Georg Heym, Hugo Ball, Carl Einstein, George Grosz im Kontext der zeitgenössischen Aussagen und Absichten vieler weiterer Autoren und Autorinnen.
Eine nachhaltig wirkende ästhetische, philosophische und politische Bewegung wird aus diesen Reaktionen, Kommentaren oder Diagnosen besser verständlich und neu wahrnehmbar.
PASSAGE
Den Surrealismus als ästhetische, philosophische und politische Bewegung hat es im deutschsprachigen Bereich bis 1945 nicht gegeben; auch nicht im Exil, und ob danach, steht durchaus nicht fest, wenn wir mehr erwarten als Analysen, Ansätze und Versatzstücke. Eine Bewegung, die heftige Rationalismuskritik von einer weitgehend materialistischen Weltanschauung her betrieb, die sich dem materiellen Fortschritt widersetzte zugunsten progressiven sozialen Engagements, die Ideologien, Idealismen und Abstraktionen attackierte, um für das Konkrete und die Erfahrung einzutreten, die den radikalen Anspruch erhob, die Kunst ins Leben einzubringen, emanzipatorisch, je nachdem frontal oder subversiv gerichtet gegen feste Ordnungen, Hierarchien, Systeme, die Macht des Kapitals, des Staates und jede andere, gegen Kommerz und Leistungsprinzip, im Widerspruch zu Vorurteilen und Beschränktheiten, und dies bedacht naiv im Namen der Freiheit und der Liebe; deren exzessiver Erkenntnisdrang entlegene Schichten des Unbewussten und fremde Bereiche der Zivilisation einem neuen Wahrnehmen erschloss; die angesichts der Apokalypse an einer lebenswerten Welt arbeitete, eine verantwortliche Mythologie entwarf, dem Glücksbedürfnis ihren ästhetischen Begriff des Wunders anbot, die ihre alltäglichen Utopien als permanente Provokationen inszenierte – dieses historische Ereignis hat sich in der Folge des französischen »Manifests des Surrealismus« von 1924, verfasst von André Breton, international ausgewirkt, ohne die deutsche Kultur mehr als flüchtig zu berühren. Dies trifft für die Malerei, das Theater und den Film ebenso zu wie für die Literatur.
Bestand hierzulande kein Bedarf? Fehlte das Verständnis? War die Situation der Kulturschaffenden, der Kritiker oder Rezensentinnen sowie des Publikums in der Weimarer Republik nicht danach? (Von Österreich, der Schweiz, der Tschechoslowakei und Luxemburg müsste eigens die Rede sein, und mit dem Nationalsozialismus kam ein kultureller Bruch.) Zwar war der Expressionismus gerade erst für überholt erklärt, als literarische Richtung ein speziell deutsches Phänomen; zwar auch formulierte die Neue Sachlichkeit zu ihm eine konstruktive Antithese, und dazwischen hatten deutsche Autoren und Autorinnen den Dadaismus lanciert, dessen Potenzial anderwärts im Surrealismus aufging. Aber über ihre Parallelen, Vorläufer und Alternativen war die surrealistische Avantgarde doch schon weit hinaus.
Im Naturalismus, im Symbolismus (beziehungsweise in der »Neuromantik«), im Impressionismus und noch im Expressionismus (über die Malerei) hatte die deutsche Kultur sich von der französischen inspirieren lassen. Obwohl sogar während des Weltkriegs die Pazifisten, der sozialistische Internationalismus und die Expansion des Medienwesens die kulturellen Kontakte zwischen den Ländern diesseits und jenseits des Rheins verbessert hatten, erzielte der Surrealismus kein vergleichbares Interesse mehr. Unter denen, die ihn zur Kenntnis nahmen, waren diejenigen noch einmal in der Minderheit, die etwas mit ihm anzufangen wussten.
Bezeichnenderweise hatten die französischen Surrealisten ihrerseits eine Vorliebe für deutschsprachige Kultur; eine ihrer erklärten Quellen war die deutsche Romantik, sie bezogen sich auf Hölderlin und Nietzsche und machten Kafka in Frankreich bekannt. In dieser Reihe steht schließlich der (missverstandene) Lehrmeister Freud.
Allerdings gibt es in der deutschen Literatur einen Surrealismus avant la lettre, und während des fraglichen Zeitraums 1924–1933 einzelne eigene surrealistische Elemente und Werke.
Die Anfänge des Surrealismus liegen in einer Zeit des offensichtlichen Verfalls der Gewissheiten. Diese »crise de conscience«1 soll zu ihrem Bewusstsein kommen, zur »conscience nouvelle«2. Denn die Aufklärung fällt der Skepsis anheim, die Wissenschaft ist weniger nachvollziehbar denn je, Ideologien erweisen sich als mörderisch, die Technik verselbstständigt sich in der Technokratie, der wirtschaftliche, soziale und moralische Fortschritt ist abwegig oder zumindest unsicher, Werte sind verdinglicht, die Religion ist diskreditiert, das Individuum muss sich zurücknehmen, Sprache wird als kommunikationsstörend erfahren. Wenn die Geschichte des Surrealismus geschrieben wird, begegnen in ihr Mentalitäten, differenzierbare, die durch diesen Kontext geprägt sind. Dabei wäre die Frage zu beantworten, wie und wie weit zwischen Ressentiment, Missverständnissen und Faszination jene Bewegung zur eigenen werden konnte.
Es ginge nach einer gescheiterten Revolution um den entsprechenden Gemütszustand der kulturell Arbeitenden in Deutschland, um Sachlichkeit und neue Illusionen, um verschärfte wirtschaftliche Krisen bei wachsendem gesamtgesellschaftlichen Reichtum, um die verstärkte Sehnsucht nach Identität. In den Blick käme das jeweilige Verhältnis zu Progressivität, Anarchie, Konstruktion und Provisorium. Zu reden wäre von den Beziehungen zwischen Kunst und Politik, Fantasie und Aktion, Avantgarde und Zeitgeist, Analyse und Kommunikation, Experiment und Hoffnung. Ein bestimmbares Wahrnehmen der Umwelt, des Alltags, des Zufalls, der Bilder, der Sprache, der Psyche, von Grenzzuständen würde bewusst. Wir kämen darauf, wie solches Wahrnehmen sich zwischen Vernunft, Mythos und Utopie in der Lebenspraxis auswirkt.
Was Surrealismus bedeutet, ist nicht einfach aus den Manifesten Bretons abzuleiten. In diesen wird die Sache auch schon dogmatisch im Sinn einer exklusiven Gruppe verengt, paradoxerweise, da die proklamierten Intentionen der Befreiung dem zuwideriaufen; immerhin spricht daraus, wie wichtig den Surrealisten ihr Vorhaben war. Die Theorie wird die Möglichkeiten, die im Surrealismus stecken, wahrzunehmen versuchen und damit so verfahren wie der Surrealismus selbst. Sie ist jeweils synthetisch und hypothetisch aus dem Material zu gewinnen; im Gegenzug ist dieses mit ihr zu kritisieren, sodass weitere Aspekte frei werden.
Ich schlage diesen Parcours vor: Ausgangspunkt ist eine gesellschaftliche Standortbestimmung der Literaten deutscher Sprache, die sich mit dem Surrealismus zusammenbringen lassen, nach Verhalten, eigenen Aussagen und den Aussagen anderer. Wir verfolgen hier bereits historisch Wege durch die Epoche, deren wechselnder Zeitgeist genauer zu beobachten ist. Dabei holen wir weiter aus, um uns mit den Mentalitäten zu befassen, auf die der französische Surrealismus trifft; schließlich um das Bewusstsein von der europäischen Kultur, Zivilisation und Geschichte überhaupt einigermaßen zu klären. Nachdem dieser Horizont abgesteckt ist, begleiten wir die Autoren beim Vorgehen, einzeln, sich mit anderen konfrontierend, gemeinsam, in ihrem eigensten Beruf, dem Schreiben: Die Kunst steht da auf dem Spiel. Jetzt geht die Theorie in die Details, in die der surrealistischen Ästhetik, welche sich von Anfang an zur Praxis wendet. Dispositionen werden individualpsychologisch verfeinert, und spätestens wo das Gedächtnis sich meldet, sind wir wieder in der Geschichte. Wir halten noch einmal inne, nehmen Abstand – die Philosophie, die durch die Erfahrung kommt und in sie zurückkehrt, hat das Wort. Was wird es bewegen ...?
Surrealismus in der Literatur, dazu würden auch Texte über die Malerei des Surrealismus gehören; von ihnen ist im Folgenden einmal abgesehen, wenn sie nicht von Schreibenden stammen, die sich mit surrealistischer Literatur beschäftigen.
Auf die deutschsprachige surrealistische Literatur der Zeit bis 1933 gehen wenige Sekundärtexte explizit und ausführlich ein. Der erste vielleicht in der Zeit selbst ist ein Artikel von Felix Weltsch in der Literarischen Welt zu Franz Kafkas Metarealismus3. In Kenntnis des französischen Surrealismus setzt sich dann Ernst Bloch mit der auch literarisch praktizierten Philosophie Walter Benjamins als surrealistischer auseinander.4 1940 erscheint in der Zeitschrift Helicon ein Beitrag des nach Schweden emigrierten gebürtigen Österreichers Ernst Alker mit dem Titel Deutscher Surrealismus, weitgehend im Geist nationalsozialistischer Germanistik5; der Begriff ist abgegrenzt gegen den französischen Surrealismus und bezeichnet eine mystische, mythische, metaphysische, meistens der Scholle verhaftete, jedenfalls irrationale Literatur, unter die, neben anderen, Autoren wie Georg Trakl und Gerhart Hauptmann fallen sollen. Gertrud Paffraths Dissertation Surrealismus im deutschen Sprachgebiet von 19536 untersucht das Phänomen etwas oberflächlich, kann aber auch über wichtige Quellen nicht verfügen. Dann gibt es Renate Böschensteins Artikel Éléments surréalistes dans la littérature allemande du XXe siècle in den Études littéraires (1970)7; die Verfasserin interessiert sich besonders für die Sprache Kafkas. Ansonsten liegen allgemeiner Studien zur Avantgarde vor und spezieller Aufsätze zu Aspekten bei einzelnen Autoren8 sowie zahlreiche Arbeiten, die mehr oder weniger ausführlich die Surrealismus-Rezeption Benjamins behandeln.
Um sich dem Surrealismus hier und jetzt anzunähern, sind einige Bestimmungen angebracht. Einmal zum Begriff der Fantastik. Sie sieht von der außer ihr bestehenden Wirklichkeit ab oder ist formelhaft in sie eingefügt. Bei ihr kommt es auf poetische Freiheit einerseits, andererseits auf ästhetische Wirkung an. Die These des L'art pour l'art ist eine formale Konsequenz aus dem fantastischen Prinzip. Eine realitätsnähere ist die der Groteske.
Idealismus und krasser Ideologie hingegen nehmen die vorgegebene Wirklichkeit nach einer konventionellen Konzeption wahr und wollen sie in Harmonie mit dieser bringen. Eine verändernde Wirkung kann beabsichtigt sein, Erkenntnis allerdings ist eingeschränkt.
Strukturell zu unterscheiden ist die Mystik dadurch, dass sie sich, noch ähnlich der Wissenschaft, registrierend und spekulativ sowohl vom konkret Fassbaren als auch von der Aktion entfernt.
In der Fantastik, im Idealismus und in der Mystik ist eine Dialektik von Ästhetik, verstanden als Theorie und Praxis des Wahrnehmens, einerseits, andererseits von Poetik, verstanden als Theorie und Praxis des Konkretisierens, nicht vorgesehen. Die Mystik steht dem Surrealismus, der sich diese Dialektik zur Aufgabe macht, näher als die Fantastik, der Idealismus ferner.
Surrealismus ist die ästhetische Praxis eines von der konkreten Wirklichkeit ausgehenden, emanzipatorischen Interpretierens – keine neue »Kunst«, sondern zuallererst eine vielleicht alte Ästhetik: ein besonderes, wirksames Wahrnehmen.
»Hier wurde der Bereich der Dichtung von innen gesprengt, indem ein Kreis von engverbundenen Menschen ›Dichterisches Leben‹ bis an die äußersten Grenzen des Möglichen trieb.« (Walter Benjamin)
1 »Bewusstseinskrise«, André Breton, Second manifeste du surréalisme (1929), Paris 1930, wieder in: ders., Manifestes du surréalisme, Paris 1962 (im Folgenden abgekürzt SM), S. 153
2 »Neues Bewusstsein«, ebd. S. 193
3 Die literarische Welt (im Folgenden abgekürzt LitW) 23/1926, S. 4. (Zeitschriften sind hier in der Regel mit der Nummer der Ausgabe, Jahr und Seite zitiert.)
4 Ernst Bloch, Revueform in der Philosophie, in: Vossische Zeitung 1.8.1928, verändert in: ders., Erbschaft dieser Zeit, Zürich 1935, wieder: Frankfurt 1973, S. 368 ff.
5 Helicon, Amsterdam/Basel, 3/1940, S. 111 ff.
6 Diss. masch. Bonn/Köln 1953
7 Études littéraires, décembre 1970, S. 283 ff. (übersetzt)
8 Z. B. Jan Bürger, »Paris brennt«. Iwan Golls Überrealismus im Kontext der zwanziger Jahre, in: Friederike Reents (Hg.), Surrealismus in der deutschsprachigen Literatur, Berlin 2009; Klaus H. Kiefer, Carl Einsteins Surrealismus – »Wort von verkrachtem Idealismus übersonnt«, in: Karina Schuller / Isabel Fischer (Hg.), Der Surrealismus in Deutschland (?), Münster 2016
Eine Passage verbindet Louis Aragons Paysan de Paris und den Leser Benjamin, dessen Werk offen ist. Passieren wir ins Offene, zunächst in die
POLITIK,
die surrealistische Öffentlichkeit.
GESELLSCHAFTLICHE STANDORTE DER LITERATEN Zwischen Engagement und Rückzug
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges fanden sich Schriftsteller aus Deutschland und Österreich, Pazifisten, Demokraten, Internationalisten, im schweizerischen Asyl zusammen. Aus ihrer Mitte startete 1916 Dada seine defätistischen Attacken gegen Staat und Bürgerlichkeit. Hugo Ball, der Initiator, stammte aus einem Unternehmerhaus, hatte zur Ausbildung in einem Ledergeschäft gearbeitet, dann Regie und Dramaturgie an Max Reinhardts Schauspielschule gelernt, auch Germanistik, Geschichte und Philosophie nicht zu Ende studiert, Nietzsche, Krapotkin und Bakunin gelesen9; trotz seiner Sympathien für den Anarchismus sagte er von sich: »Niemals würde ich das Chaos willkommen heißen«10. Den Auftritten des Cabaret Voltaire kam zustatten, dass Ball und seine Gefährtin Emmy Hennings mit einer Variététruppe getingelt hatten: ein volkstümliches und auf spontane Wirkung bedachtes Gewerbe. In dieser Zeit arbeitete Ball an einem »phantastisch-pamphletistischmystischen« Roman11(Tenderenda der Phantast12). Ernst Bloch, Beamtensohn, hielt sich nach seinem Philosophiestudium von 1916 bis 1920 in der Schweiz auf und traf in Bern mehrmals mit Ball zusammen13. Er schrieb an dem religiös-kommunistischen Geist der Utopie14; dazu Bali: »Ich lese jetzt Blochs Hexenbuch [...], das mich sehr interessiert. Ein Jude von großem Format ...«15 Beide veröffentlichten seit 1917 wie Clara Studer (später mit dem Namen Claire Goll) und Iwan Goll Artikel in Die Freie Zeitung – Unabhängiges Organ für demokratische Politik, Bern, deren Veriagsieitung Ball übernahm. Der Freie Verlag, der das Blatt herausbrachte, erklärte 1918, er hoffe, »zum internationalen Verständnis und zur politischen Emanzipation beizutragen«16.
Ball und Hans/Jean Arp, gebürtiger Elsässer, machten die Bekanntschaft von Hermann Hesse, der bereits 1912 in die Schweiz übergesiedelt war und als angesehener Autor von dort seine Aufrufe zu Frieden und Völkerverständigung an die Medienöffentlichkeit richtete (über die Neue Zürcher Zeitung und andere Blätter)17. Hesse war kein Parteigänger, seine humanitäre Haltung wirkte sich in der Publizistik für Kriegsgefangene konkreter aus.
Iwan (auch Ivan, Yvan) Goll, mit dem Geburtsnamen Isaac Lang, aus einer Textilkaufmannsfamilie in Saint-Dié, Elsass-Lothringen, Doktor der Rechte durch eine Dissertation über die lothringisch-elsässischen Heimarbeiterinnen, blieb in der Schweiz abseits der Dadaisten-Gruppe und weiterhin der expressionistischen Bewegung verbunden. Zu seinem Schweizer Bekanntenkreis gehörten unter anderen Hesse, Arp, der andere Elsässer Landsmann René Schickele, Stefan Zweig, Carl Sternheim, James Joyce. Seine Élégies internationales. Pamphlets contre cette guerre wurden 1915 in Lausanne in der Reihe Cahiers expressionistes publiziert, ein Requiem für die Gefallenen von Europa, das er Romain Rolland widmete, erschien 1917 in Genf und Zürich sowie als Requiem pour les morts de l'Europe, zusammen mit Claire Goll übersetzt. Sie, die damals noch Clara Studer hieß, stammte aus Bayern und ebenfalls aus einer bürgerlichen Familie und war Studentin der Philosophie in Genf, als das spätere Ehepaar sich in diesem Jahr kennenlernte. Von beiden erschienen im folgenden Jahr auf Deutsch geschriebene Bücher im Verlag von Franz Pfemferts Aktion (Clara Studer: Mitwelt, Lyrik, darunter engagierte Gedichte wie Arme Mädchen singen, Arbeiterinnen; Iwan Goll: Der neue Orpheus, Lyrik).
In der Münchner Zeitschrift Simplicissimus waren vor dem Krieg die Erzählungen des Bankkaufmanns Gustav Meyrink gedruckt worden, zum Teil ätzende Satiren gegen Militär und Bürokratie. Der an der bayerischen Räterepublik beteiligte anarchistische Literat Erich Mühsam berichtete später, die Texte Meyrinks hätten »die Phantasie der geistig bewegten Jugend mächtig« angeregt und jedesmal »für etliche Abende Diskussionsstoff« geboten.18 George Grosz, aus einer Gastwirtsfamilie, seit 1915 mit Grafik, Lyrik und dadaistischem Spektakel hervorgetreten (im Umkreis der Aktion und Wieland Herzfeldes Neuer Jugend), stellte sich während der Revolution von 1918/19 in Berlin an die Seite der Spartakisten. Mitglied des Soldatenrats war Carl Einstein, Sohn eines Religionslehrers und zunächst Kriegsfreiwilliger, 1918 in Brüssel – wo er Gottfried Benn und Sternheim kennenlernte – und 1919 in Berlin. Mit Grosz gab er 1919/20 die satirische Wochenschrift Der blutige Ernst heraus. Einstein hielt sich seit 1907 oft in Paris auf. Er musste sich wegen Gotteslästerung in seinem dramatischen Text Die schlimme Botschaft19 verantworten (1922). Für die Revolution trat auch Alfred Döblin ein, ebenfalls Kaufmannssohn, tätig als Neurologe und Psychiater, als Arzt im Krieg gewesen; er schloss sich der sozialistischen Partei USPD an, blieb dort bis 1920 20, war dann von 1921–30 Mitglied der SPD. Sein Buch Berlin Alexanderplatz21 sollte einen sozialen Außenseiter zum Helden haben, der sich anspruchslos in die Gesellschaft einordnet. Von der Tabula rasa des Dadaismus hatte sich 1917 schon Hugo Ball abgesetzt, um Kulturkritik zu betreiben, in der sein religiöses Interesse immer mehr durchschlug.22 Währenddessen machte Hans Arp noch mit Max Ernst in Köln Skandal; bald sahen die Letzteren wie die Golls ihre Zukunft in Frankreich.
Zu Iwan Golls satirischem Drama Methusalem oder Der ewige Bürger, das nach einer Reihe von politischen Sprechstücken und Einaktern entstand (Maskenball. Eine Szene in Die Aktion23; Explosion. Ein Akt in Die neue Schaubühne24; Lassalles Tod 1922) und von Georg Kaiser eingeleitet wurde, trug Grosz die Illustrationen der Druckausgabe im Verlag Kiepenheuer 192225 bei sowie mit John Heartfield die Bühnenausstattung der Berliner Uraufführung 1924 am Dramatischen Theater unter der Regie von Friedrich Neubauer26. In dem Stück agieren die typisierten Figuren des Kapitalisten, Frau, Sohn und die Tochter, deren Liaison mit einem Bolschewiken den Klassenkonflikt auf der familiären Ebene vorführt; nach Streik, Wirtschaftskrisen und Duell behauptet der Unternehmer das Feld. An Wladimir Majakowski schrieb Goll: »Für das wichtigste Stück des ›Nouvel Orphée‹ halte ich ›Mathusalem‹27, ein revolutionäres Drama, das durch die Groteske aufreizend wirkt, gegen den ›Ewigen Bürgen.«28 Das Publikum reagierte begeistert, wusste jedenfalls den Unterhaltungswert des Methusalem zu schätzen.29 Großkritiker Alfred Kerr sah die Wirkung entsprechend:
»Ein begabter Kerl hat hier Fetzen, Einfälle, Brocken, Flocken, Schnitzel, Splitter hingeschmettert – worin sein Ekel vor der Bürgerweit [...] – sehr ulkig, roh, sorgenfrei, zusammenhanglos gellt, bumst, wiehert, knallt, rülpst und – . Man lacht oft entsetzlich, [...] Goll ist, jenseits vom Hingehauenen, ein feiner Geist. [...] Vorläufig gibt er ein vorläufiges, ein mutiges, ein gelächterhaltiges Plakat. Man könnte das zweimal sehen. [...] Keiner [von den Schauspielenden] stört, weil sie sämtlich das Parkett stören.«30
Ein Zusammenhang ist wohl da, nur kommt es auf ihn kaum an, er darf beim gebildeten Publikum als bekannt vorausgesetzt werden: nämlich der Zusammenhang zwischen Ökonomie, Staat, Klassen, Familie, Moral. Wichtiger als Abbildung, subtile Einsichten oder modellhafte Handlung war dem Autor der »aufreizende« Effekt, von dem nach dem Theaterabend allerdings wenig mehr geblieben sein dürfte als ein Verlust an Respekt (vor Autoritäten), deshalb, weil die »revolutionäre« Rolle der Zuschauer im Stück kein Thema ist. An der Drastik des Eindrucks war die Inszenierung von Neubauer, im Sinn des Autors, nicht unerheblich beteiligt31. »Vorwärts mit einem Hymnus32, aber auch die wunderbarsten Unflätigkeiten der reaktionären Presse«, berichtete Goll weiter. »Alles in allem fühle ich, dass das Stück eben doch 4 Jahre zu spät kommt.«33 Eine auf längere Dauer aufrührerische, wenn auch ungerichtete Wirkung war gerade den scheinbar unpolitischen (nicht eindeutig politisch motivierten), weniger grotesken als surrealistischen Elementen und Szenen des Dramas zuzutrauen.34
Nachdem Iwan Goll 1920 eine Anthologie französischer Freiheitslyrik (Das Herz Frankreichs) herausgegeben hatte, schilderte seine Erzählung Germaine Berton. Die rote Jungfrau (in der Verlagsreihe Außenseiter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegenwart35) 1925 das Vorgehen einer jungen Attentäterin gegen Nation und Krieg: »Da ist die Anarchie. [...] Keine Politik, direkte Tat. Es ist nur eine Illusion. Aber sie tröstet.«36 Claire Goll veröffentlichte die sozialkritischen Romane Der Neger Jupiter raubt Europa37 und Ein Mensch ertrinkt38.
Bei der Rezeption des französischen Surrealismus musste von seinen politischen Absichten die Rede sein. Wie sich dies in einer Ära ernüchterter Sachlichkeit und zugleich des rauschhaften Lebensgenusses anhören konnte:
»Soziologisch ist der Suprarealismus uninteressant. Politisch fällt ihm nichts weiter ein als der doch recht verbrauchte und reizlos gewordene Aufruf zur Revolution.«39
Den Romanistikprofessor Ernst Robert Curtius interessierte 1926, dass diese »geistige Bewegung« Fragen der »Weltanschauung« aufwarf. Entgegen dem Verdacht, bei ihm sei einmal mehr das traditionell deutsche Unverständnis der Geistigen für die Politik aufzuweisen, hat Curtius sich des Öfteren wissend zu Problemen der europäischen Politik geäußert. Zuzugestehen ist auch, dass die surrealistische Konzeption von Politik: durch eine neue Ästhetik die Lebenspraxis auf allen Gebieten emanzipatorisch zu verändern, nicht sofort und ohne Weiteres zu erkennen war.
Sympathie für die »Plötzlichkeiten« eines Louis Aragon wollte wiederum der Kunst- und Literaturkritiker Otto Grautoff nicht verhehlen, denn sie sind »amüsant«:
»Seine unter dem Titel ›Le Libertinage‹ vereinigten [...] Entwürfe sind von blasphemischem Zauber, schlagen dem bürgerlichen Empfinden ins Gesicht.«40
Die Revolte ist als eine auf das Gebiet der Kunst und des Kunstempfindens beschränkte gesehen; zwar ist nicht gesagt, wie weit sich die Einflüsse des Künstlerischen erstrecken, doch droht der Angriff auf das Bürgerliche in dieser Form keinen Schaden anzurichten, er ist immer noch als poetische Fiktion zu genießen.
»Mann der Tat? Lebensspieler? Weltflüchtig? Direktor? Dichter? Elegant? Neger? Revolutionär? Jedes könnte sein. [...] Auch fehlt noch das Vertrauen in den Bestand einer Gesellschaft [...]. Sie behaupten, Ihr Drang, frei zu sein im Handeln und im Denken gehe bis zur Tyrannei und bis zur Zerstörung. Sie wissen dies klarer als viele junge Zeitgenossen, - die auch hauptsächlich frei sein möchten von sich selbst, dieser überkommenen Beschränkung ihrer Persönlichkeit, Nationalität und Erde.«
Heinrich Mann, der diese Sätze an Philippe Soupault richtete41, war imstande, den surrealistischen Impetus in seiner ganzen Durchschlagskraft wahrzunehmen, mit seinem Hang zur Aktion, seiner Gefahr destruktiver Absurdität. Er sah im Lebensstil des anderen Autors zugleich den Ausdruck eines Zeitgeists der Beliebigkeit inmitten des Verfalls sozialer, ökonomischer, weltanschaulicher, künstlerischer, ethischer, politischer Werte. Den Anspruch auf Freiheit, der sowohl Ursache als auch Folge solchen Zeitgeists ist, weitete Mann schließlich ins Existenzielle. Dessen Raum ist auch der, den sich die Surrealisten bewusst zu machen suchen. Doch ist es als Absolutes kaum noch mit der politischen Praxis zu vermitteln, die für Mann unverzichtbar war.
Walter Benjamin, während seiner Berner Promotion Wohnungsnachbar von Hugo Ball, wurde von diesem 1919 mit Bloch zusammengebracht; damals nicht zu publizistischem Engagement zu bewegen, verfasste er nach der Lektüre des Geistes der Utopie sein Theologisch-politisches Fragment42. Die Skandale gehörten auch für ihn zum Ersten, was seine Aufmerksamkeit auf die Surrealisten lenkte (1926)43. In den Jahren 1926 und 1927 hielt Benjamin sich in Paris auf und konnte sie näher beobachten. Nach Überlegungen zu deren Psychologie und Kunsttheorie arbeitete er 1929 im Aufsatz Der Sürrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz in der Literarischen Welt44 die politische Dimension und Dynamik der Bewegung heraus.
Seine Basis ist die eines »anthropologischen Materialismus«45. Auf ihr ist es die objekthafte Welt, die durch die »profane Erleuchtung«46 im menschlichen Leben die revolutionäre Geschichte voranzutreiben vermag. Der »Sürrealismus [...] zuerst stieß auf die revolutionären Energien, die im ›Veralteten‹ erscheinen«47, in den »Dingen«, die als »versklavte und versklavende«48 auf die sozialen Verhältnisse verweisen und durch ihre Spannung zwischen Damals und Jetzt den geschichtlichen Prozess verdeutlichen, an denen zudem der »politische« »Blick [d..e.]m, alle Intimitäten zugunsten der Erhellung des Details fallen«49, das Unbewusste zum Bewusstsein bringt, während sie sich dem aktuellen Handeln zur Disposition stellen.50 Dieser Sachverhalt entscheidet über die Lebenspraxis; in ihr vollzieht sich die »dialektische [...] Umwandlung einer extrem kontemplativen Haltung in die revolutionäre Opposition«; dabei »spielt die Feindschaft der Bourgeoisie gegen jedwede Bekundung radikaler geistiger Freiheit eine Hauptrolle. Diese Feindschaft drängte den Sürrealismus nach links.«51 Zunächst in den Anarchismus.
»Seit Bakunin hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben. Die Sürrealisten haben ihn. Sie sind die ersten, das liberale moralisch-humanistisch verkalkte Freiheitsideal zu erledigen«.52
Ihre Freiheit hat damit begonnen, dass die Dinge frei aussahen. Und sie will nicht allein eine »geistige« bleiben. Benjamin fragt, die Problematik der Surrealisten auf die kollektive erste Person beziehend:
»Gelingt es ihnen, diese Erfahrung von Freiheit mit der anderen revolutionären Erfahrung zu verschweißen, die wir doch anerkennen müssen, weil wir sie hatten: mit dem Konstruktiven, Diktatorischen der Revolution? Kurz – die Revolte an die Revolution zu binden?«53
Als »eigenste Aufgabe« des Surrealismus formuliert Benjamin, »die Kräfte des Rausches für die Revolution zu gewinnen«54. Rausch, Anarchie, Unbewusstes gehören hier zusammen. Den Akzent ausschließlich auf die anarchische Komponente im revolutionären Akt zu setzen,
»das hieße die methodische und disziplinäre Vorbereitung der Revolution völlig zugunsten einer zwischen Übung und Vorfeier schwankenden Praxis hintansetzen.«55
Derart bestimmt Benjamin den Ort, an dem das Bewusstsein konstruktiv in die spontanen »öffentlichen Manifestationen«56 des Unbewussten einzugreifen hat.57 Das Verhältnis beider wird dialektisch sein – deshalb ist der »dichterischen Politik« romantischer Tradition eine Absage zu erteilen58; sie ist einem weltfremden Idealismus verfallen.
»Wo liegen die Voraussetzungen der Revolution? In der Änderung der Gesinnung oder der äußeren Verhältnisse? Das ist die Kardinalfrage, die das Verhältnis von Politik und Moral bestimmt Der Sürrealismus ist ihrer kommunistischen Beantwortung immer näher gekommen.«59
Welche von der faktischen Wirklichkeit ausgeht, »die moralische Metapher aus der Politik herausbefördern und im Raum des politischen Handelns den hundertprozentigen Bildraum entdecken« will60. Der Bildraum ist – jenseits punktueller Standorte – der poetische, zu gestaltende, ferner utopische. Er öffnet sich im politischen Handeln, während er ihm seinen Sinn gibt. Nur in ihm ist dem Kollektiv jene Physis zu erzeugen, die das Plus des anthropologischen Materialismus gegenüber dem metaphysischen ist. Die surrealistische Aktualität schlägt Benjamin schließlich sehr hoch an:
»Erst wenn [...] sich Leib und Bildraum so tief durchdringen, daß alle revolutionäre Spannung leibliche kollektive Innervation, alle leiblichen Innervationen des Kollektivs revolutionäre Entladung werden, hat die Wirklichkeit so sehr sich selbst übertroffen, wie das kommunistische Manifest es fordert. Für den Augenblick sind die Sürrealisten die einzigen, die seine heutige Order begriffen haben.«61
»Die Zeit in diesem Bildraum ist nicht mehr die des Fortschritts«, bemerkte Benjamin in seinen Manuskripten dazu62. Was der Einsatz ist, um den es ihm in der Revolution geht, erhellt aus dem Text Feuermelder der Einbahnstraße (1928, Rowohlt)63: Es ist nicht weniger als »Bestand oder das Ende einer dreitausendjährigen Kulturentwicklung«64.
»Ist die Abschaffung der Bourgeoisie nicht bis zu einem fast berechenbaren Augenblick der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung vollzogen (Inflation und Gaskrieg signalisieren ihn), so ist alles verloren. Bevor der Funke an das Dynamit kommt, muß die brennende Zündschnur durchschnitten werden.«
Die Gegenseite ist, wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, zerstörerisch und bereit, alles in den Abgrund zu reißen. Nach Benjamin müssen die revolutionären Energien rechtzeitig in eine andere Richtung wirken.
»Daß Benjamin die Welt aus ihrem Traum wecken will, beweisen einige radikale Aphorismen der ›Einbahnstraße‹. [...] Die im Barockbuch65 verwandte Methode der Dissoziierung unmittelbar erfahrener Einheiten muß, auf das Heute angewandt, einen wenn nicht revolutionären, so doch sprengenden Sinn erhalten. In der Tat ist die Sammlung reich an Detonationen. [...] Zur vollen Wirklichkeit dränge Benjamin erst durch, wenn er die reale Dialektik zwischen den Elementen der Dinge und ihren Figuren, zwischen den Konkretionen und dem Abstrakten, zwischen dem Sinn der Gestalt und der Gestalt selbst entspönne«66,
schrieb Siegfried Kracauer als Kritiker der liberalen Frankfurter Zeitung über seines Kollegen literarische Probe auf die Surrealismus-Theorie. Was er als Mangel feststellt, ist gerade essenziell für Benjamins Surrealismus, dessen Erkenntnisse (der Bildraum) hier im Akt des Schreibens so konkretisiert (physisch geworden) sind, dass sie in der Öffentlichkeit ein Maximum an zielgerichteten Spannungen aufbauen. Diese Konstruktion (die mehr als »Entlarvung« ist67) ist provisorisch, Ergebnisse werden nicht durch Erklärungen vorweggenommen. Auf Wirklichkeit hin zu entladen, zu interpretieren wären die Texte von ihren Lesern und Leserinnen, in einem von der vereinzelten Lektüre in das kollektive Handeln umschlagenden Vorgang. Der literarische Text ist auch diesmal weder Abbild noch Modell, sondern ein sich dem Erfahren erst dialektisch erschließendes Potenzial an Energie, die verwertbare Erkenntnisse generiert. Nicht umsonst beginnt die Einbahnstraße mit der Tankstelle, und der Sürrealismus-Aufsatz mit dem Bild von Strömungen, Gefälle und Kraftstation. Die Schwäche von Benjamins Versuch liegt hingegen auf einer Ebene, die auch die von Kracauers Aktivitäten ist, der abgehobenen des literarischen Diskurses, die sich den öffentlichen Realitäten nicht ohne Weiteres vermittelt. Geschriebenes verbleibt im Bereich des Fiktiven, seine faktische Wirksamkeit ist ungewiss – sie ist anderem Handeln überlassen.
Ähnlich wie Kracauer kritisierte Ernst Bloch:
»Sichtbar ist die anarchische Bedeutung und die Bedeutung sammelnder, im Zerfall wühlender, rettender, doch substantiell unausgerichteter Betroffenheiten.«68
Er, dem die Einbahnstraße »als Typ für surrealistische Denkart« stand69, vermisste nicht die analytische Theorie, sondern die »materiale Tendenz«: den »öffentlichen Prozeß« als geschichtlichen; auf den Benjamin keine andere Hoffnung setzte als die, dass er anzuhalten, aufzuheben sei. Dies bereitete er in seinen Schriften vor, in der Einsicht, durch die literarische Illusion eines solchen Stillstandes nicht vom faktischen Organisieren ablenken zu dürfen. Hingegen sah Bloch Geschichte und Politik zwar in einem kritischen Stadium, im »spätbürgerlichen Zustand« mit seinem »Nichts der bestehenden Macht«70; doch verwies er auf
»einige Elemente der heutigen Zersetzung dieses Bürgertums, welche dialektisch gebraucht der Tendenz manche Nova mitteilen: der Relativismus und die Montage aus Bruchstücken, die Hohlräume der ideologischen Leere, ja noch der Traum der Surrealisten, der in dieser Leere möglich ist.«71
Im historischen Hohlraum fällt nach Bloch den Surrealisten die Freiheit zu, ihren »Traum« umzusetzen, antizipatorisch in Aktion zu treten und die Geschichte auf eine humane Utopie hin zu entwickeln.
Die öffentliche Wirksamkeit der surrealistischen Literatur grenzte Benjamin (1930) von der des Journalismus ab, wobei er These und Antithese scharf herausstellte: Die Surrealisten hätten
»mit einer Gewalttätigkeit, die für Frankreich, für die Gesundheit seiner Intellektuellen zeugt, auf jene Vermischung von Dichtung und Journalismus reagiert, die in Deutschland zur Formel des Literaturbetriebs zu werden begonnen hat«, und »die innige Wechselbeziehung von Dilettantentum und Korruption, die die Basis des Journalismus bildet, durchschaut«72.
Ihre Reaktion sei gewesen, die »poésie pure« zu radikalisieren, die »esoterische Dichtung« als »eine geheime heilsame Praxis«. Der Surrealismus begab sich so in die oppositionelle Position äußerster Freiheit sowie höchster Ansprüche.
»Und von hier ist er weiter gegangen, die Sabotage in immer breitere Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens vorantragend, bis endlich die politische Richtigkeit dieser Haltung, ihre scheidende, mehr: ihre ausscheidende Gewalt offenkundig und wirksam wurden.«73
Das journalistische Tagesgeschäft kann solche durchschlagende Kritik Benjamin zufolge nicht leisten. Entsprechend kompromisslos war er, als er die Einbahnstraße vorlegte; ebenso im Sürrealismus-Aufsatz, der mit seinen esoterisch-poetischen Stellen selbst surrealistisch ist – doch den veröffentlichte Benjamin in Die literarische Welt, einer eher populären Zeitschrift, und die »Vermischung von Dichtung und Journalismus« konnte er sich kaum ersparen.74 Auseinanderzuhalten sind dennoch zum einen die Medien als Orte, Wege und Mittel demokratischer Kommunikation, zum andern die journalistische Pseudo-Öffentlichkeit, die Blick und Zugriff auf andere Realitäten blockiert.
Ein Feuilletonist indes war gänzlich anderer Ansicht als Benjamin. Der Luxemburger Frantz Clément, der zeitweise in Deutschland und ab 1924 auch in Frankreich lebte, schrieb im Tagebuch über Aragons Paysan de Paris75:
»Wenn ich die literarische Methode, nach der hier meisterlich gearbeitet wurde, charakterisieren muß, so geschehe das als blendende Mischung von Journalismus und Epik, wie wir sie immer dringender nötig haben.« (1927)76
Das Bedürfnis mochte in die Richtung einer sachlichen fiktionalen Literatur gehen, wie sie auch Berlin Alexanderplatz verwirklichte, einer Literatur, die durch Reportage und Dokumentation überzeugte und zugleich ihr Thema auf das Niveau eines künstlerischen »Realismus«77 erhob. In der Tat ist das dokumentarische Wahrnehmen der Umwelt Aragons surrealistischem Text und der genuin journalistischen Reportage gemeinsam. Was im Surrealismus hinzukommt, ist ein Interpretieren der Wirklichkeit, das über Sinnsysteme, Kunstideale und noch den Text selbst weitestmöglich hinausgeht.
Zur Presse, die der Surrealismus im deutschen Sprachbereich fand, zählte neben liberalen Tageszeitungen wie der Vossischen Zeitung und der Frankfurter Zeitung die erwähnte Literarische Welt als von Willy Haas geleitete und anfangs (seit 1925) vom Rowohlt-Verlag, dann (1928) von einem Konsortium aus Schriftstellern und Verlegern publizierte Wochenschrift, die 1928 eine Auflage von 28500 (davon 20000 Abonnements) erzielte, bevor die Wirtschaftskrise sie beeinträchtigte. In der Zeitschrift kamen Literaten verschiedenster weltanschaulicher Provenienz zu Wort, Erwin G. Kolbenheyer ebenso wie Axel Eggebrecht oder Benjamin mit seinen Thesen zum Kommunismus; allerdings war von aktueller Politik kaum die Rede. Nach Benjamins Urteil war »im Ganzen es auf ernsthafte Kritik darin nicht im Geringsten abgesehen« (1926)78. In der seit 1920 ebenfalls wöchentlich erschienenen linksdemokratischen Zeitschrift Das Tage-Buch, ab 1927 Das Tagebuch Stefan Großmanns und Leopold Schwarzschilds (mitgegründet von Ernst Rowohlt) fanden dagegen qualifizierte Politik- und Literaturkritik Platz. Die neue Rundschau als renommierte Kulturmonatsschrift des S. Fischer-Verlages, deren Redaktion Rudolf Kayser leitete, und die Neue Schweizer Rundschau unter Max Rychner als ihr Pendant veröffentlichten Essays von Ernst Robert Curtius zum Surrealismus. Daneben erschien Die Literatur (Deutsche Verlags-Anstalt), für die Otto Grautoff aus Frankreich berichtete. Er gab 1928–31 die Deutsch-Französische Rundschau mit heraus, die sich der Verständigung auf allen Gebieten der Kultur und der Politik widmete. Während des ersten Weltkriegs im Dienst der deutschen Kriegspropaganda, gehörte Grautoff, mit Thomas Mann befreundet, nichtsdestoweniger dem liberal-sozialdemokratischen, 1914/15 auf eine zwischenstaatliche Übereinkunft hinwirkenden, dann verbotenen Bund Neues Vaterland an, zusammen mit René Schickele, den er denunzierte79; 1933 war er unter den deutschen Emigranten. Zu nennen wäre noch Der Querschnitt, das mondäne Magazin unter der Regie Hermann von Wedderkops 880 (Ullstein, dann Propyläen-Verlag), das die Avantgarde von Kunst und Lebensstil in Wort und Bild präsentierte, auch im fremdsprachlichen Originaltext, und gelegentlich profundere Artikel (und Kafka-Texte) einschob.
Durch Blochs Utopie-Buch kam Klaus Mann, der sich zuvor schon publizistisch für Literatur und Pädagogik eingesetzt hatte, zum emanzipatorischpolitischen Engagement81





























