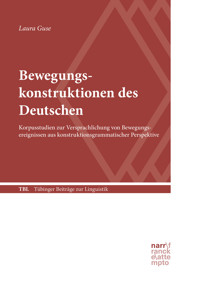
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Der Band zeigt anhand zweier Korpusstudien erstmals eine Bandbreite von Verben, die in Bewegungskonstruktionen des Deutschen auftreten können und kontrastiert diese Daten zu Versprachlichungsstrategien des Englischen und Schwedischen. Der Fokus wird auf bislang wenig systematisch erhobene Versprachlichungsstrategien gerichtet, wie etwa reflexive Konstruktionen (Sie kichern sich frisch verliebt durch die Gegend) oder Modalkonstruktionen (Sie wollen nach Hamburg). Aus Perspektive der Konstruktionsgrammatik wird die theoretische Frage aufgeworfen, wie die verschiedenen Konstruktionen auf dem Kontinuum zwischen Kompositionalität und Idiomatik zu verorten sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laura Guse
Bewegungskonstruktionen des Deutschen
Korpusstudien zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen aus konstruktionsgrammatischer Perspektive
Zugleich Dissertation am Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Hildesheim. Gutachterin: Professorin Dr. Ursula Bredel, Gutachter: Professor Dr. Ulrich Heid, Tag der mündlichen Prüfung: 11. November 2022.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381110322
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0564-7959
ISBN 978-3-381-11031-5 (Print)
ISBN 978-3-381-11033-9 (ePub)
Inhalt
Der Sprachwissenschaftler muß, wenn das Bild gestattet ist, Botaniker und Gärtner zugleich sein: er muß zur Herausbildung abstrakter und ideeller Blumentypen gelangen, doch nur, um damit das wechselvolle, vielschichtige und jedesmal überraschend neue Leben seiner lebendigen und wirklichen Blumen besser pflegen zu können; er muß Botaniker werden, um ein besserer Gärtner zu sein.
Coseriu [1952] 1975: 16
Dank
Eine der vielen seltsamen Eigenschaften von Wörtern ist, dass ihre Bedeutung verblassen kann. Das passiert vor allem dann, wenn man sie besonders oft benutzt. Das Phänomen des Verblassens der Bedeutung lässt sich auch bei dem Wort danke beobachten. Worte des Danks benutzt man bei den alltäglichsten Dingen: Beim Einkaufen an der Supermarktkasse, beim Versenden von E-Mails, beim gemeinsamen Essen. Danke, auf Wiedersehen! Danke gleichfalls! Vielen Dank und herzliche Grüße!
Und dann gibt es da diese Situationen, die sich so gar nicht alltäglich anfühlen, weil man sie vielleicht nur ein einziges Mal im Leben erlebt. Situationen, in denen die Diskrepanz zwischen dem, was man bekommen hat, und dem, was man sprachlich erwidern kann, so groß scheint. Dann bräuchte man ein Wort, dass sich etwas weniger blass anfühlt als danke. Man kann natürlich auf andere Wörter zurückgreifen und danke ein wenig anreichern. Ein Blick in das Wortauskunftsystem des DWDS zeigt, dass das eine beliebte Strategie ist: Man kann sagen: vielen, vielen Dank! oder auch ganz herzlichen Dank! oder lieben Dank! oder verbindlichsten Dank! Beliebt scheinen auch die Kombinationen mit tiefempfunden, aufrichtig, ausdrücklich, innig und überschwänglich zu sein. So richtig hilft das, meine ich, nicht.
Das Verfassen einer Danksagung für die Dissertation gehört zu diesen nicht-alltäglichen Situationen. Man wünscht sich ein Spezialwort, das das Gefühl der Dankbarkeit in angemessener Weise zum Ausdruck bringen kann. Leider habe ich keines und würde ich eines erfinden, so würde mich niemand verstehen. So sage ich also Danke! und hoffe, alle in dieser Danksagung Angesprochenen und meine Leser/-innen wissen, was ich damit formulieren möchte.
Mein Danke! geht an meine Betreuerin Prof. Dr. Ursula Bredel und meinen Betreuer Prof. Dr. Ulrich Heid. Danken möchte ich außerdem Prof. Dr. Katerina Stathi und Prof. Dr. Thomas Herbst. Ein Dankeschön gebührt außerdem PhD Gertrud Faaß und ihren Studierenden des korpuslinguistischen Praktikums. Danken möchte ich allen Promovierenden des Promotionskolloquiums unter der Leitung von Prof. Dr. Ursula Bredel und allen Korrekturleser/-innen: Christin Johnen, Iryna Honscharyuk, Louisa-Kristin Maiwald, Nina Streib, Wiebke Veddeler, Dorothee Wielenberg sowie Mark Döring. Danken möchte ich meinen Hilfskräften Julia Ryll und Michelle Woloszyn sowie der Hildegard-Henssler Stiftung für ihre Unterstützung.
Danke! rufe ich meiner kleinen Familie Juan Sebastian, Oskar Joaquín, Catalina Maria und meiner großen Familie und allen Freundinnen und Freunden zu.
So vielen Menschen danken zu können – was für ein Glück!
Abkürzungsverzeichnis
AKKADV
adverbialer Akkusativ
ASK
Argumentstrukturkonstruktion
CCxG
Cognitive Construction Grammar
DaE
Deutsch als Erstsprache
DaF
Deutsch als Fremdsprache
DaZ
Deutsch als Zweitsprache
FE
frame elements
HPSG
Head-Driven Phrase Structure Grammar
IB
intentional induziertes Bewegungsereignis
ITECX
item in construction
KB
kausal induziertes Bewegungsereignis
KxG
Konstruktionsgrammatik
L1
Erstsprache
L2
Zweitsprache
LNRE
large number of rare events
LU
lexical units
P
Produktivitätsindex
P*
Produktivitätsindex*
PCxG
Pedagogical Construction Grammar
RCxG
Radical Construction Grammar
S-framed
satellite framed
STLP
Standard theory of lexicalization patterns in the encoding of motion events
SuS
Schülerinnen und Schüler
TNE
Theory of Norms and Exploitations
TTR
Type-Token-Ratio
V-framed
verb framed
Hinweise zum Umgang mit Konventionen
Für die vorliegende Arbeit wurden die sprachwissenschaftlichen Konventionen der Textgestaltung übernommen. Die Glossierung folgt den Leipzig Glossing Rules.1Die Korpusbelege des theoretischen Teils sind mit Quellenangaben versehen. Für den empirischen Teil der Arbeit wurde zugunsten der Lesefreundlichkeit auf die Angabe verzichtet. Mögliche orthografische oder grammatische Fehler der Belege wurden nicht korrigiert.
Hinweise zur Empirie
Die Daten der vorliegenden Arbeit stammen aus dem DWDS-Kernkorpus (1990–1999) sowie dem Korpus DWDS WebXL. Die Korpora sind abrufbar unter https://www.dwds.de/. Bei Interesse stelle ich die aufbereiteten Samples gern zur Verfügung.
1Einleitung
Menschen artikulieren bei durchschnittlichem Sprechtempo zwischen 100 und 200 Wörter pro Minute – eine beachtliche Menge. Die meiste Zeit unseres Lebens sprechen wir, wie wir atmen. So wie wir unseren Atem aus uns herausfließen lassen, ohne darüber nachzudenken, wie wir unser Zwerchfell zur Kontraktion bringen, so wenig denken wir darüber nach, welche Wörter wir bei der Sprachproduktion auswählen. Sicherlich gibt es Momente, in denen wir unsere Wortwahl hinterfragen oder bewusst darüber nachdenken, welche Wörter und Sätze am besten passen, um unsere Gedanken mitzuteilen. Den überwiegenden Teil der Sprachproduktion aber lassen wir unreflektiert geschehen. Auf scheinbar magische Weise produzieren wir Wörter und Sätze, sobald wir unseren Mund öffnen oder den Stift zum Schreiben ansetzen. Warum aber nutzen wir dieses Wort und nicht jenes? Warum finden wir jenen Ausdruck normal, den anderen aber seltsam? Diese Fragen beschäftigen Sprachwissenschaftler/-innen seit dem Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Sprache.
1.1Phänomen
Die vorliegende Dissertation versucht sich dem Faszinosum sprachlicher Norm einerseits und sprachlicher Kreativität andererseits aus einer sprachgebrauchsbasierten Perspektive anzunähern. Eine der theoretischen Linien der vorliegenden Arbeit geht auf Coserius 1952 publizierten Aufsatz „Sistema, norma y habla“ zurück. Coseriu (1952) betont in seinem Aufsatz den Stellenwert der Untersuchung des tatsächlichen Sprachgebrauchs durch die Sprachwissenschaft. Damit rüttelt er an der Dichotomie von languelangue und paroleparole und bereitet den Weg für einen sprachgebrauchsbezogenen Ansatz. Es zeigt sich in der Auseinandersetzung mit Coserius Ideen allerdings, dass die Begriffe Norm und System weniger trennscharf sind als man denken möchte: Was als sprachliche Norm gilt, variiert womöglich in Abhängigkeit von Zeit, Raum und Individuum. Einen Beitrag, der sich der Untersuchung des tatsächlich realisierten Sprachgebrauchs verschrieben hat, bringt Patrick Hanks knapp 60 Jahre nach Coserius Papier mit seiner Theory of Norms and Exploitations in den Diskurs ein (Hanks 2013). Hanks beschreibt die Rolle der Korpuslinguistik für die sprachwissenschaftliche Theoriebildung und unterbreitet Vorschläge zur Deskription prototypischer und weniger prototypischer Versprachlichungsmuster. Ausgehend von einer empirisch ermittelten Norm können potenzielle Exploitationen beschrieben werden. Die vorliegende Arbeit folgt der Definition von Hanks (2013: 92): “A norm is a pattern of ordinary usage in everyday language with a particular meaning or implicature associated”. Unter ExploitationExploitationen werden unübliche Verwendungsweisen verstanden, deren Bildung eigenen Regeln folgt (vgl. Hanks 2013). Die Vorschläge von Hanks (2013) bilden einen weiteren Pfeiler der vorliegenden Arbeit.
Auch die Strömung der kognitiven Linguistik (Lakoff 1987; Langacker 1987b; Talmy 2000a) und der Usage-based linguisticsUsage-based linguistics (Bybee 1985; Bybee 2002b, 2003, 2006; Bybee & Scheibman 1999; Diessel 2013; Langacker 2006, 2010) verhandelt die Frage nach sprachlichen Normen. Tomasello beschreibt Sprache als soziales Werkzeug und sprachliche Normen als eine soziale Norm unter vielen (Tomasello 2003). Goldberg lotet die Anforderungen an Sprache aus und verortet die Frage nach sprachlicher Norm im Spannungsfeld von Expressivität und ÖkonomieÖkonomie (Goldberg 2019). Sprachliche Formen zeigen sich verschieden flexibel, was die Kombination mit neuen, noch nicht gehörten Kombinationen angeht. Man bezeichnet diese Eigenschaft als die Produktivität sprachlicher Zeichen. Es sind verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden, das Konzept der Produktivität zu operationalisieren (Baayen 1989, 1992; Barðdal 2008; Evert & Lüdeling 2001; Zeldes 2012). Auf diese Überlegungen werden in der Dissertation zurückgegriffen, um auszuloten, wie sich das Verhältnis von Normen und ExploitationExploitationen am Gegenstand der Versprachlichung von Bewegungsereignissen modellieren lässt. Werden Bewegungsereignisse versprachlicht, werden die genutzten sprachlichen Zeichen im Rahmen der Konstruktionsgrammatik als Bewegungskonstruktionen bezeichnet, die dabei unterschiedliche Komplexitätsgrade aufweisen können.
Bewegungsereignisse sind als Untersuchungsgegenstand besonders geeignet, da sie zentrale Komponenten der menschlichen Kognition darstellen (vgl. Zacks & Swallow 2007). Die Ereigniskonstruktion ist ein Mechanismus der Kognition höherer Lebewesen, den beständig auf sie einströmenden Informationsfluss zu reduzieren und ökonomischÖkonomie zu verarbeiten. Für die Sprachwissenschaft stellt die Versprachlichung von Bewegungsereignissen ein hoch relevantes Feld dar, da man sich durch intra- wie intersprachliche Vergleiche der Versprachlichungsstrategien Rückschlüsse auf das Verhältnis von Sprache und Kognition erhofft (vgl. u. a. Slobin 1987).
Das Forschungsfeld zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen hat der Typologe Leonard Talmy (1985, 2000, 2017) begründet. Talmy postuliert vier grundlegende Komponenten, um ein Bewegungsereignis zu konstituieren: FIGURE, GROUNDGround, PATH und MOTION. Hierbei bewegt sich (MOTION) ein Objekt (FIGUREFigure) im Verhältnis (PATH) zu einem anderen Objekt (GROUNDGround). Talmy klassifiziert die Sprachen der Welt in zwei unterschiedliche Typen. Das entscheidende Kriterium ist dabei, welches sprachliche Element die Komponente PATH versprachlicht. Das Deutsche realisiert PATH in einem Verb-externen Element, zum Beispiel in Form einer AdpositionAdposition. Sprachen, die diesem Muster folgen, werden satellite-framed (S-framed) genannt. Andere, wie viele romanische Sprachen, realisieren PATH Verb-intern. Man nennt diese Sprachen verb-framed Sprachen (V-framed). Möchte man etwa im Spanischen etwas darüber aussagen, wie die Bewegung der FIGUREFigure aussieht, muss man diese Information außerhalb des Verbs platzieren.
(1)
Joan
entra
al cuatro
corriendo.
FIGURE
MOTION + PATH
GOAL
MANNER
‘Joan betritt das Zimmer rennend’
Im Deutschen und anderen S-framed Sprachen ist es hingegen üblich, im Verbslot neben der Bewegung an sich weitere Informationen zu geben, zum Beispiel über die Art und Weise der Bewegung (MANNER) oder aber über kausale Relationen (CAUSE).
(2)
Sie
rannte
über die Straße.
FIGURE
MOTION + MANNER
PATH
(3)
Sie
trägt
das Kind
über die Straße.
FIGURE
MOTION + CAUSE
PATH
Durch die unterschiedlich stark konventionalisierten Bedeutungs-Form-PaareKonventionalität der jeweiligen Sprachgemeinschaften kann das Bewegungsereignis im Zuge der Versprachlichung unterschiedlich perspektiviert werden. In Beispiel (4)1 wird durch die verwendete Konstruktion beispielsweise die Geschwindigkeit und die Zeitnot der FIGURE fokussiert.
(4)
Sie hetzte mit dem Kind über die Straße.
Auch in Beispiel (5) liegt die Versprachlichung eines Bewegungsereignisses vor.
(5)
Sie winkte das Kind über die Straße.
Das Ereignis ist dabei ein komplexes: Die FIGURE bewegt sich aufgrund der Tatsache über die Straße, dass eine weitere Person sie mittels gestischer Mittel dazu auffordert. Ein solches komprimiertes Versprachlichen komplexer Ereignisketten bezeichnet man als nestingNesting (Talmy 2017). S-framed Sprachen wie das Deutsche, das Schwedische und das Englische zeigen bei der Versprachlichung von Bewegungsereignissen eine unterschiedlich hohe VariabilitätVariabilität. Studien aus dem Schwedischen weisen darauf hin, dass neben MANNERManner und CAUSE auch weitere Relationen realisiert werden. Olofsson (u. a. 2014, 2017) hat Bewegungskonstruktionen des Schwedischen erhoben und dabei festgestellt, dass auch prädikative oder modale Relationen möglich sind. Modale Relationen sind auch für das Deutsche zu beobachten. So dürfte Beispiel (6) von den wenigsten Sprachnutzern als eine Normverletzung aufgefasst werden, auch wenn der Infinitivslot der Konstruktion nicht besetzt ist.
(6)
Sie musste mit dem Kind über die Straße.
Es liegen keine empirischen Studien für das Deutsche vor, die das Phänomen modaler Relationen für Bewegungskonstruktionen beschreiben. Was aber ist mit Ausdrücken wie unter (7)?
(7)
? Sie lachte mit dem Kind über die Straße.
Für das Deutsche scheint eine solche PerspektivierungPerspektivierung über eine Bewegungskonstruktion tendenziell nicht der Norm zu entsprechen. Olofsson (2017) zeigt, dass im Schwedischen eine derartige Versprachlichung durchaus möglich ist (vgl. Beleg (8)).
(8)
Mannen
skrattade
iväg till
posten
Mann-DEF
Lach-PST
zu
Postamt-DEF
‘Der Mann lacht zum Postamt’
(Olofsson 2017)
Ein Vorweggriff auf die Ergebnisse meiner Korpusstudien der vorliegenden Arbeit zeigt, dass eine ähnliche Konstruktion unter bestimmten Umständen auch im Deutschen durchaus genutzt werden kann.
(9)
Sie kicherten sich frisch verliebt durch die Gegend.
Beleg (9) weist darauf hin, dass Sprachnutzer möglicherweise kreativer bei der Versprachlichung von Bewegungsereignissen vorgehen, als in der Literatur bislang diskutiert. Eine besondere Rolle scheint für solche ExploitationenExploitation bestehender Gebrauchsnormen die reflexive Konstruktion zu spielen: So zeigt sich eine weitere Klasse von Bewegungsereignissen an Beleg (10). Die FIGUREFigure wird dabei redundant, d. h., sowohl durch das Subjekt als auch über den Reflexivmarker versprachlicht.
(10)
Sie krümelt sich aufs Sofa.
Diese reflexive Konstruktion wird vor allem bei körperassoziierten Bewegungsereignissen genutzt, etwa des Setzens, Stellens und Legens des eigenen Körpers oder der Positionierung von Körperteilen. Reflexive Konstruktionen werden auch zur Versprachlichung sogenannter fiktiver Bewegungsereignisse genutzt. Ein fiktives Bewegungsereignis nutzt die gleichen sprachlichen Konstruktionen wie faktive Bewegungsereignisse; dennoch kommt der Sprachnutzer zu einer statischen Interpretation des Ereignisses. Ein prototypisches Beispiel für ein fiktives Bewegungsereignis stellt Beleg (11) dar.
(11)
Der Weg schlängelt sich den Berg hinauf.
Ein Beleg wie (12) zeigt ein prototypisches Beispiel einer konzeptuellen Metapher. Der Fußballverein gelangt durch das Schießen von Toren an die Spitze der Tabelle. Möglich ist eine solche Versprachlichung aufgrund der konzeptuellen Metapher GUT IST OBEN (Lakoff 1987).
(12)
Dortmund schießt sich an die Tabellenspitze.
Die weitgehende Nicht-Beachtung solcher Strukturen, wie sie die Beispiele (4)-(12) zeigen, hängt womöglich mit der vorherrschenden Verengung auf den Sprachgebrauch zusammen, den man gemeinhin als Standardsprache bezeichnen könnte. Diese Fixierung verhinderte ggf. einen Blick auf Aspekte des Sprachgebrauchs, die als okkasionelle Bildungen oder periphere Phänomene abgetan wurden.
Die Konstruktionsgrammatik bietet an dieser Stelle aus mehreren Gründen einen vielversprechenden Rahmen zur theoretischen Modellierung. In konstruktionsgrammatischen Frameworks wird die strikte Trennung von Lexikon und Grammatik zugunsten eines Kontinuums aufgegeben, wodurch die Analyse formelhafter Wendungen, routinisierten Ausdrücken und Mehrworteinheiten ermöglicht wird. Anstelle eines Regelwerks generativer Art treten Schemata unterschiedlicher AbstraktionsgradeAbstraktion, die „in bestimmten Kontexten vorkommen und nur teilweise frei mit Wortmaterial aufgefüllt werden können“ (Imo 2007: 23). All diese Konstruktionen unterschiedlicher SchematizitätSchematizität sind von Sprachnutzern mental repräsentiert.2 Man spricht vom sogenannten KonstruktikonKonstruktikon. Weiterhin wird postuliert, dass auch Wissen über die Verwendung der Konstruktion als implizites Wissen der Sprachnutzer im KonstruktikonKonstruktikon vorliegen muss. Dieses implizite Wissen muss, um eine erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten, sowohl Informationen über semantische und pragmatische Eigenschaften der Konstruktion umfassen als auch darüber, welche Slots der Konstruktion mit welchen sprachlichen Einheiten zu besetzen sind. Insbesondere Letzteres führt zur Frage der sprachlichen Norm.
1.2Fragestellungen und Ziele der Arbeit
Die Dissertationsschrift möchte die Frage beantworten, wie Bewegungsereignisse im Deutschen versprachlicht werden. Diese übergeordnete Fragestellung lässt sich in drei empirisch-deskriptive Teilfragestellungen gliedern:
Welche Verben werden in welchen Konstruktionen des Deutschen genutzt?
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich zu Bewegungskonstruktionen des Schwedischen und Englischen feststellen?
Inwiefern sind die ermittelten Verben und Konstruktionen gebräuchlich oder idiosynkratischIdiosynkrasie?
Das Ziel ist es dabei, das Verhältnis von sprachlichen Normen und Exploitation am Gegenstand der Bewegungskonstruktionen auszuloten. Die bisherige Forschung zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen im Deutschen hat sich bislang auf Konstruktionen konzentriert, in denen das Lexem des Verbslots entweder die Art und Weise (MANNER) der Bewegung spezifiziert oder eine kausale Relation (CAUSE) denotiert. Einige wenige Arbeiten für das Deutsche thematisieren sogenannte Geräusch-als-Bewegungsverben, wie unter Beispiel (13) angeführt (u. a. Maienborn 1994, Engelberg 2009, Goschler 2011). Von einem BewegungsverbBewegungsverb kann dann gesprochen werden, wenn das Verb ohne sprachlichen oder nicht-sprachlichen Kontext einen BewegungsframeBewegungsframe evoziert.
(13)
Sie rumpelte mit dem Auto über die Straße.
Es liegen für das Deutsche jedoch eine Reihe weiterer Konstruktionen zur Versprachlichung unterschiedlicher Klassen an Bewegungsereignissen vor, dessen empirische Untersuchung das ausgewiesene Desiderat schließen soll. Empirisch heißt hierbei, zwei Korpusstudien durchzuführen, um den Sprachgebrauch für diesen Phänomenbereich systematisch zu erschließen. Korpusstudie I dient dazu, Konstruktionen und Verben in der gesamten Breite zu ermitteln. Somit kann die typologische Einordnung des Deutschen hinsichtlich der Versprachlichung von Bewegungsereignissen feingranularer erfolgen, als dies bislang geschehen ist. Korpusstudie II hingegen widmet sich einer teilschematischen Konstruktion und zeigt dadurch eine Detailaufnahme. Die vorliegende Arbeit berührt dabei zwei grundlegende Fragen, die die sprachwissenschaftliche Theoriebildung betreffen:
Ist es gerechtfertigt und beschreibungsadäquat, semantische Verbklassen wie Bewegungsverben, Geräuschverben etc. anzusetzen?
Inwiefern dient die Konstruktionsgrammatik der Beschreibung sprachlicher Strukturen?
1.3Aufbau der Arbeit
Das Phänomen der Versprachlichung von Bewegungsereignissen lässt sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. In der vorliegenden Arbeit verbinden sich eine typologische und eine gebrauchsbasierte Perspektive.
In Kapitel 2 wird dargelegt, wie unterschiedliche Sprachen Bewegungsereignisse perspektivieren und welche Konstruktionen den Sprachnutzern der jeweiligen Sprachgemeinschaft zur Verfügung stehen. Die Ausführungen beruhen in erster Linie auf den Arbeiten Leonard Talmys, der eine typologische Klassifikation vorgenommen hat, die bis heute weiterentwickelt wird. Flankiert werden die Überlegungen Talmys von den Studien der Arbeitsgruppen rund um Dan I. Slobin, die die Talmy’sche Typologie um wichtige Erkenntnisse erweitert hat. Zusammen werden die Arbeiten Talmys und Slobins als Standard theory of lexicalization patterns in the encoding of motion events (kurz STLP) bezeichnet (vgl. Berthele 2013: 55). Die STLP bietet einen ersten Zugriff auf das untersuchte Phänomen und ermöglicht eine typologische Einordnung des Deutschen hinsichtlich der Versprachlichungsstrategien von Bewegungsereignissen.
Allerdings zeigt die STLP einige Schwachstellen, die sowohl methodologischer als auch theoretischer Art sind. Mit Kapitel 3 wird eine gebrauchsbasierte (usage-based) ModellierungUsage-based linguistics vorgeschlagen. Dafür wird zunächst ein kurzer Abriss zur Genese gebrauchsbasierter Ansätze dargelegt und deren theoretische Axiome vorgestellt. Wichtig wird dabei die Unterscheidung in sprachliche Normen und deren Exploitationen unter Rückgriff auch die Theory of Norms and Exploitations (TNE) von Patrick Hanks. Es folgt eine Fokussierung der konstruktionsgrammatischen Grundlagen, bei der die Eigenschaften von Konstruktionen, des Konstruktikons und die Idee der Schematizität von Argumentstrukturkonstruktionen dargelegt werden. Ein weiterer Abschnitt thematisiert die Produktivität von Argumentstrukturkonstruktionen, indem der Begriff der Produktivität zunächst aus der Morphologie abgeleitet und anschließend auf Argumentstrukturkonstruktionen übertragen wird. Es werden unterschiedliche Vorschläge zur Operationalisierung des Produktivitätsbegriffes diskutiert sowie mögliche Faktoren, die die Produktivität von Argumentstrukturkonstruktionen beeinflussen könnten, aus der gesichteten Literatur zusammengeführt. Schließlich wird das Zusammenspiel von Konstruktionsgrammatik und der Fillmor’schen Frame-Semantik aufgefaltet, da die Frame-Semantik und das zugehörige Tool FrameNet zur semantischen Annotation der erhobenen Belege herangezogen werden. Es wird darüber hinaus aufgezeigt, inwiefern konstruktionsgrammatische und valenzgrammatische Ansätze symbiotisch sein könnten.
Kapitel 4 fasst den aktuellen Forschungsstand zur Variabilität von Lexemen im Verbslot von Bewegungskonstruktionen zusammen und beleuchtet die Argumentation sowie das methodische Vorgehen der jeweiligen Studien kritisch. Die Auseinandersetzung beginnt erneut ausgehend von einer sprachvergleichenden Perspektive. Es wird eine Reihe an Studien zur Produktivität von Bewegungskonstruktionen des Schwedischen wiedergegeben. Die Erkenntnisse legen nahe, dass die Produktivität der Bewegungskonstruktionen sowohl von den konkreten verwendeten Konstruktionen als auch vom weiteren sprachlichen Kontext abhängig ist. Die Studien zu Bewegungskonstruktionen des Englischen geben einen Hinweis darauf, dass das heutige Englisch weniger tolerant hinsichtlich der Besetzung des Verbslots von Bewegungskonstruktion ist als frühere Sprachstadien und andere S-framed Sprachen, wie das Schwedische oder das Deutsche. Zudem wird ersichtlich, dass das Zusammenspiel zwischen ArgumentstrukturkonstruktionArgumentstrukturkonstruktion, AdpositionAdposition und Lexemen des Verbslots komplexer ist, als es einige konstruktionsgrammatische Arbeiten suggerieren. Die Studienlage für das Deutsche ist recht ergiebig, was sogenannte Geräusch-als-BewegungsverbenBewegungsverb angeht. Es wird die Debatte darüber nachgezeichnet, inwiefern eine valenz- oder eine konstruktionsgrammatische Modellierung zielführender sein kann. Die übrigen Studien zu Modalverben, Kopulaverben oder verblosen Konstruktionen sowie reflexiven Konstruktionen zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen sind methodologisch weniger systematisch und weniger umfangreich, was das ausgewertete Datenmaterial angeht. An dieser Stelle wird ein Desiderat erkennbar, dem ich mit der vorliegenden Arbeit nachgehen möchte.
Kapitel 5 bildet die erste Teilstudie der vorliegenden Arbeit ab. Ziel des Kapitels ist es, die prototypischen Versprachlichungsstrategien von Bewegungsereignissen des Deutschen zu erheben. Zu Beginn des Kapitels wird das für die Teilstudie I verwendete Korpus DWDS-Kernkorpus (1990–1999) vorgestellt. Darauffolgend wird dargelegt, wie die Erarbeitung der Suchanfragen erfolgt ist. Es wird gezeigt, wie man durch ein systematisches Bootstrapping-Verfahren Lexeme als unbekannte Zielgrößen erheben kann. Das derart erhobene Sample wird schließlich vorgestellt. Das methodische Vorgehen wird durch eine ausführliche diskursive Darlegung der manuellen Annotation abgeschlossen. Unter Kapitel 5.2 werden die Ergebnisse der ersten Teilstudie aufgeschlüsselt. Die Darstellung richtet sich nach den jeweiligen Bewegungsereignissen sowie nach der Argumentstruktur der Konstruktionen. In der anschließenden Diskussion unter 5.3 werden insbesondere Modalkonstruktionen sowie reflexive Konstruktionen zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen beleuchtet. In Abschnitt 5.4 wird erläutert, warum bei einer empirischen Studie mit jedem Schritt potenziell problematische Entscheidungen zu treffen sind, welche methodischen Schwierigkeiten Korpusstudie I zeigt und wie versucht wurde, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen.
Mit Kapitel 6 folgt die zweite Teilstudie der vorliegenden Arbeit. Im Kontrast zu Teilstudie I wird hierbei kein globales Bild angestrebt, sondern eine Nahaufnahme einer teilschematischen Konstruktion angefertigt. Hierzu wird zunächst begründet, inwiefern sich die teilschematische Konstruktion [durch die Gegend VERB] in besonderer Weise als gewinnbringend für eine solche Nahaufnahme erweist. Unter Abschnitt 6.2 wird das methodische Vorgehen begründet sowie auf die wesentlichen methodologischen Unterschiede zu Teilstudie I eingegangen. Wichtig sind dabei die verwendeten Assoziationsmaße sowie die Operationalisierung der Produktivität. Ein wesentlicher Unterschied zu Teilstudie I stellt zudem die Kollokationsanalyse dar, die für die frequentesten Lexeme der teilschematischen Konstruktion [durch die Gegend VERB] durchgeführt wurde. Es zeichnen sich deutliche idiosynkratischeIdiosynkrasie Gebrauchspräferenzen ab, was die verwendeten Lexeme des Verbslots betrifft. Die Kollokationsanalysen weisen allerdings gleichzeitig darauf hin, dass sich die festgestellten ExploitationenExploitation in systematischer Weise von den frequentesten lexikalisch spezifizierten Konstruktionen ableiten lassen.
Die Diskussion wird unter Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit geführt. Zunächst werden die zentralen Ergebnisse dargelegt, aber auch weitere Desiderate sowie Limitierungen der vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Ein Unterkapitel widmet sich den offenen Fragen der konstruktionsgrammatischen Theoriebildung. Dabei werden Fragen der Formalisierung sowie der Terminologie angesprochen.
2Die Standardtheorie zu Lexikalisierungsmustern von Bewegungsereignissen
In diesem Kapitel sollen die für die Fragestellung der Arbeit zentralen Begriffe definiert werden. In einem ersten Schritt wird der Begriff des Bewegungsereignisses aufgefaltet und dieser in Zusammenhang zu dem Begriff der Bewegungskonstruktion gebracht. Ich folge in diesem Kapitel weitgehend den Arbeiten Leonard Talmys, da seine typologischen Studien den Forschungsraum begründet haben. Zusammen mit den Arbeiten Dan I. Slobins werden seine Arbeiten auch als „The standard theory of lexicalization patterns in the encoding of motion events (kurz STLP)“ bezeichnet (Berthele 2013: 55).
Auf der Grundlage der STLP wird eine Abgrenzung zwischen faktiven und fiktiven Bewegungsereignissen vorgenommen. Die beiden Klassen werden von konzeptuellen Metaphern und körperassoziierten Bewegungsereignissen abgegrenzt. Es werden im Anschluss zwei unterschiedliche Perspektiven auf die Versprachlichung von Bewegungsereignissen vorgestellt. Im Rahmen der sogenannten framing typologyframing typology wird der Frage nachgegangen, wie semantische Elemente in unterschiedlichen Sprachen durch sprachliche Formen verpackt werden: Es steht somit die onomasiologische Perspektive im Fokus. Die actuatingactuating typology typology hingegen spiegelt diesen Blickwinkel und greift die semasiologische Perspektive auf: Im Rahmen der actuating typology werden die syntaktischen Kategorien unterschiedlicher Sprachen konstant gehalten und beobachtet, welche semantischen Elemente von diesen versprachlicht werden. Darauf aufbauend wird in diesem zweiten Kapitel eine typologische Einordnung des Deutschen vorgenommen. Durch einen Vorweggriff auf die Korpusstudien der vorliegenden Arbeit wird deutlich, dass das Bild ein deutlich komplexeres ist, als es die bisherigen Arbeiten zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen im Deutschen suggerieren. In einem abschließenden Unterkapitel werden drei zentrale Kritikpunkte an der STLP ausgeleuchtet. Die Kritik betrifft die Unschärfe von Kategorien, methodologische Aspekte rund um die Introspektion sowie die Idee der semantischen Dekomposition als theoretische Grundannahme der STLP.
2.1Hinführung: Bewegungsereignisse und Bewegungskonstruktionen
Um die Frage „Was ist ein Bewegungsereignis?“ zu beantworten, muss zunächst ein zweiter Begriff eingeführt werden: der Begriff des EventEvents, im Folgenden für das Deutsche als Ereignis bezeichnet. Diese beiden Begriffe sind sowohl in der Linguistik als auch in anderen an kognitiven Prozessen interessierten Wissenschaften eng verbunden. Ich beginne mit meinem Definitionsversuch bei den Ansätzen der STLP, da diese Axiome als Grundlage für die gesamte folgende Analyse dienen werden.
Unschwer zu erkennen ist in Talmys früheren Arbeiten seine Anlehnung an die Generative Linguistik. Im Kontrast zu Fillmore und dessen Idee von Tiefenkasus (1968) setzt Talmy zunächst keine Handlungsträger an, sondern geht als zentrale Idee von sogenannten Ereignissen aus. Der Begriff des Ereignisses lässt sich anhand einer alltäglichen Handlung explizieren. Nehmen wir das simple Beispiel des Blumenpflanzens: Diese komplexe Handlung lässt sich in mehrere Subsequenzen zerlegen: Man nimmt die Blume aus dem Plastiktöpfchen, steckt sie in die vorbereitete Erde, drückt diese an und gießt die frisch eingetopfte Pflanze. In jedem dieser vier Schritte steckt jedoch eine Reihe weiterer Teilhandlungen. Wenn Sie die Blume aus dem Plastiktöpfchen nehmen, müssen Sie sich zunächst zum Plastiktöpfchen hinbewegen, dann Ihre Arme und Hände koordiniert in Richtung der Pflanze strecken, an entsprechender Stelle des Stängels zupacken, ziehen, schütteln, drücken, bis sich die Pflanze aus dem Töpfchen löst, das Töpfchen abstellen und anschließend in Richtung der vorbereiteten Erde bewegen. Das Zupacken, Ziehen, Schütteln und das sich-Bewegen lässt sich selbstredend abermals in kleinere Teilhandlungen zerlegen, die an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden sollen. Die potenzielle Unabgeschlossenheit an Teilhandlungen sollte deutlich geworden sein. Ein Ereignis ist Talmy zufolge das Ergebnis einer Konzeptualisierung, die auf grundlegenden kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Geistes beruht (Talmy 1991: 481). Ereignisse existieren nicht in der realen Welt, sondern werden durch mentale Grenzziehungen einerseits sowie die Zuschreibung von Ganzheit andererseits konstruiert. Talmy weist darauf hin, dass somit Entitäten geschaffen werden, die anderweitig ein Kontinuum darstellten. Genannt werden Raum, Zeit sowie andere qualitative Domänen:
Among various alternatives, one category of such an entity is perceived or conceptualized as an eventEvent, a type of entity that includes within its boundary some portion of a qualitative domain in correlation with some portion of time, that possibly rests on primitive phenomenological experience which may be characterized as dynamism, and that is probably both foundational and universal in human cognition. (Talmy 1991: 481)
Talmys Verweis auf ein Kontinuum wird am eingangs dargelegten Beispiels der bis ins Unendliche zerlegbaren Handlungen deutlich. Eine unendlich kleine Einteilung führt zu einem kontinuierlichen Strom an Informationen. An dieser Stelle wird ebenso deutlich, warum die Fähigkeit zur Konstruktion von Ereignisrepräsentationen einen evolutionären Vorteil bietet: Sie ermöglicht einen möglichst ökonomischenÖkonomie Umgang mit dem auf die menschlichen Sinnesorgane einströmenden Informationsfluss und stellt eine angemessene Reaktionszeit auf diese eingehenden Umweltreize sicher. Talmys Ausführungen zur Ereigniskonstruktion werden durch Erkenntnisse aus der Psychologie und den Neurowissenschaften gestützt (Zacks & Swallow 2007). Ereignisse sind somit AbstraktionAbstraktionen frequenter Handlungsschemata, die es uns erlauben, potenziell unendliche Teilhandlungen zu kompakten Einheiten zu bündeln. Bewegungsereignisse stellen eine Subgruppe von Ereignissen dar, die sich dadurch auszeichnet, dass eine oder mehrere Entitäten eine Veränderung der Position im Raum erfährt.
Unterschiedliche Sprachen zeigen nun unterschiedliche Strategien zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen. Nach Talmy (1972) ist allen Sprachen ein Grundinventar an semantischen Elementen, die isoliert voneinander existieren, gemein. Als semantische Grundelemente postuliert er in seinem 1985 erschienenen Aufsatz “Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms” MOTION, PATH, FIGUREFigure, GROUNDGround, MANNERManner und CAUSE (Talmy 1985: 57). Die Versprachlichung dieser Elemente erfolgt jedoch nicht über eine eins-zu-eins-Zuordnung sprachlicher Einheiten. Mehrere semantische Grundelemente können vielmehr durch ein einziges sprachliches Element, Talmy spricht von surface elements, ausgedrückt werden, oder ein einzelnes semantisches Grundelement kann mehrere sprachliche Elemente benötigen, um versprachlicht zu werden.
Die semantischen Grundelemente FIGURE und GROUNDGround stammen ursprünglich aus der Gestaltpsychologie, haben in Talmys Framework jedoch eine abweichende Bedeutung. Der Begriff FigureFigure referiert auf eine sich bewegende oder sich potenziell bewegende Entität, während der Begriff GROUNDGround auf einen Referenzraum verweist, zu welchem sich das Objekt in seiner Bewegung verhält (ebd.: 61). Der Begriff PATH referiert auf den Weg, den die FIGURE zurücklegt. MANNERManner beschreibt dabei die Art und Weise der Bewegung und die semantische Grundkomponente CAUSE kann auftreten, wenn die Bewegung durch Fremdeinwirkung eintritt. Die vorliegende Arbeit übernimmt die Terminologie der STLP. Zusätzlich wird eine feinere Unterscheidung eingeführt, was das Element PATH betrifft. Je nachdem, ob sich die FIGURE von einem Ort entfernt, sich auf einen Ort zubewegt oder sich auf dem Weg dazwischen befindet, spreche ich von SOURCE (Quelle), GOAL (Ziel) oder ROUTE (Pfad) (vgl. Jackendoff 1983).
Talmy unterscheidet weiterhin zwischen zwei grundlegenden Typen von Bewegungsereignissen (Talmy 2000a: 25). Der erste Typ wird als translational motiontranslational motion bezeichnet. Die translational motion liegt dann vor, wenn sich die Lokalisation der Entität in einem bestimmten Zeitintervall verändert. Davon abzugrenzen ist eine Lokalisation ohne Veränderung innerhalb eines Zeitintervalls. Das bedeutet, dass innerhalb dieser Theorie auch solche Ereignisse miteinbezogen werden, bei der die FIGURE keine Veränderung im Raum erfährt (LOCATIONLocation). Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich eine Systematisierung, die Tabelle 1 zeigt.
MANNER
CAUSE
MOTION
The pencil rolled off the table.
The pencil blew off the table.
LOCATION
The pencil laid on the table.
The pencil stuck to the table (after I glued it).
Systematisierung von Bewegungsereignissen nach Talmy (2005a: 25).
Eine zweite Kategorie von Bewegungsereignissen ist die sogenannte self-contained motionself-contained motion. Hierbei bewegt sich die FIGUREFigure, ohne jedoch eine wahrnehmbare Strecke im Raum zurückzulegen. Unterschieden werden kann innerhalb dieser Kategorie in Rotationsbewegungen, Oszillationsbewegungen sowie Veränderungen durch Dilatation (ebd.). In der deutschsprachigen Literatur finden sich zur Unterscheidung dieser beiden Konzepte auch die Begriffe Fortbewegung für translational motiontranslational motion in Abgrenzung zum Terminus Bewegung für self-contained motionself-contained motion (Ágel 2017). Abbildung 1 bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Bewegungsereignisse in Form eines Organigramms durch Einbezug distinktiver semantischer Merkmale.
Klassifikation von Bewegungsereignissen durch eine distinktive Merkmalsanalyse.
Unter Berücksichtigung des Organigramms aus Abbildung 1 lassen sich die bisher angesprochenen Klassen von Bewegungsereignissen eindeutig identifizieren und benennen. Grenzfälle werden im Laufe der vorliegenden Arbeit diskutiert werden. Zunächst sollen die angesetzten Kategorien durch sprachliche Beispiele für das Deutsche fruchtbar gemacht werden. Tabelle 2 dient der Illustration.
Bewegungsereignis
Beispiel
deutsche Begriffsentsprechung
intentional motion
Der Vogel flattert auf den Baum.
Intentionale Bewegung
caused motion
Die Serviette weht vom Tisch.
Kausal-induzierte Bewegung
self-contained motion
Sie tippelt auf der Stelle.
Ego-zentristische Bewegung
Begriffsbestimmungen von Bewegungsereignissen.
In der linken Spalte sind die Bewegungsereignisse als Kategorien der STLP aufgeführt. Es folgen in der zweiten Spalte Beispiele für die deutsche Sprache. Die Übertragung der englischen Originalbeispiele in das Deutsche wirft zunächst keine größeren Schwierigkeiten auf. Das ist insofern wenig überraschend, als dass die STLP nach Talmy den Anspruch erhebt, übereinzelsprachliche Konzepte zu bestimmen. Zudem liegen das Englische und das Deutsche aus typologischer Perspektive nah beieinander. Zu den sprachspezifischen Unterschieden komme ich in den Kapiteln 2.3 sowie 5.3.
Es sind in Tabelle 2 außerdem die für diese Arbeit vorgeschlagenen Termini aufgeführt. Die Definition läuft hierbei über die Semantik und nicht etwa über die jeweilige syntaktische Umsetzung des Bewegungsereignisses. Unter caused motion findet sich als exemplarischer Beleg Die Serviette weht vom Tisch. Aus syntaktischer Perspektive liegt eine intransitive Konstruktion vor. Talmy argumentiert, dass konzeptuell ein kausal-induziertes Bewegungsereignis vorliegt, auch wenn die verursachende Entität sprachlich nicht realisiert wird. Es wird somit eine Trennung zwischen Semantik und Syntax vorgenommen, die sich in der Terminologie entsprechend niederschlägt. In einigen Arbeiten zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen wird diese Trennung aufgeweicht, indem die Begriffe intentional motionintentional motion und intransitive motion bzw. caused motion und transitive motion als quasi-Synonyme verwendet werden (exemplarisch dafür u. a. Rohde 2001). Tabelle 3 hingegen verdeutlicht die Unterschiede zwischen den Begriffen und illustriert die Verwendung innerhalb der vorliegenden Arbeit.
Syntax
Semantik
intransitive Konstruktion
transitive Konstruktion
Intentionale Bewegung (IB)
Sie steigt auf den Berg.
Sie besteigt den Berg.
kausal-induzierte Bewegung (KB)
Die Serviette weht vom Tisch.
Der Wind weht die Serviette vom Tisch.
Unterschiede zwischen syntaktisch und semantisch motivierter Terminologie.
Ein weiterer, für diese Arbeit grundlegender Aspekt lässt sich ebenfalls aus Tabelle 3 ableiten: Sprachnutzer haben bei der Versprachlichung eines Ereignisses unterschiedliche sprachliche Konstruktionen zur Auswahl (vgl. Hanks 2013), um das Ereignis auf eine bestimmte Art und Weise zu perspektivieren. Wie sich das Verhältnis von sprachlichen Normen und Exploitation theoretisch und empirisch bestimmen lässt, ist eine der zentralen Fragen der dieser Arbeit.
Nachdem der Begriff des Bewegungsereignisses abgeleitet wurde, wende ich mich der zweiten, eingangs formulierten Frage zu: Was ist eine Bewegungskonstruktion? Als mögliche Alternativen zum Begriff der Bewegungskonstruktion werden in der Literatur auch die Begriffe Direktivum/ DirektionalDirektional/ Direktionale Ergänzung genutzt. Für eine erste Annäherung lohnt ein Blick auf die vorgeschlagene Definition im Metzler Lexikon Sprache: „Direktional (lat. dīrēctum ‹(aus)gerichtet›) Ausdruck, der eine räuml. Richtung bezeichnet (z. B. von hinten, jenseits des Flusses), auch ↑ Kasus in der Funktion des Richtungskasus; ↑ Lokativ“ (Glück & Rödel 2016). Als DirektionalDirektional werden demnach sprachliche Formen bezeichnet, die eine Richtung im Raum kodieren. Dies beinhaltet nicht zwangsläufig Bewegung, denn auch LOCATIONLocation wird durch Direktionale ausgedrückt:
(1)
Sie steht neben dem Blumentopf.
(2)
Jenseits der Grenze befindet sich weites Land.
Eine Diskussion, ob es sich dabei, je nach grammatiktheoretischem Hintergrund, um ein Satzglied oder eine Ergänzung des Verbes handelt, soll in dieser Arbeit nicht geführt werden1.
Somit ist der Begriff des DirektionalDirektionals/Direktivums nicht geeignet für meine Arbeit: Er ist mit Form-/Funktionszusammenhängen assoziiert, die nicht im Fokus meines Erkenntnisinteresses stehen. Daher nutze ich im Folgenden den Begriff der Bewegungskonstruktion. Die Perspektive ist somit primär eine onomasiologische: Ausgehend von der Bedeutungsseite des sprachlichen Zeichens wird die Form in den Blick genommen. Bedeutungs- und Formseite sind dabei untrennbar miteinander verwoben: Das stellt ein Axiom dar, das die Konstruktionsgrammatik aus den strukturalistischen Arbeiten de Saussures übernommen hat und auch für die vorliegende Arbeit gilt. Somit erklärt sich der zweite Teil des Determinativkompositums, die Konstruktion als Bedeutungs-Form-Paar. Diese und weitere theoretischen Grundlagen der Konstruktionsgrammatik werden in Kapitel 3 dargelegt. Ich verbleiben vorerst bei der Standardtheorie zu Lexikalisierungsmustern von Bewegungsereignissen.
2.2Die Klassifikation von Bewegungsereignissen
In den folgenden Abschnitten werde ich die Unterschiede zwischen Subklassen von Bewegungsereignissen für das Deutsche darlegen. Dabei werden erste Verschiebungen zu den Talmy’schen Postulaten sichtbar werden. Ich beginne mit der grundlegenden Unterscheidung zwischen faktiven und fiktiven Bewegungsereignissen, bevor die konzeptuelle Metapher als eine dritte Klasse eingeführt werden. Es folgt die Thematisierung körperassoziierter Bewegungsereignisse als eine vierte Klasse.
2.2.1Faktive und fiktive Bewegungsereignisse
Zu Beginn dieses Abschnitts werden unter (3) und (4) zwei Belege angeführt, die prototypische Beispiele für Bewegungskonstruktionen des Deutschen darstellen.
(3)
Sie fährt zum Gartencenter.
(4)
Sie steckt die Pflanze in den Kübel.
In (3) handelt es sich um eine durch die FIGURE selbst initiierte translationale Bewegung in Richtung eines konkreten Ziels, also ein IB-Ereignis. In (4) liegt ebenfalls eine translationale Bewegung vor. Im Unterschied zu (3) ist die Bewegung der FIGURE jedoch extern verursacht. Es handelt sich somit um ein KB-Ereignis. Die dargelegten Beispiele in (3) und (4) sind insofern unproblematisch, als dass hier ein von der menschlichen Wahrnehmung als wirkliche Fortbewegung konstruiertes Ereignis sprachlich durch eine zu dieser Wahrnehmung passende direktionale Konstruktion ausgedrückt wird. Dass dies nicht immer der Fall ist, illustriert Beispiel (5):
(5)
Der Pfad geht vom Waldrand bis zum Aussichtsturm.
In allen drei Beispielen liegt ein Verb vor, das mit (kausaler) Bewegung assoziiert ist, sowie direktionale Präpositionalphrasen. Trotzdem weiß man intuitiv, dass sich (5) von den Beispielen (3) und (4) unterscheidet. Worin genau besteht der Unterschied zwischen den angeführten Äußerungen? Während in den Beispielen (3) und (4) eine „reale“, physische Bewegung vorzuliegen scheint, so versprachlicht das Beispiel (5) hingegen eine für die menschliche Wahrnehmung stationäre Situation, in der keine physische Bewegung einer FIGURE vorliegt.
Auf sprachlicher Ebene jedoch sind die Beispiele analog konzipiert. Auch in (5) liegt ein BewegungsverbBewegungsverb in Kombination mit einer direktionalen Präpositionalphrase vor. In anderen Worten ausgedrückt: In Beispiel (5) stimmen die Ebenen der Wahrnehmung einerseits und der Versprachlichungsstrategie andererseits nicht überein. Talmy (2000b) postuliert zur Erklärung dieses sich sprachübergreifend zeigenden Phänomens drei unterschiedliche Subsysteme der menschlichen Kognition. Eines dieser Systeme sei dafür verantwortlich, die Bewegung sprachlich zu repräsentieren. Ein zweites produziere den Eindruck eines stationären Zustandes der Situation, welche versprachlicht wurde. Das dritte Subsystem bewerte nun die Wahrheit beider, wobei die sprachliche Repräsentation als fiktiv und der Eindruck des stationären Zustandes als faktiv bewertet werde. Talmy erhebt somit nicht den Anspruch, Aussagen über die außersprachliche oder außerkognitive Wirklichkeit zu treffen, sondern folgt konstruktivistischen Ansätzen. Unter fiktiver Bewegung wird, Talmy folgend, die sprachliche Repräsentation von Bewegung verstanden, bei der keine physische Bewegung wahrgenommen wird (Talmy 2000a). In Talmy (1983) wird hierbei noch von virtual motion gesprochen. Andere verwendete Begriffe verschiedener Autor/-innen sind mentally simulated motion (Matlock 2004), subjective motion (Matsumoto 1996), extension (Jackendoff 1983) und abstract motion (Langacker 1986). Matlock (2004) findet im Rahmen ihrer psycholinguistischen Studien zu fiktiven Bewegungsereignissen Evidenz dafür, dass Sprachnutzer fiktive Bewegungsereignisse mental als faktive Bewegung verarbeiten. Daher leitet sich auch ihr Begriff mentally simulated motion ab. Hörten wir beispielsweise die Äußerung „Der Park befindet sich die Straße hinunter“, so erstellten wir Matlock zufolge eine mentale Repräsentation des Weges, der abzuschreiten ist, um vom jetzigen Standpunkt zum Park zu gelangen. Dieses Prinzip der Verarbeitung würde die sprachliche Nähe zwischen faktiver und fiktiver Bewegung erklären. Für das Englische sind die Konstruktionen für beide Typen von Bewegungsereignissen nahezu identisch. Für das Deutsche liegt nach meinem jetzigen Kenntnisstand keine systematische oder empirische Studie zum Vergleich faktiver und fiktiver Bewegungskonstruktionen vor. Das Desidarat soll durch die vorliegende Arbeit geschlossen werden.
2.2.2Subklassen fiktiver Bewegung
Talmy (2018) unterscheidet sechs Subklassen fiktiver Bewegungsereignisse. Tabelle 6 überträgt die Überlegungen zu Subklassen fiktiver Bewegungsereignisse des Englischen ins Deutsche.
Subklasse
Definition
Beispiel für das Deutsche
Emanationpaths
Eine fiktive Entität entspringt einem faktiven Objekt, bewegt sich auf einem geraden Pfad durch den Raum (und trifft auf ein entferntes faktives Objekt).
(1)
Die Wand des Bergmassivs zeigt Richtung Norden.
Pattern paths
Ein faktives Muster zeigt fiktive Bewegung, da Komponenten des Musters faktive Bewegung ausgeübt haben.
(2)
Als ich den Flur strich, tropfte Farbe die Wand entlang.
Frame-relative motion
Ein erstes Objekt, das sich faktiv bewegt, ist als fiktiv stationär zu einem zweiten Objekt repräsentiert, wobei das zweite Objekt als sich fiktiv bewegend konstruiert ist.
(3)
Ich saß im Auto und sah die Landschaft an mir vorbeiziehen.
Advent paths
Die Anordnung von faktiv stationären Objekten ist durch Ausdrücke versprachlicht, die ein fiktives Ankommen-Szenario beschreiben.
(4)
Die Bäume gruppieren sich um den Felsen.
Access paths
Die Lokalisation eines faktiv stationären Objektes ist so beschrieben, dass eine Entität dieser an einem fiktiv begangenen Weg begegnet.
(5)
Die Bäckerei ist von der Bank aus gesehen in der Straße gegenüber.
Coextension paths
Die Form, Orientierung oder Lokalisation eines faktiv stationären Objektes ist durch einen Ausdruck versprachlicht, der einen fiktiven Pfad über die Ausdehnung des Objektes beschreibt.
(6)
Der Zaun führt vom Plateau bis hinunter ins Tal.
Subklassen fiktiver Bewegung (Talmy 2017), Adaption für das Deutsche.
In der Forschungsliteratur findet sich eine Auseinandersetzung mit den Coextensionpaths (vgl. Talmy 2011); die übrigen Subklassen fiktiver Bewegung sind nach meinem Kenntnisstand eher stiefmütterlich behandelt worden. Es scheint, als sei die Subklasse Coextensionpaths der Prototyp fiktiver Bewegungsereignisse. In der Tat scheint diese Kategorie die am wenigsten problematische zu sein. Die Kategorie der Emanation paths ist eine weniger prototypische Kategorie, da die von Talmy aufgeführten Vollverben eine eher deiktische als dynamische Lesart evozieren. Weitere genannte Beispiele für die Gruppe fiktiver Bewegungsereignisse sind Emissionsereignisse (z. B. scheinen, strahlen) sowie Ereignisse, die Sinneswahrnehmungen versprachlichen (wie etwa sehen, riechen, hören.)
(6)
Light shone from the sun into the cave.
‘Von der Sonne schien Licht in die Höhle’
Inwieweit ist das Licht in Beispiel (6) eine fiktive Entität? Ähnliche Schwierigkeiten bereiten Ereignisse der Sinneswahrnehmung wie in (7), mit dem Unterschied, dass dabei aus biologischer bzw. physikalischer Perspektive fälschlicherweise ein AGENS konzipiert wird, von dem die Bewegung ausgeht, während das betrachtende Auge aus biologischer Perspektive ein passiver Rezipient der Lichtwellen ist.
(7)
I looked down the valley.
‘Ich schaute ins Tal hinab’
Für die Klasse an fiktiver Bewegung, die sensorische Ereignisse versprachlichen, schlägt Matlock (2014: 14) eine vollständige Abgrenzung von fiktiven Bewegungsereignissen vor. Sie bezeichnet diese Klasse als perceived motion. Ich folge Matlocks Abgrenzung nicht, da die Talmyʼsche Einteilung ausreichend funktional erscheint.
Kehren wir zurück zu den Subklassen fiktiver Bewegung innerhalb der STLP: Die Kategorie der Pattern paths zeigt per Definition Anteile faktiver Bewegung, sodass an dieser Stelle bereits Abgrenzungsschwierigkeiten zu faktiven Bewegungsereignissen deutlich werden. Ähnliche Schwierigkeiten bereitet die Klasse der Frame-relative paths, denn auch bei dieser Klasse liegt faktive Bewegung vor. Allerdings sind FIGUREFigure und GROUNDGround auf sprachlicher Ebene gewissermaßen vertauscht. Die Kategorie der Access paths wiederum beschreibt in meinen Augen einen stationären, nicht-dynamischen Zustand, der durch ein nicht-dynamisches Verb ausgedrückt wird. Insofern bleibt die Aufnahme der gesamten Kategorie in die Klasse der fiktiven Bewegungsereignisse fragwürdig. Nicht ausgeschlossen werden kann jedoch, dass die von Talmy für das Englische konzipierten Beispiele der Access paths eine dynamischere Lesart zeigen, als dass für das Deutsche der Fall ist (für eine ausführlichere Diskussion zur Notwendigkeit einzelsprachlicher Kategorien siehe die Abschnitte 2.4 sowie 5.3). Talmy (2000a: 104) selbst argumentiert hinsichtlich der Vagheit seiner Klassifikation wie folgt:
Most observers can agree that languages systematically and extensively refer to stationary circumstances with forms and constructions whose basic reference is to motion. We can term this constructional fictive motion Speakers exhibit differences, however, over the degree to which such expressions evoke an actual sense or conceptualization of motion – what can be called experienced fictive motion.
Aus diesem Zitat geht hervor, dass die Sprache stationäre Ereignisse mithilfe von Zeichen ausdrückt, die ein dynamische Basisbedeutung haben; die in vielen Kontexten mit Dynamik assoziiert werden. Talmy verweist nun auf sprecherindividuelle Unterschiede, was die Interpretation des sprachlichen Zeichens betrifft. Er eröffnet somit ein Kontinuum hinsichtlich der Dynamik des versprachlichten Ereignisses. Das Kontinuum ist nicht sprachlich begründet, sondern findet seine Ursache in der konstruktivistischen Wahrnehmung von Sprechenden.
2.2.3Konzeptuelle Metaphern
Eine dritte Kategorie ist notwendig, um den Untersuchungsgegenstand abgrenzen zu können: Neben faktiven und fiktiven Bewegungsereignissen finden sich in den Sprachen der Welt metaphorische Verwendungen von sprachlichen Elementen, die eine Bewegungskomponente tragen, wie in den Beispielen (8) deutlich wird.
(8)
a. Die Zeit läuft uns davon.
b. Die Tage flogen nur so vorbei.
Nach der Metapherntheorie von George Lakoff und Marc Johnson sind Metaphern mehr als rhetorische Stilmittel. In ihrem Grundlagenwerk Metaphors we live by zeigen die beiden kognitivistisch orientierten Linguisten anhand inzwischen vielfach zitierter Sprachbeispiele, dass Metaphern Werkzeuge des Denkens sind und unsere Vorstellungen über unsere Umwelt strukturieren (Lakoff & Johnson 1980a, 1980b; Lakoff 1987). Dabei sind alle Konzepte, die sich nicht unmittelbar körperlich erfahren lassen, notwendigerweise durch Metaphern strukturiert, die es uns ermöglichen, diese nicht-wahrnehmbaren Konzepte begreifbar werden zu lassen. Diese Struktur ist Sprachnutzern weitgehend nicht zugänglich. So wie das Sprechen an sich in den meisten Fällen unbewusst verläuft, so unbewusst bleibt auch die Metaphorik, die sich hinter alltäglichen Aussagen verbirgt. Die Sprache bietet dabei Hinweise auf diese unbewussten Denkstrukturen. Aus der metaphorischen Versprachlichung abstrakter Konzepte ergeben sich bestimmte Konsequenzen. Eine der vermutlich wichtigsten Konsequenzen der Metapherntheorie nach Lakoff & Johnson ist, dass durch das Mapping einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne bestimmte Aspekte eines Konzeptes in den Vordergrund treten, während andere im Hintergrund verbleiben.1
Unterschieden werden kann im Rahmen der Metapherntheorie in Subklassen konzeptueller Metaphern: Ontologische Metaphern dienen der Konstruktion von Entitäten. Typische Beispiele sind Personifikationen nicht-belebter Gegenstände oder von Konzepten, die keine natürlichen/physisch erkennbaren Grenzen aufweisen. Strukturmetaphern hingegen dienen der Organisation und Hierarchisierung von komplexen Wissensbereichen, wobei alltägliche Konzepte auf alltagsferne Konzepte übertragen werden.
Im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind konzeptuelle Metaphern höchst relevant, denn eine Vielzahl von abstrakten Wissensfeldern wird mithilfe von Raumausdrücken organisiert: Allein die beiden konzeptuellen Metaphern TIME IS A MOVINGOBJECT sowie CHANGE IS MOTION sind Grundlage für eine Vielzahl von Ausdrücken, die mit Bewegung assoziiert sind (Lakoff & Johnson 1980a: 468). Hinzu kommen die konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN; SCHLECHTIST UNTEN, die wiederum eine Basis für eine breite Sprachverwendung bilden. Exemplarisch sind die Belege (9) a. und b. angeführt.
(9)
a. Gesundheitlich geht es wieder bergauf.
b. Nach der Trennung war ich tief gefallen.
2.2.4Körperassoziierte Bewegung
Nicht erfasst sind bislang solche Bewegungsereignisse, die die Bewegung von Körperteilen beinhalten. Bei der Bewegung von Körperteilen handelt es sich deswegen um eine spezielle Kategorie von Bewegungsereignissen, da die Relation zwischen AGENSAgens und PATIENSPatiens eine Teil-Ganzes-Relation sein kann, wie an Beleg (10) sowie (11) gezeigt wird.
(10)
Der Übende beugt den Rumpf vorwärts und setzt die Hände in Schulterbreite auf dem Boden auf, die Finger zeigen nach vorn. [Borrmann, Günter u. Mügge, Hans: Gerätturnen in der Schule, Berlin: Volk u. Wissen 1957, S. 261]
(11)
Steil und drohend stach er den Finger nach oben. [Neutsch, Erik: Spur der Steine, Halle: Mitteldeutscher Verl. 1964 [1964], S. 248]
Es handelt sich somit nicht um prototypisch faktive, kausal induzierte Bewegungsereignisse. Bei prototypisch kausalen Bewegungsereignissen fallen AGENS und PATIENSPatiens nicht zusammen, sondern stellen verschiedene Entitäten dar. Da sich die Bewegung von Körperteilen also deutlich von kausalen Bewegungsereignissen unterscheidet, wurde die Klasse körperassoziierte Bewegungsereignisse für die vorliegende Arbeit angesetzt und im empirischen Teil berücksichtigt. Den nicht-prototypischen Charakter machen Knop & Dirven (2008: 307) daran fest, dass Körperteile lediglich das Element GOAL der Bewegung ausdrücken könnten. Dies trifft es in meiner Einschätzung nicht, denn Beleg (12) zeigt sehr wohl die Versprachlichung der SOURCE.
(12)
Sie wandte ihr Gesicht langsam von mir ab dem Fenster zu […] [Rinser, Luise: Mitte des Lebens, Frankfurt a. M.: S. Fischer 1952 [1950], S. 35]
Neben diesen Bewegungsereignissen wurden durch die Suchanfragen in den Korpusstudien der vorliegenden Arbeit auch solche identifiziert, in denen der gesamte Körper des AGENSAgens positioniert wird. Dazu gehören die Konstruktionen mit den klassischen PositionsverbenPositionsverbsetzen, stellen, legen sowie weniger frequente Verben wie plumpsen oder krümeln, jeweils in reflexiven Konstruktionen1 und teilweise in Passivkonstruktion. Eine weitere Unterkategorie der körperlichen Bewegungsereignisse stellt die Gruppe der Konstruktionen dar, in denen Körperflüssigkeiten bewegt werden (vgl. Belege (13)-(15)).
(13)
[…] und Laura weinte ins Bett hinein, weinte in die noch schweißwarmen Kissen hinein, […] [Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. In: ders., Drei Romane, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1972 [1954], S. 555]
(14)
Er hält ein Nasenloch zu, rotzt auf den Boden, […] [Knef, Hildegard: Der geschenkte Gaul, Berlin: Ullstein 1999 [1970], S. 80]
(15)
Er hebt seinen rechten Arm, winkelt ihn an und speit Priemtabaksaft durch den Armwinkel in den Sand. [Strittmatter, Erwin: Der Laden, Berlin: Aufbau-Verl. 1983, S. 269]
Die Kategorie körperassoziierte Bewegungsereignisse subsumiert somit eine Bandbreite an Bewegungsereignissen, die das besondere Merkmal zeigen, das AGENSAgens und PATIENSPatiens entweder identisch sind oder aber durch Teil-Ganzes-Beziehungen strukturiert sind.
2.2.5Zusammenfassung
Nach diesen Ausführungen können die unterschiedlichen Bewegungsereignisse kategorisiert und definiert werden. Das Ergebnis der Systematisierung zeigt Tabelle 5.
Kategorie
Definition
faktive Bewegung
Die Bewegungskonstruktion wird vom Sprachnutzer als dynamisches Bewegungsereignis gewertet.
fiktive Bewegung
Die Bewegungskonstruktion wird als nicht-dynamisches Bewegungsereignis gewertet.
konzeptuelle Metapher
Die Bewegungskonstruktion resultiert aus dem Mapping eines dynamischen Quellbereichs auf einen nicht-dynamischen Zielbereich.
körperassoziierte Bewegung
Die Bewegungskonstruktion wird als dynamisch gewertet und entweder durch eine Teil-Ganzes-Beziehung strukturiert oder AGENS und PATIENS sind identische Entitäten.
Bewegungsereignisse und deren Definitionen.
Mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten sind auf unterschiedlichen Ebenen begründet und werden daher an unterschiedlichen Stellen der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und diskutiert. Zunächst ergeben sich Probleme, die bereits in der Theorie der Talmy’schen STLP angelegt sind. Dazu wird in Abschnitt 2.4 die Fuzzylogik herangezogen. Als zweite Ursache lassen sich Ambiguitäten wie etwa bei unklarem Referentenbezug feststellen. Schließlich taucht das Phänomen sich überlagernder Bewegungsereignisse auf, das die eindeutige Zuordnung in die vier abgeleiteten Klassen faktive Bewegung, fiktive Bewegung,konzeptuelle Metapher und körperassoziierte Bewegung verhindert. Anhand authentischer Korpusbelege werden somit unscharfe Kategoriengrenzen sichtbar. Die beiden letzteren Probleme stellen ein eher methodisches Problem für die Korpusstudien dar. Daher werden diese Probleme im empirischen Teil unter Abschnitt 5.1.4 erörtert, wenn es um die Frage der Datenkodierung geht.
Während Kapitel 2.2 weitere grundlegende Konzepte der Versprachlichung von Bewegungsereignissen beleuchtet hat, werden in 2.3 die typologischen Unterschiede im Mapping der hier eingeführten semantischen Grundbausteine auf sprachliche Einheiten aufgefaltet.
2.3L. Talmys Framing- und Actuating-Typologien
Talmys Ziel ist es, das Verhältnis von Bedeutungseinheiten und sprachlichen Einheiten zu beschreiben. Postuliert werden demnach zwei unterschiedliche Ebenen, die beide konzeptualisiert und mental repräsentiert seien: (1) die semantische Ebene sowie (2) die syntaktische Ebene. Potenziell sind zwei Wege gangbar, um das Ziel einer Beschreibung der Relationen zwischen diesen beiden Ebenen zu erreichen: (1) Die abstrakte Bedeutungsentität wird konstant gehalten und ermittelt, welche sprachlichen Elemente von Sprechern genutzt werden, um diese auszudrücken. (2) Die konkreten sprachlichen Elemente werden als Ausgangspunkt genutzt, um die semantischen Elemente zu analysieren, die durch das sprachliche Element ausgedrückt werden. Der zweite Ansatz ist als framing typologyframing typology bekannt, vielfach zitiert, erweitert und entsprechend kritisiert worden (u. a. Slobin 2004; Pourcel & Kopecka 2005; Ibarretxe-Antuñano & Hijazo-Gascón 2012; Ibarretxe-Antuñano 2017a). Mit diesem Ansatz werde ich mich im folgenden Abschnitt auseinandersetzen.
2.3.1Framing typology
Talmy postuliert als Ergebnis seiner Arbeiten zur Versprachlichung von Bewegungsereignissen drei typologische Klassen, nach denen semantische Elemente im Verb repräsentiert sind (siehe Tabelle 6).
Sprache/Sprachfamilie
im Verb lexikalisierte Elemente
Romanische Sprachen
Semitische Sprachen
Polynesisch
Nez Perce
Caddo
PATH + MOTION
Indo-Europäische exklusive der
romanischen Sprachfamilie
Chinesisch
MANNER/CAUSE + MOTION
Atsugewi
Navajo
FIGURE + MOTION
Typologische Klassifikation nach Talmy (1985: 75, 2000: 222).
In der darauffolgenden Rezeption und Weiterentwicklung wurden für diejenigen Sprachen, welche PATH + MOTION durch das Verb versprachlichen, der Begriff verb-framed languages eingeführt. Es wird auf diesen Sprachtyp mit der gebräuchlichen Abkürzung V-framed verwiesen. Für diejenigen Sprachen, in denen MANNER + MOTION bzw. CAUSE + MOTION im Verb lexikalisiert sind, wurde der Begriff satellite-framed languages, kurz S-framed, geprägt. In diesem Abschnitt soll näher auf diese beiden typologischen Klassen eingegangen werden. Sicherlich gibt es sowohl in S-framed Sprachen einige Konstruktionen, die sich am Muster der V-framed Sprachen orientieren und vice versa. Die typologische Klassifikation einer Sprache stellt eine starke Abstraktion des Sprachgebrauchs dar, bei der nicht alle Strukturen gleichermaßen berücksichtigt werden. Talmy bemerkt dazu (2017: Foreword):
While every language may exhibit a certain variety of such cross-tier relations, each typology rests on determining the characteristic pattern for a given language—that is, the cross-tier pattern that is most colloquial in style, frequent in occurrence, and pervasive across different types of constructions.
Das Zitat mag darüber hinwegtäuschen, dass Talmy selbst keine quantitativen Daten von Sprachen für seine Analyse nutzt. Die angeführten Eigenschaften Unmarkiertheit, Frequenz und Produktivität werden nicht weiter operationalisiert. Eine ausführlichere Diskussion hierzu bietet Abschnitt 2.4.2.
Ich fahre zunächst mit dem Typ der V-framed Sprachen fort. Dazu werden die sprachlichen Beispiele in (16) und (17) aus dem Spanischen angeführt, das als prototypisch für V-framed Sprachen betrachtet werden kann (Talmy 1985: 69).
(16)
La
botella
entró
a
la
cueva
(flotando).
the
bottle
moved-in
to
the
cave
(floating)
‘Die Flasche trieb in die Höhle’
(17)
La
botella
salió
de
la
cueva
(flotando).
the
bottle
moved-out
from
the
cave
(floating)
‘Die Flasche trieb aus der Höhle’
Talmys Beobachtungen zufolge sei es in V-framed Sprachen unüblich, die Art und Weise der Bewegung zu versprachlichen. Vielmehr werde diese durch den Rezipienten aus dem Kontext konstruiert. Daher sind die Angaben, die MANNER kodieren, in Klammern dargestellt. Jedoch lägen in diesen Sprachen eine Reihe von Verben vor, die die PATH-Komponente der Bewegung spezifizieren. In den Beispielen (16) und (17) sind dies die Verben entro sowie salio, die sowohl die Richtung als auch das Überschreiten einer konzeptionellen Grenze ausdrücken. Diese Beobachtungen gehen Wälchli (2001) zufolge bereits auf Tesnière (1959) zurück.
Wie bereits in Tabelle 6 dargelegt, wird das Deutsche als indo-europäische Sprache zum Typ der S-framed Sprachen gezählt. S-framed Sprachen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die PATH-Komponente nicht durch das Verb versprachlichen, sondern durch ein Verb-externes Element, das sogenannten satelliteSatellite, wodurch sich auch der Terminus satellite-framed bedingt. Unter satellite versteht Talmy (2000: 102): „It is the grammatical category of any constituent other than a noun-phrase or prepositional-phrase complement that is in a sister relation to the verb root“. Für das Englische werden PartikelnPartikel aufgeführt sowie Wörter, die ebenso als Präpositionen fungieren können. Für das Deutsche werden trennbare und nicht-trennbare Präfixe angeführt. Der Vorteil einer neu eingeführten Wortkategorie statt der Nutzung tradierter Begriffe liegt für Talmy darin, Wörter, die in verschiedenen Sprachen ähnliche Funktionen erfüllen, durch eine einzige übersprachliche Klasse zu systematisieren (vgl. ebd.). Der Zusammenfall mit einzelsprachlichen WortartenklassenWortart kann eine Abgrenzung jedoch erschweren und die explizite Abgrenzung zwischen dem Begriff satelliteSatellite und AdpositionAdposition hat zu Kontroversen in der Rezeption von Talmys Arbeiten geführt (vgl. u. a. Goschler & Stefanowitsch 2013, siehe Abschnitt 2.4 der vorliegenden Arbeit).
Da die PATH-Komponente in Sprachen des S-framed Typs Verb-extern versprachlicht wird, kann eine andere semantische Komponente innerhalb des Verbs erscheinen. Typischerweise, so Talmy (1985), sei dies entweder die Art und Weise der Bewegung, MANNERManner, wie in Beispiel (18) aus Talmy (1985: 62), oder die Verursachung der Bewegung, CAUSE.
(18)
The rock slid/rolled/bounced down the hill.
‘Der Stein rutschte/rollte/sprang den Berg herunter’
Neben den Relationen MANNER und CAUSE definiert Talmy (2000, 2017) eine Reihe weiterer Kategorien, die in der einschlägigen Literatur jedoch bislang weniger rezipiert worden sind. Eine Auseinandersetzung mit diesen Relationen auch für das Deutsche findet sich in Kapitel 2.3.4 der vorliegenden Arbeit.
2.3.2Actuating typology
Während sich der vorausgehende Abschnitt mit der framing typology auseinandergesetzt hat, wird in diesem Teil der Arbeit die actuatingactuating typology typology thematisiert, die bislang weit weniger rezipiert wurde, wie Talmy selbst bemerkt (Talmy 2017). Die beiden Typologien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Perspektivierung: Die framing typologyframing typology hält das semantische Element PATH konstant und nimmt dessen Enkodierung in verschiedenen Sprachen in den Blick. Die actuating typology hingegen fokussiert das Vollverb von Bewegungskonstruktionen, um die enkodierten semantischen Elemente zu fassen. Der Unterschied in der Perspektivierung wird in Abbildung 2 illustriert.
Perspektive der framing typology und der actuating typology im Vergleich.
Als Co-EventCo-Event bezeichnet Talmy (2000b) die zusätzlich zum Fakt der Bewegung hinzutretende Komponente, die innerhalb des Verbs ausgedrückt werden kann. Diesen typologischen Ansatz fasst Ibarretxe-Antuñano (2017b: 14–16) zusammen, indem sie die drei unterschiedliche Sprachtypen kontrastiert. In Beispiel (19) für das Spanische fallen die semantischen Komponenten MOTION sowie PATH im Verb zusammen:
(19)
El niño entra corriendo.
‘Der Junge tritt rennend ein’
Im Englischen hingegen ist es die semantische Komponente MANNERManner, die im Verb mit der MOTION Komponente verschmilzt, siehe (20). Diese Sprachen nennt Ibarretxe-Antuñano (2017b) Co-eventCo-Event languages.
(20)
The boy runs in.
‘Der Junge rennt rein’
In nur wenigen der bisher weltweit beschriebenen Sprachen fallen die FIGUREFigure und MOTION im Hauptverb einer sprachlich kodierten Bewegungssituation zusammen. Einer dieser Sprachen ist Atsugewi, eine inzwischen beinahe ausgestorbene Sprache eines gleichnamigen amerikanischen Ureinwohnervolkes, das im Nordosten Kaliforniens lebt. Es war diese Sprache, über die Talmy seine Dissertationsschrift (Talmy 1972: Semantic structures in English and Atsugewi) verfasste und ihn zu seiner sprachtypologischen Theorie führte.
(21)
‚w
ca
st’aq‘
-íc’t-ɑ
3SG
from the wind blowing on it
runny icky material moved
into liquid
‘Dadurch, dass der Wind auf das Material geblasen hat, ist das eklige Material zu Flüssigkeit zerlaufen’
Die Holprigkeit der Übertragungsversuche sowohl ins Englische als auch ins Deutsche zeigen auf, wie eng Kognition und Versprachlichungsstrategien verbandelt sind. Die Idee, dass FIGUREFigure und MOTION im Verb einer sprachlich kodierten Bewegungssituation zusammenfallen, ist für Sprachnutzer des Deutschen oder Englischen schwer zu fassen.
Diese Beispiele aus drei typologisch völlig unterschiedlichen Sprachen illustrieren erneut den Talmy’schen Grundgedanken: Nach Talmy (2000b; 2017) ist ein Bewegungsereignis auf zwei unterschiedlichen Ebenen konzeptualisiert und repräsentiert: (1) auf der semantischen Ebene, die die Komponenten FIGURE/ MOTION/ PATH/ GROUND umfasst und (2) auf der syntaktischen Ebene, die u. a. die Elemente Subjekt NP / Verb(en) / Objekt NP(s) / Satellit(en)Satellite / Präposition(alphrase) enthalten kann. Diese Annahmen haben nach Talmy (2000; 2017) übersprachliche Gültigkeit. Form und Funktion syntaktischer Kategorien werden hierbei nicht trennscharf unterschieden: Die Kategorien Subjekt-NP sowie Objekt-NP referieren auf funktionale Kategorien, während andere gelistete Elemente auf die Form verweisen (Präposition, Verb).
Wichtig für die weitere Argumentation ist die Unterscheidung in simple Ereignisse und komplexe Ereignisse (Talmy 1991: 481). Ein simples Ereignis kann durch einen einzigen Satz versprachlicht werden. Komplexe Ereignisse hingegen lassen sich lediglich durch einen übergeordneten und einen untergeordneten Satz paraphrasieren. Sie können nicht durch einen einzelnen Satz paraphrasiert werden. Deutlich wird dies an den Beispielen in (22) für ein simples Ereignis und (23) für ein komplexes Ereignis (Talmy 1991: 488):
(22)
The bottle moved into the cave.





























