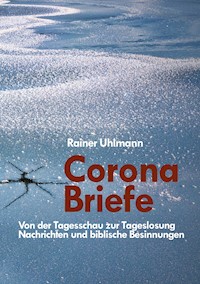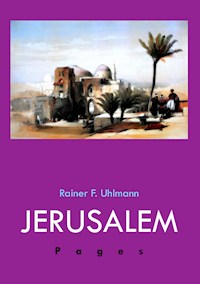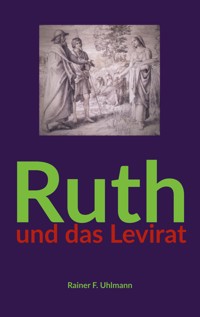Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Bibel Navi Israel« ist der biblische Reiseführer, der aus der Praxis von Gruppenreisen entstanden ist. Er konzentriert sich fast ausschließlich auf Orte, die in der Bibel vorkommen und zum Heil des Menschen in die Geschichte eingegangen sind. Mit biblischer »Navigation« das Land kennenzulernen ist eine Erfahrung, die unvergleichlich und unvergesslich bleibt. Handelt es sich bei den biblischen Schauplätzen doch nicht um stumme Zeugen der Vergangenheit, sondern um Steine, die sprechen: "Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken" (Mt 3,9; Lk 3,8). Die Erklärungen der Orte beschreiben zunächst, was der Besucher vor Augen hat. Danach werden die dazu gehörenden Bibeltexte aufgeführt. Sie eignen sich gut für eine Andacht oder einen geistlichen Impuls. Wer noch weitergehen möchte, findet anschließend wichtige Hinweise zur Geschichte des Ortes. Bilder sind in der App. Nach der Beschreibung von Jerusalem und Umgebung folgen die Orte einer kreisförmigen Route, die im Norden der Mittelmeerküste beginnt, sich nach Süden bewegt, dann nach Osten in die Negevwüste abbiegt und in Galiläa, dem hauptsächlichen Wirkungsgebiet Jesu, endet. Wie finde ich möglichst schnell den gesuchten Ort? Ganz einfach: entweder Sie schauen auf die folgenden Übersichts-karten und ihre Seitenangaben, oder Sie orientieren sich am alphabetischen Inhaltsverzeichnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Geleit
Dieses Buch ist ein Geschenk – für jeden, der in Israel unterwegs ist, der die Stätten sehen will, an denen sich Gott in besonderer Weise gezeigt hat. Zu allen Zeiten wollten Christen diese Orte, Wege und Berge kennenlernen, wo man in "die geschichtlichen Fußspuren" des Jesus von Nazareth "treten" kann. Diese Sehnsucht zieht sich durch die Jahrhunderte: altkirchliche Pilger, fragwürdige Kreuzritter, Templer, Pietisten und Archäologen. Ludwig Schneller, Conrad Schick, Samuel Gobat - in dieser pietistischen Tradition ist der Autor zu sehen. Er hat viele Reisegruppen durch Israel geführt. Durch seine Mitarbeit beim "Evangeliumsdienst für Israel" ist er ein Freund Israels und insbesondere der messianischen Bewegung geworden.
Und wir auf dem Schönblick teilen diese Freundschaft. Hier treffen sich an Jesus glaubende Juden zu Tagungen – wie auch arabische Christen. Wir bringen sie miteinander ins Gespräch. Versöhnungsinitiativen zwischen israelischen und palästinensischen Christusgläubigen aus Israel, dem Westjordanland und Gaza treffen sich hier, um Schritte aufeinander zu zu gehen: "Damit sie alle eins seien", wie Jesus im Abschiedsgebet gelehrt hat. Deswegen editiert der Schönblick dieses Buch gerne, wir wünschen ihm weite Verbreitung.
Kuno Kallnbach
Leiter Seminare
Schönblick
Was Sie erwartet …
»Bibel Navi Israel« ist der biblische Reiseführer, der aus der Praxis von Gruppenreisen entstanden ist. Er konzentriert sich fast ausschließlich auf Orte, die in der Bibel vorkommen und zum Heil der Menschen in die Geschichte eingegangen sind. Mit biblischer »Navigation« das Land kennenzulernen ist eine Erfahrung, die unvergleichlich und unvergesslich bleibt. Handelt es sich bei den biblischen Schauplätzen doch nicht um stumme Zeugen der Vergangenheit, sondern um Steine, die sprechen: "Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken" (Mt 3,9; Lk 3,8).
Was Sie in diesem Buch lesen, ist zugleich Text des iBooks »Israel Geo Guide«, das darüber hinaus zahlreiche Fotos und historische Abbildungen der jeweiligen Stätten enthält. Es kann im iTunes store bezogen werden und eignet sich vorzugsweise zur Verwendung auf dem iPad, kann aber ebenso auf jedem Notebook oder Computer betrachtet werden. Auch die dazu gehörende website www.israel-geo-guide.de gibt einen umfassenden und illustrierten Einblick in die biblischen Stätten Israels.
Die Erklärungen der Orte beschreiben zunächst, was der Besucher vor Augen hat. Danach werden die dazu gehörenden Bibeltexte aufgeführt. Sie eignen sich gut für eine Andacht oder einen geistlichen Impuls. Wer noch weitergehen möchte, findet anschließend wichtige Hinweise zur Geschichte des Ortes.
Nach der Beschreibung von Jerusalem und Umgebung folgen die Orte einer kreisförmigen Route, die im Norden der Mittelmeerküste beginnt, sich nach Süden, dann nach Osten in die Negevwüste bewegt und über das Jordantal nach Galiläa gelangt, dem hauptsächlichen Wirkungsgebiet Jesu.
Wie finde ich möglichst schnell den gesuchten Ort? Ganz einfach: entweder Sie schauen auf die folgenden Übersichtskarten und ihre Seitenangaben, oder Sie orientieren sich am alphabetischen Inhaltsverzeichnis.
Schalom und eine gesegnete Zeit im Heiligen Land!
Rainer F. Uhlmann
Jerusalem: Biblische Stätten ab Seite →
Galiläa: Biblische Stätten ab Seite →
Inhaltsverzeichnis
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
Wichtig zu wissen …
Faszination Israel
Geschichtliche Epochen
Jerusalem
Jerusalem in der Bibel
Geschichte Jerusalems
Teich Bethesda
Geschichte des Teichs Bethesda
Via Dolorosa
Via Dolorosa in der Bibel
Geschichte der Via Dolorosa
Grabeskirche
Biblisches zur Grabeskirche
Geschichte der Grabeskirche
Erlöserkirche
Gartengrab
Biblisches zum Gartengrab
Geschichte des Gartengrabs
Zion
Zion in der Bibel
Geschichte des Zion
Klagemauer
Geschichte der Klagemauer
Biblisches zur Klagemauer
Tempelplatz
Der Tempelplatz in der Bibel
Geschichte des Tempelplatzes
Kirche des Hahnenschreis
St. Peter in der Bibel
Geschichte von St. Peter in Gallicantu
Davidsstadt
Die Davidsstadt in der Bibel
Geschichte der Davidsstadt
Berg des bösen Rats
Ölberg
Der Ölberg in der Bibel
Geschichte des Ölbergs
Bethanien
Bethanien in der Bibel
Geschichte Bethaniens
Ein Karem
Ein Karem in der Bibel
Geschichte Ein Karems
Bethlehem
Bethlehem in der Bibel
Geschichte Bethlehems
Akko
Akko in der Bibel
Geschichte von Akko
Haifa / Karmel
Der Berg Karmel in der Bibel
Geschichte Haifas
Cäsarea Maritima
Biblisches Cäsarea
Geschichtliches zu Cäsarea
Tel Aviv
Geschichte Tel Avivs
Jaffa
Ayalon
Hebron
Hebron in der Bibel
Geschichtliches zu Hebron
Beersheba
Beersheba in der Bibel
Geschichte Beershebas
Eilat
Eilat in der Bibel
Geschichte Eilats
En Gedi
En Gedi in der Bibel
Geschichte En Gedis
Qumran
Qumran und die Bibel
Aus der Geschichte Qumrans
Jericho
Jericho in der Bibel
Geschichte Jerichos
Galiläa
Bet Shean
Biblisches zu Bet Shean
Aus der Geschichte Bet Sheans
Megiddo
Megiddo in der Bibel
Geschichte Megiddos
Nazareth
Nazareth in der Bibel
Aus der Geschichte Nazareths
Tabor
Tabor in der Bibel
Aus der Geschichte des Tabor
Kana
Kana im Neuen Testament
Aus der Geschichte Kanas
Yardenit (Taufstelle)
Johannes der Täufer
Tiberias
Aus der Geschichte von Tiberias
See Genezareth
Der See Genezareth in der Bibel
Kapernaum
Tabgha
Biblische Geschichte zu Tabgha
Geschichtliches zu Tabgha
Berg der Seligpreisungen
Bethsaida
Kursi / Gerasa / Gadara
Chorazin
Zefat / Safed
Banyas
Banyas in der Bibel
Geschichte von Banyas
Tel Dan
Hazor
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
Abendmahlssaal
Ayalon, Tal
Akko
Banyas
Beersheba
Berg der Seligpreisungen
Berg des bösen Rats
Bet Shean
Bethanien
Bethesda, Teich
Bethlehem
Bethsaida
Bezahlung
Brotvermehrungskirche Tabgha
Busfahren
Cäsarea
Chorazin
Davidsgrab
Davidsstadt
Dominus Flevit
Dormitio-Abtei
Eilat
Ein Karem
Einreise
Eisenbahn
Elektrische Geräte
Eleona-Basilika / Vaterunser-Kirche
En Gedi
Erlöserkirche
Faszination Israel
Feilschen, Handeln
Flugsicherheit
Galiläa
Garten Gethsemane
Gartengrab
Geburtskirche
Geldwechsel
Genezareth, See
Gerasa / Gadara / Kursi
Geschichtliche Epochen Israels
Grabeskirche
Hahnenschrei-Kirche
Haifa / Karmel
Hazor
Hebron
Hirtenfelder
Jaffa
Jericho
Jerusalem
Jesusboot
Kana
Kapernaum
Karmel
Landkarten mit Seitenverweisen
Kirche der Nationen
Klagemauer
Kursi
Megiddo
Nationenkirche
Nazareth
Nov Ginosar
Ölberg
Ölberg-Friedhof
Qasr al Yahud
Qumran
Rahels Grab
Reisepass
Safed / Zefat
See Genezareth
Seligpreisungen, Berg der
Siloah-Teich
St. Anna Kirche
St. Peter in Gallicantu
Strom / Adapter
Tabgha
Tabor
Taufstelle Yardenit
Taxi
Teich Bethesda
Tel Aviv
Tel Dan
Tempelplatz
Templer
Tiberias
Trinkgelder
Via Dolorosa
Währung
Yardenit, Taufstelle
Zefat / Safed
Zion
Wichtig zu wissen …
Reisepass, Flugsicherheit, Einreise
Die Einreise nach Israel ist grundsätzlich völlig unproblematisch, wenn Sie einen Reisepass (ab Zeitpunkt der Einreise noch 6 Monate gültig) besitzen. Auch wenn Ihr Pass Einreisestempel verschiedener arabischer Länder enthält, ist die Einreise gestattet. Bei einigen Airlines wird der Passagier um eine Sicherheitsbefragung gebeten, darum sollten Sie ausreichend Zeit (2-3 Stunden) vor Abflug einkalkulieren.
Die Existenz eines israelischen Stempels im Pass führt zur Einreiseverweigerung in einigen arabischen Staaten, z.B. Kuwait, Libanon, Libyen, Syrien, Saudi-Arabien, VAE, Yemen oder Iran. Es wird empfohlen, um Komplikationen bei späteren Reisen in diese Länder zu vermeiden, den israelischen Einreisebeamten zu bitten, den Einreisestempel auf einem separaten Papierstück anzubringen. Weil man dieses leicht verliert, ist es besser, für solche Fälle zwei Reisepässe zu haben.
Mit einem israelischen Stempel im Pass nach Jordanien und Ägypten zu reisen stellt kein Problem dar, da beide Staaten Israel anerkennen und diplomatische Beziehungen unterhalten. Falls man also nur eine Reise nach Israel mit Abstecher auf den Sinai in Ägypten oder nach Petra in Jordanien plant, reicht ein Pass vollkommen aus.
Geldwechsel, Währung, Bezahlung
Die Währung des Staates Israel ist der Neue Israelische Shekel (NIS) oder kurz: Schekel (plural: Schkalim in Hebräisch oder Schekel in Deutsch). Ein Schekel enthält 100 Agorot (singular: Agora). Banknoten tragen die Nennwerte von NIS 20, 50, 100 und 200; Münzen die Werte von NIS 10, NIS 5, NIS 1 sowie 50, 10 und 5 Agorot.
Alle ausländischen Währungen können am Flughafen, in den Banken, in den Postämtern, in den meisten Hotels oder auch in amtlich zugelassenen Agenturen in den großen Städten umgetauscht werden.
Schekel können bis zu US$ 500 bzw. dem Gegenwert in anderen Währungen an den Bankschaltern am Flughafen zurückgetauscht werden.
Sämtliche Waren und Dienstleistungen können auch bezahlt werden in Euro, US-Dollar, Englische Pfund, Schweizer Franken, u.a. Allerdings sind weder die Geschäftsinhaber noch Dienstleistende verpflichtet, ausländische Währungen zu akzeptieren und dürfen auch Schekel als Wechselgeld zurückgeben. Allerdings sollte man in solchen Fällen auf den Umrechenkurs achten.
Die Umsatzsteuer wird bei einem Mindestkauf von US$ 100 zurückerstattet. Der Verkauf von Juwelen, deren Wert US$ 200 einschließlich Umsatzsteuer übersteigt, ist nicht von der Umsatzsteuer befreit. Die Händler informieren ihre ausländischen Kunden darüber und geben ihnen eine Rechnung, die bei der Ausreise aus Israel (entsprechende Stelle im Flughafen) zusammen mit den in eine versiegelte Tasche verpackten erworbenen Artikeln vorgelegt werden muss. Die Umsatzsteuer wird abzüglich einer Kommission unverzüglich zurückerstattet. Allerdings gibt es auch Geschäfte, die vom Ministerium für Tourismus amtlich legitimiert sind, die Umsatzsteuer bereits im Laden zurückzuerstatten.
Israelische Restaurants, Läden, Hotels, Museen etc. akzeptieren sämtliche führenden Kreditkarten: American Express, Diners, Visa, Mastercard/Access/Eurocard.
Trinkgelder, Feilschen, Preise
In Israel werden vor allem in Restaurants Trinkgelder gegeben. In der Regel ist die Bedienung nicht in der Rechnung inbegriffen, so dass ein Trinkgeld von mindestens 12% zur Endsumme aufgerechnet werden sollte. Im Hotel erhalten Hotelpagen, Kellner und anderen Dienstleistende ein Trinkgeld. Taxifahrer hingegen erhalten kein Trinkgeld.
Sie können in Israel bisweilen auch verhandeln, aber nicht überall. Auf den Freiluftmärkten gehört das Feilschen natürlich mit zum Spaß, so dass Sie hier nicht zu zögern brauchen. Ladeninhaber dagegen sind gesetzlich verpflichtet, die Preise der Waren auszuschildern und sind daher auch nicht bereit zu verhandeln (Ausnahmen bestätigen die Regel). Dasselbe gilt für Restaurants und öffentliche Verkehrsmittel. Um unnötigen Missverständnissen vorzubeugen, sollten Sie auch Taxifahrer bitten, das Taxameter anzustellen.
Busfahrten, Eisenbahn, Taxen
Busse sind die beliebtesten aller öffentlichen Verkehrsmittel in Israel, sowohl für den Nahverkehr als auch für Intercityfahrten. Die Egged Busgesellschaft betreibt die meisten der Intercitybuslinien, sowie den Nahverkehr in den meisten großen Städten. Nahverkehrs- und Intercityverkehrsmittel in der Gush Dan Region (Tel Aviv und die umgebenden Vororte) werden von der Dan Busgesellschaft, Buslinien in Beersheba und Nazareth von privaten Busgesellschaften betrieben. Die Preise für alle Verbindungen sind akzeptabel, die Busse sind bequem und in der Regel klimatisiert, auch werden die Fahrzeuge regelmäßig gewartet.
Fahrkarten können an den Schaltern im zentralen Busbahnhof in jeder Stadt oder beim Fahrer erworben werden. Die meisten der Buslinien fahren nicht am Sabbat oder an jüdischen Feiertagen. Der Betrieb endet am Freitagnachmittag und wird am Samstagabend wieder aufgenommen.
Die Busfahrt in palästinensische Gebiete wie z.B. von Jerusalem nach Bethlehem geht vom arabischen Busbahnhof östlich des Damaskustors mit Linie Nr. 21 über Beit Jala nach Bethlehem. Die durchschnittliche Fahrtzeit beträgt 40 Min., der Preis ist günstig. Ausstieg in Bethlehem ist die Kreuzung "Bab el-Zkak", etwa 1 km von der Geburtskirche entfernt. Man folgt einfach der Papst Paul
VI. Straße, vorbei am Holy Family Hospital und der ehemals deutschen Weihnachtskirche, um in 15 Min. dorthin (Manger Square, Krippenplatz) zu gelangen. Mit dem Taxi kostet es etwa 15 NIS für eine Fahrt (nicht pro Person!), man sollte aber nicht mehr als 20 Schekel zahlen, was immer der Taxifahrer erzählt. - Alternative Buslinie: Bus 124 (24) geht direkt zum Bethlehem Checkpoint, man muss dann aber etwa 2,5 km laufen oder mit dem Taxi ins Zentrum fahren (15-20 NIS). Wichtig in jedem Fall: den Pass mitnehmen!
Israels Eisenbahn ist in den letzten Jahren gewachsen und hat immer mehr Verbindungen eingerichtet. Züge fahren jetzt häufiger und mehr Ziele an, die Zahl der Bahnhöfe in den größeren Städten wächst, und die Züge sind komfortabler geworden.
Studenten und Senioren erhalten gegen Vorlage einer Studentenkarte oder eines Ausweises einen Preisnachlass.
Wegen der Verkehrsstaus auf vielen Straßen empfiehlt sich, wann immer es geht die Eisenbahn zu nehmen. Züge fahren von Tel Aviv zu den meisten großen Städten, von Naharia im Norden bis Dimona im Süden, einschließlich der Flughäfen Jerusalem und Ben Gurion.
Eisenbahnfahrkarten gibt es am Schalter oder am Automaten. Sitzplätze können auch zuvor reserviert werden. Züge fahren nicht am Sabbat oder an jüdischen Feiertagen.
Lokaler und Intercity-Taxiservice ist von und zu jedem Ort im Land verfügbar. Fahrpreise innerhalb der Städte werden entsprechend dem Zähler (Taxameter) erhoben. Die Fahrpreise für den Intercity-Taxiservice sind Standardfahrpreise und werden vom Verkehrsministerium festgelegt. Es wird empfohlen die Höhe des Fahrpreises nachzufragen, bevor man ins Taxi einsteigt.
Taxis können per Telefon von einer lokalen Taxistation aus bestellt werden oder indem man sie auf der Straße heranwinkt.
Eine durchschnittliche Fahrt in der Stadt kostet etwa NIS 20. Es gibt einen Preisaufschlag von NIS 3,50 für telefonische Bestellungen und eine zusätzliche Gebühr von NIS 2,90 für jeden Koffer, der nicht als Handgepäck zählt.
Die Fahrpreise für die Nacht liegen 25% höher, sie beginnen um 21:01 Uhr und enden um 5:29 Uhr. Diese Fahrpreise gelten auch für den Sabbat und für Feiertage.
Fahrer müssen für Fahrten innerhalb der Stadt den Zähler einschalten. Lassen Sie sich vom Fahrer nicht dazu überreden, vor Beginn der Fahrt einem Preis zuzustimmen, wenn Sie mit den Preisen nicht vertraut sind!
Sherut Taxi – die populäre Alternative. Sie fahren in einem Großraum-Taxi (Mercedes Sprinter o.ä.) mit anderen Fahrgästen gemeinsam. Sammeltaxis fahren auf lokalen und Intercityrouten, die weitgehend mit den Busrouten übereinstimmen, z.B. vom Flughafen Ben Gurion nach Jerusalem. Der Preis für diese Taxen wird entsprechend der Entfernung festgesetzt. In vielen Fällen entspricht er einem gleichwertigen Busfahrpreis oder ist etwas billiger.
Vorteile: Sie bezahlen zu Beginn der Fahrt erheblich weniger als mit normalem Taxi. Sammeltaxis halten an ständigen Haltestellen, aber auch auf Anfrage entlang des Weges. Man kann die Haltestelle, z.B. die Unterkunft in Jerusalem, auch direkt mit dem Fahrer ausmachen. Einige zentrale Taxilinien fahren sogar am Sabbat.
Nachteile: Abfahrtszeiten werden nicht geplant: das Taxi verlässt die Station, wenn es voll ist. Aus diesem Grunde sollte man in Erwägung ziehen, eine Zeit lang warten zu müssen, bevor es losgeht. Sie müssen zu einem Sammelpunkt kommen oder sich vorher telefonisch anmelden, um auf der Route des Taxis mitgenommen zu werden. Das gestaltet sich aufgrund von eventuellen Sprachbarrieren etwas schwierig, ist aber einen Versuch wert. Mit jüdischen Sherut (Betreiber ist »Nesher«) können Sie nicht in arabische Gebiete oder den arabischen Teil Jerusalems fahren.
Strom, elektrische Geräte, Adapter
Das israelische Stromsystem ist einphasig mit einer Wechselspannung von 220V / 50 Hz. Die meisten Steckdosen sind mit drei Anschlüssen ausgestattet. Diese können aber größtenteils ohne Adapter von Geräten mit europäischem Doppelstecker genutzt werden.
Wenn möglich sollte man zuerst den Stecker in die Dose und danach in das Gerät stecken, damit der oft beim Einstecken entstehende »Blitz« nicht als Überspannung im Gerät endet. Wer besonders vorsichtig sein möchte, etwa um sein teures Notebook zu schützen, kann einen Adapter mit einem zusätzlichen Überspannungsschutz verwenden.
Faszination Israel
Ein Besuch in Israel ist für viele ein Erlebnis, das mit nichts anderem vergleichbar ist. Wer mit der israelischen Fluggesellschaft EL AL fliegt, kann ein besonderes Willkommen erleben: bei der Landung ertönt aus den Lautsprechern ein Popsong - mit dem Titel »Halleluja«. So fängt es an, und so geht es weiter: Namen wie Josef, Jesus, Abraham, David klingen hier nicht nach ferner Vergangenheit, sie sind so gegenwärtig wie der Nachbar von nebenan. In Israel liegt »etwas« in der Luft, das nicht einfach zu beschreiben ist. Hier ist man nicht nur Tourist, sondern Angesprochener, im Herzen Berührter. Manche Reisende haben den Eindruck, zuhause angekommen zu sein, da, wo sie schon immer hin wollten.
Gilt der Orient als die Wiege der Zivilisation, trifft das auf Israel in besonderer Weise zu. Einflüsse aus der ganzen Welt bilden in Israel eine überraschende und bisweilen paradoxe Mischung wie sonst nirgends. Auseinander driftende Zeugen von Antike und Moderne, Gegensätze in Kultur und Tradition, Berufsethos und Lifestyle gehen eine mitunter unvorbereitete und erfrischende Verbindung ein, - miteinander, nebeneinander und manchmal auch gegeneinander.
Israel - Land im Wandel
Was vor 2000 Jahren geschah, könnte gestern gewesen sein. Die Zeiten begegnen einander. Ebenso die Kulturen, die Lebensformen und Landschaften in ihrer großartigen Vielfalt. Unübersehbar ist die unglaubliche Aufbauleistung der Israelis, die aus Wüsten Wälder, aus Sümpfen Anbauflächen, aus dem Sand haben Städte erstehen lassen. "So grün habe ich das Land noch nie gesehen" war jüngst der Kommentar eines Besuchers, der schon mehrfach Israel bereiste.
Der beste Reiseführer
Ein Land voller Widersprüche, Ungewissheiten und Bedrohungen, - dennoch: trotz eines hochsensiblen politischen Balanceaktes erstaunlich stabil. Sich in diesem vielfältigen Land zurechtzufinden ist gar nicht so einfach. Was seine älteste historische Schicht und ursprüngliche Geschichte angeht, ist sicherlich die Bibel der erste und beste Reiseführer.
Mit der Bibel begibt man sich auf eine Reise mit dem Volk Gottes. Angefangen von der Besiedlung des Landes nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten und der Gesetzgebung am Berg Sinai bis zur Lebens- und Leidensgeschichte Jesu, seiner Auferstehung und Sendung der Jünger in alle Welt. Die in der Bibel beschriebenen Geschehnisse sind der Beginn einer neuen Epoche der Weltgeschichte. Gottes Heil für die Menschen dringt vor zu den Völkern der Welt: "Und Jesus … sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker." (Mt 28,18.19).
Ernest Renan (1823-1892) hat das Land Jesu als das "Fünfte Evangelium" bezeichnet. Die historischen Plätze veranschaulichen die biblischen Erzählungen und lassen das Geheimnis von Jesu Leben und Sterben aufleuchten. Wer die vier Evangelien liest, begreift das fünfte; und wer das fünfte "liest", versteht die vier. Der Reisende wird an sich selbst erfahren, was François-René de Chateaubriand (1768-1848) so beschrieb: Das heilige Land ist das einzige Land auf Erden, das den Reisenden an Dinge gemahnt, die zugleich menschlichen als auch himmlischen Ursprungs sind. Und gerade diese Verknüpfung lässt Gedanken und Gefühle aufsteigen, wie sie uns kein anderes Land zu geben vermag. Es stimmt nachdenklich, wenn man an den biblischen Stätten erlebt, wie selbstsichere und erfolgsverwöhnte Verstandesmenschen ein Schweigen überkommt, und wie selbst hochrangige Akademiker von Demut ergriffen werden.
Der deutsche Jerusalem-Pionier und Universalgenie Conrad Schick, der im 19. Jahrhundert wesentlich zum Aufbau der Stadt beitrug, hat die Bedeutung des Heiligen Landes darin gesehen: "… dass der Gläubige innerlich und wahrhaftig von den großen Tatsachen Gottes lebt, welche sich an bestimmten Orten auf dieser Erde und zwar zunächst in Jerusalem begeben haben und nach der Heiligen Schrift ... noch begeben werden." Hier hat Gott sein »Basislager« aufgeschlagen und die Fäden in alle Welt und Zeiten ausgezogen. Hier wird er die weltgeschichtlichen Linien wieder zusammenführen und in Gericht und Gnade zu ihrem Ziel bringen.
Geschichtliche Epochen
Alttestamentliche Zeit
1. Nachdem König Salomo den ersten Tempel für Jahwe gebaut hatte, wurde Jerusalem das Zentrum Israels. Nach seinem Tod spaltete sich das Königreich in das nördliche Israel und das südliche Juda, dessen Zentrum Jerusalem blieb.
2. Nachdem Königin Atalja den Baalskult in den Tempel einführte, waren es die Könige Hiskia und später Josia, die den Tempel wieder Jahwe weihten. Indessen war unter den Omriden das Nordreich Israel mit dem Zentrum in Samaria wirtschaftlich und militärisch dem Südreich Juda überlegen.
3. Der babylonische Herrscher Nebukadnezar deportierte ab 597 v. Chr. die Oberschicht, 586 v. Chr. ließ er Jerusalem und seinen Tempel zerstören und führte die Reste der Führungsschicht, darunter den bisherigen König Zedekia, in das babylonische Exil.
4. Nachdem die Perser unter Kyros II. Babylon erobert hatten, verfügte das Kyros-Edikt 538 v. Chr. die Heimkehr der Juden und den Wiederaufbau von Stadt und Tempel. Die Differenzen zwischen Judäern und Samaritanern nahmen zu, nachdem diese sich immer mehr mit Heiden vermischt hatten. Die Abgrenzung von Jerusalem ging so weit, dass sie ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Garizim errichteten.
Griechisch-römisch-byzantinische Epoche
5. Nach griechischer und jüdisch-makkabäischer Herrschaft wurde Palästina römische Provinz, die zum Statthalter von Syrien gehörte. Der von Herodes dem Großen aufwändig ausgebaute zweite Tempel wurde im Jahre 70 n. Chr. am Ende des Jüdischen Krieges durch den römischen Oberbefehlshaber Titus zerstört. Die Römer und Byzantiner hatten die folgenden 600 Jahre die Herrscher über Palästina und machten Caesarea zur Hauptstadt.
6. Der römische Kaiser Hadrian verbot nach dem Bar-Kochba-Aufstand Juden den Zutritt zur Stadt und benannte sie in Aelia Capitolina um, wobei Aelius aus seinem Namen, Publius Aelius Hadrianus, stammte und Capitolina sich auf den römischen Kapitolshügel bezog, wo der römische Hauptgott Jupiter verehrt wurde. Entsprechend wurde der Tempel mit einem Jupitertempel überbaut. Die jüdische Bevölkerung war gezwungen auszuwandern: nach Westen in den Mittelmeerraum oder nach Osten bis Persien.
7. Nachdem die christliche Kaiserin Helena Nachforschungen und Grabungen veranlasst hatte, ließen sie und ihr Sohn Konstantin der Große am Ort der Kreuzauffindung die Grabeskirche erbauen. Nach der römischen Reichsteilung 395 fiel Jerusalem an das oströmisch-byzantinische Reich. Unter byzantinisch-christlicher Herrschaft erlebte Jerusalem eine anhaltende Friedensperiode.
8. Die persischen Sassaniden drangen während des römischpersischen Kriegs (602-628) nach Palästina vor. Von den Juden wurden sie als Befreier von Byzanz begrüßt. Nach 21-tägiger Belagerung eroberten die Perser im Juli 614 Jerusalem, angeblich mit Hilfe jüdischer Verbündeter. Juden sollen anschließend bis zu 90.000 christliche Stadtbewohner ermordet haben.
9. Die Eroberer zerstörten fast alle Kirchen und verschleppten viele Christen nach Persien, darunter den Patriarchen Zacharias. 629 fiel Jerusalem nach dem Sieg des oströmischen Kaisers Herakleios an Byzanz zurück.
Frühe islamische Epoche
10. Nur kurze Zeit nach der gewaltsamen Einführung der neuen Religion wurde auch Palästina von den islamischen Eroberungen nicht verschont. Im Jahre 637 belagerte eine arabische Armee unter General Abu Obaidah ibn al-Jarrah im Auftrag des Kalifen Omar die Stadt und konnte sie nach sechs Monaten durch die Kapitulation der byzantinischen Verteidiger einnehmen. Dem Patriarchen von Jerusalem, Sophronius (560– 638), wurde zugesichert, dass die christliche Bevölkerung die Stadt verlassen dürfe, auch wenn dies de facto nur wenige taten. Juden durften sich wieder in Jerusalem niederlassen, was die 500 Jahre währende Phase jüdischer Vertreibung beendete. Zunächst wurde Jerusalem von der Dynastie der Omaijaden kontrolliert, die seit 639 die islamischen Statthalter Syriens stellte und in Damaskus das erbliche Kalifat („Stellvertreter Gottes“) begründete. Unter ihrer Ägide entstanden die wichtigsten islamischen Sakralbauten in Jerusalem. Auf dem Tempelberg ließ Kalif Abd el-Malik um 692 den Felsendom fertig stellen und die unter seinem Sohn vollendete Al-Aqsa-Moschee beginnen.
11. In einer »konservativen Revolution« im Jahr 750 wurden die Omaijaden von den religiös rigoroseren Abbasiden verdrängt, deren Statthalter Jerusalem für die zwei folgenden Jahrhunderte regieren sollten. Das Kalifat wanderte von Damaskus nach Bagdad. Gegenüber Juden und Christen wechselten Phasen der Toleranz mit Phasen ausdrücklicher Feindschaft. Über jüdische Fernhändler kam es zu einem Deal mit Karl dem Großen, der vom muslimischen Herrscher Harun al-Raschid als formeller Beschützer der christlichen heiligen Stätten anerkannt wurde, - sehr zum Missfallen von Byzanz. Innerhalb der islamischen Welt verlor Jerusalem zu dieser Zeit an Bedeutung, was sich unter den nachfolgenden schiitischen Fatimiden verstärkte, die andere palästinische Stätten wie Ramla oder Tiberias bevorzugten und Jerusalem auch nicht mit dem Zielort der in Sure 17 erwähnten Nachtreise Mohammeds identifizierten. Erst in der Kreuzfahrerzeit begann die christliche Deutung Jerusalems als der 'heiligen Stadt' stärker auf die islamische Sichtweise abzufärben.
12. Im Jahr 979 wurde Jerusalem von den schiitischen Fatimiden aus Ägypten erobert, die ein eigenes Kalifat in Rivalität zum sunnitischen Abbasidenkalifat in Bagdad errichtet hatten. In Jerusalem richteten sie ein Blutbad an, dem sowohl Sunniten wie auch Christen und Juden zum Opfer fielen. Die Grabeskirche wurde gebrandschatzt, zahlreiche Synagogen und Kirchen beschädigt oder zerstört.
13. Dreißig Jahre später wurde die Grabeskirche 1009 auf Befehl des Fatimiden-Kalifen Al-Hakim abgerissen, Christen und Juden als »Ungläubige« verfolgt und durch entwürdigende Demütigungen diskriminiert. - Nachdem der byzantinische Kaiser Romanos III. den Bau einer Moschee in Konstantinopel genehmigt hatte, durfte die Grabeskirche durch griechische Bauleute ab 1028 wieder aufgebaut werden.
14. Im Jahr 1071 fiel Jerusalem widerstandslos in die Hand sunnitischer Seldschuken aus Damaskus, die eine innere Krise des Fatimidenreiches dazu nutzten, Syrien und Palästina zu unterwerfen. Zwischen der vorherrschenden schiitischen Bevölkerung und den verfeindeten Sunniten kam es zu Unruhen und tätlichen Auseinandersetzungen mit zahlreichen Todesopfern. Im August 1098 stießen die Fatimiden erneut gegen Jerusalem vor und eroberten die Stadt mithilfe moderner Kriegsmaschinen in sechswöchiger Belagerung zurück. Innere Zwistigkeiten wie auch der Vormarsch des Kreuzfahrerheeres hatte die Seldschuken in Beschlag genommen, so dass die Schiiten wenig Widerstand verspürten. Die sunnitische Bevölkerung wurde zu großen Teilen aus der Stadt vertrieben, zum Teil auch getötet. Dem seldschukischen Militär gewährte man freien Abzug.
Kreuzfahrerzeit
15. Doch die nächsten Belagerer standen schon vor den Toren Jerusalems: die Kreuzritter begannen die Belagerung der Stadt ohne geeignetes Kriegsgerät. Nachdem ihnen jedoch mit angeliefertem Holz der Bau von drei Belagerungstürmen gelang, eroberten die Kreuzritter am 15. Juli 1099 unter Gottfried von Bouillon und Raimund von Toulouse die heilige Stadt Jerusalem, deren »Reinigung« von den »Heiden« das Ziel ihrer bewaffneten Wallfahrt gewesen war. Nach der blutigen Eroberung von Jerusalem gründeten die Kreuzritter das christliche Königreich Jerusalem und bauten Verwaltung und Kirche neu auf. Nach der Neugründung des Patriarchats von Jerusalem wurde dieses von lateinischen Bischöfen besetzt und neu organisiert; während die einheimische christliche Bevölkerung ihrer orientalischen und orthodoxen kirchlichen Herkunft treu blieb. - Dies war in Jerusalem die Zeit der geistlichen Ritterorden: die Hospitaliter benannten sich nach dem Krankenhaus für Pilger, in dem sie als Bruderschaft von Krankenpflegern begonnen hatten; die Templer leiteten ihre Namen von ihrem Hauptquartier auf dem Tempelplatz im königlichen Palast der Kreuzritter ab.
Erneute islamische Epoche
16. Nach der vernichtenden Niederlage der christlichen Ritter in der Schlacht bei den Hörnern von Hittim 1187 gelang es Saladin, der die ägyptischen Fatimiden gestürzt und die Herrschaft der nach seinem Vater Ayyub benannten Ayyubiden in Ägypten, Palästina und Syrien begründet hatte, Jerusalem nach kurzer Belagerung zu erobern. Er ließ das von den Kreuzfahrern errichtete goldene Kreuz auf der Kuppel des Felsendoms, der neben der Grabeskirche als Hauptkirche gedient hatte und Templum Domini genannt wurde, wie auch die Marmorverkleidung des Felsens samt Altar entfernen. Im dritten Kreuzzug plante der englische König Richard Löwenherz nach erfolgreichen Kämpfen in der Levante die Rückeroberung Jerusalems, gab den Plan angesichts der Übermacht Saladins jedoch wieder auf. Regierungssitz des Königreiches Jerusalem war von nun an die Hafenstadt Akko im Norden.
17. Kurzzeitig gelangte Jerusalem noch einmal in den Besitz der Kreuzfahrer, als der Stauferkaiser Friedrich II. die Stadt 1229 durch Verhandlungen mit dem Ayyubidensultan al-Kamil ohne militärische Aktionen gewann und sich zum König von Jerusalem proklamierte, aber nur wenige Monate im Heiligen Land blieb. 1244 schließlich wurde die Stadt durch marodierende ägyptische Söldner eingenommen und ausgeplündert.
18. 1260 wurde die Ayyubiden-Dynastie in Ägypten von dem Mameluken-General und anschließenden Sultan Baibars gestürzt. Er hatte den Mongoleneinfall in den Nahen Osten gestoppt und danach ganz Syrien und Palästina unter ägyptische Herrschaft gebracht. 1291 vertrieben die Mameluken die letzten Kreuzritter aus Palästina. Jerusalem, damals klein und unbedeutend, blieb bis zur osmanischen Eroberung Anfang des 16. Jahrhunderts unter ägyptisch-mamelukischer Verwaltung. Unter mamelukischer Herrschaft gelten nur Muslime als vollgültige Bürger, Christen und Juden mussten sich durch ihre Kleidung kenntlich machen. Der christliche Pilgerstrom riss dennoch nicht ab.
Osmanische Zeit
19. Ab 1516 traten die von den Rum-Seldschuken herkommenden Osmanen ihren Siegeszug durch den Orient an. Sie besiegten unter Sultan Selim I. (1470–1520) die Mameluken in Syrien, eroberten Ägypten und Arabien und machten Jerusalem zum Verwaltungssitz eines osmanischen Sandschaks (Regierungsbezirk). Nach 1535 ließ Sultan Süleyman I. (1496–1566) die Befestigungen der Stadt in zum Teil veränderter Linie erneut errichten, so wie sie gegenwärtig zu sehen sind.
20. Durch diese Mauern erhielt die Altstadt ihr heutiges Gepräge. Dabei machte Süleyman seinem Beinamen »der Prächtige« alle Ehre. Jerusalem gewann in der Folgezeit viel an Bedeutung. Die osmanische Verwaltung war sich unschlüssig in ihrer Haltung gegenüber den Juden sowie Christen und schwankte zwischen Gewaltherrschaft und Toleranz.
Britische Mandatszeit
21. Um Kämpfe und Schäden an den historischen Stätten zu vermeiden übergab der osmanische Gouverneur der Stadt am 9. Dezember 1917 Jerusalem an die Briten. General Edmund Allenby marschierte an jenem Tag zu Fuß in die Stadt ein. Fortan unterstand Jerusalem dem Völkerbundsmandat für Palästina und wurde Sitz des Hochkommissars und der britischen Mandatsverwaltung. Dies war eine Zeit des Aufblühens für Jerusalem. Die Hebräische Universität wurde errichtet, ebenso das prestigevolle King David Hotel. Die damaligen Baurichtlinien sind bis heute in Kraft geblieben. So verfügte Sir Ronald Storrs (1881–1955), erster britischer Gouverneur Jerusalems, die Häuser der Hauptstadt nur aus Jerusalemer Kalkstein zu erbauen.
22. Seit Beginn des Nahostkonflikts war Jerusalem umkämpft und wurde von beiden Seiten als Hauptstadt beansprucht. Darum konzentrierte sich der UN-Teilungsplan von 1947 darauf, einen jüdischen und einen palästinensischen Staat zu schaffen und Jerusalem als corpus separatum unter internationale Verwaltung zu stellen. Die Stadt sollte demilitarisiert, neutral und von einer aus fremdländischen Truppen rekrutierten Polizei geschützt werden. Sie würde Teil eines gemeinsamen Handelsraums sein, den Bürger beider Staaten betreten und bewohnen durften. So sollte der gleichberechtigte Zugang zu den heiligen Stätten der drei Weltreligionen gesichert werden. Obwohl von mehr als zwei Dritteln der UN-Vollversammlung mit der Resolution 181 angenommen, wurde der Teilungsplan nie umgesetzt. Die arabischen Staaten betrachteten Jerusalem als Teil des islamischen Hauses, des Dar al Islam, von dem sie nichts abzutreten bereit waren. Bis 1952 versuchten die Vereinten Nationen mehrmals ergebnislos, den Status Jerusalems zu klären.
Der neue Staat Israel
23. Die israelische Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 erwähnte Jerusalem nicht, versprach aber, dass Israel die heiligen Stätten aller Religionen beschützen werde. Am Folgetag griffen die arabischen Nationen den jungen Staat an. Im darauffolgenden Unabhängigkeitskrieg eroberten die israelischen Streitkräfte große Gebiete des Landes, verloren jedoch das jüdische Viertel der Altstadt Jerusalems und den Osten der Stadt an die Arabische Legion Jordaniens. Jerusalem war eine geteilte Stadt: im Westen das israelische und im Osten das jordanische Jerusalem. Von hier wurde die jüdische Bevölkerung vertrieben, das jüdische Viertel in der Altstadt zerstört, und der Zugang zur Klagemauer für Juden gesperrt.
24. Ende 1949 erklärte Premierminister David Ben Gurion vor der Knesset Jerusalem zum untrennbaren Teil Israels und seiner ewigen Hauptstadt. Am 4. Januar 1950 machte Israel Jerusalem offiziell zu seiner Hauptstadt.
25. Der Sechstagekrieg 1967 war zunächst ein reiner Verteidigungskrieg. Israel wollte Jordanien aus den Kämpfen heraushalten, änderte jedoch seine Taktik, nachdem Westjerusalem beschossen und das Hauptquartier der UN von den Jordaniern erobert wurde. In den nächsten drei Tagen wurde erst das UN-Hauptquartier, dann der jordanische Militärstützpunkt auf dem Giv’at HaTahmoschet (Munitionshügel) und schließlich die Altstadt erobert. Dabei verzichteten die israelischen Streitkräfte zur Schonung von Moscheen und Kirchen auf den Einsatz schwerer Waffen und nahmen dafür erhebliche Verluste in Kauf. Erstmals seit der Staatsgründung konnten Juden an der Klagemauer beten. Anders als die arabische Seite, die ab 1949 den Juden den Zugang zu ihren religiösen Stätten verweigerte, gewährte Israel den Muslimen nicht nur den Besuch ihrer heiligen Stätten, sondern unterstellte den Tempelberg einer autonomen muslimischen Verwaltung (Waqf).
26.1988 gab Jordanien seinen Anspruch auf Souveränität über das Westjordanland und damit auch über Ostjerusalem auf. Im selben Jahr rief die PLO den Staat Palästina aus und erklärte Jerusalem zu seiner Hauptstadt. Die völkerrechtlichen Bedingungen für die Errichtung eines Staates waren jedoch in keinster Weise erfüllt. Die PLO war zu diesem Zeitpunkt z.B. weit davon entfernt, effektive Kontrolle über irgendeinen Teil der umstrittenen Gebiete auszuüben.
27. 1993 unterzeichneten Israel und die PLO eine Prinzipienerklärung, die die palästinische Selbstverwaltung in der Westbank, jedoch nicht in Jerusalem regelt. Der Endstatus der Stadt soll im Zuge des Oslo-Friedensprozesses in einem endgültigen Vertrag bestimmt werden. Jedoch bestreitet die herrschende Hamas das Existenzrecht Israels und zielt auf dessen Auslöschung. Wenngleich es aufgrund der technischen Überlegenheit Israels - und nicht zuletzt dank des Eingreifens Gottes - nicht dazu kommen konnte, zeigten der Gaza-Krieg 2014 und die darauf folgende Anschlagswelle eindrücklich, wie die Hamas die Vernichtung Israels mit immer größerem Nachdruck und militärischer Aufrüstung betreibt.
Jerusalem
Explosivste Quadratmeter
Die New York Times sprach vom Tempelplatz als den "explosivsten Quadratmetern der Welt". Wie kaum ein anderer Ort steht Jerusalem im Brennpunkt der Weltgeschichte - wie auch der biblischen Heilsgeschichte. Sodann betrachten alle drei großen monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) Jerusalem als "ihre" heilige Stadt. Für viele Christen steht die Tatsache, daß Jerusalem wieder aufgebaut wurde und im Fokus der Weltöffentlichkeit steht, ganz im Einklang mit biblischen Verheißungen und bildet eine tiefgreifende und zugleich weitreichende Zäsur der Heilsgeschichte (Röm 11,2).
Epizentrum geistlicher Konflikte
Ziel und Vollendung der Heilsgeschichte kann indes nicht die alttestamentliche Form der Anbetung Gottes in einem wiederhergestellten Tempel in Jerusalem sein (Jes 27,13; Joh 4,21 ff). Da ist das Kreuz Jesu Christi, das sich solchen Erwartungen als ein Zeichen des Gerichtes und der Gnade Gottes über diese Welt entgegenstellt. Erst durch ihn werden die Leiden des Volkes Gottes ein Ende finden. Darum können Christen von politischen Mitteln letztlich keine endgültige Lösung erwarten. Es geht in Israel und im Nahen Osten nicht in erster Linie um politische oder ethnische, sondern um geistliche Auseinandersetzungen.
Stadt voller Zukunft
Die Souveränität des wahren Gottes wird sich für alle Welt in Jerusalem erweisen. Sein zukünftig sichtbares Reich ist keine Utopie, sondern entspricht der kontinuierlichen Erfüllung biblischer Voraussagen. Seine Herrschaft wird von Jerusalem ausgehen und sich auf die Völker ausdehnen. Die neue Existenz von Israel und Jerusalem ist darum Zeichen der Hoffnung auf eine große Zukunft.
Leben wir angesichts der Entwicklungen in Jerusalem in der Endzeit? Steht die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevor? Jesus hat seinen Jüngern Zeit und Stunde seines erneuten Kommens nicht mitgeteilt, - der Vater im Himmel allein kenne diesen Zeitpunkt. Wir haben also jederzeit mit ihm zu rechnen. Er hat aber gleichwohl die Zeichen der letzten Zeit benannt, den Charakter dieser geschichtlichen Epoche geschildert und dazu aufgefordert, diese Phänomene nicht zu übersehen.
Beim Kommen des Messias, der Wiederkehr Christi, sind die Zeiten der heidnischen Weltvölker zu Ende. Jerusalem hat (die) Zukunft. Es ist die Stadt des großen Königs (Mt 5,35). Erneut werden Jesu Füße auf dem Ölberg stehen (Sach 14,1-6; Apg 1,1011). Das Heidentum muss seine Vormachtstellung in der Welt aufgeben. Die Existenz Israels inmitten tödlicher Bedrohung ist dafür ein vorausweisendes Zeichen.
Wie Jerusalems Türme dem alttestamentlichen Wallfahrer (Ps 122; Phil 3,20; Hebr 13,14) sein Ziel vor Augen führten, so gibt das gewaltige Bild des himmlischen, bei Gott schon vorbereiteten Jerusalem dem wandernden Glaubenden sein Ziel vor. Die Sehnsucht nach dieser zukünftigen Stadt ist die Sehnsucht, Gott in alle Ewigkeit von Angesicht zu schauen und ihn anzubeten.
Jerusalem in der Bibel
Aufstieg und Bedeutung Jerusalems
Lange Zeit widersetzte sich die alte Jebusiterfestung (2Sam 5,7) der israelitischen Landnahme und bildete so einen Sperrriegel zwischen den Süd- und Nordstämmen. Durch einen Handstreich der persönlichen Söldnertruppe Davids (2Sam 5,6ff) wurde sie sein Privateigentum (2Sam 5,9; vgl. Ri 1,21!). David übernahm die Pflichten und Rechte eines kanaanäischen Stadtkönigs und versuchte, die altisraelitischen Glaubensüberlieferungen in Jerusalem heimisch zu machen. Er selbst holte die Bundeslade nach Jerusalem ein (2Sam 6); sein Sohn Salomo baute Jerusalem zur »Reichshauptstadt« aus und verwirklichte den von seinem Vater David vorbereiteten Tempel. Zentralverwaltung, Königspalast und Tempel, Staatsmacht und Religion wurden also eng miteinander verbunden. Jerusalem war Königsstadt und Gottes Stadt, ausgesondert, erwählt, unantastbar und uneinnehmbar (1Kö 8,16; Ps 46,5-8; 48,1-4). Dort gab es Offenbarung, Vergebung (Opfer) und Weisung Gottes (Ps 40,2; Ps 122).
Die Sünde Jerusalems
Gegen die enorme Aufwertung und den großzügigen Ausbau Jerusalems als auch etlicher Garnisonsstädte Salomos erhob sich aus der mit Steuern stark belasteten ländlichen Bevölkerung (1Kö 12) Protest, was letztlich zur Reichsteilung führte. Kritik an der Religion und Politik Jerusalems blieb auch fernerhin nicht aus und richtete sich gegen die Vermischung israelitischer und kanaanäischer Überlieferungen, zudem gegen die Unterordnung der Religion unter die Staatsraison: beide Entwicklungen führten zu einem gefährlichen Sicherheitsgefühl, das sich zunehmend von der Tora Gottes unabhängig fühlen sollte (vgl. Jer 7) - ein trügerisches Spiel mit Segen und Fluch. Auch soziale Mißstände mehrten sich und verfielen harter prophetischer Kritik (Jes 1; Mi 3,10; Zeph 3,1ff).
Gericht und Wiederaufbau
Der Triumph der mächtigen Babylonier, die Zerstörung von Stadt und Tempel 587/586 v. Chr. und die phasenweise Verschleppung der Oberschicht war das vorläufige Ende der nationalstaatlichen und nationalreligiösen Existenz Israels. Aber nicht das Ende der Erwählung Gottes und des Erwählungsglaubens, wie er sich nach wie vor auf Jerusalem und seine Verheißungen bezog. Als sich das Blatt der Geschichte wendete und die Perser an die Macht kamen, erstand aus der Asche der babylonischen Zerstörung unter Esra, Nehemia und Serubbabel ein neues Jerusalem. - Die Heimgekehrten betrachteten sich als den durch Gottes Strafgericht geläuterten Rest eines trotzigen und bösen Volks (Neh 9).
Jerusalem stieg nie mehr zu früherer politischer Macht auf, wurde jedoch mit dem, wenn auch in kleinerem Umfang, neu erbauten Tempel mehr denn je geistiger und religiöser Mittelpunkt des sich immer mehr zerstreuenden Judentums.
Jerusalem im Neuen Testament
Jerusalem ist der Ort, in dem Jesus verfolgt, verurteilt und getötet wird. Durch die Hinrichtung hat er, wie von Gott und ihm selbst vorausgesagt, die gesamte menschliche Schuld auf sich übertragen. Von der höchsten Position stieg er zur niedrigsten hinab. Er hatte Titel wie Priester, König und Prophet und wurde zum Diener, ja sogar zu einem »Tier«, zum Opferlamm, das die Sünde der Welt übernimmt. Dadurch dass er nicht im Tod blieb und auferstand, wurde seine Mission bestätigt: das Werk zur Erneuerung der Menschen war vollbracht. Nachdem Jesus zu Gott zurückgekehrt war, kommt ein neuer und entscheidender Impuls: seine Nachfolger empfangen den heiligen Geist. Diese Kraft bringt sie in Bewegung - von Jerusalem aus bis zu den Enden der Erde. Durch die Verbreitung seiner Botschaft kommt Jesus selbst zu Menschen, die sich ihm öffnen. Sie erfahren die stärkste Umwälzung ihres Lebens und bekommen eine Perspektive dafür, was Gott mit ihnen vorhat.
Jerusalem ist aber auch die Stadt, die die Propheten, die von Gott zu ihr gesandt sind, tötet und steinigt (Mt 23,37), und die Stadt, über die das Strafgericht hereinbrechen wird (Lk 19,41ff). Dennoch sammelt sich das neue Volk Gottes am alten Zentrum Israels. Jerusalem ist Ort der christlichen Urgemeinde und wird zum Ausgangspunkt einer Bewegung, die von wenigen, auch noch unterdrückten und verfolgten Menschen ausgeht, aber die Welt mehr verändert hat als alles andere. In Jerusalem fallen die ersten Weichenstellungen der wachsenden Kirche (Apg 11,1ff; 15), und dorthin kehren die Apostel nach Beendigung ihrer Missionsreisen immer wieder zurück. Und in dieser Stadt wird Jesus Christus bei seiner Wiederkunft erneut erscheinen und öffentlich machen, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist.
Das himmlische Jerusalem
Seit der babylonischen Gefangenschaft zeichneten die Propheten in Israel die Zukunft Jerusalems in immer herrlicheren Farben und Bildern (Jes 60-62; Jer 31,38ff; Hes 40-48; Mi 4,1f; Hagg 2,6ff; Sach 8). Diese Zukunftsschau verdichtet sich schließlich im Neuen Testament zur Ankündigung des oberen, himmlischen, bei Gott schon gegenwärtigen Jerusalems, das sich am Ende der Zeit auf die Erde herabsenken wird (Gal 4,26; Hebr 12,22; Offb 3,12; 14,1; 21f). Mit unaussprechlicher Freude wird Gott am Ende der Zeiten vor allen Ohren und Augen bekannt machen, dass Jerusalem seine Stadt ist, in der er selbst Wohnung nimmt, die Stadt, die bei ihm verborgen war und jetzt in ihrer unveränderlichen Jugend durch die Ewigkeit hindurch vor aller Kreatur offenbar sein wird!
Jerusalem und die Kirche
Die früheste und tiefste Schicht des Christentums besteht vorwiegend aus Juden, die an Jesus als den angekündigten Messias glaubten. Die judenchristliche Gemeinde ist nach der Zerstörung des Tempels zwar ebenfalls geflohen, jedoch bald wieder nach Jerusalem zurückgekehrt. Es gab über drei Jahrhunderte hinweg eine judenchristliche Gemeinde in Jerusalem, bis das Christentum im römischen Reich Staatsreligion und die jesusgläubigen Juden Mitglieder der sich ausbreitenden byzantinischen Kirche wurden. Über beinahe zwei Jahrtausende traten Judenchristen als eigene Gruppe nicht mehr in Erscheinung. So erscheint es als ein Wunder, daß diese Gemeinde in den letzten Jahren sich weltweit neu zu bilden und insbesondere in Jerusalem zu sammeln beginnt. Derzeit gibt es etwa ein Dutzend judenchristlicher, messianischer Gemeinden.
Geschichte Jerusalems
Jerusalem - verlassen und gefunden
Ursprünglich war Jerusalem eine kleine Siedlung im kargen Bergland fernab der großen Handelsstraßen. Warum sich in dieser unwirtlichen Gegend Menschen ansiedelten, lag an der Wasserversorgung, einer ganzjährig fließenden Quelle (später Gihonquelle genannt). Erste menschliche Spuren reichen in das Chalkolithikum, den Übergang vom 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. zurück. Doch schon bald darauf ziehen die halbnomadischen Bewohner aus unerfindlichen Gründen wieder ab. Während in den fruchtbaren Ebenen Stadtstaaten einen Kulturaufschwung nehmen, bleibt Jerusalem für 800 Jahre eine menschenleere »Geisterstadt« in den Bergen.
Die Wirren, die im ausgehenden 3. Jahrtausend v. Chr. den Alten Orient heimsuchten, brachten neue Eindringlinge mit sich, rohe Gesellen, die der Kultur der Stadtstaaten ein Ende setzten. Danach waren es Flüchtlinge aus dem nordsyrischen Raum, die vor den akkadischen Eroberern in das südliche Bergland flohen und in der frühen Mittelbronzezeit (2100 - 1900 v. Chr.) Jerusalem neu besiedelten, - zwar nicht ihre Wunschheimat, jedoch eine Notheimat. Nach Zeiten dumpfer Stagnation kommt ein weiterer Einwandererstrom aus der hochentwickelten syrisch-libanesischen Küstenregion rund um die Metropole Byblos. Sie importieren zugleich eine stark ausgeprägte Kultur, die kanaanäische, - die für das spätere Israel Herausforderung und Anfechtung zugleich sein sollte.
Jerusalem kennt keine Ureinwohner, es ist ein Ort für Wanderer und Heimatlose, keine Wahlheimat, eher ein notgedrungener Zufluchtsort. Warum sich die göttliche Vorsehung ausgerechnet diesen unattraktiven Flecken Erde als Mittelpunkt der Welt ersehen hat? Sucht Gott gleichfalls Heimat? Als Flüchtiger, Heimatvertriebener? Nicht seine Wunschheimat, aber eine Notheimat? Die einmal doch zur Wunschheimat wird? Für ihn und alle Welt! Sowohl die Stadt Jerusalem als auch das Land und Volk Israel stellt die Bibel als Gottes besonderes Eigentum dar. Bedeutsam ist die lesenswerte Darstellung Jerusalems als Findelkind, das von Gott selbst aufgezogen wird, in Hesekiel 16: „Niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, ... sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben! Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben und heranwachsen; wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Und du wuchsest heran und wurdest groß und schön“ (Hes 16,5-7).
Jerusalem - am Rande der antiken Welt
Ein ägyptischer Ächtungstext aus dem 19. Jahrhundert v. Chr. nennt den Namen des kanaanäischen Stadtstaates „Uruschalim“. Im Hochland mit seinen schwierigen Lebensbedingungen gelegen nahm die erste Ansiedlung Jerusalems eine Randposition abseits der großen Verkehrsströme ein. Wenngleich Kanaan in der frühen Bronzezeit ein überwiegend reiches Land (Küste, Jesreel, Negev) war, dessen Einwohner Wein, Öl, Honig, Bitumen und Korn exportierten. Die Quelle am Jerusalemer Berg Ophel zog zwar Jäger, Ackerbauern und zeitweise Siedler an (Feuersteine und Tonscherben aus der Altsteinzeit), dennoch scheint Jerusalem während dieser ersten Blütezeit Kanaans keine Rolle gespielt zu haben.
Was bedeuten 'Jerusalem' und 'Zion'?
Die Herkunft des Namens 'Jerusalem' ist unklar, am wahrscheinlichsten ist 'Gründung des Gottes Salem'. Der Begriff 'Zion' lässt sich in seiner Wortbedeutung nicht mehr erschließen (evtl. kahler oder trockener Hügel?), er bezeichnete ursprünglich die Burg auf dem Südosthügel, später diesen Felssporn selbst. Etwas nördlich dieser alten Anlage erbaute Salomo den ersten Tempel. Häufiger bezeichnet Zion die ganze Stadt (u.a. Ps 51,20; Jes 10,24; 33,20; 51,3.11; Jer 3,14) oder den Tempelberg (Ps 2,6; 110,2). In den frühen christlichen Pilgerberichten wird schließlich Zion auf dem Südwesthügel, dem Zentrum der Urgemeinde lokalisiert, rückt also etwa 500m nach Westen. - Der Name Jerusalem erscheint in der Bibel wesentlich häufiger (ca. 800mal) als „Zion“ (ca. 160mal). Zion ist zwar seltener als Ortsbezeichnung, begegnet aber sehr häufig in dichterischer oder gottesdienstlicher Sprache.
Teich Bethesda
Teich Bethesda heute und zur Zeit Jesu
Wer die Anlage des Teichs Bethesda betritt, wird in die Zeit Jesu versetzt. Hier tritt einem das Jerusalem des zweiten Tempels und der byzantinischen Epoche in Form von Ruinen entgegen, die sich mit ein wenig Vorstellungsvermögen zu imaginären Bauten vervollständigen lassen. Entsprechende Ausblicke bietet das Ausgrabungsareal, das 1992 für eine möglichst informative Besichtigung neu gestaltet und mit Rundgängen versehen wurde.
Nördlich des antiken Tempelgebiets lag das Tal Bezeta mit seinen monumentalen Wasseranlagen, offensichtlich ein Bereich der Versorgung, der Fruchtbarkeit, der Heilungen und der Erholung. Die Winterwasser der Sahira-Ebene sammelten sich einst in diesem Tal und konnten wie durch einen Trichter ins Kidrontal abfließen. Die Einrichtung von Stau- und Speicheranlagen für die Trockenzeit war darum naheliegend. Mit diesen antiken Wasseranlagen ist die Geschichte von der Heilung eines 38 Jahre lang Gelähmten durch Jesus verbunden (Joh 5,1-9).
St. Anna Kirche: Geschichte mit Nachhall
Um 1130 n. Chr. bauten die Kreuzfahrer eine große romanische Kirche zu Ehren der Heiligen Anna, Marias Mutter, nach menschlicher Abstammung die Großmutter von Jesus. Die Basilika wurde über den Grotten im südlichen Bereich errichtet, wo man den Geburtsort von Maria in Ehren hielt. Sie war die Konventskirche der Benediktinerinnen. Sultan Saladin machte aus der St. Anna Kirche im Jahr 1192 eine Schule für koranisches Recht. Obwohl die Kirche fortan vernachlässigt wurde, besuchten viele Pilger heimlich die Krypta. Jahrhunderte später schenkten die ottomanischen Türken die Anlage den Franzosen als Zeichen der Dankbarkeit für die geleistete Hilfe im Krim-Krieg gegen Russland (1854-56). Nach Restauration und Ausgrabungen durch den Architekten C. Mauss wurde die Kirche 1878 Kardinal Lavigerie und seinen Afrikamissionaren anvertraut. Sie leiteten eine Ausbildungsstätte für den melkitischen (orientalischen) Klerus und führten die Ausgrabungsarbeiten fort und konnten das Vorhandensein des Zentraldamms zwischen den Zwillingsteichen nachwiesen. Die Dominikaner der Ecole Biblique brachten mit ihren Grabungen die Ruinen der byzantinischen Basilika und die medizinischen Bäder ans Licht.
Die St. Anna-Kirche hat den längsten Nachhall aller Kirchen des Heiligen Landes und lädt ein, mehrstimmige Hymnen und Kanons zu singen. Eine kleine Touristengruppe mutiert auf diese Weise zu einem großen Chor, - auch schon bei mittelmäßigen Stimmqualitäten. Allerdings Vorsicht: man sollte sich vor Betreten der Kirche einigen, was man singt: Reden ist im Innern streng verboten und wird sofort angemahnt.
38 Jahre krank und geheilt
Dass es bei Jesus kein »zu spät« gibt, durfte ein Mann erfahren, der 38 lange Jahre krank dahinsiechte und keine Heilung fand. Jesus richtet ihn auf und gibt ihm neuen Lebensmut. Joh 5,1-18 berichtet von diesem Heilungswunder Jesu in der Umgebung des Teichs beim "Schaftor": "Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen; in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, daß er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein.
Jesus sendet gesund Gewordene
Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat; du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin! Da fragten sie ihn:Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wußte nicht, wer es war; denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war.
Höre auf zu sündigen!
Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich."
Geschichte des Teichs Bethesda
Tempel-Becken
Direkt nördlich außerhalb der heutigen Haram-Mauer (Tempelplatz), in der Nähe des Teichs Bethesda, war einst ein riesiges Wasserbecken von 110m Länge, 38m Breite und 27m Tiefe (ca. 113.000 Tonnen Wasser), wahrscheinlich von Herodes im Zuge der Tempelerweiterung neu angelegt und von al-Muqadassi um 985 n. Chr. "Teich der Söhne Israels" genannt, - möglicherweise aufgrund einer Legende, nach der Nebukadnezar 587/6 v. Chr. das Becken mit den Köpfen der erschlagenen Kinder Israels gefüllt habe. Von den Kreuzfahrern wurde der Name "Schafteich" von dem nördlicheren Doppelbecken auf diesen Pool übertragen und hielt sich bis ins 19. Jahrhundert. In den 1930er Jahren wurde die Anlage von den Briten vollends zugeschüttet, so dass heute nichts mehr zu erkennen und von einem Parkplatz bedeckt ist.
Schafteich
Becken »groß wie das Meer«
Der Hohepriester Simon II. der Gerechte lässt um 200 v. Chr. ein Wasserreservoir graben, das in Sir 50,3 als „Becken groß wie das Meer“ beschrieben wird. Möglicherweise bezieht sich diese Angabe auf einen weiteren Ausbau des Schafteichs, dessen Anfänge archäologisch in die Königszeit zurückweisen, insbesondere des südlichen Beckens. Die Wasseranlagen weisen also eine umfangreiche Baugeschichte auf, auch deshalb, weil wasserführende Einrichtungen schon grundsätzlich einen hohen Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf haben. Auch scheint es sinnvoll, dass das ins Kidrontal abgeführte überschüssige Wasser dort zum Walken, Gerben und Färben verwendet wurde. Eusebius lokalisiert entsprechend den "Acker des Walkers … in den Außengebieten Jerusalems".
Wunder im Krankenhaus
Die Ausgrabungen haben zwei Becken mit einer Größe von etwa 50x50 Metern nachgewiesen. Hier wurde das Winterwasser gestaut und dann dem Tempel zugeführt (vgl. Jes 7,3; 2Kön 18,17). Um 150 v. Chr. entstand östlich der Becken eine Heilstätte. In ausgehauenen Grotten wurden eine Wasserzisterne und Bäder für medizinische und religiöse Behandlungen angelegt. Kleine Kanäle brachten das Wasser zu den Bädern, wo die Menge der Kranken wartete, um religiöse Reinigung und körperliche Heilung zu erfahren. Dieser Badeplatz lag in der Nähe der "Probatike", wo Jesus nach Joh 5,1-16 den 38 Jahre lang Gelähmten heilte. Das Wasserbecken, an dessen Rand der Kranke lag, war beim Schafsmarkt und Schaftor (Neh 3,1.32; 12,39) und hieß deshalb griechisch "probatike kolymbethra", lateinisch "Piscina probatica" (wörtl. Kleinvieh-Teich). Der Hinweis des Evangelisten, dass es hier fünf Säulenhallen gab, wurde seit Kyrill von Jerusalem (350 n. Chr.) so verstanden, dass zwei jeweils 50x50 Meter große und 13m tiefe Becken durch einen Damm getrennt waren und von vier Säulenhallen flankiert wurden, während die fünfte auf dem Damm stand (jedoch ohne archäologischen Hinweis).
Intermittierendes Wasser
Das von Johannes berichtete Aufwallen des Wassers im Schafteich kann archäologisch bislang nicht auf ein hydrologisches Phänomen wie eine intermittierende Quelle oder einen Brunnen mit Syphoneffekt, deren Wasser als heilkräftig galten, zurückgeführt werden. Aber vielleicht hängt das Aufwallen auch mit der Konstruktionsweise der Zuleitungen und entsprechenden Speichertechniken wie z.B. einem phasenweise Abfließen in ein Klärbecken zusammen.
Via Dolorosa
Jesus geht zum Kreuz
Jeden Freitag Nachmittag versammeln sich eine große Anzahl Andächtiger im Hof der Omaryiya-Schule, wo unter der Leitung von Franziskanern die Kreuzwegandacht beginnt. Die Prozession zieht durch die Via dolorosa, deren Verlauf durch die 14 teils auf die Passionsberichte der Evangelien teils auf die Tradition zurückgehende Kreuzwegstationen markiert ist. Die Stationen I-IX liegen entlang der Straße, X-XIV sind innerhalb der Grabeskirche. Geschah die Verurteilung Jesu durch Pilatus in der Burg Antonia, können Ausgang und Ende des Weges als gesichert betrachtet werden. Der heutige Verlauf ist nicht historisch, sondern geht auf christliche Konventionen während der Kreuzfahrerzeit zurück. Auch liegen nicht alle Stationen direkt an der Bazarstraße, manche befinden sich innerhalb von Gebäudekomplexen oder in Nebengassen.
Station I »Jesus wird zum Tode verurteilt« liegt im Hof der islamischen Mädchenschule Al-Omariya-Medrese, zu der eine Treppe hinaufführt. Hier versammeln sich freitags ab 14:30 Uhr die Franziskanermönche zu ihrer Prozession; - der einzige Zeitpunkt, an dem diese Station öffentlich zugänglich ist. Von Fensternischen in der Südmauer, die der Südmauer der Burg Antonia entspricht, bietet sich ein schöner Blick auf den Tempelplatz. An der vermutlich höchsten Stelle dieser Festung, also auf der Plattform des Treppenaufgangs der Schule, soll Jesus von Pontius Pilatus verurteilt worden sein.
Mt 27,22-23,26: "Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen."
Station II »Jesus nimmt das Kreuz auf« befindet sich auf der anderen Straßenseite gegenüber der Al-Omariya-Schule beim Eingang des Franziskanerklosters kurz vor dem Ecce-Homo-Bogen (links oben neben dem Eingang ist die "II" zu lesen). Im Hof des Klosters (Geißelungskloster) liegt rechts die Geißelungskapelle und links die Verurteilungskapelle.
Die Geißelungskapelle stammt aus dem Mittelalter und verfiel im Laufe der Jahrhunderte zur Ruine. Herzog Maximilian von Bayern ermöglichte den Wiederaufbau des Kreuzfahrerbaus, der 1929 nach den Plänen von Antonio Barluzzi im Stil des 12. Jahrhunderts wiederhergestellt wurde. Thema der drei Fenster ist die Geißelung Jesu, sodann Pilatus, wie er sich seine Hände in Unschuld wäscht, und der Triumph des freigelassenen Barabbas.
Die links des Eingangstors gelegene Verurteilungskapelle weist auf den Ort hin, wo Pilatus das Todesurteil über Jesus sprach. Auch diese Kapelle ist relativ neuen Datums und entstand 1903 über den Resten eines byzantinischen Kirchenbaus. Sie hat den byzantinischen Baustil bewahrt und zeigt Darstellungen von Engeln, die unter Folterwerkzeugen leiden. Das zentrale Gemälde zeigt die Verurteilung Jesu, andere Bilder, wie Jesus seiner Mutter begegnet.
Im Untergrund dieses Areals befindet sich eine interessante archäologische Anlage. Glattgewetzte Steinplatten im Boden sind Überreste eines Lithostrothos (Steinpflaster), auf hebräisch "Gabbata", Joh. 19,13: "Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf hebräisch Gabbata." Auf einigen dieser Steinplatten sind noch Drainage-Rinnen zur Wasserableitung zu sehen, ebenso die Gravur von Spielen, die vermutlich römische Soldaten einritzten, um sich die Zeit zu vertreiben. Allerdings wurde dieses großformatige Pflaster erst 100 Jahre nach Jesus von Kaiser Hadrian angelegt, der die gesamte Stadt in eine römische Metropole umgestaltete. Er überbaute damit eine Wasserzisterne, den Strouthionteich, der beim Rundgang einen imposanten Eindruck der zahlreichen Zisternen vermittelt, die zur ganzjährigen Wasserversorgung Jerusalems in dessen Untergrund angelegt wurden (Maße: 52m lang, 15m breit, 13m hoch).
Auf diesem Gelände ist auch der Sitz des Studium Biblicum Franciscanum (SBF). 1924 wurde es als Zentrum für biblische und archäologische Forschungen und Studien gegründet. Zudem entwickelte sich eine Gelehrtengesellschaft um die Lehr- und Forschungsgebiete der Bibelwissenschaft und Christlichen Archäologie. Weiter befinden sich im "Kloster der Schwestern Zions" eine bedeutende Bücherei und ein Museum mit sehenswerten Ausgrabungen sowie einer interessanten Ausstellung über die Flora und Fauna des Heiligen Landes.
Mt 27,27-31: "Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an."
Station III »Jesus fällt zum erstenmal« kommt an der starken Linksbiegung gegenüber dem Österreichischen Hospiz, im Hintergrund steht eine armenische Kirche. Diese Station wurde im 13. Jahrhundert festgelegt und ist heute durch eine zerbrochene Säule am Kircheneingang sichtbar. Die direkt an der Straße liegende Kapelle steht auf einem Gelände, das durch armenische Katholiken aus Polen gekauft wurde. Sie selbst wurde 1946 erbaut und durch Spenden katholischer polnischer Soldaten finanziert. Sie zeigt im Hochrelief über dem Eingang den unter dem Kreuz zusammengebrochenen Jesus. Die Erinnerung an dieses Ereignis beruht auf Legenden. Wenn auch keine Bibelstelle von einem Sturz Jesu berichtet, geschweige denn drei Stürzen auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte Golgatha, ist durchaus vorstellbar, dass der von den Geißelungsschlägen geschundene Körper Jesu unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen ist.