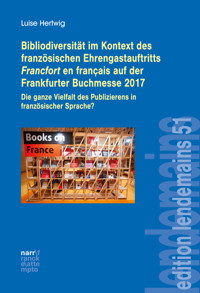
Bibliodiversität im Kontext des französischen Ehrengastauftritts Francfort en français auf der Frankfurter Buchmesse 2017 E-Book
Luise Hertwig
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: edition lendemains
- Sprache: Deutsch
Der französische Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2017 rückte statt der Literatur Frankreichs die französische Sprache in den Fokus, und erklärte, "ein internationales Schaufenster der Literatur in französischer Sprache in ihrer größten Vielfalt" sein zu wollen. Die Studie setzt sich mit dem Konzept der Bibliodiversität - kultureller Vielfalt bezogen auf das Buchwesen - und seiner Bedeutung im Kontext von Francfort en francais auseinander. Sie klärt, wie Bibliodiversität bei der Umsetzung des Auftritts berücksichtigt wurde, und untersucht dessen Folgen für die Akteur:innen in den beteiligten frankophonen und deutschsprachigen literarischen Feldern, sowie für die Diversität von Übersetzungen aus dem Französischen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt. Die Studie stellt eine der wenigen bisher existierenden, umfassenden und empirischen Untersuchungen zur Bibliodiversität dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luise Hertwig
Bibliodiversität im Kontext des französischen Ehrengastauftritts Francfort en français auf der Frankfurter Buchmesse 2017
Die ganze Vielfalt des Publizierens in französischer Sprache?
Umschlagabbildung: picture alliance / Sven Simon / Elmar Kremser
Zugl. Diss. Europa-Universität Flensburg 2022
Die Dissertation entstand im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts „Buchmessen als Räume kultureller und ökonomischer Verhandlung“ (Projektnummer 317687246).
DOI: https://www.doi.org/10.24053/9783381102129
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1861-3934
ISBN 978-3-381-10211-2 (Print)
ISBN 978-3-381-10213-6 (ePub)
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
AIEI
Alliance internationale des éditeurs indépendants
ASDEL
Association Suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires
BIEF
Bureau international de l’édition française
BNF
Bibliothèque Nationale de France
Börsenverein
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.
CNL
Centre national du livre
DDC
Dewey Decimal Classification
DFG
Deutsche Forschungsgemeinschaft
DNB
Deutsche Nationalbibliothek
États généraux
États généraux du livre en langue française dans le monde
FCE
Field-Configuring Event
GfK
Gesellschaft für Konsumforschung
HHI
Herfindahl-Hirschman-Index
IF
Institut français
ISBN
Internationale Standardbuchnummer
OiF
Organisation internationale de la Francophonie
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
SNE
Syndicat national de l’édition
WBI
Wallonie-Bruxelles International
1Einleitung
Notre participation à la Foire du livre de Francfort est tournée vers la jeunesse, l’innovation et la langue française : nous avons souhaité que ‹Francfort en français› soit une vitrine internationale d’une littérature d’expression française dans sa plus grande diversité. (Le Drian 2017)
Im Jahr 2017 war Frankreich zum zweiten Mal Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Während der französische Gastlandauftritt 1989 noch von einer eher nationalen Herangehensweise geprägt war, stellte das Organisationskomitee des Gastlandauftritts Francfort en français im Jahr 2017 nicht die Literatur Frankreichs, sondern die französische Sprache in den Mittelpunkt. Ziel des Ehrengastauftritts war es dem damaligen französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian zufolge also, die kulturelle Vielfalt der Literatur in französischer Sprache zu zeigen. Diese kulturelle Vielfalt bezogen auf das Buchwesen wird auch als Bibliodiversität bezeichnet.
Die vorliegende Studie widmet sich der Frage, wie Bibliodiversität im Kontext des französischen Ehrengastauftritts auf der Frankfurter Buchmesse 2017 und in der Interaktion der beteiligten literarischen Felder einzuordnen und zu bewerten ist. Aufgrund der Entscheidung Frankreichs, die Einladung der Frankfurter Buchmesse auf die französische Sprache auszuweiten, gehörte zu den beteiligten literarischen Feldern neben dem deutschsprachigen (mit der Buchmesse als Gastgeberin) und dem französischen auch das frankophone literarische Feld. Das Projekt Francfort en français präsentierte auf der Frankfurter Buchmesse unter anderem eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren mit unterschiedlicher Herkunft, die aber alle das Französische als ihre Literatursprache teilten. Auf institutioneller Ebene wurden die frankophonen Gebiete der Schweiz, Luxemburgs und Belgiens sowie die Organisation internationale de la Francophonie (OiF) am Auftritt beteiligt.
Die Frankfurter Buchmesse legt wie auch andere internationale Buchmessen jedes Jahr den Schwerpunkt auf ein anderes Land oder eine Region mit einer eigenen Präsentation auf der Messe, kulturellen Begleitveranstaltungen und häufig intensiver Medienberichterstattung. Damit möchte sie dem anwesenden Publikum sowie der Gesellschaft einen neuen Zugang zum jeweiligen Gastland und seiner Literatur ermöglichen und den kulturellen Dialog zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren der Buchbranchen unterstützen (vgl. Website Frankfurter Buchmesse, „Informationen rund ums Thema Ehrengast“). So verfolgt die Buchmesse mit dem Ehrengastkonzept neben ökonomischen Zielen und der Absicht, Sichtbarkeit für die Buchmesse zu generieren, auch die Intention, Bibliodiversität zu begünstigen.
Das Konzept der Bibliodiversität, ihre Indikatoren und Messbarkeit wurde bisher kaum erforscht, gerade auch in internationaler Perspektive. Um auch in Zukunft die Vielfalt im internationalen Buchwesen zu erhalten und Möglichkeiten zu ihrer Stärkung auszuloten, ist es gerade angesichts der bevorstehenden Transformation der Buchmessen durch die Effekte der Covid19-Pandemie von großem Interesse, zu untersuchen, ob und inwieweit Ehrengastauftritte auf internationalen Buchmessen zur Demonstration, Erhaltung und Förderung der kulturellen Vielfalt im Buchwesen beitragen können. Diese Forschungsarbeit bietet daher eine erste größere empirische Studie zur Bibliodiversität im Kontext des Phänomens der Ehrengastauftritte auf der Frankfurter Buchmesse am Beispiel von Francfort en français sowie im Teilbereich der Übersetzungen aus dem Französischen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt.
Die Studie klärt erstens, wie Bibliodiversität bei der Umsetzung des Ehrengastauftritts Francfort en français berücksichtigt wurde, das heißt insbesondere in der Integration verschiedener Akteurinnen und Akteure in dieses Projekt. Zweitens analysiert sie das Projekt Francfort en français und seine Folgen für die Akteurinnen und Akteure der beteiligten Buchmärkte im deutsch- und französischsprachigen Raum. Entsprechend der Orientierung des Ehrengastauftritts hin zur Frankophonie ist es besonders wichtig, auch die Perspektive der Akteurinnen und Akteure anderer frankophoner Länder bzw. die Auswirkungen des Projekts für die Bibliodiversität im frankophonen literarischen Feld zu betrachten. Drittens untersucht sie, wie es um die Bibliodiversität von Übersetzungen aus dem Französischen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt in einem längeren Zeitraum, von 2007 bis 2019, bestellt ist, und welche Auswirkungen der Ehrengastauftritt von 2017 auf den Literaturtransfer vom frankophonen ins deutschsprachige literarische Feld hatte.
Unter Bibliodiversität wird in dieser Studie die Fähigkeit des Buchwesens verstanden, in allen Stufen des Entstehungs- und Verbreitungsprozesses von Literatur bis hin zu ihrer Lektüre Vielfalt zu produzieren (vgl. Galliand 2011b, 3). Bibliodiversität wird vor allem durch die Vielfalt der Akteurinnen und Akteure, die in den literarischen Feldern (inter-)agieren, aufrechterhalten. Eine besondere Rolle für die Bibliodiversität spielen kleine, unabhängige Verlage, die entgegen der Tendenz größerer Verlagsgruppen, Bestseller zu produzieren und sich insbesondere auf Übersetzungen aus den anglophonen Buchmärkten zu konzentrieren, mit ihren Veröffentlichungen von Stimmen abseits des Mainstreams und Übersetzungen aus diversen Sprachräumen ein vielfältiges Literaturangebot schaffen (vgl. Hawthorne 2017 und Bourdieu 1999).
Die Vielfalt und das Gleichgewicht im ökosozialen System des Buchwesens sind zunehmend durch ökonomische Effekte der Globalisierung der Buchmärkte gefährdet. Durch Konzentrationsprozesse und international agierende Konzerne, die auch im Buchwesen in Erscheinung treten, nehmen Homogenisierungserscheinungen auf den Buchmärkten zu (vgl. Schiffrin 1999). Es besteht die Herausforderung, kulturelle Vielfalt und freie Meinungsäußerung zu erhalten und zu stärken. Die Globalisierung birgt für das internationale Buchwesen neben den Risiken aber auch Chancen. So erleichtert etwa die zunehmende Digitalisierung neue Interaktionsformen zwischen Akteurinnen und Akteuren unterschiedlicher literarischer Felder. Diese fördern die Entstehung sozialer Netzwerke, welche im Verlagswesen unter anderem in Form von internationalen Interessensgemeinschaften wie der Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI) in Erscheinung treten.
Die Entscheidung, die Einladung zur Frankfurter Buchmesse auf die französische Sprache auszuweiten, statt eine Nationalliteratur Frankreichs darstellen zu wollen, war für das Organisationsteam des Ehrengastauftritts Francfort en français unumstritten (vgl. Hertwig 2018a), und wurde grundsätzlich auch als positiv und in der heutigen Zeit als selbstverständlich aufgenommen. Dennoch handelte es sich bei Francfort en français um ein hauptsächlich vom Institut français (IF) organisiertes und damit vom französischen Staat finanziertes Projekt der Außenkulturpolitik, in dem die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen verschiedenster Akteurinnen und Akteure aus dem politischem, dem literarischen sowie weiteren Feldern ausgehandelt werden mussten. Der vorliegenden Untersuchung der Bibliodiversität im Kontext des französischen Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse 2017 liegt daher folgende Hypothese zugrunde: Francfort en français repräsentierte vor allem diejenigen Akteurinnen und Akteure, die bereits eine starke Position im frankophonen bzw. französischen literarischen Feld innehatten.
Die Studie geht davon aus, dass das Projekt Francfort en français, indem es die französische Sprache anstatt der Literatur Frankreichs in den Mittelpunkt stellte, zwar die Darstellung der ganzen Vielfalt des Publizierens in französischer Sprache anstrebte. In der konkreten und praktischen Umsetzung stand aber die französische Verlagswirtschaft im Mittelpunkt, was sich auch in der zentralen Rolle des Syndicat national de l’édition (SNE) als Mitorganisator des Auftritts manifestierte. Verlage außerhalb Frankreichs erlebten im Vorfeld und während des Ehrengastauftritts kaum spürbare Effekte im Hinblick auf die internationale Anerkennung und das Interesse an ihrer Literatur. Deutschsprachige Verlage, die anlässlich der Ehrengastauftritte der Frankfurter Buchmesse üblicherweise einen Fokus auf Übersetzungen aus der jeweiligen Landessprache legen, konnten im Jahr des französischen Ehrengastauftritts in besonderer Weise profitieren, da das Interesse an dem Nachbarland allgemein sehr groß ist und Französisch ohnehin eine etablierte Übersetzungssprache im deutschsprachigen Verlagswesen darstellt. So konnten deutschsprachige Verlage besonders viele Anknüpfungspunkte an das Ehrengastprojekt Francfort en français finden.
Dennoch spricht die Studie dem Projekt Francfort en français und den ausgelösten Diskussionen um die ungleichen Chancen französischsprachiger Autorinnen und Autoren sowie Verlage im globalen Norden und Süden positive Veränderungen zu. Francfort en français rückte die bestehenden asymmetrischen Machtverhältnisse stärker ins Bewusstsein der Akteurinnen und Akteure auch der französischen Buchbranche, und die Entstehung von Netzwerken und Initiativen zur Änderung des Status Quo hatten mit der Veranstaltung der États généraux du livre en langue française dans le monde (États Généraux) auch politische Folgen.
Die vorliegende Studie stellt zunächst eine punktuelle Studie zur Bibliodiversität im Kontext des französischen Ehrengastauftritts auf der Frankfurter Buchmesse dar. Darüber hinaus wird über einen längeren Zeitraum zu untersuchen sein, wie Francfort en français die Bibliodiversität in den beteiligten literarischen Feldern langfristig beeinflusst, beispielsweise ob der Ehrengastauftritt die Anzahl und die Nachfrage an Übersetzungen aus dem Französischen und insbesondere von Literatur aus Territorien außerhalb Frankreichs auf dem deutschen Buchmarkt nachhaltig erhöht. Vor allem regt die Studie zu weiterer Forschung zum Konzept der Bibliodiversität an, welches gerade im deutschen Sprachraum noch vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat.
1.1Stand der Forschung
Trotz der schon Jahrhunderte währenden Bedeutung der Buchmessen als Warenumschlagplätze und Orte des jährlichen, persönlichen Zusammentreffens aller an Produktion, Vertrieb und Verkauf von Büchern beteiligten Akteurinnen und Akteuren für die Entwicklung des internationalen Buchwesens, ist die Forschungslage zum Phänomen der Buchmessen und der Frankfurter Buchmesse im Speziellen noch recht überschaubar. Unter anderem durch zwei internationale Forschungsprojekte hat die Zahl der Publikationen in den letzten Jahren jedoch zugenommen. Diese Studie entstand im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojekt Buchmessen als Räume kultureller und ökonomischer Verhandlung an der Europa-Universität in Flensburg (2017-2020).1 Ebenso wie das vom spanischen Bildungsministerium geförderte Projekt Nuevas estrategias de promoción cultural. Las ferias internacionales del libro y la condición de invitado de honor von Carmen Villarino Pardo an der Universidad de Santiago de Compostela (seit 2018) untersuchte es verschiedene Aspekte gegenwärtiger Buchmessen insbesondere im deutsch-, spanisch- und portugiesischsprachigen Raum, und legte dabei den Fokus auf das Konzept der Ehrengastauftritte.
Die bisherige Forschung zur Frankfurter Buchmesse ist insbesondere im Bereich der Buch‑, Medien- und Literaturwissenschaften sowie der Sozialforschung angesiedelt. Eine Geschichte der Frankfurter Buchmesse seit ihren Anfängen im 15. Jahrhundert stammt von Peter Weidhaas (vgl. Weidhaas 2003). Darin legt der langjährige Direktor der Buchmesse den Schwerpunkt auf ihre Entwicklung seit der Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg und auf den persönlichen Bericht aus der Zeit seiner Messeleitung.2 Auch dem Thema der Ehrengastauftritte widmet sich Peter Weidhaas: Er führte als Reaktion auf den Vorwurf der deutschen Presse, der Buchhandel und auch die Buchmesse seien nur noch auf den ökonomischen Erfolg ausgerichtet, in den 1970er Jahren zunächst die Themenschwerpunkte und ab 1988 Länderschwerpunkte ein (vgl. Weidhaas 2003, S. 255f). Die Gastlandauftritte wurden daraufhin in der Tat ein beliebtes Thema in der Medienberichterstattung zur Buchmesse (siehe hierzu Kapitel 3.1). Mit historischen sowie ökonomischen Aspekten beschäftigt sich auch eine Studie zum Funktionswandel der Frankfurter Buchmesse über die Jahrhunderte und zur Bedeutung für die Akteurinnen und Akteure des gegenwärtigen Buchwesens (vgl. Niemeier 2001). Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der gegenwärtigen Frankfurter Buchmesse erschien der von Stephan Füssel herausgegebene Sammelband, der Untersuchungen einzelner Phänomene dieser Bücherschau zusammenführt (vgl. Füssel 1999a), darunter eine Darstellung der ersten Gastlandauftritte Italiens und Frankreichs Ende der 1980er Jahre sowie der Reaktionen der Presse und des Publikums darauf (vgl. Rütten 1999). Aktueller und stärker auf die Gegenwart der Frankfurter Buchmesse ausgerichtet ist die Studie von Beth Driscoll und Claire Squires, die unter anderem mit kreativen Methoden der teilnehmenden Beobachtung und Interviews in den Jahren 2017 bis 2019 die Entstehung von internationalen Bestsellern im Rahmen der Buchmesse untersuchte (vgl. Driscoll und Squires 2020).
Speziell zu den Ehrengastauftritten auf der Frankfurter Buchmesse existieren einige weitere Beiträge mit medienanalytischen, kulturpolitischen und literatursoziologischen Ansätzen. Corinna Norrick-Rühl widmet sich den Effekten der Ehrengastauftritte und vergleicht die Anzahl von Belletristik-Übersetzungen aus der Sprache des jeweiligen Gastlandes ins Deutsche für den Zeitraum 2009 bis 2018. Dabei betrachtet sie – wo möglich – Übersetzungszahlen für jeweils zwei Jahre vor und bis zu fünf Jahre nach dem jeweiligen Ehrengastauftritt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Menge an Belletristik-Übersetzungen und der Status der Gastlandsprache unter Übersetzungen ins Deutsche im Jahr des Auftritts auf der Frankfurter Buchmesse einen deutlichen Höhepunkt erreichen, die Ehrengastauftritte jedoch keinen langanhaltend positiven, quantitativ messbaren Effekt für die Übersetzungstätigkeit der deutschsprachigen Verlage in Bezug auf diese Sprache haben (vgl. Norrick-Rühl 2020). In einer umfassenden Arbeit zum finnischen Ehrengastauftritt 2014 betrachtet Helmi-Nelli Körkkö das Finnland-Image in den deutschen Medien (vgl. Körkkö 2017). Weitere Aufsätze zu einzelnen Ehrengastauftritten in Frankfurt widmen sich dem Litauen-Bild in den deutschen Medien während des Auftritts 2002, der Rolle der Übersetzerinnen und Übersetzer im Rahmen der Präsentation Neuseelands im Jahr 2012, dem Auftritt Argentiniens in kulturpolitischer Hinsicht sowie dem Konzept der Ausstellung im argentinischen Ehrengastpavillon 2010 (vgl. Eidukevičiené 2005; Kölling 2014; Dujovne und Sorá 2011; Pedota 2015).
Der französische Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2017, das zentrale Thema dieser Studie, hat ebenfalls bereits Eingang in die Forschungsliteratur gefunden. Ein Beitrag von Marco Thomas Bosshard arbeitet die Kontroversen um die Bewerbungen Mexikos und Frankreichs als Gastland der Buchmesse in Frankfurt für das Jahr 2017 mit Blick auf die Einflussnahme des politischen auf das literarische Feld auf (vgl. Bosshard 2019). Eine Untersuchung zu staatlich gefördertem Literaturexport im Vorfeld der Ehrengastauftritte auf der Frankfurter Buchmesse vergleicht die Zusammensetzung der mithilfe von Übersetzungsförderung ins Deutsche übertragenen argentinischen Literatur vor dem Auftritt 2010 mit der französischsprachigen Literatur im Vorfeld von Francfort en français 2017 (vgl. Hertwig 2020).
Außerdem ist insbesondere ein Dossier der Zeitschrift Lendemains zu nennen, welches sich Francfort en français widmet (vgl. Bosshard, Brink und Hertwig 2018). Eine vergleichende Analyse der Ehrengastauftritte Frankreichs auf der Frankfurter Buchmesse 1989 und 2017 zeigt, dass sich beide Auftritte auf das Leitwort „Vielfalt“ beziehen, die zugrundeliegenden Konzepte jedoch 1989 einen eher nationalen Ansatz hatten, während man 2017 eine transnationale Perspektive wählte (vgl. Hertwig 2018b). Hinsichtlich der Vielfalt der ausgestellten Literatur und der Sichtbarkeit ihrer Produzentinnen und Produzenten im Ehrengastpavillon analysiert Matteo Anastasio die ästhetische Gestaltung des französischen Gastlandpavillons und kommt zu dem Schluss, dass der Auftritt Frankreichs sich auf die Darstellung der Produktion von Literatur und den Charakter des Französischen als eine sich fortwährend entwickelnde Sprache fokussierte (vgl. Anastasio 2018).
Weitere Beiträge des Dossiers in Lendemains beschäftigen sich mit der Beteiligung europäischer frankophoner Länder am französischen Ehrengastauftritt und seiner Rezeption in den Medien, in der französischsprachigen Schweiz (vgl. Hunkeler 2018a), in Belgien (vgl. Houscheid und Letawe 2018), in Frankreich sowie auch in der deutschen Presse (vgl. Hethey und Struve 2018). Jan Rhein erweitert die frankophone Perspektive auf das Projekt Francfort en français mit seiner Funktionsanalyse des unter anderem vom Bureau International de l’édition française (BIEF) organisierten Gemeinschaftstands, zu dem Verlegerinnen und Verleger aus subsaharischen Ländern und Haiti eingeladen wurden (vgl. Rhein 2018). Marco Thomas Bosshards Untersuchung zur Rezeption des französischen Auftritts beim Publikum der Buchmesse, bei Buchhändlerinnen und Fachbesuchern, die auf quantitativen Befragungen beruht (vgl. Bosshard 2018), wurde in dieser Forschungsarbeit aufgegriffen und um eine qualitative Studie zur Bedeutung und Auswirkungen des Ehrengastauftritts für Akteurinnen und Akteure auf dem deutschsprachigen Buchmarkt ergänzt. Im Hinblick auf die Bedeutung des Ehrengastauftritts für Verlage auf dem deutschen Buchmarkt existiert eine weitere Studie darüber, wie diese mit dem Bezug zum Gastland Argentinien im Jahr 2010 in ihren Verlagsvorschauen für argentinische Literatur werben (vgl. Bosshard und Gieseker 2015). Marco Thomas Bosshard und Sarah Gieseker ziehen darin das Fazit, dass die Verlage Suhrkamp, Insel, S. Fischer, Klaus Wagenbach und Berenberg in ihren Vorschauen eine Art der Literaturvermittlung wählen, die auf Stereotypen und der Vorstellung einer homogenen Nationalliteratur beruht. Die vorliegende Forschungsarbeit ergänzt unter Rückgriff auf einzelne Aspekte der bereits vorhandenen Literatur zu Ehrengastauftritten in Frankfurt und Francfort en français im Speziellen eine Untersuchung zu den Strategien von verschiedenen unabhängigen Verlagen und Buchhandlungen, mit denen die Akteurinnen und Akteure über das Gastlandkonzept eine erhöhte Sichtbarkeit generieren. Damit liefert die Studie auch einen neuen Ansatz zur Untersuchung der Auswirkungen der Ehrengastauftritte auf den deutschsprachigen Buchmarkt.
Viele Publikationen zur Bibliodiversität, zu Veränderungen im Verlagswesen, und der Rolle unabhängiger Verlage stammen von Akteurinnen und Akteuren der Buchbranche selbst. Es sind wertvolle Zeugnisse aus der Praxis. Es ist aber gleichzeitig zu berücksichtigen, dass es in ihrer Natur liegt, dass sie von persönlichen Erfahrungen, Wertungen, Meinungen und partieller Wahrnehmung der unmittelbar Involvierten geprägt sind (vgl. auch Thompson 2012, 24–25). Zu ihnen gehören etwa L’édition sans éditeurs des Verlegers André Schiffrin (vgl. Schiffrin 1999) und Publikationen wie Des paroles et des actes pour la bibliodiversité, Zeugnisse der Mitglieder der AIEI (vgl. Des paroles et des actes pour la bibliodiversité 2006). Die AIEI mit Sitz in Paris leistet dennoch mit dem Observatoire de la bibliodiversité, welches die internationale Forschung zum Thema zusammenträgt, einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung der Diversität im Buchwesen.3 Sie gibt in größeren Abständen die Zeitschrift Bibliodiversity heraus. Für das vorliegende Thema sind insbesondere jene Ausgaben dieser Zeitschrift relevant, welche Beiträge zu den Indikatoren der Bibliodiversität und zur Wechselwirkung von Übersetzung und Globalisierung versammeln (vgl. Galliand 2011a und Sapiro 2014a).
Die französischen Ökonominnen Françoise Benhamou und Stéphanie Peltier veröffentlichten in dieser Zeitschrift eine wichtige Studie mit dem Titel „How should cultural diversity be measured? An application using the French publishing industry“ zur Messbarkeit kultureller Diversität im Buchwesen (vgl. Benhamou und Peltier 2011). Sie definieren Bibliodiversität darin als ein multidimensionales Konzept und stellen – in Anlehnung an die Forschung zur Biodiversität – drei Kriterien der Vielfalt heraus: Auswahl, Gleichgewicht und Verschiedenheit. Für die Bibliodiversität gilt: „The greater the variety, the balance and the disparity of a system, the larger its diversity“ (Benhamou und Peltier 2011, 14). In ihrer Studie zur Vielfalt im französischen Verlagswesen zwischen 1990 und 2003 untersuchen Françoise Benhamou und Stéphanie Peltier nicht nur die Vielfalt des Angebots (supplied diversity), welche den Leserinnen und Lesern zur Verfügung steht, sondern setzen dieses auch in Beziehung zur tatsächlichen Nutzung, gemessen etwa durch Verkaufszahlen von Büchern sowie Platzierungen auf Bestsellerlisten (consumed diversity). Dieses Analysemodell diente in der vorliegenden Studie – nach Anpassung an die bestehenden Möglichkeiten der Datenerhebung – als Basis für die Untersuchung der Bibliodiversität im Transfer frankophoner Literatur auf den deutschsprachigen Buchmarkt im zeitlichen Umfeld des Ehrengastauftritts Francfort en français.
Übersetzungsströme, literarische und kulturelle Austauschprozesse zwischen möglichst vielen beteiligten Sprachen, Literaturen und Akteurinnen und Akteuren sind ein wichtiger Faktor für die Produktion von Vielfalt im Buchwesen. In ihren Leitlinien zur Bibliodiversität nennt Susan Hawthorne Netzwerke, und damit Interaktionsmöglichkeiten, als Voraussetzung, „damit Kulturen gedeihen können“ (Hawthorne 2017, 95). Buchmessen stellen solch einen Raum für die Etablierung und Vertiefung dieser (internationalen) Netzwerke dar, welche Bibliodiversität begünstigen können. Inwiefern das Konzept von Bibliodiversität im Kontext von Francfort en français berücksichtigt wurde, und welche Auswirkungen der Ehrengastauftritt auf den Literaturtransfer und die Akteurinnen und Akteure des deutschsprachigen und frankophonen literarischen Feldes hat, untersucht diese Forschungsarbeit. Im Folgenden wird dargestellt, welche Materialien dazu herangezogen und welche Methodik angewendet wurde.
1.2Forschungsdesign, Material und Methodik
Zu den Herausforderungen bei einer wissenschaftlichen Untersuchung der Frankfurter Buchmesse schreiben Beth Driscoll und Claire Squires:
The Buchmesse is a compressed, intense layering of social, technological, cultural and commercial transactions, and its scale and organisational complexita pose a methodological challenge for book culture researchers. […] The Fair is multilingual, multicultural and literally multilevel with intersecting experiences across parallel, never quite touching worlds. (Driscoll und Squires 2020, 7–8)
Die Feststellung Robert Darntons in Bezug auf die historische Buchforschung, dass „Bücher weder sprachliche noch nationale Grenzen“ respektieren und „sich auch dagegen [wehren], in die Schranken einer einzelnen Disziplin gebannt zu werden“, weshalb „die Geschichte des Buches vom Format her international und von den Methoden her interdisziplinär sein“ (Darnton 1998, 96) müsse, gilt auch für die Gegenwart des Buchwesens. Auch die Untersuchung der Bibliodiversität im Kontext von Francfort en français erfordert daher aufgrund ihrer kulturpolitischen, literatur- und übersetzungssoziologischen sowie ökonomischen Aspekte sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsmethoden. Durch die Triangulation sollen die Schwächen der spezifischen Methoden ausgeglichen und die Ergebnisse durch das voneinander unabhängige Vorgehen bei den verschiedenen Teiluntersuchungen abgesichert werden. Den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bildet die Forschung zu literarischen Feldern nach Pierre Bourdieu (vgl. u. a. Bourdieu 1992, Bourdieu 1999 und Bourdieu 2004). Elemente der Theorie werden an jenen Stellen näher erläutert, an denen darauf zurückgegriffen wird bzw. an denen die von Pierre Bourdieu geprägten Begriffe angewendet werden.
Die Studie gliedert sich in drei zentrale Teiluntersuchungen: Erstens zur Bibliodiversität im Vorfeld und während des Ehrengastauftritts Francfort en français, zweitens zu den Auswirkungen des französischen Ehrengastauftritts auf die Vielfalt im deutschsprachigen sowie im frankophonen literarischen Feld, sowie drittens zur Bibliodiversität im Hinblick auf Übersetzungen frankophoner Literatur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt und mögliche Effekte von Francfort en français hierauf (siehe Abbildung 1).
Skizze zum Forschungsdesign der Studie
Im ersten Schritt wurde analysiert, inwiefern das Konzept der Bibliodiversität bei der Realisierung des Projektes Francfort en français berücksichtigt wurde (Kapitel 4 und 5). Mithilfe von rekonstruierenden Expertinnen- und Experteninterviews1 mit den Mitgliedern des französischen Organisationskomitees sowie offiziellen Publikationen des Projektes wurde dazu zunächst der französische Ehrengastauftritt mit seinen Zielen und seinem Selbstverständnis kartographiert, um anschließend verschiedene Aspekte des Auftritts hinsichtlich der Bibliodiversität zu untersuchen. Mittels einer Analyse der Daten zur französischen Übersetzungsförderung des Centre national du livre (CNL) sowie des Institut français (IF) wurde ermittelt, welche deutsch- und französischsprachigen Verlage, Autorinnen und Autoren sowie Genres im Vorfeld des französischen Ehrengastauftritts von dieser Maßnahme, die als Instrument zur staatlichen Förderung der Bibliodiversität verstanden werden kann, profitiert haben.
Eine Analyse der offiziellen Delegation der Autorinnen und Autoren hinsichtlich der darüber vertretenen Genres und Verlage, der Herkunft, des Alters und des Geschlechts der Schriftstellerinnen und Schriftsteller ermöglichte es, das Verständnis des Projektes von Diversität in dieser Hinsicht zu beleuchten. Auch die Betrachtung der Gestaltung des Ehrengastpavillons auf der Messe erlaubte Schlüsse bezüglich des Verständnisses von Vielfalt: Auch wenn es in Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war, die mehr als 43.000 ausgestellten Bücher nach Autorinnen und Autoren, Genres und Verlagen zu katalogisieren, konnte jedoch die Schwerpunktsetzung der Ausstellungen sowie die Ankündigung der Spende der ausgestellten Bücher an Länder im globalen Süden im Hinblick auf ihre möglichen Auswirkungen für die Bibliodiversität in diesen Ländern diskutiert werden.
In einem zweiten Schritt wurden die Auswirkungen des französischen Ehrengastauftritts auf die Vielfalt im deutschsprachigen sowie im frankophonen literarischen Feld erforscht (Kapitel 6). Mittels eines standardisierten Online-Fragebogens wurde untersucht, welche Bedeutung der Ehrengastauftritt Frankreichs insbesondere für unabhängige Akteurinnen und Akteure im deutschsprachigen literarischen Feld hatte. Dabei wurde Fragen nachgegangen wie: Inwiefern nutzen Buchhändlerinnen und Buchhändler die Gastlandauftritte auf der Frankfurter Buchmesse für Aktivitäten zur Kundinnen- und Kundenbindung und Verkaufsförderung? Welchen Einfluss haben die Auftritte auf den Verkauf in der jeweiligen Buchhandlung?
Eine weitere standardisierte Online-Befragung unter Fachbesucherinnen und Fachbesuchern sowie zusätzliche Interviews verdeutlichten, dass der Ehrengastauftritt auf der Buchmesse die Buchproduktion beeinflusst. Kleinere, unabhängige Verlage wenden unterschiedliche Strategien an, um die Gastlandauftritte auf der Frankfurter Buchmesse regelmäßig als Möglichkeit wahrzunehmen, auf sich und ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen. Schließlich wurden die Auswirkungen des Projektes Francfort en français auf die Vielfalt im frankophonen literarischen Feld analysiert. Mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens wurden französischsprachige Fachbesucherinnen und Fachbesucher zu ihrer Wahrnehmung des französischen Ehrengastauftritts befragt. Vertieft wurden diese Aussagen exemplarisch mittels Interviews mit frankophonen Verlegerinnen und Verlagsmitarbeitern aus Frankreich, der Schweiz, dem Libanon und Tunesien. Auch dabei wurde der Fokus auf die Erforschung der Auswirkungen des französischen Ehrengastauftritts auf die Bibliodiversität und die (Macht‑)Beziehungen im frankophonen literarischen Feld gelegt. Mittels einer Analyse von Medienberichten und politischen Reden wurden außerdem die Folgen von Francfort en français untersucht, wie sie sich in der auswärtigen Kulturpolitik des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in seiner Strategie für die weltweite Stärkung der französischen Sprache und Neudefinition der Frankophonie (verkündet am Internationalen Tag der Frankophonie am 20. März 2018) manifestieren. Mit der daraus resultierenden Einberufung der États généraux hatte Francfort en français indirekt auch Effekte auf die Diversität und Kooperation im frankophonen literarischen Feld.
Im dritten Schritt wurden die Bibliodiversität der Übersetzungen frankophoner Literatur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt und mögliche kurzfristige Effekte von Francfort en français analysiert (Kapitel 7). Dazu wurde zunächst eine Liste französischsprachiger Literatur in aktueller deutscher Übersetzung auf Basis der Daten der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) erstellt. Als Zeitraum wurden die Jahre 2007 bis 2019 gewählt – somit konnten ein zehnjähriger Entwicklungszeitraum bis zum Ehrengastauftritt 2017 sowie darüber hinaus zwei Jahre nach dem Ehrengastauftritt betrachtet werden. An dieser Stelle ist bereits anzumerken, dass eine längere Beobachtung im Anschluss an diese Forschungsarbeit wünschenswert ist. Angesichts der Tatsache, dass die Vorbereitung von Übersetzungen oftmals bis zu zwei Jahre in Anspruch nimmt, sowie dass, rein quantitativ betrachtet, die Anzahl der Übersetzungen nach Ehrengastauftritten auf der Frankfurter Buchmesse in den Folgejahren in den meisten Fällen zunächst abnimmt (vgl. Norrick-Rühl 2020), wurden in diesem kurzen zweijährigen Zeitraum nach dem Ehrengastauftritt zunächst keine deutlichen Effekte auf die Vielfalt der Übersetzungen beobachtet.
Für die angestrebte Analyse des Zustands der Bibliodiversität bei Übersetzungen aus dem Französischen ins Deutsche hinsichtlich der konsumierten Diversität wurden außerdem Daten zur consumed diversity, also Verkaufszahlen und Bestsellerplatzierungen, benötigt. Da viele Verlage Verkaufs- und Absatzzahlen nicht herausgeben und veröffentlichen möchten, war eine Korrelierung solcher Daten zur Gesamtheit des Korpus in dieser Arbeit nicht möglich. Zum Ausgleich wurde daher in diesem Teil der Analyse mit den anonymisierten Daten zweier Beispielverlage unterschiedlicher Größe gearbeitet.
Material und Methodik
In vielerlei Hinsicht war für die Entstehung dieser Studie der Besuch der Verfasserin auf der Frankfurter Buchmesse 2017 und die teilnehmende Beobachtung des französischen Ehrengastauftritts Francfort en français von zentraler Bedeutung. Nicht nur wurde während der Buchmesse und der Teilnahme an ihren Veranstaltungen ein Feldtagebuch geführt, die Eröffnungsfeier mit ihren politischen Reden, Ausstellungen im französischen Ehrengastpavillon sowie das Veranstaltungsprogramm dokumentiert und diverse Materialien der offiziellen Projektkommunikation gesammelt. Es wurden außerdem standardisierte Befragungen des Publikums sowie bereits erste Interviews durchgeführt, deren Methodik später in diesem Abschnitt erläutert wird, bzw. wurden die Kontakte für deren spätere Durchführung geknüpft. Viele Verantwortliche des französischen Ehrengastauftritts sowie frankophone Verlagsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter standen aufgrund ihrer begrenzten zeitlichen Kapazität in Frankfurt im Oktober 2017 erst während eines Besuchs der Buchmesse Livre Paris im März 2018 für Interviews zur Verfügung. Besuche der Frankfurter Buchmesse in den Folgejahren 2018 und 2019 ermöglichten die Nachverfolgung der Effekte von Francfort en français sowie Vergleiche zu späteren Ehrengastauftritten. Während zusätzlicher Aufenthalte in Frankfurt wurden Recherchen zum Ehrengastauftritt Frankreichs 1989 im Büro der Buchmesse selbst sowie im Frankfurter Stadtarchiv durchgeführt, und die Leiterin des Ehrengastprogramms bei der Buchmesse interviewt.
Im Folgenden wird das Vorgehen bei den standardisierten (Online-)Befragungen sowie bei den leitfadengestützten Interviews erläutert, da auf die Ergebnisse dieser Befragungen in verschiedenen Kapiteln der Studie Bezug genommen wird. Dem methodischen Vorgehen bei der Erfassung und Auswertung von Daten zur französischen Übersetzungsförderung sowie bei der Ausgestaltung des Untersuchungsdesigns zur Bibliodiversität im Hinblick auf Angebot und Nachfrage frankophoner Literatur in deutscher Übersetzung zwischen 2007 und 2019 wird dagegen in Kapitel 5.1 bzw. in Kapitel 7 jeweils eine eigene, ausführliche Darstellung gewidmet.
Die Studie greift an verschiedenen Stellen auf standardisierte Befragungen zurück, die im Rahmen des von der DFG geförderten Forschungsprojektes „Buchmessen als Räume kultureller und ökonomischer Verhandlung“ an der Europa-Universität Flensburg anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2017 durchgeführt wurden.1 Drei verschiedene Zielgruppen wurden mittels verschiedener standardisierter Fragebögen, die sich in einigen Fragen überschnitten, zu ihren Erfahrungen mit der Frankfurter Buchmesse, den Ehrengastauftritten und speziell zu Francfort en français befragt. Gemeinsam mit dem sich auf der Buchmesse bewegenden Publikum füllten studentische Interviewerinnen und Interviewer vor Ort Papier-Fragebögen aus, während im Anschluss an die Buchmesse deutsche Buchhändlerinnen und Buchhändler sowie die bei der Frankfurter Buchmesse registrierten teilnehmenden Unternehmen wie Verlage und Literaturagenturen aus dem deutsch- sowie dem französischsprachigen Raum mittels eines Online-Fragebogens kontaktiert wurden.
Während der Frankfurter Buchmesse 2017 wurden vor Ort an vier Tagen (Donnerstag, 12. Oktober bis Sonntag, 15. Oktober 2017) 368 Personen an verschiedenen Orten auf der Buchmesse, auch im Umfeld des französischen Ehrengastpavillons, befragt. Bei den ersten beiden Tagen handelte es sich um Fachbesuchertage, an denen sich das Laufpublikum der Branchenveranstaltung größtenteils aus deutschsprachigen und internationalen Fachbesucherinnen und -besuchern zusammensetzte. An den Wochenendtagen wird die Frankfurter Buchmesse auch für das allgemeine Publikum geöffnet, so dass an diesen Tagen vorrangig diese Zielgruppe an der Befragung teilnahm. Nachdem im Jahr 2017 insgesamt 286.425 Menschen die Frankfurter Buchmesse besuchten (vgl. Frankfurter Buchmesse 2017b), ermöglicht die Befragung der nur 368 zufällig ausgewählten Besucherinnen und Besuchern keine repräsentativen Aussagen. Es handelte sich dabei jedoch um die maximal erreichbare Anzahl an Interviewpartnerinnen und ‑partnern unter den gegebenen organisatorischen sowie finanziellen Möglichkeiten des Forschungsprojekts: Zwölf Studierende der Europa-Universität Flensburg führten an den vier Tagen in Zweiergruppen die Befragungen durch. Die Ergebnisse erlauben es, in der vorliegenden Arbeit Tendenzen der Meinungen und Wertungen des Fachbesucherinnen- sowie Laienpublikums zu Francfort en français darzustellen.
Für die Verbreitung der Online-Befragung der Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus dem deutsch- sowie dem französischsprachigen Raum wurden die Kontaktdaten des Ausstellerkatalogs der Frankfurter Buchmesse 2017 genutzt. 1.060 Verlage und Literaturagenturen aus Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz sowie 288 registrierte Unternehmen aus Frankreich, Québec, den französischsprachigen Regionen der Schweiz und Belgiens sowie aus Haiti erhielten im November 2017 per E-Mail eine Einladung zur Teilnahme an der Befragung. Den deutschen Online-Fragebögen füllten 192 Personen aus; aus Frankreich und den anderen genannten frankophonen Ländern und Regionen trafen 91 bearbeitete französischsprachige Online-Fragebögen ein.
Damit lag die Rücklaufquote unter den kontaktierten Verlagen und Literaturagenturen deutlich höher als diejenige der Buchhändlerinnen und Buchhändler. Aufgrund vorheriger Erfahrung mit wenig zufriedenstellenden Rücklaufquoten bei der Online-Befragung von Buchhändlerinnen und Buchhändlern wurde neben dem Versand einer Einladung zur Teilnahme an der Umfrage über den Newsletter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. (Börsenverein) an seine Mitglieder eine nach Unternehmensform, Standort und Größe repräsentative Auswahl an deutschen Buchhandlungen getroffen, die persönlich angeschrieben wurden. Insgesamt gingen daraufhin nur 40 beantwortete Fragebögen (online sowie solche in Papierform von den direkt kontaktierten Buchhandlungen) ein, und damit eine sehr geringe Anzahl angesichts von circa 2.850 im Börsenverein organisierten Buchhandlungen.2 Aufgrund der höheren Rücklaufquote von 25 Prozent in der Gruppe der direkt kontaktierten und nach repräsentativen Kriterien ausgewählten Buchhandlungen ergibt sich hier dennoch „zumindest ein gewichtetes Stimmungsbild“ (Bosshard 2018, 28). Da es keine andere Datengrundlage zu den Erfahrungen verschiedener Akteurinnen und Akteure auf der Frankfurter Buchmesse 2017 gibt, beschreiben die Ergebnisse der quantitativen Befragungen in dieser Arbeit Tendenzen, und werden teilweise durch eigens geführte qualitative Interviews und weitere Materialien ergänzt. Die Auswertung aller in den verschiedenen quantitativen Befragungen gesammelten Daten erfolgte mithilfe der Statistik-Software SPSS. Die für diese Arbeit relevanten Ergebnisse werden insbesondere in Kapitel 6 zu den Effekten und der Rezeption von Francfort en français unter Akteurinnen und Akteuren im deutschsprachigen sowie dem frankophonen literarischen Feld dargestellt.
Um die in den standardisierten Befragungen gewonnenen Informationen zu vertiefen, aber auch um in der Vergangenheit liegende Ereignisse wie die Organisation von Francfort en français und den französischen Ehrengastauftritt von 1989 rekonstruieren zu können, wurden Expertinnen- und Experteninterviews durchgeführt. Die Interviews erlaubten es, diese Rekonstruktionen vergangener Ereignisse und die sozialen Mechanismen bei der Organisation der Ehrengastauftritte und ihrer Bewertung durch die Akteurinnen und Akteure in den verschiedenen literarischen Feldern zu erforschen. Dem Vorteil, dass die Interviews als qualitative Methode es überhaupt erst ermöglichen, sich diesen Aspekten, über die Analyse öffentlich gemachter Dokumente hinaus, zu nähern, steht die Problematik gegenüber, dass die Interviews persönliche Perspektiven, Wahrnehmungen und Wertungen der Befragten abbilden, also als anekdotische Evidenz eingestuft werden müssen (vgl. Gläser und Laudel 2010, 71 und Allington 2010, 11). Um dieser Problematik zu begegnen, wurden mehrere Personen, teilweise auch aus derselben Organisationsstruktur, zu denselben Themen befragt, und die jeweils von persönlichen Situationen beeinflusste Färbung bei der Beantwortung von Fragen bei der Analyse so weit erkennbar berücksichtigt (vgl. Allington 2010, 13). Außerdem wurde die Repräsentativität der Aussagen auch über die Auswahl der verschiedenen Befragten gewährleistet.
Die für diese Arbeit geführten Interviews können in zwei Kategorien eingeteilt werden: einerseits Interviews zur Rekonstruktion zurückliegender Ereignisse, andererseits Interviews, in denen nach Deutungen und Wertungen der Akteurinnen und Akteure gefragt wurde. Auch wenn die Grenzen zwischen beiden Formen teilweise fließend sind, zählen zu den eher rekonstruierenden Interviews insbesondere jene mit den Beteiligten an der Organisation des ersten Ehrengastauftritts Frankreichs auf der Frankfurter Buchmesse 1989 sowie an Francfort en français 2017, aber auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Institution Frankfurter Buchmesse. Es wurden dabei Personen aus verschiedenen Hierarchieebenen befragt, da diese nicht nur über verschiedene Informationen, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa auch über mehr Zeit verfügten als die Projektleitung und in gewisser Weise über kritische Aspekte offener sprechen konnten. Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner stand nicht im Vorhinein fest – durch die Weiterempfehlung und zusätzliche Kontakte erweiterte sich die Liste der Befragten noch während des Befragungsprozesses (sogenanntes Schneeballprinzip).
Mit einer Perspektive von außerhalb blickten Vertreterinnen und Vertreter von französischen und deutschen Verlagen sowie von Verlagen aus verschiedenen frankophonen Ländern wie der Schweiz, Tunesien und dem Libanon auf das Ehrengastprojekt Francfort en français und seine Auswirkungen auf das deutschsprachige sowie das frankophone literarische Feld. Vor dem Hintergrund der Bedeutung, die unabhängige Akteurinnen und Akteure für die Bibliodiversität haben, sollten bei der Auswahl vorrangig unabhängige Verlage in die Befragung mittels Interviews einbezogen werden. In der Praxis gelang dies im Hinblick auf die Vertreterinnen und Vertreter aus französischen Verlagen weniger gut. Auf Anfragen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Lizenzabteilungen der Verlage, von denen angenommen wurde, dass sie auf der Frankfurter Buchmesse 2017 mit Sicherheit anwesend sein würden, reagierten insbesondere Personen aus den größeren Verlagshäusern. Aufgefangen werden konnte dies durch die Berücksichtigung dieses Umstands bei der Auswertung sowie durch die Tatsache, dass die drei betroffenen Verlage – Gallimard, Plon und Groupe Libella – dennoch unterschiedliche Positionen im literarischen Feld besetzen.
Die Interviews wurden in allen Fällen auf der Grundlage von Leitfäden durchgeführt. Damit wurde gewährleistet, dass alle im Voraus geplanten Themen angesprochen wurden, aber gleichzeitig ausreichend Freiraum für die Wahl der Gesprächsthemen durch die Interviewpartnerinnen und -partner bestand. Außerdem konnten auf diese Weise Personen mit ähnlichen Rollen dieselben Fragen gestellt werden, und deren Antworten verglichen werden. Größtenteils konnten die Interviews bei persönlichen Treffen auf der Buchmesse selbst oder bei Besuchen in den Verlagen bzw. Institutionen durchgeführt werden. Bei terminlichen Schwierigkeiten oder zu großer Distanz wurde auf eine telefonische Befragung ausgewichen, und in zwei Fällen eine schriftliche Beantwortung von Fragen realisiert.
Insgesamt wurden für die Studie 34 Interviews geführt. Für die Auswertung der stets aufgezeichneten Interviews wurden Transkriptionen erstellt.3 Aussagen zu sich überschneidenden Themen wurde mithilfe eines Kategoriensystem eingeordnet und anschließend analysiert. Die Interviews halfen nicht nur zu einem besseren Verständnis der Thematik und flossen in das Hintergrundwissen ein, sondern wurden insbesondere für die Kartographierung der französischen Ehrengastauftritte 1989 und 2017 in Kapitel 3.3 und 4 sowie die Analyse der Rezeption und der Effekte von Francfort en français in Kapitel 6 herangezogen.
1.3Aufbau der Arbeit
Um den zentralen Forschungsgegenstand „Bibliodiversität“ einzuordnen und zu definieren, wird in Kapitel 2 zunächst eine historisch-theoretische Kontextualisierung vorgenommen. Kapitel 2.1 beschäftigt sich mit der Entstehung des Konzeptes Bibliodiversität und seiner Bedeutung. Einführend wird als Prämisse des Konzeptes der Strukturwandel im internationalen Buchwesen der vergangenen Jahrzehnte dargestellt, bevor ein Überblick über die historischen Diskurse zu den Themen Vielfalt im Buchwesen und Schutz kultureller Diversität gegeben wird, da diese die Akteurinnen und Akteure des Buchwesens schon vor Entstehen des Konzeptes Bibliodiversität beschäftigt haben. Außerdem werden verschiedene Interpretationen des Konzeptes vorgestellt.
In Kapitel 2.2 werden Indikatoren und die Messbarkeit von Bibliodiversität diskutiert. Dabei wird das multidimensionale Analysemodell von Françoise Benhamou und Stéphanie Peltier präsentiert (vgl. Benhamou und Peltier 2006) und der Einfluss von unabhängigen Verlagen sowie Übersetzungen auf die Bibliodiversität diskutiert. Als weiterer Indikator für Bibliodiversität wird die Einbeziehung marginalisierter Gruppen in das Buchwesen definiert.
Mit einem Fokus auf die in Frankreich und Deutschland existierende Buchpolitik werden in Kapitel 2.3 die kulturpolitischen Rahmenbedingungen für Bibliodiversität behandelt. Für das Thema der vorliegenden Arbeit, der Bibliodiversität im Kontext des Ehrengastauftritts Francfort en français, ist speziell die Übersetzungsförderung als Element staatlicher Buchpolitik relevant, weshalb darauf detaillierter eingegangen wird. Die insbesondere von der AIEI herausgegebenen kulturpolitischen Empfehlungen zur Förderung von Bibliodiversität werden ebenfalls in diesem Kapitel thematisiert. Kapitel 2.4 widmet sich abschließend der Rolle internationaler Buchmessen bei der Förderung und Verbreitung des Konzeptes Bibliodiversität.
Um den französischen Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2017 zu situieren, wird in Kapitel 3 die Entwicklung der Internationalität der Buchmesse im 20. Jahrhundert sowie die Konstituierung des Ehrengastmodells nachgezeichnet. Die Frankfurter Buchmesse wird dabei als Raum ökonomischer und kultureller Verhandlungen zwischen Akteurinnen und Akteuren verschiedener literarischer Felder beschrieben (Kapitel 3.1). Die einleitenden Ausführungen geben einen Einblick in die Entwicklung der Buchmesse in Frankfurt mit einem besonderen Fokus auf ihren internationalen Charakter ab der Neugründung im 20. Jahrhundert, bevor das heutige Ehrengastkonzept als integrales Element dieses Aufeinandertreffens ökonomischer und kultureller Interessen mit seinen Motiven und seiner Bedeutung für die Gastländer und für die Akteurin „Buchmesse“ analysiert wird.
Kapitel 3.2 beschäftigt sich mit den Interaktionen in und zwischen literarischen Feldern. Da für das Projekt Francfort en français die Beziehungen zwischen Akteurinnen und Akteuren aus dem Buchwesen verschiedener französischsprachiger Territorien von besonderem Interesse sind, wird hier zunächst das transnationale frankophone literarische Feld charakterisiert. Dem gegenwärtigen Literaturaustausch des deutsch- und französischsprachigen literarischen Feldes ist das darauffolgende Unterkapitel gewidmet. Schließlich wird mit einer Analyse des ersten Gastlandauftritts Frankreichs 1989 in Kapitel 3.3 mit Blick auf das Selbstverständnis, den zeitgeschichtlichen Kontext sowie die konkrete Umsetzung die Voraussetzung des Projektes Francfort en français und gleichzeitig sein Vergleichsmoment dargestellt.
In Kapitel 4 wird der französische Ehrengastauftritt anhand seiner wichtigsten Parameter kartographiert. Seine Vorgeschichte und die Entscheidungsfindung sowie die Einordnung des Ehrengastauftritts als Projekt der französischen Außenkulturpolitik demonstrieren die Verflechtungen und die Einflussnahme von Akteurinnen und Akteuren des politischen im literarischen Feld. In Kapitel 4.2 wird mit einer Betrachtung der Wahl des Mottos Francfort en français das Selbstverständnis des Ehrengastprojekts analysiert, bevor es in den zeitgeschichtlichen Kontext der deutsch-französischen Beziehungen sowie in die gegenwärtige Situation innerhalb Europas eingeordnet wird. In Kapitel 4.3 wird die Umsetzung des Auftritts Francfort en français hinsichtlich seiner Organisationsstrukturen, der Gestaltung des Ehrengastpavillons sowie der Ausrichtung des Programms und der Veranstaltungen betrachtet. Methodische Grundlage der Darstellung ist neben der eigenen Beobachtung die Auswertung von rekonstruierenden Interviews mit Mitgliedern der Organisationskomitees, offizieller Publikationen wie Programmheften und Pressedossiers sowie der Medienberichterstattung.
Die verschiedenen Teilanalysen in Kapitel 5 beleuchten Fragen der Bibliodiversität vor und während des französischen Ehrengastauftritts. Bevor darin die konkrete Umsetzung des Projektes Francfort en français analysiert wird, wird die dem Ehrengastauftritt vorangegangene französische Übersetzungsförderung untersucht: In Kapitel 5.1 wird betrachtet, inwieweit die Programme des CNL und des IF mit ihrer Wahl von förderungswürdigen Übersetzungsprojekten einen Einfluss auf die Bibliodiversität der Übersetzungen aus dem Französischen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt ausüben. Die Existenz dieser Übersetzungen wiederum stellte die Grundlage für die Einladung frankophoner Schriftstellerinnen und Schriftsteller zur Frankfurter Buchmesse 2017 und die thematische Schwerpunktsetzung des französischen Ehrengastauftritts dar. Das Ziel, während des französischen Ehrengastauftritts die ganze Vielfalt des Publizierens in französischer Sprache abzubilden, strebten die Organisatorinnen und Organisatoren auch über die Auswahl frankophoner Autorinnen und Autoren, die in die offizielle Delegation eingeladen wurden, an. Kapitel 5.2 untersucht daher deren Zusammensetzung unter anderem hinsichtlich der Kriterien Geschlecht, Alter und Herkunft der eingeladenen Repräsentantinnen und Repräsentanten frankophoner Literatur.
Die Ausstellung Frankreichs im Forum der Buchmesse war als „Ehrengastpavillon ohne Grenzen“ konzipiert. Kritik rief dabei die Ankündigung der Organisatorinnen und Organisatoren von Francfort en français hervor, die mehr als 40.000 Bücher, mit denen der Ehrengastpavillon als bibliothèque éphémère bestückt war, als Spende an Bildungseinrichtungen in Ländern des globalen Südens zu übergeben. Der konkrete Fall und die möglichen negativen Effekte solcher Bücherspenden für die Bibliodiversität im lokalen Buchwesen werden in Kapitel 5.3 diskutiert.
In Kapitel 6 wird die Bedeutung des französischen Ehrengastauftritts für die Akteurinnen und Akteure sowie für die Vielfalt im deutschsprachigen sowie im frankophonen literarischen Feld untersucht. In Kapitel 6.1 werden dazu die Strategien von und Auswirkungen für Buchhandlungen und unabhängige Verlage im deutschsprachigen Raum betrachtet, während sich Kapitel 6.2 den Folgen von Francfort en français für Akteurinnen und Akteure des frankophonen literarischen Feldes widmet. Dabei wird unterschieden zwischen der Wahrnehmung der befragten Akteurinnen und Akteure in Frankreich sowie in anderen französischsprachigen Territorien. Kapitel 6.3 analysiert die Berichterstattung über Francfort en français in den deutsch- und französischsprachigen Medien.
Der längerfristigen Entwicklung der Bibliodiversität von Übersetzungen frankophoner Literatur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt und möglichen ersten Effekten des Ehrengastauftritts Francfort en français auf diese Vielfalt ist Kapitel 7 gewidmet. Die Festlegung der Variablen der Analyse in Anlehnung an Françoise Benhamou und Stéphanie Peltier (vgl. Benhamou und Peltier 2006 sowie Benhamou und Peltier 2007) sowie das methodische Vorgehen bei der Erfassung der benötigten Daten werden in Kapitel 7.1 beschrieben, bevor in Kapitel 7.2 die Ergebnisse der Analyse dargestellt werden.
Im abschließenden Kapitel 8 werden schließlich die Nachwirkungen von Francfort en français untersucht. Dazu werden Stellungnahmen von Vertreterinnen und Vertretern aus dem frankophonen literarischen Feld in den Debatten um den Zustand desselben sowie die auswärtige Kulturpolitik des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron etwa in seiner Strategie für die weltweite Stärkung der französischen Sprache und Neudefinition der Frankophonie analysiert, welche auch Effekte auf die Diversität und Kooperation im frankophonen literarischen Feld haben könnte. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf mögliche langfristige Folgen von Francfort en français für die Bibliodiversität und das frankophone literarische Feld.
2Bibliodiversität
2.1Entstehung des Konzeptes und seine Bedeutung
Der Begriff Bibliodiversität als Schlagwort für den Schutz kultureller Vielfalt im Buchwesen entstand in den 1990er Jahren und wurde von unabhängigen Verlagen geprägt. Mindestens zwei Gruppierungen reklamieren die Schöpfung des Neologismus für sich. Sicher ist, dass er als bibliodiversidad aus dem spanischen Sprachraum stammt. Verlegerinnen und Verleger in Chile verwendeten ihn Ende der 1990er Jahre anlässlich ihres Zusammenschlusses zum Kollektiv Editores independientes de Chile (vgl. Pinhas 2011, 30). Etwa zur selben Zeit gründete die Asociación de Editores de Madrid eine Zeitschrift mit dem Titel Bibliodiversidad, welche bis heute mehrmals jährlich erscheint und zum Ziel hat, die Buchproduktion unabhängiger Verlage der Stadt bekannt zu machen. Bibliodiversität beschreibt zunächst einmal die Fähigkeit des Buchwesens, in allen Herstellungs- und Verbreitungsstufen ihrer Buchprodukte1 bis hin zum Lesen Vielfalt zu generieren (vgl. Galliand 2011b, 3), sowie das Bestreben nach einer Erhaltung der kulturellen Vielfalt im Buchsektor angesichts ihrer Gefährdung durch eine neoliberale Form der Globalisierung.
Aufgrund seiner Eingängigkeit verbreitete sich der Begriff schnell über die internationalen Netzwerke der Verlage, zunächst in mehrere romanische Sprachen, aber bald auch darüber hinaus.2 Besonderen Anteil an der Bekanntmachung der Bibliodiversität hat die Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI), deren Ziel es ist, neben ihrer Verbreitung die Idee der Bibliodiversität in einem Netzwerk aus heute mehr als 550 unabhängigen Verlagen aus sechs Sprachräumen3 und mithilfe wissenschaftlicher Studien zu einem verlegerischen und kulturpolitischen Konzept zu schärfen.
Welche Entwicklungen forcierten die Entstehung einer Idee und eines Konzeptes wie Bibliodiversität um die Jahrtausendwende? Im Folgenden werden die wesentlichen Umbrüche im internationalen Buchwesen der vergangenen Jahrzehnte und die Risiken, aber auch möglichen Chancen, die die Globalisierung des Buchwesens für seine Vielfalt mit sich bringt, aufgezeigt, bevor vorangegangene Diskurse um kulturelle Vielfalt und eine Auslegung des Konzeptes Bibliodiversität vorgestellt werden.
2.1.1Strukturwandel im Buchwesen als Prämisse des Konzeptes
Verbände unabhängiger Verlage wie die Editores independientes de Chile und andere Zusammenschlüsse in Lateinamerika und auf internationaler Ebene, die auf die schützenswerte kulturelle Vielfalt im Buchwesen aufmerksam machten, entstanden unter anderem als Reaktion auf den zunehmenden Einfluss transnationaler Verlagsunternehmen aus dem globalen Norden in den Buchmärkten vor allem Lateinamerikas ab Ende der 1980er Jahre.1
Die Entstehung international agierender Verlagskonzerne sowie die radikalen Veränderungen infolge der ökonomischen Globalisierung des Buchwesens beschreibt der US-amerikanische Verleger André Schiffrin wie folgt:
Jusqu’à une époque récente, l’édition était fondamentalement une activité artisanale, souvent familiale, de petite échelle, qui se satisfaisait de modestes profits provenant d’un travail qui était encore en liaison avec la vie intellectuelle du pays. Ces dernières années, les maisons d’édition ont été achetées les unes après les autres par de grands groupes internationaux. (Schiffrin 1999, 9–10)
Das Aufkommen transnational operierender Medienkonzerne, welche häufig auch in der Unterhaltungsindustrie tätig waren und deren Gewinnvorgaben auf das Buchgeschäft übertrugen (vgl. Schiffrin 1999, 66), veränderte laut André Schiffrin nicht nur die Machtstrukturen im Verlagswesen sowie die Arbeitsbedingungen in den Verlagen – neben Entlassungen und anderen Rationalisierungsmaßnahmen auch veränderte Entscheidungsprozesse und zunehmender Einfluss der Marketingabteilungen auf die Verlagsprogramme –sondern hatte auch inhaltliche Konsequenzen hinsichtlich des Buchangebots zur Folge:
Damit sie diese neuen Erwartungen erfüllen können, haben die Verleger den Zuschnitt ihres Programms drastisch umgebaut. Die ‘kleineren’ Titel – anspruchsvolle Literatur, Kunstgeschichte, Theorie – kurz alle Titel, die in der Regel mit zarten Erstauflagen starten–, sind aus den Katalogen der Großverlage mittlerweile so gut wie vollständig verschwunden, und zwar selbst in den Häusern, die sich mit ihrer Arbeit in diesen Bereichen einen Namen gemacht haben. Statt dessen [sic!] setzen die Verlage ihre Hoffnungen mehr und mehr auf Megaseller […]. (Schiffrin 2000b, 73)2
Über den sich vollziehenden Wandel referiert André Schiffrin anschaulich aus langjähriger Erfahrung als unabhängiger Verleger in den USA; im Vordergrund stehen jedoch seine persönliche Haltung und Kritik an der westlichen Konsumgesellschaft und den Marktverhältnissen: „La bataille se déroule également sur le terrain du livre, qui devient peu à peu un simple appendice de l’empire des médias, offrant du divertissement léger, de vieilles idées, et l’assurance que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes“ (Schiffrin 1999, 93).
Die Evolution des Verlagswesens der vergangenen Jahrzehnte nachzuvollziehen, um die Logik und die Dynamiken des anglo-amerikanischen literarischen Feldes zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu analysieren, ist das Ziel einer soziologischen Studie von John B. Thompson (vgl. Thompson 2012, 14). Da die Buchmärkte in den USA und Großbritannien aufgrund ihrer Dominanz im internationalen Buchwesen Entwicklungen in anderen Ländern häufig vorwegnehmen oder direkt beeinflussen und nicht zuletzt europäische Medienunternehmen wie Bertelsmann, Holtzbrinck und Hachette Livre/Lagardère auf dem anglo-amerikanischen Buchmarkt eine zentrale Rolle einnehmen, werden hier John B. Thompsons allgemeine Erkenntnisse dargestellt, bevor signifikante Unterschiede und spezifische Aspekte der Konsolidierung in den deutsch- und französischsprachigen Buchmärkten aufgezeigt werden.
Der Soziologe John B. Thompson bezieht sich in seiner Untersuchung auf die Feldtheorie von Pierre Bourdieu und ihre Begrifflichkeiten, um das Verhältnis der Akteurinnen und Akteure zueinander sowie die Dynamiken des Feldes zu charakterisieren, welche er wie folgt definiert:
It is also a set of processes and preoccupations that has a certain self-referential, self-reinforcing character, in the sense that the key players in the field are locked together in a system of reciprocal interdependency such that the actions of each, pursuing what they perceive as their own interests (or those of their clients), tend to elicit a certain pattern of action from other players in the field. (Thompson 2012, 294)
John B. Thompson zufolge haben folgende drei Hauptentwicklungen seit den 1960er Jahren das heutige anglo-amerikanische Buchwesen maßgeblich geprägt und bei den anderen Akteurinnen und Akteuren des Feldes entsprechende Reaktionen hervorgerufen: das Aufkommen von Buchhandelsketten, der Aufstieg der literarischen Agenturen sowie die Entstehung von Verlagskonzernen.
Das Aufkommen von großen Buchhandlungen und Buchhandelsketten in den 1960er Jahren in den USA (vgl. Thompson 2012, 26–36) stand im Zusammenhang mit der Eröffnung von Einkaufszentren in den Vorstädten. Dort sowie auch in den attraktiven sogenannten book superstores in den guten Lagen der Innenstädte wurden Bücher für viele US-Amerikaner leichter zugänglich; die großen Ketten verwandelten den Buchkauf jedoch gleichzeitig „into a consumer experience like any other“ (Thompson 2012, 35). Die Filialen der großen Buchhandelsketten öffneten häufig dort, wo die demographischen Bedingungen für den Handel mit Büchern vorteilhaft und oftmals bereits kleinere, unabhängige Buchhandlungen ansässig waren. Dem Konkurrenzdruck angesichts dem viel größeren Titelangebot und aggressiven Rabattaktionen der Buchhandelsketten konnten die kleineren Buchhandlungen nicht standhalten. Viele von ihnen mussten ihr Geschäft aufgeben (vgl. dazu auch Schiffrin 1999, 77–79). Die Tatsache, dass Bücher zunehmend wie jede andere Ware behandelt wurden und den Prinzipien des Einzelhandels unterlagen, sowie steigende Immobilienpreise und die Konkurrenz um Ladengeschäfte in guter Lage zwangen Buchhandelsketten dazu, sich auf den Absatz schnell verkäuflicher Buchtitel bekannter Autorinnen und Autoren zu konzentrieren. Dies gereichte Büchern mit sich langsamer einstellendem Verkaufserfolg und den Backlist-Titeln der Verlage zum Nachteil. Die in den Buchhandlungen vorrätigen Titel zirkulierten immer schneller.
Zusätzliche Konkurrenz entstand für die Buchhandlungen – für die Ketten ebenso wie für die unabhängigen – durch den Buchverkauf im Internet, insbesondere durch den Online-Buchhändler Amazon, der nach seinem Eintritt in den Markt innerhalb von drei Jahren zum drittgrößten Buchhandelsunternehmen der USA wurde. Mit seinem umfassenden Titelangebot, der Annehmlichkeit der ständigen Zugänglichkeit und des Versands nach Hause sowie seinem aggressiven Rabattverhalten bot Amazon vielen Buchkäuferinnen und Buchkäufern gegenüber physischen Buchhandlungen enorme Vorteile (vgl. Thompson 2012, 42) – und wurde somit auch zu einem der wichtigsten Kunden der Verlage. Für viele Verlage war der Online-Buchhandel zunächst eine willkommene Ergänzung der Verkaufskanäle, nachdem die Buchhandelsketten ihre steigende Marktmacht bei den Verhandlungen um Konditionen mit den Verlagen zu nutzen wussten und viele unabhängige Buchhandlungen als Absatzorte weggefallen waren. Es zeigte sich, dass der Online-Buchhandel besonders für den Verkauf von Backlist-Titeln, Bücher zu Nischenthemen und Werke von noch unbekannten Autorinnen und Autoren von Vorteil war. Zudem orientierte sich auch der stationäre Buchhandel an den im Internet erfolgreich verkauften Titeln. Insbesondere Amazon wurde so zu einer Referenz (vgl. Thompson 2012, 44). Gleichzeitig bereitete dieser Umstand den Verlagen zunehmend Schwierigkeiten, da es Amazon eine starke Verhandlungsposition ermöglicht: Leserinnen und Leser ebenso wie Autorinnen und Autoren prüften die Verfügbarkeit von Büchern auf der Website des Online-Buchhändlers, weshalb es für die Verlage von Nachteil sei, wenn die eigenen Titel nicht bei Amazon gelistet seien (vgl. Thompson 2012, 45–46).
Die Ausbreitung der großen Buchhandelsketten trug auch zum Aufstieg der Literaturagenturen in den USA und Großbritannien bei. Indem in den Buchhandlungen in den Einkaufszentren und den book superstores in den 1960er und 1970er Jahren immer mehr Kundinnen und Kunden der Zugang zu Büchern ermöglicht und vereinfacht wurde, konnte eine viel höhere Menge an Büchern abgesetzt werden. Insbesondere die Bestseller waren in einem solchen Maße kommerziell erfolgreich, dass die Agentinnen und Agenten für ihre Autorinnen und Autoren bei den Verlagen immer bessere Konditionen aushandelten, von denen letztendlich die Literaturagenturen selbst profitierten und so ihr Geschäft ausbauen konnten. Zudem gewann die zusätzliche Verwertung von Rechten an Werken wie etwa für Verfilmungen und Übersetzungen an Bedeutung. Dieses Lizenzgeschäft behielten sich Agentinnen und Agenten in den Verträgen mit den Verlagen oftmals ein, auch um damit ihre Rolle zu stärken (vgl. Thompson 2012, 62). Schriftstellerinnen und Schriftsteller wandten sich immer häufiger an Agenturen, da die Bindungen zu ihren Lektorinnen und Lektoren aufgrund des Wandels durch Aufkäufe und Zusammenschlüsse im Verlagswesen und der Mobilität der Verlagsangestellten zunehmend weniger stabil waren (vgl. Thompson 2012, 73). Auf diese Weise nahmen sowohl die Anzahl der Literaturagenturen auf dem anglo-amerikanischen Buchmarkt als auch deren Bedeutung stark zu.
John B. Thompson plädiert dafür, die Verlage als Zwischenhändler und den Aufstieg der Verlagskonzerne in diesem Kontext zu betrachten:
Large publishing houses may seem to be the major players and to have a great deal of power (and, indeed, they do); but in the book supply chain, the publisher is in many ways just another intermediary, a player in the middle, and the power of the publishing house, however large it is, is always hemmed in by and traded off against the power of two other key players in the field: the power of the retailers, on the one hand, who largely control access to the customers, that is, the readers; and the power of the agents, on the other, who largely control access to the content and the creators of content, that is, the authors. (Thompson 2012, 101)
Die erste Phase der zunehmenden Verbreitung von Verlagskonzernen zwischen etwa Ende der 1950er und den 1980er Jahren war laut John B. Thompson auf der einen Seite gekennzeichnet von der Suche der damaligen Verlegerinnen und Verleger nach einer Nachfolgeregelung und damit Zukunftssicherung für ihre Verlage bei ihrem Eintritt in den Ruhestand, sowie dem Interesse großer Firmen an Investitionen in das Verlagswesen auf der anderen Seite. Dabei handelte es sich vor allem um US-amerikanische Unternehmen, die bereits bedeutende Beteiligungen an Firmen anderer Sektoren wie der Informations-, Unterhaltungs-, Bildungs- oder aufkommenden Computerindustrie hatten, und sich Synergien zwischen verschiedenen Medienformaten sowie der technischen Ausstattung und den im Verlagswesen vorhandenen Inhalten erhofften (vgl. Thompson 2012, 105).
Die in den 1980er Jahren beginnende, weiter andauernde Phase der Zusammenschlüsse und Aufkäufe im Verlagswesen charakterisiert John B. Thompson als Wachstumsphase. Unabhängige Verlage konnten unter anderem aufgrund von gestiegenen Forderungen bezüglich der Vorschusssummen – als Folge des Bedeutungsaufstiegs der Literaturagenturen – im Wettbewerb um Autorinnen und Autoren und ihre Inhalte nicht mehr mithalten und wurden aus dem Markt gedrängt. Der Verkauf des Verlags an einen Konzern wurde zu einem Mittel des Überlebens in der Branche. Auf der anderen Seite stellten einige der Unternehmen angesichts nicht erfüllter Rendite- und Synergieziele die zuvor zugekauften Verlagshäuser wieder zum Verkauf. In Anbetracht eingeschränkter Wachstumsmöglichkeiten auf den heimischen Märkten sowie der Bedeutung der anglo-amerikanischen Verlagsbranche stieg zu diesem Zeitpunkt das Kaufinteresse international agierender Medienkonglomerate auf dem US-amerikanischen Buchmarkt. Auf diese Weise wurden europäische Unternehmen wie beispielsweise Bertelsmann, Holtzbrinck, Lagardère und Pearson zu zentralen Akteuren im globalen Buchwesen (vgl. Thompson 2012, 108–9).
Ohne die Auswirkungen der Konzentrationsprozesse im Buchwesen und die Probleme der großen Marktmacht einzelner Unternehmen abzuschwächen, relativiert John B. Thompson gängige Klischees über die Verlagskonzerne, die vor allem deren Umgang mit Inhalten betreffen:
it does mean that the suggestion that there is a straightforward trade-off between quality and sales, and that the drive for growth and profit in the large corporations will necessarily eliminate all quality publishing from their programmes, is much too simple and doesn’t do justice to the complex reality of life inside the worlds of corporate publishing. (Thompson 2012, 396)
So hätten auch Verlagskonzerne ein Interesse daran, qualitativ hochwertige Bücher und nicht ausschließlich kommerzielle Bestseller zu veröffentlichen. Auch qualitätsvolle literarische Werke und anspruchsvolle Sachbücher ließen sich erfolgreich und vor allem langfristig verkaufen. Ein ausgeglichenes Verlagsprogramm bedeute außerdem ein diversifiziertes Risiko. Nicht zuletzt hätten auch Verlagskonzerne das Ziel, nicht nur ihr ökonomisches, sondern auch ihr symbolisches Kapital etwa durch die Verleihung von Literaturpreisen an ihre Autorinnen und Autoren zu vermehren (vgl. Thompson 2012, 141). Hinsichtlich des Vorwurfs einer Zensur durch die großen Medienkonzerne räumt John B. Thompson ein, dass es vorgekommen sei, dass der Eigentümer eines Medienkonzerns Einfluss auf eine inhaltliche Programmentscheidung genommen habe;3 diese Form der direkten Einflussnahme sei jedoch selten. Weitaus häufiger handele es sich vermutlich um eine Art der Selbstzensur der verantwortlichen Lektorinnen und Lektoren, sich mit der Auswahl der Themen und Werke nicht gegen die Interessen des Konzerns zu stellen (vgl. Thompson 2012, 141–42).
John B. Thompson argumentiert, dass große Verlagsunternehmen, anders als oftmals behauptet wird, zwar kein generelles Desinteresse an der Veröffentlichung noch unbekannter Schriftstellerinnen und Schriftsteller hätten, jedoch diesen keine Möglichkeit böten, sich auf dem Buchmarkt zu etablieren, sofern sich kein kurzfristiger Erfolg einstellte (vgl. Thompson 2012, 143). Der Autor stellt fest, dass sich der Prozess über die Entscheidung der zu veröffentlichenden Bücher von einem eher linearen Modell, ausgehend von der alleinigen Entscheidung einer Verlegerin oder eines Lektors, hin zu einem Modell entwickelt habe, welches stärker auf Beratung und Dialog mit anderen Beteiligten wie der Marketingabteilung oder den Buchhandelsvertreterinnen und -vertretern setze. Dies sei eine auch in kleineren, unabhängigen Verlagen mittlerweile verbreitete Praxis (vgl. Thompson 2012, 143).
Die Folge des Strukturwandels der Buchbranche ist insbesondere eine starke Polarisierung des Sektors, mit einigen Verlagskonzernen im Machtzentrum – John B. Thompson zählt vier bis fünf im anglo-amerikanischen Feld –, wenigen mittelgroßen Verlagsunternehmen und einer Vielzahl kleinerer, unabhängiger Verlage (vgl. Thompson 2012, 292). Insgesamt sind es dennoch gerade die kleineren, unabhängigen Verlage und Buchhandlungen, welche von den negativen Konsequenzen des Strukturwandels besonders betroffen sind. Einige dieser konkreten Auswirkungen auf die Buchproduktion und den Buchhandel werden im Folgenden benannt.
Die Gewinn- und Wachstumsvorgaben der Verlagskonzerne bringen die integrierten Imprints dazu, die Veröffentlichung schnell zu produzierender, potenzieller Bestseller anzustreben, für die üblicherweise hohe Vorschüsse gezahlt werden.4 Daraus könne man keinen allgemeinen Verzicht der Verlagskonzerne auf literarische und inhaltliche Qualität ableiten. Dennoch ließe sich feststellen, dass
it is also undoubtedly the case that a short-termist mentality leads to plenty of bad publishing. You don’t have to be a cultural snob to see that a good number of the books that are put together in great haste […] and published quickly in the hope that they will help to fill a budget gap are not books that add much to the cultural well-being […] of the human race. (Thompson 2012, 380)
Die Konzentration der großen Verlagskonzerne und Buchhandelsketten auf den Verkauf der Werke der als Marken gehandelten Bestsellerautorinnen und -autoren, oftmals aus dem Bereich kommerzieller Belletristik, führten zu einer Standardisierung des Angebots:





























