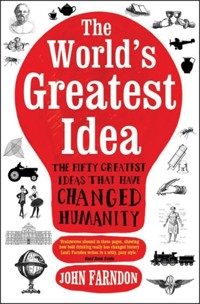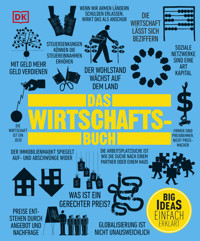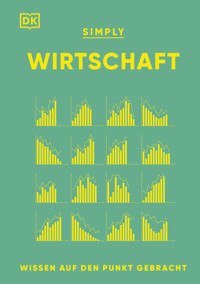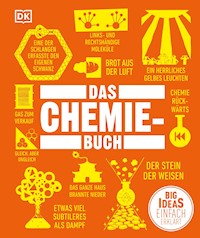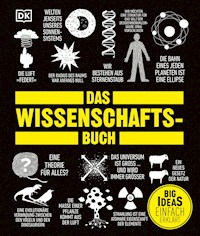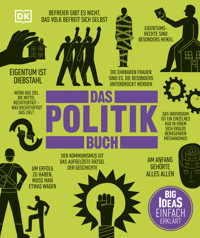
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dorling Kindersley Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Politik einfach erklärt • Über 100 Ideen und Konzepte der wichtigsten politischen Denker*innen der Geschichte einfach und anschaulich erklärt • Chronologische Gliederung in politische Epochen – von der Antike bis heute • Kurzbiografien wichtiger Persönlichkeiten wie Friedrich von Hayek, Hannah Arendt oder Elinor Ostrom • Anschaulich & verständlich mit spannenden Grafiken aufbereitet • Vollständig überarbeitet und aktualisiert Big Ideas: Das große Politik Buch zum Nachschlagen Politik endlich verstehen: Warum prägen Benjamin Franklins Ideen die USA bis heute? Wie trug Emmeline Pankhurst mit ihrem Einsatz entscheidend zum Wahlrecht der Frauen bei? Und wieso kämpfte Simone Weil im Spanischen Bürgerkrieg? Dieses umfangreiche Nachschlagewerk aus der DK Erfolgsreihe Big Ideas präsentiert über 100 Ideen und Taten derwichtigsten politischen Denker – von den ersten Staatstheorien der Antike über die Entwicklung der Grund- und Menschenrechte bis zu aktuellen Herausforderungen wie dem Kampf gegen Armut, Terrorismus und Rassismus. Zusätzlich informieren Kurzbiografien anschaulich und kompakt über die bewegten Lebenswege wichtiger Persönlichkeiten wie z.B. Konfuzius, Friedrich Nietzsche oder Michail Gorbatschow. Politik fundiert und zugänglich – Basiswissen zum Studieren, Informieren oder Nachschlagen. Dieses Buch ist Teil der Reihe "Big Ideas".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wie Sie dieses E-Book benutzen
Bevorzugte Anwendungseinstellungen
Für ein optimales Leseerlebnis werden die folgenden Anwendungseinstellungen empfohlen:
Ausrichtung:
Hochformat
Farbthema:
Weißer Hintergrund
Ansicht scrollen:
[AUS]
Textausrichtung:
Auto-Ausrichtung [AUS]
(wenn der E-Book-Reader über diese Funktion verfügt)
Auto-Hyphenation:
[AUS]
(wenn der E-Book-Reader über diese Funktion verfügt)
Schriftstil:
Standardeinstellung des Verlags [EIN]
(wenn der E-Book-Reader über diese Funktion verfügt)
Ändern Sie in den Einstellungen die
Schriftgröße
auf eine Größe, mit der Sie am besten zurechtkommen.
Doppelklicken Sie auf die Bilder im Buch, um sie im Vollbildmodus zu öffnen und die Details deutlich zu sehen.
INHALT
Wie Sie dieses E-Book benutzenEINLEITUNGPOLITISCHES DENKEN IN ALTEN ZEITEN • 800 V. CHR.–30 N. CHR.
Wenn Ihr das Gute wirklich wollt, so wird Euer Volk gut werden • Konfuzius (Kong Fuzi)Die Kriegskunst ist von entscheidender Bedeutung für den Staat • SunziPläne für das Land sollten nur mit den Gebildeten geteilt werden • Mozi (Mo Di)Wenn nicht die Philosophen zu Königen werden, wird es mit dem Elend der Städte kein Ende haben • PlatonDer Mensch ist von Natur aus ein soziales, politisches Wesen • AristotelesEin einzelnes Rad bewegt sich nicht • ChanakyaWenn schlechte Minister sicher und profitabel leben, ist das der Anfang vom Ende • Han FeiziUnd die Regierung wird zum Spielball • CiceroMITTELALTERLICHE POLITIK • 30–1515
Was sind Reiche ohne Gerechtigkeit – wenn nicht große Räuberbanden? • Augustinus von HippoVorgeschrieben ist euch der Kampf, obwohl er euch zuwider ist • MohammedDas Volk will die Herrschaft der Tugendhaften nicht • Al-FarabiKein freier Mann soll gefangen genommen werden, außer es gibt ein rechtmäßiges Urteil • Barone des Königs JohannEin gerechter Krieg wird um eine gerechte Sache geführt • Thomas von AquinPolitisch leben bedeutet, in Übereinstimmung mit guten Gesetzen zu leben • Aegidius RomanusDie Kirche sollte es Christus gleichtun und ihre weltliche Macht aufgeben • Marsilius von PaduaDie Regierung verhindert Unrecht – es sei denn, sie begeht es selbst • Ibn KhaldunEin kluger Herrscher kann und darf sein Wort nicht halten • Niccolò MachiavelliRATIONALITÄT UND AUFKLÄRUNG • 1515–1770
Am Anfang gehörte alles allen • Francisco de VitoriaSouveränität ist die absolute und dauerhafte Macht über ein Gemeinwesen • Jean BodinDas Naturrecht ist die Grundlage des menschlichen Rechts • Francisco SuárezPolitik ist die Kunst, Menschen zusammenzubringen • Johannes AlthusiusFreiheit ist die Macht, die wir über uns selbst haben • Hugo GrotiusDer Mensch lebt im Kriegszustand • Thomas HobbesDer Zweck des Gesetzes besteht darin, die Freiheit zu erhalten und zu erweitern • John LockeWenn Legislative und Exekutive in der gleichen Institution vereint sind, kann es keine Freiheit geben • MontesquieuUnabhängige Unternehmer sind gute Bürger • Benjamin FranklinREVOLUTIONÄRE GEDANKEN • 1770–1848
Auf seine Freiheit verzichten heißt auf sein Menschsein verzichten • Jean-Jacques RousseauKein allgemein gültiger Grundsatz der Gesetzgebung kann auf der Glückseligkeit beruhen • Immanuel KantDie Leidenschaften von Einzelpersonen sollten unterdrückt werden • Edmund BurkeEigentumsrechte sind besonders heikel • Thomas PaineAlle Menschen sind gleich erschaffen • Thomas JeffersonJede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich • Johann Gottfried HerderDie Regierung hat die Wahl zwischen mehreren Übeln • Jeremy BenthamDie Menschen haben ein Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen • James MadisonDie ehrbaren Frauen sind es, die besonders unterdrückt werden • Mary WollstonecraftDer Sklave hält die Eigenexistenz für etwas Äußerliches • G.W.F. HegelEin Staat, der sich zu weit ausdehnt, geht unter • Simón BolívarDer Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln • Carl von ClausewitzAngriffe gegen »die Familie« sind Symptome des sozialen Chaos • Auguste ComteDER AUFSTIEG DER MASSEN • 1848–1910
Sozialismus ist ein neues System der Leibeigenschaft • Alexis de TocquevilleSag nicht »ich«, sondern »wir« • Giuseppe MazziniDass so wenige wagen exzentrisch zu sein, ist die größte Gefahr unserer Zeit • John Stuart MillKein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu regieren • Abraham LincolnEigentum ist Diebstahl • Pierre-Joseph ProudhonEin privilegierter Mensch ist ein Mensch mit verdorbenem Geist und Herz • Michail BakuninDie beste Regierung ist die, die nicht regiert • Henri David ThoreauWo Gerechtigkeit verweigert wird ... sind weder Personen noch Eigentum sicher • Frederick DouglassDer Kommunismus ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte • Karl MarxDer Mann, der die Republik ausrief, wurde zum Mörder der Freiheit • Alexander HerzenWir müssen nach einer zentralen Achse für unser Land suchen • Ito HirobumiDer Wille zur Macht • Friedrich NietzscheDer Mythos ist das einzig Wichtige • Georges SorelWir müssen die Arbeiter so nehmen, wie sie sind • Eduard BernsteinDie Verachtung unseres gewaltigen Nachbarn stellt die größte Gefahr für Lateinamerika dar • José MartíEntweder werden Frauen getötet oder sie erhalten das Wahlrecht • Emmeline PankhurstDie Existenz einer jüdischen Nation zu bestreiten, ist lächerlich • Theodor HerzlUm Erfolg zu haben, muss man etwas wagen • Pjotr KropotkinDie Sozialgesetze in Amerika sind schändlich unzureichend • Jane AddamsNichts wird eine Nation retten, deren Arbeiter verelendet sind • Beatrice WebbLand den Bauern! • Sun Yat-senDas Individuum ist ein einzelnes Rad in einem sich endlos bewegenden Mechanismus • Max WeberDER KAMPF DER IDEOLOGIEN • 1910–1945
Gewaltlosigkeit ist der erste Artikel meines Glaubens • Mahatma GandhiPolitik beginnt dort, wo die Massen sind • Wladimir Iljitsch LeninDer Generalstreik resultiert aus den sozialen Bedingungen und ist historisch unvermeidlich • Rosa LuxemburgEin Beschwichtiger ist jemand, der ein Krokodil füttert und hofft, erst am Ende selbst gefressen zu werden • Winston ChurchillDas faschistische Konzept des Staates ist allumfassend • Giovanni GentileDen reichen Bauern muss die Existenzgrundlage entzogen werden • Josef StalinWenn das Ziel die Mittel rechtfertigt – was rechtfertigt das Ziel? • Leo TrotzkiWir werden die Mexikaner durch Bürgschaften für den Bauern und den Geschäftsmann vereinen • Emiliano ZapataKrieg ist ein unlauteres Geschäft • Smedley D. ButlerSouveränität wird nicht verliehen – sie wird errungen • Mustafa Kemal AtatürkEuropa besitzt keinen Moralkodex • José Ortega y GassetWir sind 400 Millionen Menschen, die nach Freiheit rufen • Marcus GarveySolange Indien sich nicht vom britischen Reich trennt, kann es nicht frei sein • Manabendra Nath RoySouverän ist, wer über die Ausnahme entscheidet • Carl SchmittKommunismus ist so schlecht wie Imperialismus • Jomo KenyattaDer Staat muss als Erzieher betrachtet werden • Antonio GramsciDie politische Macht kommt aus den Gewehrläufen • Mao ZedongPOLITIK NACH DEN WELTKRIEGEN • 1945 BIS HEUTE
Das Hauptübel ist ein grenzenloser Staat • Friedrich von HayekParlamentarismus und Rationalismus gehören nicht demselben System an • Michael OakeshottZiel des islamischen Dschihad ist es, die Herrschaft eines unislamischen Systems zu eliminieren • Abul Ala MaududiEs gibt nichts, das einem Menschen die Freiheit raubt – außer andere Menschen • Ayn RandJede bekannte und erwiesene Tatsache kann geleugnet werden • Hannah Arendt[Des Menschen] Krieg gegen die Natur [ist] zwangsläufig ein Krieg gegen sich selbst • Rachel CarsonWas ist eine Frau? • Simone de BeauvoirWer am Boden liegt, spürt, was geschieht • Simone WeilKein natürliches Objekt ist nur eine Ressource • Arne NæssWir sind nicht gegen die Weißen, wir sind gegen die Vorherrschaft der Weißen • Nelson MandelaGerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen • John RawlsKolonialismus ist Gewalt im Naturzustand • Frantz FanonWahl oder Waffe • Malcolm XMan muss dem König den Kopf abschlagen • Michel FoucaultBefreier gibt es nicht. Das Volk befreit sich selbst • Che GuevaraAlle müssen dafür sorgen, dass die Reichen glücklich sind • Noam ChomskyNichts auf dieser Welt ist gefährlicher als aufrichtige Ignoranz • Martin Luther King Jr.Perestroika vereint Sozialismus mit Demokratie • Michail GorbatschowDie Intellektuellen bekämpften fälschlicherweise den Islam • Ali SchariatiDie Menschen vor Ort ... haben den stärksten Anreiz, die richtige Lösung zu finden • Elinor OstromDie Abscheulichkeit des Krieges bringt uns dazu, jede Zurückhaltung aufzugeben • Michael WalzerKein Staat außer dem Minimalstaat kann gerechtfertigt werden • Robert NozickKeine Frau ist frei, solange nicht alle Frauen gleich sind • Catharine McKinnonKein Gesetz im Islam ruft zur Missachtung der Rechte der Frauen auf • Shirin EbadiANHANG
WEITERE PERSONENGLOSSARBEITRAGENDEDANKImpressumAlternativtextEINLEITUNG
Wenn jeder stets haben könnte, was er (oder sie) will, gäbe es keine Politik. Was auch immer »Politik« genau bedeuten mag – und darunter kann man vieles verstehen, wie dieses Buch zeigt –, es ist klar, dass wir nie all das bekommen, was wir wollen. Stattdessen müssen wir miteinander wetteifern, Kompromisse eingehen und manchmal um Dinge kämpfen. Dabei entwickeln wir besondere Sprachen, um unsere Ansprüche zu verdeutlichen und zu rechtfertigen, um andere herauszufordern und ihnen zu widersprechen. Das kann eine Sprache der Interessen sein, ob von Einzelnen oder Gruppen, eine Sprache der Werte, in der es um Rechte und Freiheiten oder gerechte Anteile und Gerechtigkeit geht. Zentral für die Politik war auf jeden Fall von Anfang an die Entwicklung politischer Ideen, die uns helfen, Ansprüche zu äußern und Interessen zu verteidigen.
Politik lässt sich aber nicht darauf reduzieren, wer was wo wann und wie bekommt. Vielmehr ist sie teilweise Reaktion auf die Herausforderungen des täglichen Lebens und Ausdruck der Erkenntnis, dass kollektives Handeln häufig besser ist als individuelles Handeln. Eine andere Tradition des politischen Denkens geht auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurück, der sagte, in der Politik gehe es nicht nur darum, materielle Bedürfnisse zu befriedigen. Denn mit dem Entstehen komplexer Gesellschaften stellten sich verschiedenste Fragen: Wer soll regieren? Welche Macht sollen politische Herrscher haben und wie stehen diese zu anderen Autoritäten, beispielsweise der Familie oder der Kirche?
Aristoteles sagt, der Mensch sei von Natur aus ein politisches Wesen, und meint damit nicht nur, dass es dem Menschen in einer komplexen Gesellschaft besser geht als in der Einsamkeit. Gemeint ist auch, dass es etwas ureigen Menschliches ist, eine Meinung zu öffentlichen Angelegenheiten zu haben. Politik ist etwas Nobles: Die Menschen legen die Regeln fest, nach denen sie leben, und zudem die Ziele, die sie gemeinsam verfolgen wollen.
»Man muss also die politischen Gemeinschaften auf die edlen Handlungen hin einrichten und nicht bloß zum Beisammenleben.«
Aristoteles
Politischer Moralismus
Aristoteles glaubte nicht, dass alle Menschen an der Politik beteiligt sein sollten: In seinem System stand Frauen, Ausländern und Versklavten nicht das Recht zu, über sich und andere zu herrschen. Doch seine Idee, dass die Politik eine unverwechselbare kollektive Aktivität ist, mit der bestimmte gemeinschaftliche Zwecke verfolgt werden, findet heute noch Widerhall. Worum geht es dabei? Viele Denker haben seit der Antike unterschiedliche Ideen entwickelt, welche Ziele die Politik verfolgen sollte. Einen derartigen Ansatz nennt man politischen Moralismus.
Für die Moralisten ist das politische Leben ein Zweig der Ethik oder Moralphilosophie. Sie sind der Auffassung, die Politik solle auf wesentliche Ziele ausgerichtet sein. Politische Vereinbarungen würden getroffen, um bestimmte Dinge zu schützen – beispielsweise Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Glück, Brüderlichkeit oder nationale Selbstbestimmung. Der radikale Moralismus liefert darüber hinaus Beschreibungen idealer politischer Gesellschaften, sogenannter Utopien, benannt nach dem Buch Utopia des englischen Staatsmannes und Philosophen Thomas Morus, das 1516 veröffentlicht wurde. Darin schildert er die ideale Nation. Die Tradition des utopischen politischen Denkens reicht zurück bis zum antiken griechischen Philosophen Platon mit seiner Politeia, und in ihr stehen moderne Denker wie Robert Nozick (Anarchie, Staat, Utopia). Manche Theoretiker finden das utopische politische Denken gefährlich, weil es in der Vergangenheit dazu gedient hat, totalitäre Gewalt zu rechtfertigen. Doch im besten Fall ist das utopische Denken Teil des Strebens nach einer besseren Gesellschaft und viele von den Denkern, die in diesem Buch erwähnt werden, rufen damit zur Einhaltung oder zum Schutz bestimmter Werte auf.
Politischer Realismus
Eine andere Tradition des politischen Denkens lehnt die Vorstellung ab, dass die Politik für moralische oder ethische Werte wie Glück oder Freiheit zuständig ist. Stattdessen, so wird argumentiert, gehe es in der Politik um Macht. Macht ist das Mittel, mit dem Ziele erreicht, Feinde geschlagen und Kompromisse aufrechterhalten werden. Ohne die Fähigkeit, Macht zu erwerben, sind Werte – wie nobel sie auch sein mögen – nutzlos.
Die Denker, die sich im Gegensatz zur Moral auf die Macht konzentrieren, werden Realisten genannt. Sie richten ihr Augenmerk auf die Machtausübung, auf Auseinandersetzungen und Kriege und sind häufig zynisch, was die menschliche Motivation angeht. Die beiden größten Theoretiker der Macht sind vielleicht der Italiener Niccolò Machiavelli und der Engländer Thomas Hobbes. Sie beide erlebten eine Zeit mit Bürgerkrieg und politischen Unruhen im 16. bzw. 17. Jahrhundert.
Machiavelli etwa findet, dass Menschen »undankbare Lügner« sind, weder edel noch tugendhaft. Er hält politische Motive, die über die Beschäftigung mit der Macht hinausreichen, gar für gefährlich. Für Hobbes ist der gesetzlose »Naturzustand« ein Krieg aller gegen alle. Per »Sozialvertrag« mit seinen Untertanen übt der Herrschende absolute Macht aus, um die Gesellschaft vor diesem anarchischen Zustand zu bewahren. Aber die Beschäftigung mit der Macht fand nicht nur im frühen modernen Europa statt. Auch weite Teile des politischen Denkens im 20. Jahrhundert beschäftigten sich mit dem Thema Macht.
»… politische Fragen [sind] viel zu ernst …, als dass sie den Politikern überlassen werden sollten.«
Hannah Arendt
Kluge Berater
Realismus und Moralismus sind große politische Entwürfe, die dazu beitragen sollen, der Gesamtheit der politischen Erfahrungen im menschlichen Leben einen Sinn zu geben. Doch nicht alle politischen Denker bewegen sich in diesen Zusammenhängen. Neben den politischen Philosophen gibt es eine ebenso alte Tradition, die pragmatisch orientiert ist und in der immer versucht wird, das beste Ergebnis zu erzielen. Gut möglich, dass es stets Kriege geben wird und Diskussionen über die Beziehung zwischen politischen Werten wie Freiheit und Gleichheit. Aber vielleicht können wir Fortschritte beim Entwerfen von Verfassungen, bei der Umsetzung politischer Maßnahmen oder der Auswahl möglichst fähiger Beamter machen. Einige frühe politische Denker wie der chinesische Philosoph Konfuzius (Kong Fuzi) haben sich beispielsweise mit den Fähigkeiten und Tugenden beschäftigt, die kluge Berater ausmachen.
Das Aufkommen der Ideologie
Eine andere Art politischen Denkens wird häufig als ideologisch bezeichnet. Diese Richtung betont, dass gewisse Ideen typisch sind für bestimmte historische Epochen. Die Ursprünge des ideologischen Denkens finden sich bei den deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx. Sie erläutern, inwiefern die Ideen verschiedener politischer Epochen voneinander abweichen, einfach weil die Institutionen und Gewohnheiten der Gesellschaften verschieden waren und die Gedanken hinter den Ideen sich veränderten.
Platon und Aristoteles sahen in der Demokratie beispielsweise ein gefährliches und korruptes System, während die meisten Menschen in der modernen Welt sie als bestmögliche Staatsform betrachten. Ebenso galt die Sklaverei einst als natürlich, obwohl sie unzählige Menschen ihrer Rechte beraubte, und bis ins 20. Jahrhundert hinein galten die meisten Frauen nicht als Staatsbürger.
Dies wirft die Frage auf: Warum gewinnen manche Ideen an Bedeutung (beispielsweise die Gleichberechtigung), während andere an Bedeutung verlieren (etwa die Sklaverei oder das Gottesgnadentum der Könige)? Marx erklärt die historischen Veränderungen damit, dass Klasseninteressen die großen »Ismen« der Ideologien entstehen ließen, vom Kommunismus und Sozialismus (der Arbeiterschaft) bis zum Konservatismus und Faschismus (der Kapitalisten). Doch viele politische Ideen des späten 20. Jahrhunderts sind im Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus oder Nationalismus entstanden.
Das ideologische politische Denken wurde durchaus kritisch betrachtet. Wenn Ideen lediglich der Reflex eines historischen Prozesses sind, so die Kritiker, haben die Individuen, die diesen Prozess durchlaufen, eine im Wesentlichen passive Rolle. Rationales Abwägen und Argumentieren sind dann von sehr begrenztem Wert und die ideologische Auseinandersetzung ähnelt dem Wettbewerb zwischen Fußballmannschaften. Leidenschaft, nicht Vernunft, spielt bei der Unterstützung der eigenen Mannschaft eine wichtige Rolle und letztendlich geht es ums Gewinnen. Daraus ergibt sich die Sorge, dass ideologische Politik zu den schlimmsten Exzessen des Realismus führen kann, bei denen der Zweck brutale oder ungerechte Mittel heiligt. Ideologische Politik könnte unter diesen Voraussetzungen zu einem Grabenkrieg zwischen rivalisierenden und unvereinbaren Einstellungen führen.
Marx sah als Lösung für politische Konflikte den revolutionären Triumph der Arbeiterklasse und die technologische Überwindung von Mängeln. Dieser Ansatz war aus Sicht des 20. Jahrhunderts allzu optimistisch: Veränderungen durch Revolutionen haben häufig dazu geführt, dass eine Tyrannei durch eine andere ersetzt wurde. Aus diesem Blickwinkel sind der Marxismus und andere Ideologien lediglich die jüngsten Formen eines unrealistischen utopischen Moralismus.
»Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.«
Karl Marx
Die umstrittene Zukunft
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind neue Nationalstaaten entstanden, als Ergebnis des schwindenden Imperialismus und der Entkolonisierung. Bundesstaaten wie Jugoslawien und die Tschechoslowakei sind zerbrochen, genau wie die ehemalige UdSSR. Der Wunsch nach nationaler Unabhängigkeit bleibt stark, schaut man nach Québec, Katalonien, Kurdistan oder Kaschmir. Völker ringen darum, während manche Staaten komplizierte Bündnisse und Föderationen eingegangen sind. In den letzten drei Jahrzehnten ist so die Europäische Union entstanden, deren politische Integration nach innen wie außen weiter vorangetrieben wird.
Etablierte Vorstellungen von staatlicher Souveränität spielen eine ungelenke Rolle in der neuen politischen Welt der Zusammenarbeit und Globalisierung. Das hat zur Entstehung neuer Probleme geführt, die nicht mehr nur einzelne Staaten betreffen. Etwa wenn es um Fragen wie den Klimawandel, den weltweiten Terrorismus und die Auswirkungen der technologischen Entwicklung geht. Gleichzeitig gerät die Demokratie als Staatsform unter Druck durch die weltweite Verbreitung von Desinformation und den Aufstieg autoritärer Politiker.
Wie gut ist die Politik heute aufgestellt, um diesen Problemen zu begegnen? Es fällt leicht, unsere Zeit für besonders progressiv, aufgeklärt und rational zu halten, schließlich glauben wir an Demokratie, Menschenrechte, offene Wirtschaftsformen und konstitutionelle Regierungen. Aber diese Ideen sind nicht einfach, und sie werden nicht überall auf der Welt geteilt.
Die jüngere Geschichte politischer Ideen beschäftigt sich folglich damit, wie traditionelle Vorstellungen zu diesen Themen im heutigen Kontext dastehen. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit auf zeitgenössische politische Denker, darunter die Stimmen von Frauen und nichtwestlichen Autoren. Indem wir uns mit Ansichten auseinandersetzen, die das traditionelle politische Denken hinterfragen, erweitern wir die Grenzen des »Politischen« um die Vielfalt möglicher Perspektiven und neuer Beteiligter.
Um Gegenwart und Zukunft zu begreifen, müssen wir die politischen Ideen und Theorien aus der Geschichte verstehen. Denn aus ihnen hat sich der aktuelle Zustand entwickelt. Gleichzeitig sollte uns die Vergangenheit eine Warnung sein, allzu sehr auf unsere politischen Werte zu vertrauen. Das komplexe Leben in einer Gemeinschaft kann sich in einer Weise verändern, die nicht vorhersagbar ist. Mit neuen Möglichkeiten der Machtausübung entwickeln sich neue Vorstellungen von Kontrolle und Verantwortung, neue politische Ideen und Theorien. Politik betrifft uns alle. Wir alle sollten uns an der Diskussion beteiligen.
»… politisches Engagement [lässt] sich unter keinen Umständen umgehen … Indem man sich fernhält, nimmt man Stellung.«
Simone de Beauvoir
EINFÜHRUNG
Die Anfänge des politischen Denkens lassen sich ins alte China und in die griechische Antike zurückverfolgen. In beiden Kulturen gab es Denker, die die Welt infrage stellten und sie auf eine Art analysierten, die wir heute Philosophie nennen. Ab rund 600 v. Chr. rückte die Frage in den Mittelpunkt, wie eine Gesellschaft zu organisieren ist. Zunächst wird sie als Teil der Moralphilosophie oder Ethik betrachtet. Die Philosophen untersuchten, wie eine Gesellschaft strukturiert sein sollte, um nicht nur das Glück und die Sicherheit der Menschen zu garantieren, sondern ihnen ein »gutes Leben« zu ermöglichen.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Politisches Denken in China
Ab rund 770 v. Chr. erlebte China eine Phase des Wohlergehens, die als »Zeit der Frühlings- und Herbstannalen« in die Geschichte einging. Verschiedene Dynastien regierten friedlich über getrennte Staaten. Gelehrsamkeit stand hoch im Kurs; die »Hundert Schulen« der klassischen chinesischen Philosophie entstanden. Der einflussreichste Vertreter war Konfuzius (Kong Fuzi). Er plädierte für die Aufrechterhaltung traditioneller chinesischer Werte in einem Staat, der von einem tugendhaften Herrscher, unterstützt von Beratern, geführt werden sollte.
Diese Idee haben Mozi (Mo Di) und Menzius (Mengzi) weiterentwickelt, um Korruption und despotischer Herrschaft vorzubeugen. Doch als die zwischenstaatlichen Konflikte zunahmen und im 3. Jahrhundert v. Chr. die Zeit der Streitenden Reiche anbrach, kämpften die Beteiligten um die Vorherrschaft in einem vereinten China. In dieser Atmosphäre plädierten Denker wie Han Feizi und die legalistische Schule für Disziplin als leitendes Staatsprinzip; der Militärführer Sunzi übertrug Kriegsstrategien auf die Außen- und Innenpolitik. Dieses autoritäre politische Denken brachte dem neuen Reich Stabilität, das später zu einer Form des Konfuzianismus zurückkehrte.
Griechische Demokratie
Etwa gleichzeitig erblühte die griechische Kultur. Wie China war Griechenland keine geeinte Nation, sondern eine Ansammlung von Stadtstaaten mit unterschiedlichen Regierungsformen – meist Monarchie oder Aristokratie. In Athen bestand jedoch eine Art Demokratie nach einer Verfassung des Staatsmannes Solon von 594 v. Chr. Die Stadt wurde zum kulturellen Zentrum Griechenlands, hier entstand intellektueller Freiraum, in dem Philosophen über den idealen Staat spekulieren konnten. Platon zum Beispiel plädierte für die Herrschaft einer Elite von »Philosophenkönigen«, während sein Schüler Aristoteles die verschiedenen möglichen Regierungsformen miteinander verglich. Gemeinsam legten diese Denker den Grundstein für die westliche politische Philosophie.
Mit Aristoteles endete dann das »goldene Zeitalter« der klassischen griechischen Philosophie: Alexander der Große unternahm eine Reihe von Feldzügen, um sein Reich von Mazedonien nach Nordafrika und quer durch Asien bis zum Himalaja auszudehnen. Doch in Indien stieß er auf Widerstand.
Der indische Subkontinent bestand aus verschiedenen unabhängigen Staaten, doch der innovative politische Theoretiker Chanakya trug dazu bei, dass ein einheitliches Reich unter der Herrschaft seines Protegés Chandragupta Maurya entstand. Chanakya war pragmatisch in seinem politischen Denken: Er trat für strenge Disziplin ein mit dem Ziel, die Existenz des Staates wirtschaftlich und materiell zu sichern, es ging weniger um Moral und Wohlergehen des Volkes. Sein Realismus half, das Maurya-Reich vor Angriffen zu schützen: Der Großteil Indiens wurde von einer Stelle aus regiert, dies hatte mehr als 100 Jahre Bestand.
Der Aufstieg Roms
In der Zwischenzeit begann in Europa der Aufstieg einer anderen Macht. Nach dem Sturz einer tyrannischen Monarchie wurde 510 v. Chr. die Römische Republik gegründet. Ähnlich wie in Athen handelte es sich um eine repräsentative Demokratie. Die Regierung unter der Führung von zwei Konsuln wurde jährlich von den Bürgern gewählt; ihr stand ein Gremium von Senatoren beratend zur Seite. Die Römische Republik wurde immer mächtiger und übernahm Provinzen fast überall auf dem europäischen Festland. Im 1. Jahrhundert v. Chr. kam es zum Bürgerkrieg, mehrere Parteien stritten um die Macht. 48 v. Chr. setzte sich Julius Cäsar durch und wurde zum Kaiser. Rom befand sich damit erneut unter monarchischer Herrschaft. In den folgenden 500 Jahren beherrschte das neue Römische Reich den Großteil Europas.
IM KONTEXT .
Konfuzianismus
Paternalistisch
1054 v. Chr. Während der chinesischen Zhou-Dynastie werden politische Entscheidungen durch das Mandat des Himmels gerechtfertigt.
8. Jh. v. Chr. Die Zeit der Frühlings- und Herbstannalen beginnt; die »Hundert Schulen des Denkens« entstehen.
5. Jh. v. Chr. Mozi (Mo Di) schlägt eine Alternative zur möglichen Vetternwirtschaft des Konfuzianismus vor.
4. Jh. v. Chr. Der Philosoph Menzius (Mengzi) verbreitet die Ideen des Konfuzius.
3. Jh. v. Chr. Die autoritären Prinzipien des Legalismus prägen die Regierung.
Kong Fu Zi (»Meister Kong«), der später im Westen als Konfuzius bekannt wurde, lebte an einem Wendepunkt in der politischen Geschichte Chinas, zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen: 300 Jahre lang hatten Wohlstand und Stabilität geherrscht, Kunst, Literatur und Philosophie geblüht. Damals entstanden die »Hundert Schulen des Denkens«, in denen zahlreiche Ideen frei diskutiert wurden. Eine neue Klasse von Gelehrten bildete sich heraus, die überwiegend als Berater an den Höfen adliger Familien lebten.
Die neuen Ideen dieser Gelehrten erschütterten die chinesische Gesellschaft. Neu war auch, dass diese aufgrund ihrer Verdienste ernannt wurden, nicht wegen ihrer familiären Verbindungen. Damit wurden sie zu einer Herausforderung für die angestammten Herrscher, die zuvor nach einem »Mandat des Himmels« regiert hatten. Es kam zu Konflikten: Verschiedene Herrscher wetteiferten um die Macht in China. In dieser Zeit der »streitenden Reiche« wurde immer deutlicher, dass eine starke Regierung vonnöten war.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Konfuzius
Obwohl er in der chinesischen Geschichte eine große Rolle spielt, ist über das Leben des Konfuzius wenig bekannt. Es heißt, er sei 551 v. Chr. in Qufu im Staat Lu (China) geboren worden. Ursprünglich hieß er Kong Qiu (den Ehrentitel Kong Fu Zi erhielt er erst später). Seine Familie war angesehen und wohlhabend. Trotzdem arbeitete er in jungen Jahren als Diener, um die Familie zu ernähren, nachdem sein Vater gestorben war. In seiner Freizeit studierte er und wurde schließlich Verwaltungsbeamter am Hof von Zhou, wo er seine Ideen zur Staatsführung entwickelte. Sein Rat wurde aber ignoriert und er gab seine Position auf.
Den Rest seines Lebens verbrachte Konfuzius mit Reisen durch das chinesische Reich. Dabei lehrte er Philosophie und Staatstheorie. Schließlich kehrte er nach Qufu zurück, wo er 497 v. Chr. starb.
Hauptwerke
Analekten
Mitte und Maß
Das große Lernen
(Diese drei Werke wurden im 12. Jh. von chinesischen Gelehrten zusammengestellt.)
Konfuzius glaubte, weise und gerechte Herrscher hätten einen wohltuenden Effekt auf ihre Untertanen.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Der Ehrenmann
Wie die meisten gebildeten jungen Männer der Mittelklasse verfolgte Konfuzius eine Karriere als Verwaltungsbeamter. Dabei entwickelte er bestimmte Vorstellungen, wie ein Land regiert werden sollte. Die Beziehungen zwischen dem Herrscher und seinen Ministern sowie dem Herrscher und seinen Untertanen kannte er aus erster Hand. Er wusste genau, wie heikel die politische Situation war. Daher machte er sich daran, ein Rahmenwerk zu formulieren, das die Herrscher in die Lage versetzen würde, auf der Grundlage eines eigenen Systems der Moralphilosophie gerecht zu regieren.
Konfuzius’ Standpunkt war fest in der chinesischen Tradition verankert; im Kern ging es ihm um Loyalität, Pflicht und Respekt. Diese Werte verkörperte der junzi oder Ehrenmann: Sein Verhalten sollte als Beispiel dienen. Konfuzius hielt die menschliche Natur nicht für perfekt, aber er glaubte, sie könne durch das Vorbild aufrichtiger Tugend verändert werden – und die Gesellschaft als Ganzes durch das Vorbild einer gerechten, wohlwollenden Regierung.
Die Vorstellung der Gegenseitigkeit – dass ein gerechter und großzügiger Umgang eine ebensolche Reaktion hervorruft – ist ein Grundpfeiler der konfuzianischen Moralphilosophie. Damit eine Gesellschaft gut ist, müssen die Herrschenden jene Tugenden verkörpern, die sie bei ihren Untertanen sehen möchten. Die Menschen ihrerseits werden durch Loyalität und Respekt inspiriert, diese Tugenden zu leben.
In der Sammlung seiner Lehren und Sprüche, bekannt als Analekten, rät Konfuzius: »Wenn Eure Hoheit das Gute wünscht, so wird das Volk gut. Das Wesen des Herrschers ist der Wind, das Wesen der Geringen ist das Gras. Das Gras, wenn der Wind darüber hinfährt, muss sich beugen.« Um diese Idee umzusetzen, musste jedoch eine neue Gesellschaftsstruktur etabliert werden: In ihr sollte die neue meritokratische Klasse der Verwaltungsbeamten ihren festen Platz bekommen, während die traditionelle Herrschaft der adligen Familien weiterhin respektiert werden würde. Bei seinem Vorschlag, wie dies zu erreichen sei, verließ sich Konfuzius erneut auf traditionelle Werte. Er wollte die Gesellschaft umgestalten und sich dabei an den Beziehungen innerhalb der Familie orientieren. Für Konfuzius waren die Güte der Herrschenden und die Loyalität ihrer Untertanen wie ein Abbild der liebenden Eltern und ihres gehorsamen Sohnes.
Konfuzius glaubte, dass es fünf solche »elementaren Beziehungen« gibt: Herrscher – Untertan, Vater – Sohn, Ehemann – Ehefrau, älterer Bruder – jüngerer Bruder und Freund – Freund. Innerhalb dieser Beziehungen geht es nicht nur um den Rang der jeweiligen Personen in Bezug auf Generation, Alter und Geschlecht, sondern auch darum, dass es auf beiden Seiten Pflichten gibt. Die Verantwortung des Überlegenen gegenüber dem Unterlegenen ist genauso wichtig wie die des Jüngeren gegenüber dem Älteren. Die familiären Beziehungen übertrug Konfuzius auf die Gesellschaft als Ganzes, die dadurch ihren Zusammenhalt erhält: Die wechselseitigen Rechte und Pflichten sorgen für eine Atmosphäre der Loyalität und des Respekts unter den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Die ererbte Herrschaft rechtfertigen
An der Spitze der konfuzianischen Hierarchie stand der Herrscher, der diesen Status ohne jeden Zweifel ererbt hatte. In dieser Hinsicht war das konfuzianische Denken konservativ. Die Familie galt als Modell für die Beziehungen innerhalb der Gesellschaft, der traditionelle Respekt gegenüber den Eltern wurde entsprechend dem Thronerben entgegengebracht. Die Position des Herrschers war allerdings nicht unanfechtbar, ein ungerechter oder unkluger Herrscher verdiente es, dass man ihm Widerstand entgegensetzte oder ihn sogar absetzte.
In Bezug auf die nächste Gesellschaftsschicht war Konfuzius besonders innovativ. Er wollte eine Klasse von Gelehrten etablieren, die als Minister, Berater oder Verwalter fungieren sollten. Aufgrund ihrer Mittlerposition zwischen Herrscher und Untertanen hatten sie die Pflicht, beiden Seiten gegenüber loyal zu sein; damit trugen sie viel Verantwortung. Für diese Aufgabe kamen also nur sehr fähige Kandidaten infrage. Wer ein öffentliches Amt bekleidete, musste höchsten moralischen Ansprüchen genügen; er musste ein junzi sein. Im konfuzianischen System wurden die Minister vom Herrscher ernannt. Daher hing viel davon ab, wie es um den Charakter des Staatsoberhaupts selbst bestellt war. Konfuzius sagte: »Die Kunst des Regierens besteht darin, die richtigen Menschen zu bekommen. Man erhält sie über den Charakter des Herrschers. Dieser Charakter muss kultiviert werden, indem er dem Weg der Pflicht folgt. Dass er dem Weg der Pflicht folgt, erreicht man, indem er die Güte zu schätzen lernt.«
Die Rolle der Beamten war vorrangig beratend. Minister mussten sich nicht nur in Bezug auf die Verwaltung und die Struktur der chinesischen Gesellschaft gut auskennen, sondern auch über Geschichte, Politik und Diplomatie Bescheid wissen. Das war nötig, um den Herrschern bei Allianzen und Kriegen mit Nachbarstaaten zur Seite stehen zu können. Zudem hatte die neue Gesellschaftsklasse die Aufgabe, die Herrscher am Despotentum zu hindern. Zwar waren die Beamten ihrem Vorgesetzten gegenüber loyal, doch gleichzeitig verhielten sie sich wohlwollend gegenüber den Untertanen. Sie mussten wie die Herrscher durch ihr Beispiel führen und sowohl das Staatsoberhaupt als auch die Untertanen durch ihre Tugend beflügeln.
»Die rechte Regierung besteht darin, dass die Herrscher Herrscher, die Minister Minister, die Väter Väter und die Söhne Söhne sind.«
Konfuzius
Die Bedeutung des Rituals
Viele Teile der Schriften des Konfuzius lesen sich wie ein Handbuch der Etikette oder des Protokolls. Sie gehen auf das angemessene Verhalten eines junzi in den verschiedensten Situationen ein. Betont wird, dass es sich bei den beschriebenen Ritualen nicht um Leerformeln handelt, vielmehr haben sie einen tieferen Sinn. So war es wichtig, dass die daran Beteiligten sich aufrichtig verhielten, um die Bedeutung der Rituale zu verdeutlichen. Staatsbeamte etwa mussten ihre Pflichten tugendhaft erfüllen und sollten dabei auch gesehen werden. Konfuzius legte großen Wert auf Zeremonien. Sie signalisierten, welche Positionen eine Person innerhalb einer Gesellschaft einnahm.
Zeremonien und Rituale erlaubten es den Staatsbeamten, Ergebenheit (nach oben) und Rücksichtnahme (nach unten) zum Ausdruck zu bringen. Doch Konfuzius zufolge sollte es in allen Gesellschaftsgruppen Rituale geben: vom formalen Zeremoniell bei Hofe bis zur täglichen sozialen Interaktion, bei der die Beteiligten sorgfältig ihre Rollen einhielten. Nur so konnte die Idee der Führung durch Vorbild Erfolg haben. Für Konfuzius zählten dabei Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu den wichtigsten Tugenden, Treue war ebenfalls von Bedeutung.
Viele der Rituale und Zeremonien entstammten religiösen Riten, aber dieser Aspekt stand nicht im Vordergrund. Die Ethik des Konfuzius beruhte nicht auf religiösen Überzeugungen. Er ging einfach davon aus, dass die Religion einen festen Platz in der Gesellschaft hat. Tatsächlich bezog er sich in seinen Schriften selten auf die Götter. Allenfalls äußerte er die Hoffnung, dass die Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Mandat des Himmels organisiert und regiert werden könne – was dazu beitragen würde, die Staaten, die um die Macht kämpften, zu vereinen. Obwohl Konfuzius an die Vererbung der Herrschaft glaubte, sah er keine Notwendigkeit, sie als göttliches Recht hinzunehmen.
Dieser Gedanke und das Klassensystem, das auf Verdiensten beruhte und nicht auf Vererbung, sind die radikalsten Ideen im konfuzianischen System. Generell sprach sich Konfuzius für eine Hierarchie aus, die durch strenge Benimmregeln und Protokollvorschriften geregelt wurde. Jeder sollte wissen, wo in der Gesellschaft er stand. Dies bedeutet nicht, dass es keine sozialen Auf- und Abstiegsmöglichkeiten gab. Wer die Fähigkeiten (und einen guten Charakter) besaß, konnte ohne Rücksicht auf den familiären Hintergrund über alle Ränge bis in die höchsten Ebenen der Regierung gelangen. Und wer eine Machtposition innehatte, konnte sie verlieren, wenn er nicht die entsprechenden Qualitäten bewies, egal wie angesehen seine Familie war. Dieses Prinzip bezog sich sogar auf den Herrscher selbst. Konfuzius betrachtete den Anschlag auf ein despotisches Staatsoberhaupt als das notwendige Entfernen eines Tyrannen und nicht als Mord an einem legitimen Herrscher. Er meinte, durch diese Flexibilität ergäbe sich echter Respekt und politischer Konsens – die notwendige Basis für eine starke und stabile Regierung.
Schauspieler vollziehen in der Provinz Shandong (China) ein konfuzianisches Ritual. Ihre strenge Tradition vermittelt den Zuschauern heute den Eindruck respektvoller Zurückhaltung.
»Der Edle regiert die Menschen nach ihrem Charakter, wie es zweckmäßig ist, und sobald sie sich vom Falschen abwenden, hört er damit auf.«
Konfuzius
Verbrechen und Strafe
Die Prinzipien der konfuzianischen Moralphilosophie erstreckten sich auch auf die Bereiche Recht und Strafen. Zuvor hatte das Rechtssystem auf religiösen Verhaltensvorschriften beruht, aber Konfuzius wollte die von Gott gegebenen Gesetze durch einen am Menschen orientierten Ansatz ersetzen. Wie bei seiner Sozialstruktur plädierte er für ein System, das auf Gegenseitigkeit beruhte: Wirst du mit Respekt behandelt, handelst du selbst auch mit Respekt. Seine Version der goldenen Regel war als Verneinung formuliert: »Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andren zu.« Damit standen nicht mehr die begangenen Taten im Blickfeld, sondern es ging darum, schlechtes Verhalten zu vermeiden. Und dies ließe sich am besten durch das richtige Vorbild erreichen, was Konfuzius so ausdrückte: »Wenn du einen weisen Mann triffst, so versuche, ihm nachzueifern. Wenn du einen törichten Mann triffst, so prüfe dich selbst in deinem Innern.«
Konfuzius wollte Verbrechen nicht mit strengen Gesetzen oder harten Strafen bekämpfen. Er hielt es für den besseren Weg, das Gefühl der Scham zu wecken. Mag sein, dass die Menschen nicht kriminell werden, wenn sie durch Gesetze geführt oder durch Strafen gehindert werden. Aber sie entwickeln kein Gefühl für Richtig und Falsch. Werden sie hingegen durch ein Vorbild geführt und durch Respekt gehindert, dann schämen sie sich für ihr Fehlverhalten und lernen, wirklich gut zu sein, so seine Idee.
Das Gemälde aus der Song-Dynastie zeigt, wie der chinesische Kaiser bei den Prüfungen der Beamten den Vorsitz führt. Derartige Prüfungen wurden zu Konfuzius’ Lebzeiten eingeführt und beruhten auf seinen Vorstellungen.
»Wer Kraft seines Wesens herrscht, gleicht dem Nordstern. Der verweilt an seinem Ort und alle Sterne umkreisen ihn.«
Konfuzius
Unpopuläre Ideen
In der Philosophie des Konfuzius verbinden sich Vorstellungen von der angeborenen Güte und Geselligkeit des Menschen mit den starren Strukturen der traditionellen chinesischen Gesellschaft. Angesichts seiner Position als Berater bei Hofe überrascht es auch nicht, dass Konfuzius der neuen meritokratischen Klasse der Gelehrten einen wichtigen Platz einräumte. Doch die Angehörigen der herrschenden Familien fühlten sich durch die Macht, die Minister und Berater erhalten sollten, bedroht. Die Beamten hätten vielleicht gern mehr Kontrolle ausgeübt, glaubten aber nicht daran, dass das Volk sich durch ein Vorbild regieren lasse. Und sie wollten nicht ihr Recht aufgeben, Macht durch Gesetze und Strafen auszuüben. Die Ideen des Konfuzius wurden also mit Misstrauen betrachtet und zu seinen Lebzeiten nicht umgesetzt.
Auch spätere Denker hatten allerlei daran auszusetzen. Mozi (Mo Di), ein Philosoph, der kurz nach Konfuzius’ Tod geboren wurde, stimmte zwar mit dessen modernen Vorstellungen der Meritokratie und der Führung durch Vorbild überein, aber er glaubte, die Orientierung an Familienbeziehungen würde zu Vetternwirtschaft führen. Und militärisch geprägte Denker wie Sunzi hatten wenig Zeit für Moralphilosophie – sie näherten sich der Frage des Regierens von der praktischen Seite und zogen ein autoritäres System vor, um die Verteidigung des Staates sicherzustellen. Dennoch wurden in den beiden Jahrhunderten nach Konfuzius’ Tod immer mehr Elemente seiner Lehre in die chinesische Gesellschaft aufgenommen. Unter Mengzi (372–289 v. Chr.) gewannen sie im 4. Jahrhundert v. Chr. sogar eine gewisse Popularität.
»Was man weiß, als Wissen gelten lassen, was man nicht weiß, als Nichtwissen gelten lassen: Das ist Wissen.«
Konfuzius
Die Staatsphilosophie
Der Konfuzianismus mochte zum Regieren in Friedenszeiten geeignet sein. Aber in der Zeit der »streitenden Reiche«, als es darum ging, China zu vereinen, verdrängte ein autoritäres Regierungssystem, bekannt als Legalismus, die konfuzianischen Ideen. Auch der Kaiser, der seine Autorität über das neue Reich behaupten musste, setzte diesen Regierungsstil fort. Als im 2. Jahrhundert v. Chr. der Friede nach China zurückkehrte, wurde unter der Han-Dynastie der Konfuzianismus zur offiziellen Staatsphilosophie. Fortan prägte er die Strukturen in der chinesischen Gesellschaft, vor allem was die Rekrutierung der Beamten anging. Die Prüfungen für den Staatsdienst, die 605 n. Chr. eingeführt wurden, beruhten auf klassischen konfuzianischen Texten – daraus entwickelte sich eine Praxis, die bis ins 20. Jahrhundert hinein bestand.
Auch unter dem kommunistischen Regime verschwand der Konfuzianismus in China nie vollständig. Bis zur Kulturrevolution hatte er unterschwellig Einfluss auf die Strukturen in der Gesellschaft. Heute sind Elemente des konfuzianischen Denkens (etwa im Verhältnis Vater–Sohn) tief in der chinesischen Lebensart verwurzelt. Das Land entwickelt sich vom maoistischen Kommunismus zu einer chinesischen Version der gemischten Wirtschaftsform – und wendet sich dabei mit neuem Ernst konfuzianischen Ideen zu.
Als offizielle chinesische Staatsphilosophie erfüllte der Konfuzianismus auch religiöse Funktionen. Im ganzen Land entstanden konfuzianische Tempel wie dieser in Nanjing.
Siehe auch:Sunzi • Mozi (Mo Di) • Han Feizi • Sun Yat-sen • Mao Zedong
IM KONTEXT .
Realismus
Diplomatie und Krieg
8. Jh. v. Chr. Das goldene Zeitalter der chinesischen Philosophie beginnt, die »Hundert Schulen des Denkens« entstehen.
6. Jh. v. Chr. Konfuzius (Kong Fuzi) entwickelt die Rahmenbedingungen für eine Zivilgesellschaft, die auf traditionellen Werten beruht.
4. Jh. v. Chr. Chanakyas Rat an Chandragupta Maurya trägt zur Errichtung des Maurya-Reiches in Indien bei.
1532 Niccolò Machiavellis Der Fürst wird fünf Jahre nach seinem Tod veröffentlicht.
1937 Mao Zedong schreibt Über den Guerillakrieg.
Im späten 6. Jahrhundert v. Chr. war die »Zeit der Frühlings- und Herbstannalen« in China vorbei. Das friedliche Wohlergehen und die Blütezeit der Philosophie gingen zu Ende. Man hatte sich auf die Moralphilosophie oder Ethik konzentriert. In der politischen Philosophie, die darauf aufbaute, ging es darum, wie der Staat seine inneren Angelegenheiten moralisch richtig organisieren sollte. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung verband Konfuzius (Kong Fuzi) die überlieferten Tugenden mit der Hierarchie, an deren Spitze das Staatsoberhaupt stand. Die Verwaltung übernahmen Gelehrte.
Zum Ende der »Zeit der Frühlings- und Herbstannalen« hin ging die politische Stabilität verloren und die Spannungen zwischen den chinesischen Staaten wuchsen. Ihre Anführer mussten deshalb nicht nur innere Angelegenheiten regeln, sondern auch Angriffe der Nachbarn abwehren.
Die Terrakotta-Armee aus dem Grab des Kaisers Qin Shihuangdi. Sie zeigt, wie wichtig Qin das Militär war. Er lebte 200 Jahre nach Sunzi und zählte zu den Kennern von dessen Werken.
Militärstrategie
Militärberater waren auf einmal ebenso wichtig wie zivile Bürokraten, die Militärstrategie griff auf das politische Denken über. Das einflussreichste Werk zu diesem Thema ist Die Kunst des Krieges, geschrieben vermutlich von Sunzi, einem General in der Armee des Königs von Wu. Dort heißt es: »Die Kunst des Krieges ist für den Staat von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine Angelegenheit von Leben und Tod, eine Straße, die zur Sicherheit oder in den Untergang führt. Deshalb darf sie unter keinen Umständen vernachlässigt werden.« Das war ein klarer Bruch mit der politischen Philosophie der Zeit. Möglicherweise wurde hier zum ersten Mal deutlich formuliert, wie wichtig Krieg und militärische Informationen sind und dass sie zu den Staatsangelegenheiten zählen. In Die Kunst des Krieges geht es darum, das Wohl des Staates praktisch zu sichern. Während sich die früheren Denker mit der Struktur der Zivilgesellschaft befasst hatten, konzentrierte sich diese Abhandlung auf internationale Politik. Es wurden Fragen der öffentlichen Verwaltung diskutiert, und zwar allein zum Zweck der Planung und Durchführung von Kriegen.
Sunzis detaillierte Beschreibungen der Kriegskunst wurden als Rahmenvorgaben für jede Art von politischer Organisation gesehen. Er führte darin eine Reihe von Prinzipien auf, die bei der Planung eines Feldzugs zu berücksichtigen sind. Dazu gehörten neben Wetter und Gelände der moralische Einfluss des Herrschers, die Qualitäten des Generals und die Disziplin der Soldaten. Diese »Prinzipien des Krieges« lassen sich auf jede hierarchische Struktur mit einem Herrscher an der Spitze übertragen. Das Oberhaupt lässt sich von seinen Generälen beraten, denen er Befehle erteilt und die ihrerseits die Truppen organisieren. Für Sunzi ist es auch dessen Aufgabe, moralisch die Führung zu übernehmen. Das Volk muss davon überzeugt werden, dass es um eine gerechte Sache geht. Führen sollte der Herrscher durch sein Vorbild; diese Idee hatte Sunzi mit Konfuzius gemeinsam.
Es überrascht kaum, dass Sunzi großes Gewicht auf die Qualitäten der Generäle legt. Er beschreibt sie als »Bollwerk des Staates«. Ihre Ausbildung und Erfahrung bilden die Grundlage der Ratschläge, die sie dem Führer des Staates geben; sie bestimmt also die Politik maßgeblich mit. Außerdem sind ihre Fähigkeiten entscheidend für die Organisation der Armee. Der General steht an der Spitze der Befehlskette. Er ist verantwortlich für die Logistik und die Ausbildung sowie die Disziplin der Männer. Die Kunst des Krieges rät dazu, disziplinarische Maßnahmen rigoros durchzusetzen; neben harten Strafen bei Ungehorsam soll es aber auch Belohnungen geben.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Wissen, wann man kämpft
Während die Beschreibung der militärischen Hierarchie in Die Kunst des Krieges die Struktur der chinesischen Gesellschaft widerspiegelte, waren die Empfehlungen für die internationale Politik deutlich innovativer. Wie zahlreiche Generäle vor und nach ihm glaubte Sunzi, es sei der Zweck des Militärs, den Staat zu schützen und dessen Wohl zu sichern. Allerdings sollte ein guter General zunächst versuchen, die Pläne des Feindes zu durchkreuzen. Wenn das nicht gelingt, sollte er sich gegen Angriffe verteidigen und erst als letzte Möglichkeit eine Offensive beginnen.
Sunzi sprach sich für eine starke Verteidigung und die Bildung von Allianzen mit Nachbarstaaten aus, um Krieg zu vermeiden. Auch weil ein kostspieliger Krieg beiden Seiten schadet, fand er es sinnvoller, sich friedlich zu einigen. Seine Begründung: Lange Feldzüge und Belagerungen belasten die Staatskasse sehr, sodass die Kosten häufig sogar den Vorteil eines Sieges übersteigen. Die Opfer, die das Volk bringen muss, belasten dessen Treue und lassen es an der moralischen Gerechtigkeit einer Sache zweifeln.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
»Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten.«
Sunzi
Der Einsatz von Spionen
Als Schlüssel zu stabilen internationalen Beziehungen sah Sunzi das Wissen über die Pläne des Feindes. Spione sollten die entsprechenden Informationen liefern. So konnten die Generäle bei Kriegsgefahr gut einschätzen, wie die Chancen des Herrschers auf einen Sieg standen. Weiter erklärte Sunzi: Das nächstwichtige Element im Informationskrieg sei die Täuschung. Trägt man dem Feind Falschinformationen zu, lassen sich Kampfhandlungen oft vermeiden. Außerdem riet er davon ab, den Feind im Kampf zerstören zu wollen, weil das den Sieg schmälern würde – und zwar sowohl in Bezug auf das Wohlwollen der unterlegenen Soldaten als auch auf die Gewinne aus den eroberten Gebieten.
Die praxisnahen Ratschläge in Die Kunst des Krieges beruhen auf den moralischen Werten Gerechtigkeit, Angemessenheit und Mäßigung. Im Text heißt es, militärische Taktik, internationale Politik und Krieg existierten, um diese Werte zu erhalten, und sollten immer in Einklang mit diesen durchgeführt werden. Der Staat setzt seine militärische Macht ein, um diejenigen zu bestrafen, die ihn von außen schädigen oder bedrohen – so wie er Kriminelle im Innern bestraft. Wenn das auf moralisch gerechtfertigte Weise geschieht, ist der Lohn für den Staat ein glücklicheres Volk und der Gewinn von mehr Land und Reichtum.
Die Kunst des Krieges gewann großen Einfluss unter Herrschern, Generälen und Ministern der verschiedenen Staaten, die um ein vereintes chinesisches Reich rangen. Später war das Buch eine wichtige Grundlage für die Taktik von Revolutionären, darunter Mao Zedong und Ho Chi Minh. Heute ist Die Kunst des Krieges Standardlektüre an zahlreichen Militärakademien und in Kursen über Politik und Wirtschaft.
Die große chinesische Mauer, begonnen im 7. Jh. v. Chr., diente zur Verteidigung neu eroberter Gebiete. Für Sunzi waren solche Maßnahmen ebenso wichtig wie die Angriffskraft.
»Man führt durch Vorbild, nicht durch Zwang.«
Sunzi
Sunzi
Er gilt als Verfasser der legendären Abhandlung Die Kunst des Krieges: Sun Wu (später bekannt als Sunzi) wurde vermutlich um 544 v. Chr. im chinesischen Staat Qi oder Wu geboren. Über sein frühes Leben ist nichts bekannt, aber als General im Dienst des Staates Wu führte er viele erfolgreiche Feldzüge gegen den benachbarten Staat Chu.
Sunzi wurde zum unverzichtbaren Militärberater König Helüs von Wu und schrieb seine berühmte Abhandlung als Handbuch für den Herrscher. Sie ist knapp gehalten und besteht aus 13 kurzen Kapiteln. Nach Sunzis Tod um 496 v. Chr. wurde sie überall gelesen: von den Staatsführern, die um die Kontrolle im chinesischen Reich kämpften, und von militärischen Denkern in Japan und Korea. 1782 wurde Die Kunst des Krieges erstmals in eine europäische Sprache übersetzt. Gut möglich, dass die französische Ausgabe Napoleon beeinflusst hat.
Hauptwerk
6. Jh. v. Chr.Die Kunst des Krieges
Siehe auch:Chanakya • Han Feizi • Niccolò Machiavelli • Mao Zedong • Che Guevara
IM KONTEXT .
Mohismus
Meritokratie
6. Jh. v. Chr. Der chinesische Philosoph Laozi plädiert für den Daoismus, das Handeln in Übereinstimmung mit dem Weg (dao).
5. Jh. v. Chr. Konfuzius (Kong Fuzi) entwickelt eine Regierung der traditionellen Werte, umgesetzt von Gelehrten.
4. Jh. v. Chr. Die autoritären Vorstellungen von Shang Yang und Han Feizi werden im Staat Qin als Doktrin des Legalismus übernommen.
372–289 v. Chr. Der Philosoph Mengzi plädiert für die Rückkehr zum Konfuzianismus in abgewandelter Form.
20. Jh. Mozis Vorstellungen beeinflussen die Republik Sun Yat-sens und die kommunistische Volksrepublik China.
Gegen Ende des goldenen Zeitalters der chinesischen Philosophie, das zwischen dem 8. und 3. Jahrhundert v. Chr. die »Hundert Schulen des Denkens« hervorbrachte, wurden moralphilosophische Vorstellungen auf soziale und politische Organisationen angewendet. In erster Linie ist hier Konfuzius (Kong Fuzi) zu nennen. Er plädierte für eine Hierarchie auf der Grundlage traditioneller Familienbeziehungen, unterstützt durch Zeremonien und Rituale. Innerhalb der Hierarchie betonte er die Bedeutung einer führenden Klasse von Gelehrten zur Unterstützung des Herrschers, eine Idee, die Mozi (Mo Di) später weiterentwickelte.
Sowohl Konfuzius als auch Mozi gingen davon aus, dass das Wohlergehen des Staates auf der Zuverlässigkeit einer herrschenden bürokratischen Klasse beruht. Sie waren jedoch unterschiedlicher Ansicht darüber, wie diese Verwalter ausgewählt werden sollten. Für Mozis Verständnis hielt Konfuzius es zu sehr mit den Gepflogenheiten der adligen Familien, aus denen nicht zwangsläufig jene Tugenden und Fähigkeiten hervorgingen, die für eine erfolgreiche Staatsverwaltung erforderlich sind. Mozi glaubte, die Qualitäten, ein hohes Staatsamt ausfüllen zu können, resultierten aus Begabung und Studium, ohne dass der Hintergrund eine Rolle spielte.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Ein verbindender Kodex
»Die Erhebung der Tugendhaften«, wie Mozi seine meritokratische Vorstellung beschrieb, stellte einen Grundpfeiler des mohistischen politischen Denkens dar. Außerdem glaubte Mozi an das Gute im Menschen und an eine Atmosphäre der »universellen Liebe«. Gleichzeitig erkannte er die menschliche Tendenz, im eigenen Interesse zu handeln. Dies, so seine Überlegung, geschehe häufig in Konfliktsituationen, und zwar nicht aus einem Mangel an Moral, sondern wegen unterschiedlicher Vorstellungen darüber, was moralisch richtig ist. Es sei daher Aufgabe der politischen Führung, dem Volk gegenüber einen schlüssigen Moralkodex durchzusetzen. Dieser solle auf das größtmögliche Wohlergehen der Gesellschaft abzielen. Eine solche Vorgabe zu formulieren erfordere eine Weisheit, über die nur die Gelehrten verfügten.
Dass Mozi die Idee bevorzugte, Staatsdiener nach ihren Verdiensten und Fähigkeiten auszuwählen, beruhte auf seiner eigenen Erfahrung: Er war aus bescheidenen Verhältnissen gestartet und hatte sich das hohe Amt hart erarbeitet. Wenn der Adel die Minister ernannte, bestünde die Gefahr der Vetternwirtschaft, so Mozi.
Der Mohismus hatte viele Anhänger, doch Mozi selbst galt als Idealist. Seine Ideen wurden von den chinesischen Herrschern seinerzeit nicht übernommen. Erst später wurden Teile seines politischen Denkens aufgegriffen. So beeinflusste Mozis Forderung nach einem einheitlichen Moralkodex die autoritären legalistischen Regierungen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. entstanden, erheblich. Im 20. Jahrhundert wurden Mozis Vorstellungen von Chancengleichheit durch die chinesischen Führer Sun Yat-sen und Mao Zedong wiederentdeckt.
Nach Mozis Ansicht konnten geschickte Handwerker mit Talent durch eine Ausbildung fähige Verwaltungsbeamte werden.
»Die Erhebung der Tugendhaften ist die Wurzel allen Regierens.«
Mozi
Mozi (Mo Di)
Es wird angenommen, dass Mozi etwa zu der Zeit in Tengzhou in der Provinz Shandong (China) geboren wurde, als Konfuzius starb. Unter dem Namen Mo Di arbeitete er als Holzarbeiter und Ingenieur sowie am Hof adeliger Familien. Als Beamter stieg er auf und richtete eine Schule für Staatsbedienstete ein. Mit seinen politischen und philosophischen Ansichten erwarb er sich eine Anhängerschaft und den Titel »Mozi« (Meister Mo).
Die Mohisten, Mozis Anhänger, lebten nach den Prinzipien der Einfachheit und des Pazifismus in der Zeit der »streitenden Reiche« – bis zur Einführung des Legalismus unter der Qin-Dynastie. Nach seinem Tod wurden die Lehren Mozis gesammelt. Der Mohismus verschwand nach der Einigung Chinas 221 v. Chr., wurde aber Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt.
Hauptwerk
5. Jh. v. Chr.Das Buch Mozi
Siehe auch:Konfuzius (Kong Fuzi) • Platon • Han Feizi • Sun Yat-sen • Mao Zedong
IM KONTEXT .
Rationalismus
Philosophenkönige
594 v. Chr. Der athenische Gesetzgeber Solon legt die Grundlage für die griechische Demokratie.
um 450 v. Chr. Der griechische Philosoph Protagoras sagt, politische Gerechtigkeit sei das Ergebnis menschlicher Vorstellungen und nicht naturgegeben.
335–323 v. Chr. Aristoteles meint, die Politie (Staatsverfassung) sei die praktischste von den guten Herrschaftsformen.
54–51 v. Chr. Cicero schreibt De re publica (Über das Gemeinwesen) und plädiert für eine demokratischere Form der Regierung als Platon in Der Staat.
Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. begann in Griechenland ein kulturelles »goldenes Zeitalter«, das 200 Jahre andauerte. Heute spricht man von der »klassischen Zeit«. Literatur, Architektur, Wissenschaft und vor allem die Philosophie blühten und beeinflussten die Entwicklung der westlichen Zivilisation zutiefst.
Als die klassische Zeit anfing, setzte das Volk des Stadtstaats Athen seinen tyrannischen Führer ab und führte eine Form der Demokratie ein. Die Bürger wählten ihre Regierungsvertreter per Losentscheid, Entscheidungen wurden von einer demokratischen Versammlung getroffen. Alle Bürger konnten sich zu Wort melden und in der Versammlung abstimmen – sie hatten keine Vertreter, die dies an ihrer Stelle taten. Dazu muss man jedoch wissen, dass die Bürger eine Minderheit in der Bevölkerung waren. Es handelte sich um freie Männer über 30, deren Eltern Athener waren. Frauen, Versklavte, Kinder, jüngere Männer und Ausländer oder Neuankömmlinge der ersten Generation waren ausgeschlossen. Dieses politische Klima sorgte dafür, dass Athen schnell zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum wurde. Die Stadt zog führende Denker der Zeit an. Zu den wichtigsten zählte ein Athener namens Sokrates. Dass er die allgemein akzeptierten Vorstellungen von Gerechtigkeit und Tugend philosophisch infrage stellte, bescherte ihm eine Anhängerschaft unter den Jugendlichen. Leider weckte das auch die Aufmerksamkeit der Behörden. Auf deren Veranlassung verhängte die Volksversammlung ein Todesurteil: Sokrates wurde schuldig gesprochen, die Jugend verführt zu haben. Einer seiner Anhänger war Platon, der ebenfalls wissbegierig war und zudem die skeptische Haltung seines Lehrers teilte. Als er sah, wie ungerecht die Athener seinen Lehrer behandelten, zeigte er sich enttäuscht von der attischen Demokratie.
Platon gewann nach und nach genauso viel Einfluss wie Sokrates und wandte sich gegen Ende seiner Laufbahn dem Geschäftswesen und der Politik zu. Berühmt ist sein Werk Der Staat. Für die Demokratie empfand Platon wenig Sympathie. Aber auch andere Regierungsformen hatten in seinen Augen wenig Gutes. Er glaubte, sie alle würden den Staat ins Elend führen.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Das gute Leben
Um zu verstehen, was Platon in diesem Zusammenhang mit Elend meinte, muss man sich seine Vorstellung der Eudaimonie vergegenwärtigen: Das »gute Leben« (die richtige Lebensführung) war für die alten Griechen ein wichtiges Lebensziel. Gut zu leben, das war keine Frage des materiellen Wohlstands, der Ehre oder des Vergnügens. Vielmehr ging es darum, in Einklang mit den grundlegenden Tugenden Weisheit, Pietät und vor allem Gerechtigkeit zu handeln. Der Zweck des Staates, so glaubte Platon, bestehe darin, diese Tugenden zu befördern, damit die Bürger ein gutes Leben führen könnten. Der Schutz des Eigentums, Freiheit und Stabilität waren nur insoweit von Belang, als sie die Bedingungen für ein gutes Leben schufen. Nach Platons Ansicht hatte es jedoch niemals ein politisches System gegeben, mit dem sich dieses Ziel erreichen ließe.
Den Grund sah Platon darin, dass Herrscher – ob in einer Monarchie, einer Oligarchie oder einer Demokratie – dazu tendieren, im eigenen Interesse zu regieren, nicht im Interesse des Staates und seiner Bewohner. Platon erklärte, das liege an einer allgemeinen Unkenntnis der Tugenden, die das gute Leben ausmachten. Die Menschen wollten das Falsche, insbesondere die vergänglichen Freuden, die mit Ruhm und Reichtum einhergehen. Beides erringt man durch politische Macht. Doch der Wunsch, aus den – für Platon – falschen Gründen zu herrschen, führt zum Konflikt unter den Bürgern. Wer immer mehr Macht will, zerstört am Ende die Stabilität und die Einheit des Staates. Wer siegreich aus dem Machtkampf hervorgeht, nimmt den Gegnern die Möglichkeit, ihre Wünsche zu verwirklichen, was zur Ungerechtigkeit führt – einem Übel, das der platonischen Vorstellung vom guten Leben genau entgegengesetzt ist.
Doch es gibt eine Klasse, so Platon, die versteht, worauf es beim guten Leben ankommt: die Philosophen. Nur sie allein erkennen den Wert der Tugenden über Annehmlichkeiten wie Ruhm und Geld hinaus und weihen ihr Leben der richtigen Lebensführung. Deshalb streben sie nicht nach Berühmtheit oder Besitz, deshalb haben sie keinen Drang nach politischer Macht. Paradoxerweise macht sie das zu idealen Herrschern. Auf den ersten Blick scheint Platon einfach zu sagen: Die Philosophen wissen es am besten – was man einem Philosophen schwerlich glauben würde. Aber dahinter steckt eine subtilere Gedankenkette.
Sokrates wählte das Gift: Er wollte seine Ansichten nicht widerrufen. Das Verfahren gegen Sokrates ließ Platon am demokratischen politischen System in Athen zweifeln.
»Aus Demokratie wird Despotismus.«
Platon
Ideen
Von Sokrates hatte Platon gelernt, dass Tugenden nicht naturgegeben sind, sondern von Wissen und Weisheit abhängen. Wer ein tugendhaftes Leben führen will, muss das Wesen der Tugend verstehen. Platon entwickelte die Ideen seines Mentors weiter. Er zeigte, dass Menschen vielleicht in der Lage sind, einzelne Ausprägungen von Gerechtigkeit, Güte oder Schönheit zu erkennen, damit aber nicht verstanden haben, was das Wesen von Gerechtigkeit, Güte oder Schönheit ausmacht.
Wir können gerechtes Verhalten imitieren, indem wir so handeln, wie wir es für gerecht halten – aber das ist bloße Nachahmung. In seiner Ideenlehre legte Platon dar, dass Archetypen der Tugenden (und alles Seienden) existieren. Sie bestehen aus ihrem wahren Wesen, etwa der »Gerechtigkeit an sich«. Das bedeutet, dass das, was wir im Einzelfall als Tugenden wahrnehmen, nur Abbilder oder Schatten der zugrunde liegenden Ideen sind.
Die idealen Formen oder Ideen, wie Platon sie nannte, existieren in einem Bereich außerhalb der Welt, in der wir leben. Sie sind allein über das philosophische Denken zugänglich. Deshalb sind die Philosophen in besonderer Weise dazu geeignet, zu definieren, was das gute Leben ausmacht, und ein wirklich tugendhaftes Leben zu führen. Zuvor schon hatte Platon erklärt, dass der Staat, wenn er gut sein will, von den Tugendhaften regiert werden muss. Und während andere vor allem das Geld oder die Ehre schätzen, sind es die Philosophen, die Wissen und Weisheit (und damit die Tugend) zu würdigen wissen. Aus diesem Grund müssen die Philosophen Könige werden. Platon schlug vor, ihnen Machtpositionen zu überlassen, um die Konflikte zu vermeiden, die andere Regierungsformen mit sich bringen.
Platon erklärte mit der Metapher vom Staatsschiff, warum Philosophen Herrscher sein sollten. Obwohl er nicht nach der Macht strebt, ist der Nautiker der Einzige, der den Kurs halten kann – wie der Philosoph der Einzige ist, der das Wissen hat, um gerecht zu regieren.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
»Die größte Strafe aber ist, dass man von einem Schlechteren regiert wird, wenn man nicht selbst regieren mag.«
Platon
Ausbildung zum König
Platon wusste, dass dies ein utopischer Standpunkt war. So führte er weiter aus: »… oder die, welche jetzt Könige und Herrscher heißen, [müssten] echte und gründliche Philosophen werden.« Damit unterbreitete er den praktikableren Vorschlag, die künftige Herrscherklasse entsprechend auszubilden. In seinen späteren Dialogen Politikos und Nomoi beschrieb er ein Staatsmodell, mit dem die nötigen philosophischen Fähigkeiten vermittelt werden können, um das gute Leben zu verstehen. Doch wies Platon darauf hin, dass nicht jeder Bürger über die Begabung und die geistigen Fähigkeiten verfügt, solche Kenntnisse zu erwerben. Er schlug vor, dass diese Art der Ausbildung in den Fällen, wo sie angemessen erscheint (also bei einer kleinen geistigen Elite), erzwungen und nicht nur angeboten wird. Wer wegen seiner »natürlichen Gaben« für die Ausübung der Macht infrage kommt, sollte von seiner Familie getrennt in einer besonderen Gemeinschaft aufwachsen, damit er allein dem Staat gegenüber loyal ist.
Platons politische Schriften hatten großen Einfluss in der antiken Welt, besonders im Römischen Reich. Sie waren ein Echo jener Vorstellungen von Tugend und Bildung, wie sie in der politischen Philosophie der chinesischen Gelehrten Konfuzius (Kong Fuzi) und Mozi (Mo Di) angeklungen waren. Es ist sogar möglich, dass sie Chanakya in Indien beeinflussten, als dieser seine Abhandlung über die Ausbildung künftiger Herrscher schrieb. Im Mittelalter breitete sich Platons Lehre weiter aus, in das islamische Reich und in das christliche Europa, wo Augustinus sie in die Kirchenlehre aufnahm. Später stand Platon im Schatten von Aristoteles, dessen Eintreten für die Demokratie besser zu den politischen Philosophen der europäischen Renaissance passte.
Noch späteren Denkern galten Platons politische Ansichten als allzu autoritär und elitär. Als die moderne Welt um die Einführung der Demokratie rang, konnten viele sich nicht mit seinen Vorstellungen anfreunden. Platon wurde als Vertreter eines totalitären, allenfalls paternalistischen Herrschaftssystems kritisiert, angeführt von einer Elite, die behauptete zu wissen, was für alle das Beste ist. In jüngerer Zeit jedoch hat seine zentrale Vorstellung einer politischen Elite von »Philosophenkönigen« durch die politischen Denker neue Wertschätzung erfahren.
Kaiser Nero stand da und tat nichts, um zu helfen, während ein Feuer in Rom wütete. Das Ideal Platons eines Philosophenkönigs sahen einige als Grund für den Aufstieg von Tyrannen wie ihm.
»Demokratie [ist] zügellos, buntscheckig, so etwas wie Gleichheit gleicherweise unter Gleiche wie Ungleiche verteilend.«
Platon
Platon
Platon wurde um 427 v. Chr. geboren und hieß ursprünglich Aristokles. Seinen Spitznamen Platon (»breit«) bekam er später, weil er so muskulös war. Er stammte aus einer Athener Adelsfamilie und sollte wahrscheinlich eine politische Karriere einschlagen. Stattdessen wurde er ein Schüler des Philosophen Sokrates und war zugegen, als sein Mentor es vorzog, zu sterben und seine Ansichten nicht zu widerrufen.
Platon bereiste mehrmals den Mittelmeerraum, ehe er nach Athen zurückkehrte. Dort gründete er eine Schule für Philosophie, die Akademie, zu deren Schülern der junge Aristoteles zählte. Platon lehrte und schrieb einige Bücher in Dialogform, in denen meist sein Lehrer Sokrates auftrat und philosophische sowie politische Ideen vertrat. Bis ins hohe Alter soll Platon gelehrt und geschrieben haben und 348/347 v. Chr. mit ungefähr 80 Jahren gestorben sein.
Hauptwerke
um 399–387 v. Chr.Kriton
um 380–360 v. Chr.Der Staat (Politeia)
um 355–347 v. Chr.Politikos, Nomoi
Siehe auch:Konfuzius (Kong Fuzi) • Mozi (Mo Di) • Aristoteles • Chanakya • Cicero • Augustinus von Hippo • Al-Farabi
IM KONTEXT .
Demokratie
Politische Tugend
431 v. Chr. Der attische Staatsmann Perikles behauptet, Demokratie biete das gleiche Recht für alle.
um 380–360 v. Chr. In Der Staat spricht Platon sich für die Herrschaft der »Philosophenkönige« aus, die über Klugheit verfügen.
13. Jh. Thomas von Aquin übernimmt Aristoteles’ Vorstellungen in die christliche Lehre.
um 1300 Aegidius Romanus betont die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit in einer bürgerlichen Gesellschaft.
1651 Thomas Hobbes spricht sich für einen Gesellschaftsvertrag aus, damit die Menschen nicht im anarchischen Naturzustand leben müssen.
Das antike Griechenland war kein Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen, sondern eine Ansammlung unabhängiger Regionalstaaten mit städtischen Zentren. Jeder Stadtstaat oder jede Polis hatte eine eigene Verfassung: In Makedonien beispielsweise herrschte ein König, während es andernorts, insbesondere in Athen, eine Demokratie gab, bei der zu-mindest einige der Bürger an der Regierung beteiligt waren.
Aristoteles, der in Makedonien aufwuchs und in Athen studierte, war mit der Vorstellung der Polis und ihren verschiedenen Ausprägungen vertraut. Sein analytisches Denken ermöglichte es ihm, die Vorzüge des Stadtstaates zu untersuchen.
Eine Zeitlang lebte Aristoteles in Ionien, wo er Tiere und Pflanzen klassifizierte. Später wendete er seine Fähigkeiten im Kategorisieren auf Ethik und Politik an. Anders als sein Mentor Platon glaubte Aristoteles, Wissen würde durch Beobachtung erworben, weniger durch Schlussfolgern. Er meinte daher, die Wissenschaft der Politik sollte auf empirischen Daten beruhen.