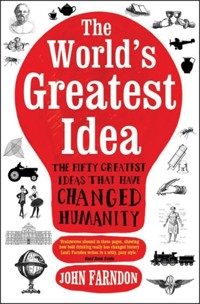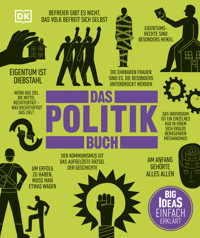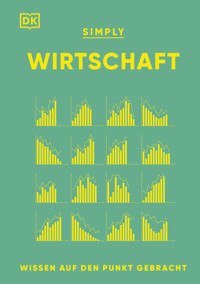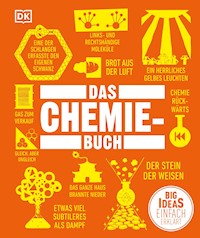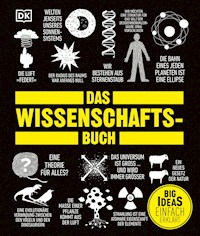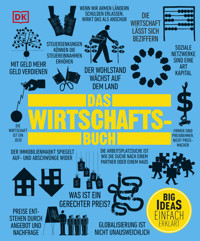
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dorling Kindersley Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Big ideas
- Sprache: Deutsch
Die Welt der Wirtschaft einfach erklärt • Über 100 wichtige Wirtschafts-Theorien und Konzepte in Texten und Grafiken einfach erklärt • Chronologisch gegliedert – von 400 v. Chr bis heute • Mit Kurzbiografien wichtiger Persönlichkeiten wie Jeffrey Sachs, Ben Bernanke oder Janet Yellen • Vollständig überarbeitet undaktualisiert Big Ideas: Das große Wirtschafts-Buch zum Nachschlagen Was waren die Anfänge des Welthandels? Wie funktioniert der Wettbewerbsmarkt? Und was bedeutet Rezession? Dieses umfangreiche Nachschlagewerk aus der DK Erfolgsreihe Big Ideas präsentiert über 100 zentrale Theorien und Konzepte der Wirtschaftswissenschaften – von Angebot und Nachfrage über Globalisierung, Ungleichheit und Wachstum bis zur Entwicklung der Spieltheorie. Zusätzlich informieren Kurzbiografien anschaulich und kompakt über die bewegten Lebenswege wichtiger Persönlichkeiten der Wirtschaftsgeschichte, wie z.B. Alberto Alesina, John Nash und Janet Yellen. Wirtschaftswissen fundiert und zugänglich – Basiswissen zum Studieren, Informieren oder Nachschlagen. Dieses Buch ist Teil der Reihe "Big Ideas".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wie Sie dieses E-Book benutzen
Bevorzugte Anwendungseinstellungen
Für ein optimales Leseerlebnis werden die folgenden Anwendungseinstellungen empfohlen:
Ausrichtung:
Hochformat
Farbthema:
Weißer Hintergrund
Ansicht scrollen:
[AUS]
Textausrichtung:
Auto-Ausrichtung [AUS]
(wenn der E-Book-Reader über diese Funktion verfügt)
Auto-hyphenation:
[AUS]
(wenn der E-Book-Reader über diese Funktion verfügt)
Schriftstil:
Standardeinstellung des Verlags [EIN]
(wenn der E-Book-Reader über diese Funktion verfügt)
Ändern Sie in den Einstellungen die
Schriftgröße
auf eine Größe, mit der Sie am besten zurechtkommen.
Doppelklicken Sie auf die Bilder im Buch, um sie im Vollbildmodus zu öffnen und die Details deutlich zu sehen.
INHALT
Wie Sie dieses E-Book benutzenEINLEITUNGDIE ANFÄNGE DES WELTHANDELS .• 400 V. CHR.–1770 N. CHR.
Eigentum sollte Privatbesitz sein.• EigentumsrechteWas ist ein gerechter Preis?.• Märkte und MoralWer Münzen hat, muss nicht tauschen.• Die Funktion des GeldesMit Geld mehr Geld verdienen.• FinanzdienstleistungenGeld und Inflation.• Die GeldmengentheorieKeine fremden Waren.• Protektionismus und HandelDie Wirtschaft lässt sich beziffern.• Die Messung des WohlstandsHandel mit Firmenanteilen.• AktiengesellschaftenDer Wohlstand wächst auf dem Land.• Landwirtschaft und VolkswirtschaftGüter und Geld zirkulieren zwischen Herstellern und Verbrauchern.• Der WirtschaftskreislaufPrivatleute zahlen nicht für Straßenbeleuchtung.• Öffentliche Güter und DienstleistungenDAS ZEITALTER DER VERNUNFT .• 1770–1820
Der Mensch ist ein kalter, rationaler Rechner.• Der ökonomische MenschDie unsichtbare Hand des Marktes schafft Ordnung.• Die freie MarktwirtschaftDer letzte Arbeiter trägt weniger zum Output bei als der erste.• Abnehmende ErträgeWarum kosten Diamanten mehr als Wasser?.• Das klassische WertparadoxonSteuern – so gerecht und effizient wie möglich .• Die SteuerlastMehr Warenausstoß durch die Aufteilung der Produktion.• Die ArbeitsteilungDas Bevölkerungswachstum verhindert die Entwicklung von Wohlstand.• Demografie und ÖkonomieUnternehmer als Bündnispartner.• Kartelle und AbsprachenDas Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst.• Überangebot auf MärktenSteuern erheben – oder Kredite aufnehmen? .• Kreditaufnahme und SchuldenDie Wirtschaft ist ein Jojo.• Aufschwung und AbschwungHandel ist gut für alle .• Der komparative KostenvorteilINDUSTRIELLE UND WIRTSCHAFTLICHE REVOLUTIONEN .• 1820–1929
Wie viel sollte man angesichts der Konkurrenz produzieren?.• Auswirkungen eines begrenzten WettbewerbsTelefongespräche sind teurer ohne Wettbewerb.• MonopoleMenschenmengen erzeugen kollektiven Wahnsinn.• WirtschaftsblasenMögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution erzittern.• Marxistische WirtschaftDer Wert eines Produkts beruht auf dem Aufwand seiner Herstellung .• Die ArbeitswerttheoriePreise entstehen durch Angebot und Nachfrage.• Angebot und NachfrageDas erste Stück Schokolade bereitet den höchsten Genuss.• Nutzen und ZufriedenheitWenn der Preis steigt, kaufen manche Leute mehr.• Paradoxe AusgabenEin System der freien Märkte ist stabil.• Wirtschaftliches GleichgewichtKaviar statt Brot – Geld verändert die Kaufentscheidung.• Die NachfrageelastizitätFirmen sind Preisnehmer, nicht Preismacher .• Der WettbewerbsmarktUns soll es besser gehen – und den anderen nicht wehtun.• Effizienz und GerechtigkeitJe größer die Fabrik, desto niedriger die Kosten.• GrößenvorteileDer Preis für den Kinobesuch ist der Spaß, den man beim Eislaufen gehabt hätte.• OpportunitätskostenDie Arbeiter müssen ihr Los gemeinsam verbessern.• TarifverhandlungenMenschen konsumieren, um beachtet zu werden.• GeltungskonsumDer Verschmutzer soll zahlen.• Externe KostenDer Protestantismus hat uns reich gemacht.• Wirtschaft und asketischer ProtestantismusDie Armen sind erfolglos, nicht schlecht .• Das ArmutsproblemDer Sozialismus ist das Ende des rationalen Wirtschaftens.• Zentrale PlanungKapitalismus zerstört das Alte und schafft das Neue.• Schöpferische ZerstörungKRISEN UND KRIEG .• 1929–1945
Arbeitslosigkeit ist nicht frei gewählt.• Konjunkturrückgang und ArbeitslosigkeitManche Menschen lieben das Risiko, andere gehen ihm aus dem Weg .• Risiko und UnsicherheitStaatsausgaben kurbeln die Wirtschaft an und vervielfachen sich dabei.• Der keynesianische MultiplikatorVolkswirtschaften sind eingebettet in eine Kultur.• Wirtschaft und TraditionManager sind an ihrer Vergütung interessiert, nicht am Firmengewinn.• UnternehmensführungDie Wirtschaft ist eine berechenbare Maschine.• Wirtschaftstheorien im TestDie Ökonomie ist die Wissenschaft von den knappen Ressourcen .• Definitionen von WirtschaftWir wollen eine freie Gesellschaft bleiben.• WirtschaftsliberalismusIndustrialisierung schafft nachhaltiges Wachstum.• Die Entstehung der modernen WirtschaftVerschiedene Preise für verschiedene Leute.• PreisdifferenzierungDIE WIRTSCHAFT NACH DEM KRIEG .• 1945–1970
Nach Krisen und Krieg müssen die Nationen zusammenarbeiten.• Internationaler Handel und Bretton WoodsAlles, was arme Länder brauchen, ist ein ordentlicher Anschub .• EntwicklungsökonomieMenschen werden von irrelevanten Alternativen beeinflusst.• Irrationale EntscheidungenDer Staat sollte lediglich die Geldmenge kontrollieren.• Monetaristische PolitikJe mehr Leute in Lohn und Brot sind, desto höher fällt ihre Rechnung aus .• Inflation und ArbeitslosigkeitDie Menschen verteilen ihren Konsum über die gesamte Lebensdauer .• Sparen, um Geld auszugebenInstitutionen spielen eine wichtige Rolle.• WirtschaftsinstitutionenMenschen drücken sich, wenn sie können.• Marktinformationen und AnreizeTheorien über die Effizienz der Märkte beruhen auf zahlreichen Annahmen.• Märkte und soziale ErgebnisseEs gibt kein perfektes Wahlsystem.• Die SozialwahltheorieDas Ziel ist die Maximierung des Glücks, nicht des Einkommens.• Die Ökonomie des GlücksEine Politik der Marktkorrektur kann die Lage der Dinge verschlimmern.• Die Theorie des ZweitbestenDie Märkte sollen gerecht sein.• Die soziale MarktwirtschaftMit der Zeit werden alle Länder reich.• WachstumstheorienGlobalisierung ist nicht unausweichlich.• MarktintegrationIm Sozialismus sind die Läden leer.• Engpässe in PlanwirtschaftenWas glaubt der andere, werde ich tun? .• Die SpieltheorieDie reichen Länder machen die armen arm .• Die DependenztheorieDie Menschen lassen sich nicht an der Nase herumführen.• Rationale ErwartungenWir denken nicht an die Wahrscheinlichkeit, wenn wir wählen.• Paradoxe EntscheidungenVergleichbare Volkswirtschaften können von einer einzigen Währung profitieren.• Wechselkurse und WährungenSelbst in guten Zeiten kann es Hungersnöte geben .• Die BerechtigungstheorieZEITGENÖSSISCHE WIRTSCHAFT .• 1970 BIS HEUTE
Investitionen ohne Risiko sind möglich.• Financial EngineeringMenschen sind nicht hundertprozentig rational.• VerhaltensökonomieSteuersenkungen können die Steuereinnahmen erhöhen.• Steuern und wirtschaftliche AnreizeDie Preise sagen alles .• Effiziente MärkteMit der Zeit kooperieren auch die Egoisten .• Wettbewerb und KooperationDie meisten Autos auf dem Markt sind Schrottkisten.• MarktunsicherheitDie Versprechungen der Regierung sind nicht glaubhaft.• Unabhängige ZentralbankenDie Wirtschaft ist chaotisch, auch wenn die Menschen es nicht sind .• Komplexität und ChaosSoziale Netzwerke sind eine Art Kapital .• Soziales KapitalHöhere Bildung ist nur ein Indiz für größere Fähigkeiten.• Signalling und ScreeningDer Staat regiert den Markt.• Das ostasiatische WunderAnsichten können Währungskrisen auslösen .• Spekulation und GeldabwertungAuktionsgewinner zahlen mehr als das Übliche .• Der Fluch des GewinnersEine stabile Wirtschaft beinhaltet die Gefahr der Instabilität.• FinanzkrisenUnternehmen zahlen mehr als den Marktlohn .• Löhne und AnreizeIn einer Rezession steigen die Reallöhne.• Starre LöhneDie Arbeitsplatzsuche ist wie die Suche nach einem Partner oder einem Haus.• Die SuchtheorieDie größte Herausforderung für gemeinsames Handeln ist der Klimawandel.• Wirtschaft und UmweltDas Bruttoinlandsprodukt ignoriert die Frauen .• Wirtschaft und GeschlechtDer komparative Kostenvorteil ist ein Zufall .• Handel und GeografieDie Computer haben die Wirtschaft revolutioniert – genau wie die Dampfmaschine.• TechnologiesprüngeWenn wir armen Ländern Schulden erlassen, wirkt das als Anschub.• Internationaler SchuldenerlassPessimismus kann gesunde Banken zerstören.• BankenansturmEine Sparschwemme im Ausland nährt die Spekulation im Inland .• Globales Ungleichgewicht der SparguthabenGleichberechtigte Gesellschaften wachsen schneller.• Ungleichheit und WachstumSelbst gut gemeinte Wirtschaftsreformen können scheitern.• Widerstand gegen den WirtschaftswandelDer Immobilienmarkt spiegelt Auf- und Abschwünge wider.• Wohnungsbau und WirtschaftszyklusKonjunkturschocks dauern nicht ewig.• Wirtschaft und PandemieMehr Vielfalt bedeutet bessere Politik.• Wirtschaftliche Vorteile von InklusivitätANHANG
WEITERE PERSONENGLOSSARDIE AUTORENDANKIMPRESSUMAlternativtextEINLEITUNG
Kaum jemand wird von sich behaupten, wirklich über Wirtschaft Bescheid zu wissen. Im Allgemeinen gilt »Wirtschaft« als die Domäne von Fachleuten aus der Finanz- und Geschäftswelt und den Regierungen. Doch den meisten von uns wird immer deutlicher bewusst, welchen Einfluss die wirtschaftliche Entwicklung auf unseren Wohlstand hat. Natürlich haben wir eine Meinung zu steigenden Lebenshaltungskosten, Steuern oder Staatsausgaben. Wir haben alle ein gewisses Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Argumente, mit denen wir unsere Ansichten begründen, sind in der Regel die gleichen wie die der Wirtschaftswissenschaftler. Daher kann uns eine bessere Kenntnis ihrer Theorien zu einem besseren Verständnis der wirtschaftlichen Prinzipien verhelfen, die unser Leben bestimmen.
»In der Wirtschaft sind Glaube und Hoffnung mit großem wissenschaftlichem Anspruch und dem tiefen Wunsch nach Respektabilität gepaart.«
John Kenneth Galbraith
US-Ökonom (1908–2006)
In den Schlagzeilen
Bei den heutigen starken wirtschaftlichen Turbulenzen scheint es wichtiger denn je, über die wirtschaftliche Entwicklung informiert zu sein. Die Themen beschränken sich aber nicht mehr nur auf den Wirtschaftsteil unserer Zeitungen – sie erscheinen auf den Titelseiten.
Aber wie viel verstehen wir wirklich, wenn wir von wachsender Arbeitslosigkeit hören, von Inflation, Krisen an den Börsen und Handelsdefiziten? Wenn wir den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern bezahlen müssen – wissen wir warum? Wenn wir den Eindruck haben, risikobereiten Banken und großen Unternehmen ausgeliefert zu sein – verstehen wir die Gründe für ihre Existenz und vor allem für ihre große Macht?
Die Lehre vom Management
Obwohl die Wirtschaftswissenschaft in vielen Alltagsbereichen von zentraler Bedeutung ist, wird sie häufig kritisch gesehen. Landläufig gilt sie als trocken und akademisch, weil sie angeblich nur auf Statistiken, Diagrammen und Formeln beruht. Der schottische Historiker Thomas Carlyle beschrieb die Wirtschaftslehre im 19. Jahrhundert als »trübselige Wissenschaft«. Sie sei »traurig, desolat und, in der Tat, ziemlich erbärmlich und erschütternd«. Ein anderer verbreiteter Irrtum lautet, dass sie sich »immer nur ums Geld« drehe. Darin liegt zwar ein Körnchen Wahrheit, aber zum Gesamtbild gehört deutlich mehr.
Worum geht es also bei der »Ökonomie«? Der Begriff ist vom griechischen Wort oikonomia (»Haushaltsführung«) abgeleitet und bezeichnet heute die Lehre vom Ressourcenmanagement, insbesondere den Umgang mit der Produktion und dem Austausch von Waren und Dienstleistungen. Natürlich ist beides so alt wie die menschliche Kultur, aber die Lehre davon, wie dieser Vorgang in der Praxis funktioniert, ist relativ jung. Philosophen und Politiker verliehen ihrer Meinung zu wirtschaftlichen Themen seit der Antike Ausdruck, aber Wissenschaftler, die daraus den Gegenstand einer Lehre machten, traten erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf den Plan.
Die sogenannte »politische Ökonomie« war zunächst ein Zweig der politischen Philosophie. Doch die Wissenschaftler betrachteten sie zunehmend als eigenständiges Fach, das sie »Wirtschaftswissenschaft« nannten.
»Weiche Wissenschaft«
Ist die Lehre von der Ökonomie tatsächlich eine Wissenschaft? Die Ökonomen des 19. Jahrhunderts waren unbedingt dieser Ansicht. Ein Großteil der ökonomischen Theorie orientierte sich an der Mathematik und sogar an der Physik; Ökonomen wollten die Gesetze der Wirtschaft ebenso erkunden, wie Naturwissenschaftler die Naturgesetze. Volkswirtschaften sind jedoch von Menschen gemacht und abhängig von ihrem rationalen oder irrationalen Verhalten. Aus diesem Grund hat die Wirtschaftslehre mehr mit den »weichen Wissenschaften« der Psychologie, Soziologie und Politik gemein.
Sehr anschaulich definierte sie der Brite Lionel Robbins. Er beschrieb die Wirtschaftslehre 1932 in einem Essay über die Natur und Bedeutung der ökonomischen Wissenschaft als »die Verhaltenswissenschaft, die die Beziehung zwischen Zielvorhaben und begrenzten Mitteln mit unterschiedlichen möglichen Verwendungen untersucht.«
Der wichtigste Unterschied zwischen der Ökonomie und anderen Wissenschaften besteht jedoch darin, dass ihre Systeme sich im Fluss befinden. Wirtschaftswissenschaftler beschreiben zwar ökonomische Zusammenhänge, sie können aber auch Vorschläge machen, wie Volkswirtschaften konstruiert sein sollten und wie sie sich verbessern ließen.
»Die erste Lektion der Wirtschaft ist die Knappheit: Es ist nie genug von allem da, um alle, die es haben wollen, zufriedenzustellen. Die erste Lektion der Politik ist, sich um die erste Lektion der Wirtschaft nicht zu kümmern.«
Thomas Sowell
US-Ökonom (geb. 1930)
Die ersten Ökonomen
Die moderne Wirtschaftslehre entstand im 18. Jahrhundert, vor allem mit der Veröffentlichung von Der Wohlstand der Nationen (1776) des schottischen Denkers Adam Smith. Das Interesse an diesem Thema wurde jedoch weniger von den Schriften der Ökonomen geweckt als von den gewaltigen Veränderungen in der Wirtschaft mit Beginn der industriellen Revolution. Bereits früher hatten sich Denker über die Kontrolle und Steuerung von Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Gesellschaft geäußert und diese Fragen als Probleme der moralischen und politischen Philosophie behandelt. Aber mit der Entstehung von Fabriken und Massenproduktion begann eine neue Ära der wirtschaftlichen Organisation, die stärker auf das Gesamtergebnis konzentriert war. Dies markierte den Beginn der sogenannten Marktwirtschaft.
Smiths Analyse dieses Systems gab mit einer umfassenden Erklärung des Wettbewerbsmarktes den Standard vor. Smith vertrat die Ansicht, der Markt werde von einer »unsichtbaren Hand« gelenkt und das rationale, von Eigeninteresse geleitete Handeln der Individuen verschaffe der Gesellschaft letztlich genau das, was sie brauche. Smith war ein Philosoph und das Thema seines Buches war die »politische Ökonomie« – welche Wirtschaft, Politik, Geschichte, Philosophie und Anthropologie einschloss. Nach Smith folgten andere ökonomische Denker, die sich ganz und gar auf die Wirtschaft konzentrierten. Sie alle haben zu unserem Verständnis von Wirtschaft beigetragen – wie sie funktioniert und wie sie organisiert werden sollte. Zudem legten sie die Grundlage für die verschiedenen Zweige der Wirtschaftswissenschaft.
Ein Ansatz, die sogenannte »Makroökonomie«, betrachtet die Wirtschaft als Ganzes – auf nationaler wie internationaler Ebene. Hier geht es um Wachstum und Entwicklung, Messung des nationalen Wohlstands in Form von Produktion und Einkommen, internationale Handelspolitik, Steuern sowie die Kontrolle von Inflation und Arbeitslosigkeit. Im Gegensatz dazu steht die »Mikroökonomie« für Interaktionen zwischen Individuen und Firmen innerhalb der Wirtschaft: Angebot und Nachfrage, Kauf und Verkauf, Märkte und Wettbewerb.
Neue Denkansätze
Viele Ökonomen begrüßten den Wohlstand, den die moderne Industriegesellschaft mit sich brachte, und plädierten für eine Haltung des »Laisser-faire«: Allein der Markt mit seinem Wettbewerb sollte für Wohlstand und technische Innovation sorgen. Andere dagegen zögerten, das Wohl der Gesellschaft ausschließlich den Märkten anzuvertrauen. Sie bemerkten Mängel im System und glaubten, diese ließen sich durch staatliche Eingriffe überwinden. Daher plädierten sie für eine Mitwirkung des Staates bei der Bereitstellung bestimmter Güter und Dienstleistungen und für die Einschränkung der Macht der Produzenten. In der Analyse mancher Ökonomen, insbesondere des deutschen Philosophen Karl Marx, war die kapitalistische Gesellschaft mit grundlegenden Fehlern behaftet und nicht überlebensfähig.
Die Vorstellungen der frühen »klassischen« Ökonomen wie Smith wurden einer immer strengeren Prüfung unterzogen. Ende des 19. Jahrhunderts näherten sich Fachleute dem Thema mithilfe der Mathematik, Physik und der Ingenieurswissenschaften. Diese »neoklassischen« Ökonomen erfassten die Wirtschaft mithilfe von Diagrammen und Formeln und entwickelten Gesetze, die das Verhalten der Märkte beschrieben und ihren Ansatz rechtfertigen sollten.
Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich nationale Varianten der Wirtschaftslehre: An den Universitäten entstanden Zentren des ökonomischen Denkens und mit ihnen deutliche Unterschiede zwischen den wichtigsten Strömungen in Österreich, Großbritannien und der Schweiz, vor allem in der Beurteilung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft.
Im 20. Jahrhundert verstärkten sich die Unterschiede. Nach den Revolutionen in Russland und China stand beinahe ein Drittel der Welt unter kommunistischer Herrschaft – mit Planwirtschaft, ohne jeglichen Wettbewerb. Der Rest der Welt fragte sich derweil, ob Märkte allein für ausreichenden Wohlstand sorgen können. Die größte Auseinandersetzung fand in den USA statt, während der Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash an der Wall Street 1929.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts verlagerte sich das Zentrum des ökonomischen Denkens von Europa in die USA, die mittlerweile zur wirtschaftlich beherrschenden Supermacht geworden waren und immer stärker eine Politik des Laisser-faire verfolgten. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 schien es, als habe sich die freie Marktwirtschaft als der richtige Weg zum wirtschaftlichen Erfolg erwiesen. Aber nicht alle waren dieser Ansicht. Zwar glaubte die Mehrzahl der Ökonomen an die Stabilität, die Effizienz und die Vernunft der Märkte, doch manche hegten Zweifel.
»Ökonomie ist im Kern eine Untersuchung über die Wirkung von Anreizen. Es geht dabei um die Frage, wie die Leute bekommen, was sie wollen oder brauchen, besonders wenn andere Leute dasselbe wollen oder brauchen.«
Steven D. Levitt Stephen J. Dubner
US-Ökonomen (geb. 1967 und 1963)
Alternative Ansätze
Ende des 20. Jahrhunderts nahm man in der Wirtschaftslehre Ideen etwa aus der Psychologie und der Soziologie in die Theorien auf – ebenso wie neue Erkenntnisse aus der Mathematik und der Physik wie die Spiel- und die Chaostheorie. Ihre Theoretiker warnten vor Schwächen des kapitalistischen Systems. Die schweren und häufigen Finanzkrisen zu Beginn des 21. Jahrhunderts verstärkten das Gefühl eines grundlegenden Fehlers im System. Gleichzeitig setzte sich die Erkenntnis durch, dass der stetig wachsende wirtschaftliche Wohlstand die Umwelt belastet und seinen Preis in Form eines Klimawandels von wohl katastrophalen Ausmaßen fordern wird.
Europa und die USA müssen sich heute den wohl schwierigsten wirtschaftlichen Problemen ihrer Geschichte stellen. Gleichzeitig entstehen neue Volkswirtschaften, insbesondere in Südostasien und den sogenannten BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika). Die wirtschaftliche Macht verlagert sich erneut und es wird ein neues ökonomisches Denken geben, um die knappen Ressourcen sinnvoll zu verwalten.
Ein Opfer der letzten Wirtschaftskrisen ist Griechenland. Gezeichnet von der globalen Rezession, hohen Haushaltsdefiziten und systembedingten Steuerhinterziehungen wandte sich Griechenland an die Europäische Union und den Internationalen Währungsfonds (IWF). Das angebotene Rettungspaket war mit Sparmaßnahmen verbunden, die die griechische Wirtschaft lahmlegten. 2015 zahlte Griechenland schließlich 1,6 Milliarden Euro an den IWF zurück.
2020 erschütterte die Corona-Pandemie die gesamte Weltwirtschaft. Die Arbeitslosigkeit schnellte hoch, während aufgrund der drastisch verlangsamten globalen Rohstoff- und Warenströme die Verbraucherpreise stark anstiegen.
Heute sieht die Welt ganz anders aus. Zwar werden wirtschaftliches Denken und die Entwicklung von Wirtschaftstheorien traditionell von weißen Männern aus Nordeuropa und den USA dominiert und die Wirtschaftswissenschaften haben erst spät die Arbeit und die Meinungen von Nicht-Europäern und Frauen einbezogen, doch dies ändert sich nun. Eine stärkere Teilhabe kann dazu beitragen, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln und die Bedürfnisse einer vielfältigen Gesellschaft widerzuspiegeln.
»Der Sinn und Zweck des Studiums der Wirtschaftswissenschaften besteht darin … zu lernen, wie man es vermeidet, von Wirtschaftswissenschaftlern übers Ohr gehauen zu werden.«
Joan Robinson
Britische Ökonomin (1903–1983)
EINFÜHRUNG
In den Kulturen der Antike entwickelten sich Systeme zur Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen. Diese frühen Wirtschaftssysteme entstanden auf natürliche Weise: Handwerk und Gewerbe produzierten Güter, die sich zum Austausch eigneten. Die Menschen begannen Handel zu treiben, zunächst als Tauschgeschäft und später mit Münzen aus Edelmetall. Der Handel entwickelte sich zu einem zentralen Bestandteil des Lebens. Jahrhundertelang wurden Waren gekauft und verkauft, ehe jemand danach fragte, wie das System eigentlich funktionierte.
Die Philosophen der griechischen Antike gehörten zu den Ersten, die über die »Ökonomie« schrieben. In Der Staat beschreibt Platon die politische und soziale Gestalt eines idealen Staates, der seiner Ansicht nach ökonomisch funktionieren würde: Spezialisierte Produzenten sollten die Allgemeinheit mit Gütern versorgen. Doch sein Schüler Aristoteles verteidigte das Privateigentum, das es erlaube, auf dem Markt Handel zu treiben. Diese Diskussion setzt sich bis heute fort. Als Philosophen betrachteten Platon und Aristoteles die Ökonomie als Angelegenheit der Moralphilosophie: Statt zu analysieren, wie die Wirtschaft funktionierte, entwickelten sie Ideen, wie sie funktionieren sollte.
Dieser normative Ansatz hat im wirtschaftlichen Denken bis in die christliche Zeit überdauert. Mittelalterliche Philosophen wie Thomas von Aquin versuchten, eine Ethik des Privateigentums und des Handels zu definieren. Thomas von Aquin machte sich Gedanken über die Preismoral, er plädierte für »gerechte« Preise ohne überhöhte Gewinne für die Händler.
In den Gesellschaften der Antike wurde die Arbeit zum großen Teil von versklavten Menschen verrichtet und das mittelalterliche Europa funktionierte nach einem Feudalsystem: Die Bauern wurden von Regionalfürsten geschützt und leisteten dafür Arbeit und Militärdienst. Die Argumente der Philosophen waren daher eher theoretischer Natur.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Aufstieg der Stadtstaaten
Eine wesentliche Veränderung fand im 15. Jahrhundert statt. In Europa entwickelten sich Stadtstaaten, die durch Handel zu Reichtum gelangten. Eine neue, wohlhabende Schicht von Kaufleuten löste die feudalen Landbesitzer als Akteure der Wirtschaft ab. Sie arbeiteten Hand in Hand mit Bankiers, die ihren Handel und ihre Entdeckungsreisen finanzierten.
Neue Handelsnationen ersetzten die kleinräumigen feudalen Wirtschaftsformen, der Austausch von Waren und Geld zwischen den Ländern rückte zunehmend in den Vordergrund. Das wirtschaftliche Denken jener Zeit, bekannt als Merkantilismus, kreiste um die Zahlungsbilanz – die Differenz zwischen dem, was ein Land für Importe ausgibt, und dem, was es durch Exporte einnimmt. Waren im Ausland zu verkaufen, galt als gut, Waren zu importieren, galt als schädlich. Um ein Handelsdefizit zu vermeiden und die Produzenten im Inland gegen Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen, plädierten die Merkantilisten dafür, Importe zu besteuern. Der zunehmende Handel entzog sich immer mehr den einzelnen Kaufleuten. Teilhaberschaften und Kompanien wurden gegründet, häufig mit Unterstützung von Regierungen. Diese Firmen wurden oft in »Anteile« zergliedert, sodass sich mehrere Investoren beteiligen konnten. Das Interesse am Kauf von Anteilen wuchs im späten 17. Jahrhundert schnell, was zur Einrichtung zahlreicher Aktiengesellschaften und Börsen führte.
Eine neue Wissenschaft
Die gewaltige Zunahme des Handels führte zu einem verstärkten Interesse am Funktionieren der Wirtschaft und zur Begründung der Wirtschaftswissenschaft. Sie entstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts, im Zeitalter der Aufklärung, als rationales Denken hoch im Kurs stand. Man suchte einen wissenschaftlichen Zugang zur »politischen Ökonomie«. Die Ökonomen versuchten, die Wirtschaftsaktivität zu messen, und beschrieben das Funktionieren des Systems ohne Rücksicht auf die Moral.
In Frankreich analysierten die »Physiokraten« den Geldfluss in der Wirtschaft und produzierten so das erste makroökonomische Modell. Sie stellten die Landwirtschaft und nicht den Handel oder das Finanzwesen in den Mittelpunkt. Gleichzeitig verlagerten politische Philosophen in Großbritannien den Schwerpunkt von merkantilistischen Vorstellungen hin zu Produzenten und Verbrauchern sowie zum Nutzen und Wert der Waren. Die moderne Wirtschaftswissenschaft begann sich zu entwickeln.
IM KONTEXT
Wirtschaft und Gesellschaft
Aristoteles. (384–322 v. Chr.)
423–347 v. Chr.. Platon argumentiert in Der Staat, die Regenten sollten das Eigentum für das Gemeinwohl verwalten.
1–250 n. Chr.. Im klassischen römischen Recht wird die Summe der Rechte einer Person über eine Sache als dominium bezeichnet.
1265–1274. Thomas von Aquin hält es für natürlich und gut, Eigentum zu besitzen.
1689.. John Locke betont, was man durch eigener Hände Arbeit schaffe, sei rechtmäßiges persönliches Eigentum.
1848.. Karl Marx verfasst das Kommunistische Manifest und setzt sich für die Abschaffung des Privateigentums ein.
Was Eigentum und persönlicher Besitz sind, lernen wir schon aus den Balgereien unserer Kindheit. Wir halten diese Vorstellung für selbstverständlich, sie ist es aber keineswegs. Privateigentum ist eine der Säulen des Kapitalismus. Schon Karl Marx fiel auf, dass der Kapitalismus den Gesellschaften ein gewaltiges Warenangebot zur Verfügung stellt, das sich in Privatbesitz befindet und mit dem Handel getrieben werden kann. Auch Unternehmen sind Privateigentum und funktionieren gewinnbringend auf dem freien Markt. Ohne die Idee des Privateigentums gibt es keinen Spielraum für persönlichen Gewinn – es gibt noch nicht einmal einen Grund, »zu Markte zu gehen«, ja, es gibt überhaupt keinen Markt.
Verteidigung des Privateigentums ist in kapitalistischen Ländern wichtig. Dieses Haus in Warschau (Polen) ist stark gesichert: Auf Knopfdruck verwandelt es sich in einen stählernen Würfel.
Eigentumsformen
»Eigentum« umfasst viele Dinge, von materiellen Gütern bis zu geistigem Eigentum (wie Patente oder Texte). Manche Eigentumsformen würden nicht einmal die Anhänger des freien Marktes verteidigen – etwa die Sklaverei, bei der Menschen als Ware betrachtet wurden.
Historisch gesehen werden materielle Güter auf eine von drei verschiedenen Arten organisiert. Erstens können sie als Gemeineigentum verwaltet werden, das auf der Basis gegenseitigen Vertrauens genutzt wird, wie z. B. heute noch beim Volk der Huaorani im Amazonasgebiet. Zweitens können sie Kollektiveigentum sein – das ist das Wesen des kommunistischen Systems. Die dritte Form ist das Privateigentum. Diese Vorstellung liegt dem Kapitalismus zugrunde.
Moderne Wirtschaftssysteme rechtfertigen das Privateigentum vor allem aus pragmatischen Gründen, da der Markt nicht ohne eine Aufteilung der Ressourcen funktionieren könne. Frühere Philosophen befürworteten das Privateigentum eher aus moralischen Gründen. So vertrat z. B. Aristoteles die Ansicht, Eigentum solle Privatsache sein, denn bei gemeinschaftlichem Besitz übernehme letztlich niemand die Verantwortung. Außerdem könnten Menschen nur großzügig sein, wenn sie etwas zu verschenken hätten.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Ein Recht auf Eigentum
Im Europa des 17. Jahrhunderts befanden sich alles Land und alle Behausungen im Besitz von Königen. Der englische Philosoph John Locke (1632–1704) plädierte jedoch für die Rechte des Individuums: Da Gott uns das Eigentumsrecht über unseren Körper gegeben habe, könnten wir auch frei über die Dinge verfügen, die wir herstellten. Auch Immanuel Kant (1724-1804) hielt Privateigentum für den legitimen Ausdruck der Persönlichkeit.
Ein anderer deutscher Philosoph lehnte später das Privateigentum aber kategorisch ab. Laut Karl Marx eignen sich Kapitalisten die Arbeit der Proletarier an und grenzen sie aus. Kapitalisten bilden so eine exklusive Gruppe, die Macht und Reichtum kontrolliert und zu der Proletarier keinen Zugang haben.
»Es ist also offenbar besser, dass der Besitz privat bleibt, aber durch die Benutzung gemeinsam wird. Dass aber die Bürger sich dementsprechend verhalten, ist die besondere Aufgabe des Gesetzgebers.«
Aristoteles
Wie privat?
In jeder modernen Gesellschaft werden manche Dinge gemeinsam genutzt, beispielsweise Parks und Straßen. Andere Dinge wie Autos sind Privatbesitz. Das Eigentumsrecht an einer bestimmten Ressource räumt dem Eigentümer normalerweise die ausschließlichen Verfügungsrechte darüber ein, aber es gibt auch Ausnahmen. Ein Haus in der Altstadt darf oft beispielsweise selbst vom Eigentümer nicht einfach abgerissen und durch einen Wolkenkratzer oder eine Fabrik ersetzt werden. Die Regierungen aller Länder der Welt behalten sich das Recht vor, im Notfall private Eigentumsansprüche außer Kraft zu setzen. Die Gründe können eine Infrastrukturmaßnahme sein oder auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Selbst in den USA, einer streng kapitalistischen Nation, kann die Regierung Eigentümer zwingen, ihre Rechte abzutreten. Immerhin muss er dafür mit dem Marktpreis entschädigt werden.
Siehe auch:Märkte und Moral.•Öffentliche Güter und Dienstleistungen.•Marxistische Wirtschaft.•Definitionen von Wirtschaft
IM KONTEXT
Gesellschaft und Wirtschaft
Thomas von Aquin. (1225–1274)
Um 350 v. Chr.. Aristoteles schreibt in Die Politik, dass der Wert der Güter am Bedarf gemessen werden solle.
529–534 n. Chr.. Römische Gerichte sorgen dafür, dass Grundeigentümer für ihr Land den »gerechten Preis« erhalten.
1544.. Der Spanier Luis Saravia de la Calle meint, Preise sollten durch »allgemeine Schätzung« von Menge und Qualität festgelegt werden.
1890.. Alfred Marshall schlägt vor, Preise sollten sich durch Angebot und Nachfrage bilden.
1920.. Ludwig von Mises hält den Sozialismus für nicht funktionsfähig, weil der Bedarf nur durch den Preis feststellbar sei.
Viele Menschen wissen, was es bedeutet, »über den Tisch gezogen« oder »abgezockt« zu werden, beispielsweise in bekannten Touristenorten. Trotzdem gibt es der vorherrschenden Wirtschaftstheorie zufolge keine Abzocke. Alle Preise sind Marktpreise – eben das, was die Menschen zu zahlen bereit sind. Für Marktwirtschaftler haben Preise keine moralische Dimension: Sie betrachten die Preisbildung als das automatische Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Kaufleute, die dem Anschein nach zu viel verlangen, gehen nur bis an die äußerste Grenze. Treiben sie den Preis zu hoch, kaufen die Kunden die Ware nicht mehr und der Preis muss wieder gesenkt werden. Für Marktwirtschaftler ist der freie Markt das einzige Mittel zur Preisgestaltung, weil nichts – nicht einmal Gold – an sich einen Wert hat.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Im Mittelalter reagierte man empfindlich auf irreguläre Preisgestaltung: 1321 wurde William le Bole aus London durch die Straßen geschleift, weil er zu leichtes Brot verkauft hatte.
Aus freien Stücken
Eine völlig andere Auffassung vertritt der sizilianische Gelehrte Thomas von Aquin in seiner Summa Theologica, einer der ersten Marktstudien. Für den gelehrten Mönch waren Preise eine zutiefst moralische Angelegenheit. Er betrachtete Habgier als Todsünde. Gleichzeitig war ihm klar, dass Händler aufhören Handel zu treiben, wenn sie den Profit als Anreiz verlieren. Dann erhielte die Gemeinschaft nicht die Güter, die sie braucht.
Thomas von Aquin schloss daraus, dass Händler berechtigt seien, einen »gerechten Preis« zu fordern – mit einem anständigen Profit, aber ohne sündhaften Wucher. Dieser gerechte Preis sei der Preis, den der Käufer aufgrund ehrlicher Information freiwillig zu zahlen bereit sei. Auf künftige Ereignisse, die den Preis verringern könnten, müsse der Käufer jedoch nicht aufmerksam gemacht werden.
Die Frage einer moralischen Preisgestaltung spielt auch heute noch eine große Rolle. Ökonomen und Öffentlichkeit diskutieren »den gerechten Preis«, den Banker für ihre Arbeit verlangen dürfen, oder auch das Problem eines Mindestlohns. Verfechter einer freien Marktwirtschaft, die Einmischungen in den Markt ablehnen, und Befürworter von Eingriffen der Regierung diskutieren unablässig über das Für und Wider einer Preisregulierung.
»Also darf keiner dem andern ein Ding teurer verkaufen, als es wert ist.«
Thomas von Aquin
Thomas von Aquin
Der heilige Thomas von Aquin war einer der bedeutendsten Gelehrten des Mittelalters. Er wurde 1225 in Aquino (Sizilien) als Sohn einer Adelsfamilie geboren und begann früh mit dem Lernen. Mit 17 beschloss er, weltlichen Besitztümern zu entsagen, und schloss sich einem Orden armer Dominikanermönche an. Seine Familie war so schockiert, dass sie ihn entführen ließ und zwei Jahre gefangen hielt. Sein Entschluss stand jedoch fest. Schließlich gab die Familie nach und ließ ihn nach Paris ziehen, wo er bei dem Gelehrten und Mönch Albertus Magnus (1206–1280) in die Lehre ging. Von Aquin lernte und lehrte in Frankreich und Italien. 1272 begründete er ein studium generale (eine Art Universität) in Neapel (Italien). Seine philosophischen Werke gelten als Wegbereiter der Moderne.
Hauptwerke
1256–1259.Über die Wahrheit
1261–1263.Summa contra gentiles
1265–1273.Summa Theologica
Siehe auch:Eigentumsrechte.•Die freie Marktwirtschaft.•Angebot und Nachfrage.•Wirtschaft und Tradition
IM KONTEXT
Bank- und Finanzwesen
Kublai Khan. führt im 13. Jh. im mongolischen Reich das Fiatgeld ein.
3000 v. Chr.. In Mesopotamien dient der Schekel als Währung: Eine Gewichtseinheit Gerste entspricht einem bestimmten Gold- oder Silberwert.
700 v. Chr.. Auf der griechischen Insel Ägina werden die ältesten bekannten Münzen hergestellt.
13. Jh.. Marco Polo bringt Schuldscheine aus China mit nach Europa.
1696.. Als erste Privatnotenbank gibt die Bank of Scotland Banknoten aus.
1971.. US-Präsident Nixon hebt die Konvertierbarkeit des US-Dollars in Gold auf.
In vielen Ländern geht der Trend hin zur bargeldlosen Gesellschaft, in der Waren nur noch per Kreditkarte, elektronischer Überweisung oder Handy gekauft werden. Auf Bargeld zu verzichten bedeutet nicht, dass gar kein Geld mehr benutzt wird. Im Kern geht es bei allen Transaktionen immer um Geld.
In religiösen Riten wird Geld als Zeichen des Respekts oder zur Dekoration verwendet. Mit »Blutgeld« zahlt man für einen Mord, Bräute können eine Mitgift erhalten. Geld verleiht Status und Macht.
Tauschhandelswirtschaft
Ohne Geld konnten die Menschen nur tauschen. Viele von uns betreiben heute noch eine Art Tauschhandel, wenn wir Gefälligkeiten erwidern und beispielsweise im Gegenzug für die Kinderbetreuung die Haustür des Nachbarn reparieren. Im großen Rahmen ist ein solcher Austausch aber schwierig. Was ist, wenn jemand einen Laib Brot haben möchte, aber nur das neue Auto zum Tauschen hat? Beim Tauschhandel müssen Bedürfnisse genau zusammenpassen. Die anderen müssen haben, was ich brauche, und ich muss haben, was sie brauchen.
Geld löst diese Probleme. Wenn Waren bezahlt werden, kann man das Geld nehmen und selbst woanders das kaufen, was man braucht. Geld ist übertragbar und die Verwendung aufschiebbar. Ohne den flexiblen Austausch, den das Geld ermöglicht, wären nach Meinung vieler Fachleute keine hoch entwickelten Kulturen entstanden. Zudem dient Geld als Maßstab für den Wert der Dinge. Wenn alle Güter einen Gegenwert in Geld haben, kann man ihre Preise vergleichen.
Die Volksgruppe der Tiwa aus Assam (Indien) treibt Tauschhandel bei der Jonbeel Mela, einem uralten Fest zur Wahrung der Freundschaft zwischen den Volksgruppen.
Verschiedene Arten Geld
Es gibt zwei Arten Geld: Primitivgeld und Fiatgeld. Primitivgeld hat neben dem festgelegten Tauschwert einen inneren Wert, wenn z. B. Goldmünzen als Währung eingesetzt werden. Fiatgeld, das zuerst im 10. Jahrhundert in China in Umlauf kam, ist dagegen ein an sich wertloses Tauschmittel, dessen Wert nur gesetzlich festgelegt wird. Geldscheine sind Fiatgeld.
Viele Papierwährungen waren ursprünglich durch Goldreserven abgesicherte »Zahlungsversprechen«. Theoretisch konnten früher Dollarnoten der US-Notenbank gegen ihren Goldwert eingetauscht werden. Seit 1971 ist das jedoch nicht mehr der Fall. Fiatwährungen beruhen auf dem Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität ihrer Länder. Diese ist allerdings nicht immer sicher.
Seit 2009 gibt es die sogenannten »Kryptowährungen«. Diese elektronischen Einheiten eines virtuellen Geldes werden nicht von einer Regierung ausgegeben und oft für illegale Geschäfte verwendet.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Perlen – zum Bezahlen
Wampum waren Ketten aus weißen oder schwarzen Muschelperlen, die von den nordamerikanischen Ureinwohnern in den Wäldern im Osten des Kontinents geschätzt wurden. Vor dem Eintreffen der europäischen Siedler im 15. Jahrhundert hatten sie überwiegend zeremonielle Bedeutung. Man tauschte sie aus, um Übereinkünfte zu besiegeln oder Tribute zu entrichten.
Als die Europäer kamen, revolutionierten ihre Werkzeuge die Wampum-Herstellung, sodass die holländischen Kolonisten die Perlen gleich millionenweise produzieren konnten. Bald verwendeten sie die Wampum, um Dinge von den Einheimischen zu kaufen. So wurde daraus eine Währung mit einem Wechselkurs. In New York entsprachen acht weiße oder vier schwarze Wampum einem Stuiver (einer holländischen Münze aus jener Zeit). Ab den 1670er-Jahren wurden die Wampum-Perlen seltener verwendet und ihr Wert sank.
Diese Shawnee-Schultertasche ist mit Wampum-Perlen besetzt. Einige nordamerikanische Völker setzten die Perlen als Währung ein.
Siehe auch:Finanzdienstleistungen.•Die Geldmengentheorie.•Das klassische Wertparadoxon
IM KONTEXT
Finanz- und Bankwesen
Die Familie Medici. (1397–1494)
13. Jh.. Die Scholastiker verurteilen den Zinswucher.
1873.. Der britische Journalist Walter Bagehot drängt die Bank of England, bei Liquiditätsengpässen im Bankensystem einzuspringen.
1930.. In Basel (Schweiz) wird die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gegründet. Es entstehen internationale Regeln für das Bankwesen.
1992.. Der US-Ökonom Hyman Minsky veröffentlicht das Buch Die Hypothese der finanziellen Instabilität, das sich auch zur Erklärung der Finanzkrise 2007/08 als nützlich erweist.
Das Leihwesen ist so alt wie die Menschheit. Solche Geschäftsbeziehungen gab es bereits vor 5000 Jahren in Mesopotamien (dem heutigen Irak). Aber moderne Banken entstanden erst vor rund 600 Jahren in Norditalien. Das italienische Wort banca bezeichnete ursprünglich die Bank, auf der die Geldverleiher saßen.
Im 14. Jahrhundert war Italien in lauter Stadtstaaten gegliedert, die vom Einfluss und den Einnahmen des Heiligen Stuhls in Rom profitierten. Die Halbinsel lag ideal für den Handel zwischen Asien, Afrika und den aufstrebenden europäischen Nationen. Der Wohlstand stieg, besonders in Venedig und Florenz. Venedig bot als Seemacht Möglichkeiten, um Reisen zu finanzieren und zu versichern. In Florenz konzentrierte man sich dagegen auf den Handel mit Nordeuropa. Hier trafen Kaufleute und Bankiers im Banco Medici zusammen.
Florenz war auch die Heimat anderer Bankiersfamilien, z. B. der Peruzzi und der Bardi, sowie verschiedenster Finanzdienstleister – von Pfandleihern bis zu örtlichen Banken, die Handel mit fremden Währungen trieben, Spareinlagen annahmen und regionalen Unternehmen Kredite gewährten. Die Bank, die Giovanni di Bicci de’ Medici 1397 gründete, finanzierte den Fernhandel und unterschied sich von den bestehenden Banken gleich dreifach.
Erstens wurde der Banco Medici sehr groß. In der Blütezeit unter dem Sohn des Gründers, Cosimo, unterhielt er Filialen in elf Städten, darunter London, Brügge und Genf. Zweitens war das Filialnetz dezentralisiert. Die Zweigstellen wurden nicht von einem Angestellten geleitet, sondern von einem Juniorpartner vor Ort, der an den Gewinnen beteiligt war. Die Medici-Familie in Florenz betreute das Netzwerk, strich den größten Gewinn ein und hielt den Namen der Familie hoch – wichtig für den soliden Ruf der Bank. Drittens nahmen die Filialen große Geldeinlagen von reichen Sparern an. Damit konnten bereits bei bescheidenem Anfangskapital langfristige Kredite vergeben werden – auf diese Weise vervielfachten sich die Gewinne der Bank.
Die Handelsbanken im späten 14. Jh. nahmen Spareinlagen an, vergaben Kredite und tauschten Währungen. Außerdem zogen sie gefälschte oder verbotene Münzen aus dem Verkehr.
Bankwirtschaft
Diese Aspekte der Erfolgsgeschichte der Medici entsprechen drei ökonomischen Konzepten, die heute im Bankwesen von großer Bedeutung sind. Das erste ist die sogenannte Betriebsgrößenersparnis. Den Einzelnen kommt es teuer, einen Darlehensvertrag abzuschließen, Banken können dagegen 1000 solche Verträge zu einem Bruchteil der Kosten pro Vertrag ausfertigen lassen. Geldgeschäfte (mit Bareinlagen) sind etwas für Großunternehmen. Das zweite ist die Anlagenstreuung. Die Medici hielten das Risiko fauler Kredite gering, indem sie die Kreditvergabe räumlich großzügig verteilten. Da die Juniorpartner an Gewinn und Verlust beteiligt waren, ließen sie bei der Darlehensvergabe Vorsicht walten – ja, sie übernahmen ein Teil des Risikos der Medici. Der dritte Grundgedanke ist die Vermögensumwandlung«. Manche Händler benötigen einen sicheren Aufbewahrungsort für ihr Gold. Andere brauchen einen Kredit – was für die Bank riskant ist und das Geld oft längerfristig bindet. So steht die Bank zwischen zwei Erfordernissen: »kurzfristig Geld aufzunehmen und langfristig Kredite zu vergeben.« Am Ende ist allen gedient – den Sparern, den Kreditnehmern und natürlich der Bank, die sich das Geld ihrer Kunden ausleiht, um Kredite zu vergeben (Leverage-Effekt), und die auf diese Weise ihre Profite vervielfacht.
Doch diese Praxis macht eine Bank auch angreifbar. Wenn sehr viele Anleger gleichzeitig ihr Geld zurückfordern, kann sie möglicherweise nicht alle auszahlen, weil sie die Spareinlagen in langfristige Kredite investiert und nur einen kleinen Teil des angelegten Geldes zurückbehalten hat. Dieses kalkulierte Risiko geht eine Bank ein.
Im Europa des 14. Jahrhunderts war die Finanzierung des Fernhandels äußerst riskant – vor allem wegen der weiten Entfernungen und der damit verbundenen Reisedauer. Folglich gab es ein »grundsätzliches Problem des Austausches«: Es bestand die Gefahr, dass einer der Partner nach Geschäftsabschluss mit den Waren oder dem Geld verschwinden würde. Daher entwickelte man den Wechsel. Dieses Papier bezeugte das Versprechen des Käufers, für die Waren bei ihrem Eintreffen in einer bestimmten Währung zu bezahlen. Der Verkäufer konnte, wenn er wollte, den Wechsel sofort verkaufen, um an Geld zu gelangen. Italienische Handelsbanken entwickelten ein besonderes Geschick im Umgang mit Wechseln. So entstand ein internationaler Geldmarkt.
Durch den Kauf eines Wechsels übernahm die Bank das Risiko, dass der Käufer am Ende nicht bezahlte. Daher mussten Banken gut beurteilen können, wer vermutlich zahlen würde und wer nicht. Der Geldverleih, ja, die Finanzwirtschaft insgesamt, setzt ein sensibles Spezialwissen voraus: Fehlende Informationen können ernste Probleme nach sich ziehen. Meist brauchen genau die Leute einen Kredit, die ihn eher nicht zurückzahlen können. Und wenn sie ihn erhalten, sind sie versucht, nicht zu zahlen. Die wichtigste Aufgabe einer Bank besteht darin, Kredite klug zu vergeben und die Kreditnehmer im Auge zu behalten, um moralisches Fehlverhalten abzuwenden.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Wechsel wie dieser von 1713 entwickelten sich später zum Bankscheck – beide sind ein Versprechen, dem Überbringer einen festgelegten Betrag auszuzahlen.
Konzentration an einem Ort
Banken ballen sich häufig an einem Ort zusammen, um Informationen und Kompetenzen zu maximieren. Das erklärt die Entstehung von Finanzdistrikten in Großstädten. Ökonomen bezeichnen dies als »Netzwerkeffekt«: Alle Banken ziehen Nutzen daraus. Florenz war eine solche Ansammlung von Banken. Die Londoner City entwickelte sich zu einer weiteren. Früh im 19. Jahrhundert wurde die entlegene Inlandsprovinz Shanxi zum führenden Finanzzentrum Chinas. Heute ermöglicht das Internet die Entstehung solcher Ballungsräume auch online und Kryptowährungen brauchen für ihre dezentralen Transaktionen keine Bank mehr; Überweisungen werden anonym über Grenzen hinweg getätigt.
Spezialisierung hat Vorteile, darum gibt es so viele verschiedene Arten von Banken – für Spareinlagen, zur Finanzierung von Häusern, Kraftfahrzeugen und so weiter. Die Form einer Bank kann sich auch nach anderen Aspekten richten. Bei Genossenschaftsbanken sind z. B. die Mitglieder gleichzeitig Miteigner. Sie entstanden im 19. Jahrhundert, in einer Zeit der sozialen Veränderungen, um das Vertrauen zwischen der Bank und ihren Kunden zu verbessern. Da die Mitglieder dieser Organisationen sich gegenseitig kontrollierten und die Manager sich vor Ort gut auskannten, konnten sie die langfristigen Kredite vergeben, die ihre Kunden brauchten. In manchen Ländern, auch in Deutschland, florierten die Genossenschaftsbanken.
Doch die Zusammenballung führt manchmal auch zu riskantem Wettbewerb und unerwünschtem Verhalten. Da die Banken eine Rolle bei der Vermögensumwandlung spielen, ist für sie ein guter Ruf sehr wichtig: Sie wandeln Spareinlagen in Kredite um – und die sind riskanter, länger festgelegt und weniger leicht zu verflüssigen.
Schlechte Nachrichten können eine Panik auslösen. Der Zusammenbruch einer Bank hat oft massive Folgen für andere Banken, für den Staat und für die Gesellschaft – wie beim Scheitern des Creditanstalt-Bankvereins in Österreich 1931. Es kam zu einem Run auf die deutsche Mark, auf das britische Pfund und schließlich auf den US-Dollar, sodass sogar Banken in den USA in Mitleidenschaft gezogen wurden. Daher müssen Banken reguliert werden, und in den meisten Ländern gelten strenge Regeln für die Gründung einer Bank.
»Ein Banker leiht dir seinen Regenschirm, wenn die Sonne scheint, will ihn aber sofort wiederhaben, wenn es anfängt zu regnen.«
Mark Twain
US-amerikanischer Schriftsteller (1835–1910)
Eine Bankenkrise im 21. Jahrhundert
Die globale Finanzkrise von 2007 hat ein Umdenken zur Folge. Sie wurde vor allem durch zu hohe Fremdkapitalaufnahme ausgelöst. Um 1900 durften etwa drei Viertel der Vermögenswerte einer Bank durch Kredite finanziert sein. 2007 lag der Wert oft bei 95–99 Prozent. Ihre Begeisterung für Finanzwetten auf künftige Marktentwicklungen – die Derivate – machte die Banken abhängiger von Fremdkapital und das Risiko wuchs. Interessanterweise folgte die Krise auf eine Zeit der Deregulierung. Innovative Finanzprodukte machten den Markt lukrativ, führten aber auch zu negativen Kreditvergabepraktiken: in Form von Hypotheken an finanzschwache US-Familien und in Form von Investitionen in Anleihen, die von den Ratingagenturen zu hoch bewertet wurden. Seit den Medici gibt es für Banken drei immer gleiche Probleme: zu wenig Information, finanzielle Anreize und Risiko.
Hypothekenvergabe an Personen, die sie nicht zurückzahlen konnten, führte zu einer Welle von Enteignungen und zur Finanzkrise von 2007/08.
Finanzierungsmöglichkeiten
Das Bankwesen bildet den größten Teil des Finanzmarkts, auf dem es immer darum geht, Menschen, die mehr Geld haben, als sie brauchen, mit Personen zusammenzubringen, die mehr Geld brauchen, als sie haben und es produktiv einsetzen wollen. Börsen stellen hier die direkte Verbindung her – durch Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und andere Instrumente.
Börsen sind entweder reale Orte, wie z. B. die New York Stock Exchange, oder regulierte Märkte, auf denen der Handel per Telefon und Computer stattfindet. Der vorrangige Handel an den Börsen macht langfristige Anlagen flexibler: Sie lassen sich leicht wieder verkaufen und zu Geld machen. Spareinlagen können gebündelt werden, um Transaktionskosten zu senken und das Risiko zu streuen. Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungen – sie alle spielen dabei eine Rolle.
Die Londoner City gilt schon seit sehr langer Zeit als das weltweit größte Zentrum für Devisenhandel. Allerdings wirkt sich der Brexit negativ auf diese Führungsposition aus.
Siehe auch:Aktiengesellschaften.•Financial Engineering.•Marktunsicherheit.•Finanzkrisen.•Bankenansturm
IM KONTEXT
Die Makroökonomie
Jean Bodin. (1530–1596)
1492.. Christoph Kolumbus erreicht Amerika. Silber und Gold fließen nach Spanien.
1752.. David Hume stellt fest, dass die Geldmenge in direkter Beziehung zum Preisniveau steht.
1911.. Irving Fisher erstellt eine mathematische Formel für die Quantitätstheorie des Geldes.
1936.. John Maynard Keynes behauptet, die Geschwindigkeit der zirkulierenden Geldmenge sei unbeständig.
1956.. Milton Friedman sagt, die Veränderung der Geldmenge könne einen vorhersagbaren Effekt auf das Einkommen der Menschen haben.
Im Europa des 16. Jahrhunderts stiegen die Preise auf unerklärliche Weise. Manche führten es darauf zurück, dass die Regenten die Währungen »verdarben«, da sie Münzen mit immer geringerem Gold- und Silbergehalt prägten. Das traf auch zu, doch laut dem französischen Anwalt Jean Bodin geschah gleichzeitig etwas viel Bedeutenderes.
1568 veröffentlichte Bodin seine Reaktionen auf die Paradoxien des Herrn von Malestroit. Der französische Ökonom Jean de Malestroit (gest. 1578) hatte die Preisinflation ausschließlich der Geldentwertung zugeschrieben, aber Bodin zeigte, dass die Preise deutlich anstiegen, selbst wenn sie in reinem Silber gemessen wurden. Er machte das Überangebot an Gold und Silber dafür verantwortlich, das aus den amerikanischen Kolonien nach Spanien gelangte und sich von dort in ganz Europa verbreitete.
Bodins Berechnungen der Münzgeldzunahme waren bemerkenswert genau. Spätere Ökonomen erkannten, dass sich die Preise in Europa während des 16. Jahrhunderts vervierfachten, während sich die Gold- und Silbermenge verdreifachte. Auch Bodin hatte die Edelmetallzunahme auf das mehr als 2,5-Fache geschätzt. Er verwies noch auf andere Faktoren hinter der Inflation: die Nachfrage nach Luxusgütern, eine Verknappung des Warenangebots aufgrund von Exporten und Verschwendung, habgierige Kaufleute, die mit Monopolen das Angebot künstlich niedrig hielten, und eben die Herrscher, die die Münzen verdarben.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Jean Bodin
Als Sohn eines Schneidermeisters wurde Jean Bodin 1530 in Angers (Frankreich) geboren. Seine Ausbildung erhielt er in Paris und Toulouse. 1560 wurde er in Paris als Anwalt zugelassen. Bodins Tätigkeit als Gelehrter – er hielt Vorlesungen in Jura, Geschichte, Politik, Philosophie, Wirtschaft und Religion – erregte die Aufmerksamkeit des Königs.
1576 heiratete er Françoise Trouilliart und trat die Nachfolge seines Schwiegervaters als Staatsanwalt im nordfranzösischen Laon an. 1589 wurde Heinrich III. ermordet und es kam zum Religionskrieg. Bodin, der eigentlich eine tolerante Haltung befürwortete, musste sich auf die Seite der Katholiken schlagen, bis der siegreiche protestantische König Heinrich IV. die Herrschaft über Laon übernahm. 1596 starb Bodin im Alter von 66 Jahren an der Pest.
Hauptwerke
1566..Die Methode zum leichten Begreifen der Geschichte
1568..Reaktionen auf die Paradoxien des Herrn von Malestroit
1576..Sechs Bücher über den Staat
Die Geldmenge
Bodin war nicht der Erste, der die Wirkung des neuen Reichtums aus Amerika – und damit der Geldmenge – auf die Preise erkannte. 1556 hatte der spanische Theologe Martín de Azpilcueta (auch bekannt als Navarrus) den gleichen Schluss gezogen. Doch Bodins Aufsatz befasste sich zudem mit dem Geldangebot und der Geldnachfrage, mit der Art, wie diese beiden Seiten der Wirtschaft funktionieren, und damit, wie Störungen in der Geldversorgung zur Inflation führen. Seine Untersuchung gilt als die erste Darlegung der Geldmengentheorie.
Die Logik dieser Theorie beruht zum Teil auf dem gesunden Menschenverstand. Warum kostet eine Tasse Kaffee in reichen Stadtvierteln deutlich mehr als in armen? Weil die Kunden dort mehr Geld haben. Wird die Geldmenge in den Taschen der Bevölkerung eines ganzen Landes verdoppelt, ist es nur natürlich, dass die Leute ihre erhöhte Kaufkraft einsetzen wollen, um mehr Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Aber Waren und Dienstleistungen sind immer begrenzt. Es gibt also zu viel Geld und die Preise steigen.
Diese Ereigniskette zeigt die wichtige Beziehung zwischen der Geldmenge in einer Wirtschaft und dem allgemeinen Preisniveau. Die Geldmengentheorie besagt, dass eine Verdoppelung der Geldmenge zu einer Verdoppelung des Wertes der Transaktionen (oder der Einkommen oder der Ausgaben) führt. In der extremen Form der Theorie führt eine Verdoppelung des Geldes zu einer Verdoppelung der Preise, aber nicht des realen Wertes. Geld verhält sich gegenüber dem echten, relativen Wert von Waren und Dienstleistungen neutral – z. B. in der Frage, wie viele Jacken man für den Preis eines Computers erhält.
Realpreis und Nominalpreis
Viele Ökonomen entwickelten später Bodins Gedanken weiter. Sie stellten einen klaren Unterschied zwischen Realwirtschaft und Geldwirtschaft fest. Nominale Preise sind einfach nur Geldpreise, die sich mit der Inflation ändern können. Darum konzentrieren sich die Ökonomen auf die realen Preise – darauf, wie viel von einer Sache (Jacken, Computer oder Arbeitszeit) gegen eine andere eingetauscht werden muss, unabhängig davon, wie hoch ihr nominaler Preis ist. In der extremen Geldmengentheorie können Veränderungen in der Geldmenge zwar die Preise beeinflussen, aber das hat keine Auswirkungen auf die tatsächlichen ökonomischen Variablen wie Output oder Arbeitslosigkeit. Außerdem ist Geld selbst eine »Ware«: Die Menschen wollen es wegen seiner Kaufkraft besitzen.
»Der Reichtum an Gold und Silber … ist in diesem Königreich heute größer denn je in den letzten 400 Jahren.«
Jean Bodin
Die Fisher-Gleichung
Die umfassendste Darstellung der Geldmengentheorie stammt von dem US-Ökonomen Irving Fisher (1867–1947). Er verwendete die Formel MV=PT. P ist hier das allgemeine Preisniveau und T sind die Transaktionen im Laufe eines Jahres. PT ist also der Gesamtwert der Transaktionen in einem Jahr. M ist die verfügbare Geldmenge, die immer wieder eingesetzt werden kann. Nun fehlt noch eine letzte Größe für den Geldumlauf: V ist die Geschwindigkeit, mit der das Geld durch die Wirtschaft zirkuliert.
Aus dieser Gleichung wird eine Theorie, wenn wir Annahmen über die Beziehungen zwischen den Buchstaben machen. Ökonomen tun das gleich dreifach. Zunächst betrachten sie V, die Geschwindigkeit des Geldes, als konstant. Wie wir unser Geld verwenden, ist Gewohnheitssache und ändert sich nicht sonderlich von Jahr zu Jahr. Zweitens gehen sie davon aus, dass T, die Anzahl der Transaktionen in einer Volkswirtschaft, ausschließlich von der Nachfrage der Verbraucher und der Technologie der Hersteller gesteuert wird, die gemeinsam den Preis bestimmen. Drittens rechnen sie damit, dass es einmalige Veränderungen an M (der Geldmenge) geben kann, wie den Zustrom von Edelmetallen aus der Neuen Welt nach Europa. Wenn V und T feststehende Größen sind, folgt daraus, dass eine Verdoppelung der Geldmenge zu einer Verdoppelung der Preise führt.
Zusammen mit den Nominalund Realpreisen führte die Geldmengentheorie zu der Vorstellung, dass Geld in seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft neutral sei.
Irving Fisher veranschaulichte die Geldmengentheorie anhand des Bildes einer Waage. Nimmt die Geldmenge zu, wird der Sack schwerer und die Warenpreise werden angehoben. Sie müssen also nach rechts rutschen, um die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Zweifel und Überarbeitung
Aber ist Geld wirklich neutral? Kaum jemand hält dies auf kurze Sicht für zutreffend. Die unmittelbare Auswirkung von Bargeld ist, dass man es für reale Waren und Dienstleistungen ausgibt. Laut John Maynard Keynes mag Geld auf lange Sicht durchaus neutral sein, aber kurzfristig ändert es reale Variablen wie Output und Arbeitslosigkeit. Alles deutet außerdem darauf hin, dass die Geldgeschwindigkeit (V) nicht konstant ist. Sie scheint sich hochzuschaukeln, wenn die Inflation hoch ist. In Rezessionszeiten mit niedriger Inflationsrate sinkt sie dagegen ab.
Keynes’ Vorstellungen stellten die Geldmengentheorie infrage: Geld dient nicht nur als Tauschmittel, sondern auch als Wertspeicher. Man kann es für einen späteren Kauf, als Unterpfand für harte Zeiten oder für künftige Investitionen aufbewahren. Keynesianer sind der Ansicht, dass diese Motive nicht so sehr von Einkommen oder Transaktionen (PT in der Formel) beeinflusst werden, sondern vielmehr durch die Zinsen. Ein Anstieg der Zinsen führt zu einem Anstieg der Geldgeschwindigkeit.
1956 verteidigte der US-Ökonom Milton Friedman die Geldmengentheorie: Der Bedarf des Einzelnen an realem Guthaben sei vom Wohlstand abhängig, denn das Einkommen der Menschen erzeuge diese Nachfrage.
Jahrelang kauften die Zentralbanken Staatsschulden, um mehr Geld in das Bankensystem zu pumpen. Zinsen blieben somit niedrig und Investitionen und Arbeitsplätze wurden gefördert, ohne die Inflation anzuheizen. Zwar tätigen Banken solche Käufe heute seltener, sie steuern aber immer noch die Zinssätze, um Preisstabilität und Wirtschaftswachstum zu erhalten.
Dieses Gemälde des niederländischen Malers Pieter Bruegel (1559) zeigt Vagabunden und reiche Leute in der Fastenzeit dicht beieinander. Hohe Preise führten im 15. Jh. zu großem Elend und zu Bauernaufständen.
»Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen.«
Milton Friedman
Siehe auch:Die Funktion des Geldes.•Der keynesianische Multiplikator.•Monetaristische Politik.•Inflation und Arbeitslosigkeit
IM KONTEXT
Weltwirtschaft
Thomas Mun. (1571–1641)
Um 1620.. Gerard de Malynes meint, England solle den Devisenhandel so regulieren, dass Gold und Silber nicht mehr ins Ausland abfließen könnten.
1691.. Der englische Kaufmann Dudley North betrachtet den Konsum als die Hauptquelle für größeren nationalen Wohlstand.
1791.. Der US-Finanzminister Alexander Hamilton plädiert dafür, junge Industriezweige zu schützen.
1817.. Der britische Ökonom David Ricardo argumentiert, der Außenhandel komme allen Nationen zugute.
1970er-Jahre. US-Ökonom Milton Friedman vertritt die Ansicht, der Freihandel helfe den Entwicklungsländern.
In den letzten 50 Jahren finden sich unter den Ökonomen zahlreiche Verfechter des Freihandels. Sie argumentieren, nur durch die Aufhebung von Handelsschranken könnten Waren und Geld frei um die Welt zirkulieren und die globalen Märkte sich entfalten. Andere stimmen dem nicht zu. Ihrer Meinung nach sind Arbeitsplätze und Wohlstand gefährdet, wenn im Handel zwischen zwei Staaten zu großes Ungleichgewicht herrscht.
Die merkantilistische Sicht der Dinge
Die Diskussion um den Freihandel reicht zurück bis in die Zeit des Merkantilismus, die im 16. Jahrhundert begann und bis ins späte 18. Jahrhundert andauerte. Mit dem Aufstieg des niederländischen und englischen Seehandels begann die Verlagerung des Wohlstands von Südeuropa nach Norden.
Gleichzeitig traten zu dieser Zeit die Nationalstaaten auf den Plan, zusammen mit der Vorstellung vom Wohlergehen der Nation, das an der Größe des »Staatsschatzes« (an Gold und Silber) gemessen wurde. Die Merkantilisten glaubten, die Welt lebe aus einem »begrenzten Topf«, daher sei der Wohlstand einer Nation abhängig von einer günstigen »Handelsbilanz«, bei der mehr Gold zufließt als ausgegeben wird. Fließt zu viel Gold ab, sinkt der Wohlstand der Nation, die Löhne fallen und Arbeitsplätze gehen verloren. England versuchte, den Abfluss von Gold durch Luxusgesetze einzuschränken, die darauf abzielten, den Konsum ausländischer Waren einzuschränken.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Malynes und Mun
Gerard de Malynes (1586–1641), ein englischer Experte für Devisenhandel, plädierte für eine Beschränkung der abfließenden Goldmenge. Wenn zu viel abfloss, so argumentierte er, verfalle der Wert der englischen Währung.
Doch der bedeutendste merkantilistische Theoretiker Englands, Thomas Mun, hielt dagegen, dass es nicht so sehr darauf ankomme, ob Zahlungen im Ausland erbracht würden, sondern darauf, wie Handel und Zahlungen einander letztendlich ausglichen. Mun wollte zwar den Export fördern und den Import durch sparsamen Verbrauch von inländischen Produkten reduzieren. Aber er sah kein Problem darin, Gold im Ausland auszugeben, wenn es zum Ankauf von Waren diente, die dann für eine umso größere Summe re-exportiert wurden. Das kurbelte den Handel an, gab den Reedern Arbeit und vergrößerte den Staatsschatz.
Thomas Mun
Thomas Mun wurde 1571 geboren und wuchs in einer reichen Londoner Kaufmannsfamilie auf. Sein Vater starb, als er drei war, und seine Mutter heiratete Thomas Cordell, einen späteren Direktor der Ostindien-Kompanie. Mun begann seine Karriere als Kaufmann im Mittelmeerraum. 1615 wurde er Direktor der Ostindien-Kompanie. Seine Vorstellungen entwickelte er, um die Kompanie zu verteidigen: Sie exportierte große Mengen Silber – gut für den Re-Exporthandel, sagte Mun. 1628 suchte die Kompanie die Unterstützung der britischen Regierung, um ihren Handel gegen die niederländische Konkurrenz zu schützen. Mun trug dieses Anliegen im Parlament vor. Als er 1641 starb, hatte er ein erhebliches Vermögen angesammelt.
Hauptwerke
1621..A Discourse of Trade
um 1630..England’s Treasure By Foreign Trade
Freihandelsvereinbarungen
Adam Smith vertrat im 18. Jahrhundert eine andere Auffassung. In Der Wohlstand der Nationen betonte er, entscheidend sei nicht der Reichtum einzelner Nationen, sondern der Wohlstand aller Nationen. Und die Größe des Topfes sei nicht vorgegeben: Er könne mit der Zeit wachsen – aber nur, wenn der Handel zwischen den Nationen nicht beschnitten werde. Ließe man ihm die Freiheit, würde der Markt immer weiter wachsen und alle Länder reich machen.
In den letzten 50 Jahren war Smiths Ansicht vorherrschend. Die meisten westlichen Ökonomen halten Handelseinschränkungen zwischen den Nationen für schädlich für die Volkswirtschaften. Heute sind Freihandelszonen die Regel, während globale Organisationen wie die Welthandelsorganisation WTO und der Internationale Währungsfonds IWF die Länder zur Senkung ihrer Zölle drängen, damit ausländische Mitbewerber Zugang zu ihren Märkten erhalten. Barrieren im Außenhandel werden als protektionistisch kritisiert.
Doch manche Ökonomen sorgen sich um die Entwicklungsländer, denn ihnen könnte es schaden, mächtigen globalen Unternehmen ausgeliefert zu sein. Sie können dann nicht ihre jungen Industrien hinter Schutzbarrieren pflegen, wie Großbritannien, die USA, Japan und Südkorea es taten, ehe sie zu bedeutenden Industrienationen aufstiegen. China dagegen verfolgt eine Handelspolitik, die in vieler Hinsicht Muns Denken entspricht. Die Handelsüberschüsse sind enorm und das Land baut gewaltige Devisenreserven auf.
2010 in Paris: Französische Bauern mit ihren Traktoren demonstrieren nach einer Liberalisierung der Importe gegen den Verfall der Getreidepreise.
Siehe auch:Der komparative Kostenvorteil.•Internationaler Handel und Bretton Woods.•Marktintegration.•Die Dependenztheorie.•Globales Ungleichgewicht der Sparguthaben.•Wirtschaft und Pandemie
IM KONTEXT
Wirtschaftswissenschaftliche Methoden
William Petty. (1623–1687)
1620.. Der Engländer Francis Bacon setzt sich für einen neuen wissenschaftlichen Ansatz ein: Fakten sammeln.
1696. Der englische Statistiker Gregory King verfasst eine statistische Übersicht über die englische Bevölkerung.
1930er-Jahre. Der Australier Colin Clark erfindet das Bruttonationaleinkommen (BNE).
1934.. Der Ökonom Simon Kuznets entwickelt eine moderne volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
1950er-Jahre. Der britische Ökonom Richard Stone entwickelt Systeme zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, z. B. für UN und OECD.
Heute halten wir es für selbstverständlich, dass man die Wirtschaft messen und ihre Expansion und Schrumpfung exakt beziffern kann. Diese Vorstellung geht auf die 1670er-Jahre und den englischen Wissenschaftler William Petty zurück. Er wandte die neuen empirischen Methoden der Naturwissenschaften auf wirtschaftliche Fragestellungen an. Dazu sammelte er Daten aus der realen Welt und beschloss, sich nur »in Form von Zahl, Maß und Gewicht« auszudrücken. Mit diesem Ansatz trug er zur Entstehung der Wirtschaftswissenschaft bei.
In seinem Buch Politische Arithmetik zeigte Petty anhand realer Daten, dass England entgegen der vorherrschenden Ansicht reicher war denn je. Eine seiner bahnbrechenden Entscheidungen bestand darin, den Wert der Arbeit ebenso zu berücksichtigen wie Land- und Kapitalbesitz. Auch wenn Pettys Zahlen nicht unumstritten sind, besteht kein Zweifel an der Effektivität seiner grundsätzlichen Idee. In seine Berechnungen bezog er die Bevölkerungszahl, die persönlichen Ausgaben, den Lohn pro Person, die Mieten und anderes mit ein. Er multiplizierte diese Zahlen, um einen Gesamtwert für den Wohlstand der Nation zu erhalten.
Ähnliche Methoden entwickelten Pierre de Boisguilbert und Sébastien Le Prestre de Vauban (1633–1707) in Frankreich. In England analysierte Gregory King (1648–1712) Wirtschaft und Bevölkerung von England, Holland und Frankreich. Er gelangte zu dem Ergebnis, dass keines dieser Länder die Mittel hatte, den Pfälzischen Erbfolgekrieg über das Jahr 1698 hinaus fortzusetzen – der Krieg endete 1697.
Barrierefreie Beschreibungen lesen
Die Seeschlacht von La Hogue fand 1692 während des Pfälzischen Erbfolgekriegs statt. Gregory King berechnete, wie lange sich die beteiligten Länder den Krieg noch leisten konnten.
Kennzahlen für den Fortschritt
Die Statistik ist heute ein Kernstück der Wirtschaftslehre. Ökonomen messen in der Regel das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Staates in einem bestimmten Zeitraum für Geld verkauft werden. Allerdings gibt es immer noch kein festgelegtes Verfahren für eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
Das BIP eignet sich aus verschiedenen Gründen nicht gut als Kennzahl, da es z. B. weder Umweltschäden der Produktion noch Lebensqualität berücksichtigt. Daher haben Ökonomen neue Konzepte entwickelt, wie z. B. den Genuine Progress Indicator (GPI), der u. a. Einkommensverteilung, Kriminalität und Umweltverschmutzung einbezieht, oder den Happy Planet Index (HPI).
William Petty
1623 wurde William Petty in Hampshire (England) in bescheidenen Verhältnissen geboren. Er durchlebte den Englischen Bürgerkrieg und stieg in hohe Positionen auf, im Commonwealth ebenso wie in der restaurierten Monarchie. Als junger Mann arbeitete er für den englischen Philosophen Thomas Hobbes in Holland. Nach seiner Rückkehr nach England lehrte er Anatomie in Oxford. Da er sich an der Universität langweilte, reiste er nach Irland, wo er die Aufgabe erhielt, ganz Irland in ein Kataster einzutragen.
In den 1660er-Jahren kehrte er nach England zurück und begann mit seinen ökonomischen Arbeiten, für die er heute bekannt ist. Den Rest seines Lebens verbrachte er teils in England, teils in Irland. Petty gilt als einer der ersten großen politischen Ökonomen. Er starb 1687 im Alter von 64 Jahren.
Hauptwerke
1662..Traktat über die Besteuerung
1690..Politische Arithmetik
1695..Quantulumcunque Concerning Money
Siehe auch:Der Wirtschaftskreislauf.•Wirtschaftstheorien im Test.•Die Ökonomie des Glücks.•Wirtschaft und Geschlecht
IM KONTEXT
Märkte und Firmen
Josiah Child. (1630–1699)
Ab 1500.. Regierungen gewähren Kaufleuten Handelsmonopole in bestimmten Weltregionen.
1552–1571. Die Bourse in Antwerpen und die Royal Exchange in London werden gegründet, damit Anteilseigner ihre Anteile kaufen und verkaufen können.
1680.. Londoner »Makler« treffen sich in Jonathan’s Coffee House, um Aktien zu handeln.
1844.. Der Joint Stock Companies Act vereinfacht Firmengründungen im Vereinigten Königreich.
1855.. Die beschränkte Haftung schützt die Investoren vor Börsenschwindeln wie der Südseeblase von 1720.