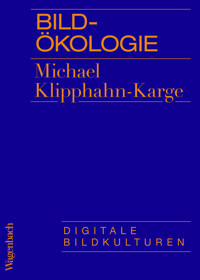
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Herstellung und Verbreitung digitaler Bilder sind keine saubere Sache. Etwa hundert Rohstoffe sind nötig, um ein Smartphone zu produzieren. Der Abbau dieser Metalle, Mineralien und fossilen Energieträger führt zu massiven CO2-Emissionen und zerstört ganze Ökosysteme – ebenso wie die unsichtbare Infrastruktur aus Unterseekabeln und Serverfarmen. Anschaulich legt Michael Klipphahn-Karge die desaströsen ökologischen Folgen digitaler Bildökonomien frei: Was kostet es den Planeten, wenn er täglich fünf Milliarden Mal mit dem Smartphone fotografiert wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mineraliensandwich in der Hosentasche: Digitale Bilder verbrauchen Unmengen an Rohstoffen und Energie. Anschaulich legt Michael Klipphahn-Karge die desaströsen ökologischen Folgen dieser vermeintlich immateriellen Erscheinungen frei. Was kostet es den Planeten, wenn er täglich fünf Milliarden Mal mit dem Smartphone fotografiert wird?
Michael Klipphahn-Karge
BILDÖKOLOGIE
Materielle Lasten immaterieller Erscheinungen
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
DIGITALE BILDKULTUREN
Durch die Digitalisierung haben Bilder einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dass sie sich einfacher und variabler denn je herstellen und so schnell wie nie verbreiten und teilen lassen, führt nicht nur zur vielbeschworenen »Bilderflut«, sondern verleiht Bildern auch zusätzliche Funktionen. Erstmals können sich Menschen mit Bildern genauso selbstverständlich austauschen wie mit gesprochener oder geschriebener Sprache. Der schon vor Jahren proklamierte »Iconic Turn« ist Realität geworden.
Die Reihe DIGITALE BILDKULTUREN widmet sich den wichtigsten neuen Formen und Verwendungsweisen von Bildern und ordnet sie kulturgeschichtlich ein. Selfies, Meme, Fake-Bilder oder Bildproteste haben Vorläufer in der analogen Welt. Doch konnten sie nur aus der Logik und Infrastruktur der digitalen Medien heraus entstehen. Nun geht es darum, Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden und ästhetische, kulturelle sowie soziopolitische Zusammenhänge herzustellen.
Die Bände der Reihe werden ergänzt durch die Website www.digitale-bildkulturen.de. Dort wird weiterführendes und jeweils aktualisiertes Material zu den einzelnen Bildphänomenen gesammelt und ein Glossar zu den Schlüsselbegriffen der DIGITALEN BILDKULTUREN bereitgestellt.
Herausgegeben von
Annekathrin Kohout und Wolfgang Ullrich
Instagram-Post zu den Bränden in Südkalifornien, Anfang 2025
0 | Keine Bilder: Einleitung
»Unter den zahlreichen umweltschädlichen und sinnlos energieverbrauchenden Neigungen der Menschen findet sich auch jene, ihr Essen zu fotografieren«, schreibt der Tagesspiegel im Frühjahr 2022.1 Anstoß für diese Zeilen gibt ein Pressegespräch im Rahmen eines Treffens von G7-Digitalisierungsminister*innen in Düsseldorf. In einem Anflug umweltpolitischer Dringlichkeit nimmt Volker Wissing – zu dieser Zeit Bundesminister für Digitales und Verkehr – die Frage einer Journalistin zum Verhältnis von Digitalkonsum und Klimaschutz zum Anlass für einen Appell: Er wirbt dafür, auf sogenannten ›Food Porn‹ zu verzichten.2 Aus seiner Sicht schlägt er damit vor, einen mikropolitischen, da leicht umzusetzenden Beitrag zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels zu leisten. Zugleich suggeriert Wissing, dass der Verzicht darauf, das eigene Essen via Smartphone zu fotografieren und die Fotos online zu teilen, eine Möglichkeit makropolitischen Engagements in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, also große Wirksamkeit offeriere: Bilder in den Sozialen Netzwerken zu posten verbrauche schlicht zu viel Energie. Infolge dieser ›bewusstseinsbildenden‹ Maßnahme des Politikers kursiert online rasch ein vorgeblich demaskierender Post: ein Foto, das Wissing auf seinem eigenen Instagram-Account hinter einem Berg gezuckerter Waffeln mit Kirschen zeigt. (# 1, 2)
# 1 Instagram-Post auf dem offiziellen Kanal von Volker Wissing
# 2 Kommentarspalte (Ausschnitt)
Unter ›#wissingisst‹ macht sich schnell Schadenfreude breit. Die Häme, eine Person bei einer angeblichen Klimasünde ertappt zu haben, gegen die sie öffentlich moralisiert, macht einen großen Anteil der gesellschaftlichen Reaktionen auf die seit Anfang der 1970er-Jahre anhaltenden und erbittert geführten Klimadebatten aus.3 Entsprechende Diskussionen über den Zustand von Planet Erde entzünden sich insbesondere an den Folgen der industriekapitalistischen Übernutzung von Rohstoffen.4 Der globale Bedarf an Erdreserven und Energie hat nicht nur den menschengemachten Klimawandel verschuldet, sondern auch historisch gewachsene, vor allem soziale Ungleichheiten verschärft.5 Die größten Volkswirtschaften stemmen sich dennoch vehement gegen die Dekarbonisierung des Welthandels. So werden etwa Landnutzungsänderungen sowie agrarisch-industrielle und infrastrukturelle Großprojekte – Monokulturen, Staudämme, Kanäle, Wehre oder Ölpipelines – rigoros vorangetrieben. Solche Eingriffe in die Umwelt bleiben nicht folgenlos, vielmehr sind die Konsequenzen klar abzusehen: in diesem Falle Kohlenstoffspeicher- und Habitatverluste.6 Trotzdem werden solche Einschnitte weder staatlich noch unternehmensseitig adäquat reguliert. Ungehemmt setzen kapitalgetriebene Umformungen der Erde so verheerende und zudem meist unumkehrbare Prozesse in Richtung eines ›Peak Everything‹ in Gang.7
Volker Wissing hat mit seinem Statement insofern recht, als auch die steigenden ökonomischen Bedarfe datengetriebener Gesellschaften gewaltigen Anteil an der ökologischen Krise haben. Digitale Vernetzung, Immaterialisierung von Finanzdienstleistungen, erhöhte Mobilität von Menschen und Gütern sowie Miniaturisierung fordern ihren Tribut. Allein der weltweite Output von 57.246 geschossenen Smartphone- Bildern pro Sekunde ist immens: Circa fünf Milliarden Fotos entstehen pro Tag, hunderte Millionen davon werden binnen 24 Stunden ins Netz geladen.8 Um symbolisches Kapital aus der Brisanz solcher Zahlen zu schlagen, setzt Wissings Appell gegen Food Porn dezidiert bei privaten digitalen Sozialpraktiken an – und sei es, das eigene Abendessen fürs Netz zu fotografieren. Dabei schiebt der Minister – ganz dem Zeitgeist von Dienstleistungsgesellschaften verpflichtet – eine Individualisierung von Problemverkettungen vor, anstatt auf ›Global Player‹ abzuzielen.9 Das ist ebenso typisch wie kontraproduktiv: Der bloße Verzicht auf Food Porn würde kaum einen Unterschied machen. Es sind nicht zuvorderst ›Otto Normalverbraucher‹, die für die circa 2.500 Milliarden Tonnen CO₂ verantwortlich sind, die seit dem Beginn der Industrialisierung durch Verbrennungsprozesse in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Schuld daran tragen vielmehr Großkonzerne und die ›Polluter Elite‹, also die finanzkräftigsten zehn Prozent der Gesamtbevölkerung.10 Zwänge rentabler Unternehmensführung und globalwirtschaftliche Trends tun ihr Übriges – nun eng verschränkt mit der Digitalisierung und damit auch der Smartphone-Industrie.11
Der Verbrauch digitaler Infrastrukturen wächst: Er wird bis 2040 für 14 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich zeichnen – und das ist noch eine recht optimistische Prognose.12 Der ›Product Carbon Footprint‹ – also die Produktklimabilanz von Smartphones, die immerhin zwei Drittel der Weltbevölkerung als das Kommunikationswerkzeug schlechthin verwenden – weist aus, dass die durch Treibhausgasemissionen verursachte Umweltbelastung smarter Devices schon jetzt zu circa 30 Prozent auf ihre Nutzung und damit auf ebenjene digitalen Infrastrukturen zurückzuführen ist.13 Die übrigen 70 Prozent machen Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Aufbereitung smarter Devices aus.
Im Folgenden interessiert mich daher insbesondere, wie und woraus digitale Endgeräte hergestellt, wie sie genutzt, entsorgt und gegebenenfalls weiterverarbeitet werden. Ebenso relevant ist deren Vermarktung: die Digitalwirtschaft, ihre Wertschöpfungsketten und konsumptiven Anreize an der Schwelle eines vielfach antizipierten Postkohlenstoffzeitalters. Denn freilich sind Nutzer*innen zunächst selbstverantwortlich und nicht unmündig hinsichtlich dessen, was sie kaufen, nutzen und verantworten können. Doch stellt sich auch hier die Frage nach Unternehmensinteressen: nach Transparenz, Framing und Alternativen, letztlich aber auch nach Bedürfnissteuerung. Gerade soziale Zwänge, die durch die Angebote digitaler Gemeinschaftsbildung entstehen, aber ebenso Digitalisierungsdruck im Allgemeinen schränken die Souveränität ein, smarte Devices in Anspruch zu nehmen oder nicht. Beispiele sind etwa ausschließlich digitale Fahrkarten im öffentlichen Mobilitätssektor oder ein zusehends digitalisiertes Bankwesen für Privatkund*innen.
Auch ein genauerer Blick auf das digitale Bild ist angeraten: Digitale Bilder werden oft als immateriell verstanden und als bloße Informationseinheiten wahrgenommen – als Bilder, die quasi aus dem Nichts entstehen und damit ohne materiellen oder energetischen Ballast auskommen.14 Begriffe wie ›Cloud‹, ›Stream‹ oder ›Software‹ machen die vermeintlich harte, häufig raumgreifende und kalte Technik hinter digitalen Phänomenen vorgeblich weich, leicht und anschmiegsam und verschleiern so deren Materialität. Insbesondere bilderzeugende Digitaltechnologien muten daher oft an, als wären sie beziehungsweise ihre Nutzung ökologisch gänzlich unbedenklich. Doch der gigantische Bildbetrieb Sozialer Medien (wie Instagram, TikTok oder WhatsApp) fordert indirekt jede Menge Energie aus kohlenstoffintensiven Quellen wie Gas, Kohle und Öl.15 Daher dient mir speziell die Smartphone-Industrie als Indikator für eine generelle Verbrauchsökonomie, die nur durch Exzess überdauert: Immer kürzerer Gebrauch, höherer Bedarf, schnellerer Verschleiß und dauerhaft anwachsende Produktion verlangen immer mehr Rohstoffe für stetig steigenden Konsum.16
Ausgehend von der Geschichte des Rohstoffbedarfs apparativer Bilderzeugungstechnologien möchte ich in diesem Band zeigen, dass sich der dahingehend historische Materialverbrauch der Fotografie in der gegenwärtigen Bildproduktion maximiert. Dabei interessieren mich auch die Millionen Jahre alten Metalle und Mineralien, die für den Bau und Betrieb von Smartphones aus der Erde extrahiert und in kürzester Zeit verbraucht werden. Zudem werde ich mich der digitalen Infrastruktur aus Unterseekabeln und Rechenzentren widmen, mittels derer die – via digitalem Device erzeugten – Bilddaten energieintensiv transferiert werden. Schließlich wende ich mich dem Recycling von Smartphones, aber auch sich beschleunigenden Innovationszyklen zu. Letztlich befasse ich mich mit dem Verbrauch durch Social-Media-Nutzung und der Frage, wie sich die Klimakrise im digitalen Bild selbst visuell geltend macht.
Mit dem Titel dieses Bandes möchte ich meine Gedanken zu Verbrauch und Bildproduktion verknüpfen. Mit dem Kompositum Bildökologie ziele ich im engeren und eigentlichen Sinne des Begriffs ›Ökologie‹ auf die Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und dessen Umwelt(en) ab: die genuin private, oft interaktive und zusehends digitale Umwelt, aber auch die Umwelt im Sinne wirtschaftspolitischer Ordnungssysteme und Konzernstrukturen, die den Menschen umgeben. Ökologie schließt demnach keine romantisierte Vorstellung einer menschenunabhängigen Natur als System ein, das durch Verzicht zu erhalten wäre.17 Vielmehr beschreibt Ökologie, wie die physische Natur durch den Eingriff der Ökonomie strukturiert wird – etwa als Lebensraum des Menschen.
Welche Folgen hat es nun also für die Umwelt, dass der Mensch sie abbildet? Was kostet es die Erde, wenn sie milliardenfach auf Smartphones als Bild festgehalten wird? Und wie zeigt sich das? Kurz: Welche materielle Last hängt an einer immateriellen Erscheinung wie dem digitalen Bild?
1 | Toxische Bilder: Geschichte
Die US-amerikanische Zeitschrift Fortune sieht Anfang der 1990er-Jahre das Ende der Geschichte der Analogfotografie gekommen – zumindest als kommerziellster Form der Bilderzeugung. Grund ist ein wegweisender Entwicklungsdurchbruch im Bereich digitaler Fotografie: Bilder können nun dauerhaft digital gesichert werden.18





























