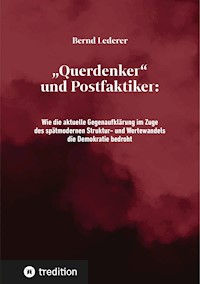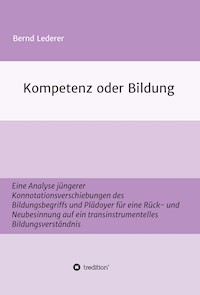INHALT
I. Motivationen extremistischer Jugendgewalt:
Die Entwicklung der fanatischen Persönlichkeit am Beispiel islamistischer und rechtsextremer Gewalttäter sowie von (Schul)Amokläufern: erste Annäherungen 13
1. Terrorismus als extremste Erscheinungsform des fanatischen Charakters 13
Amokläufe und Terror als extremste Form der Selbstwirksamkeitserfahrung 19
2. Terror und Geschlecht 23
3. Amok und psychische Störungen 25
Fanatismus lässt sich nicht einfach „wegpathologisieren“ 31
II. Soziale Ausschlüsse und Kränkungserfahrungen als Ursachen fanatischen Denkens und Handelns39
1. Hass, Zorn und Wut als destruktive Antriebskräfte 39
2. Erfahrungen sozialer Isolation als Grundlage fanatischer Radikalisierung 40
3. Ohnmachtsempfinden durch soziale Ausschlüsse 44
4. Soziale bzw. soziokulturelle Kontexte des Fanatismus 47 Exkurs: Ist die Vernachlässigung von Sozialpolitik zugunsten minoritärer Identitätspolitiken eine Mitursache für Radikalisierungen? 50
Exkurs: Der neoliberale Kapitalismus als Kultur der Kränkung 59
5. Das Streben nach Identität, Gruppenzugehörigkeit und Orientierung als elementares soziales Bedürfnis: zur Bedeutung von Identität und Anerkennung 60
Exkurs: Bemerkungen zur Relativität von Frustrationserfahrungen heute und in Zukunft 62
5.1 Identität, Anerkennung und Sinnstiftung durch reaktionäreIdeologien und Organisationen 64
5.2 Sinn und Orientierung als Voraussetzung und Ergebnis von Identitätsstiftung 70
6. Ein schwaches Selbstkonzept und fehlendes Selbstvertrauen als Basis autoritärer bis fanatischer Persönlichkeiten 72
6.1 Das Streben nach sozialer Anerkennung 75 Soziale Ausschlüsse in der Wettbewerbsgesellschaft 76
6.2 Soziale Verwahrlosung als Nährboden für Extremismus 78
6.3 Fehlender Sinn und negativer Selbstwert als entscheidende Faktoren für die Entwicklung von Fanatismus und Gewalt 81
7. Sind alle Fanatiker dumm? Sozialstruktur, Qualifikation und Bildungsniveau am Beispiel von Islamisten: Vom Kleinkriminellen bis zum Akademiker sind alle Gruppen vertreten 85
Viele islamistische Fanatiker verfügen über eine hohe Qualifikation 89
Technische Intelligenz und autoritäre Persönlichkeitsstruktur 97
Einwurf: Humane Bildung ist bedeutsamer als die formale Qualifikation! 99
8. Überforderungserfahrungen in der individualisierten Gesellschaft und die Sehnsucht nach der heilen Welt 101
Der Hass auf das Bunte und Vielfältige als einigendes Motiv (vordergründig) unterschiedlicher Extremismen 105
9. Der Stellenwert der Popkultur: Fanatismus als Lifestyle108
9.1 Einwurf: Warum gibt es gegenwärtig kaum wirkmächtige emanzipatorische Jugendprotestkulturen? 111
Eine neue progressive Sub- und Gegenkultur wäre wünschenswert! 116
9.2 Eine ganz kurze Skizze der Jugendkulturen seit 1945 121
9.3 Die Frage nach Alternativen: ein kurzer Essay127
10. Der Faktor Geschlecht: Fanatismus als „toxische Männlichkeit“ 132
10.1 Das Problem der fehlenden Väter 134
10.2 „Toxische Maskulinität“ 137
Militante Männlichkeit und Religion 141
10.3 Autoritäre Frauenbilder und „Pascha-Kultur“ als Merkmal autoritärer Charaktere143
10.4 „Pascha Pädagogik“ als Erziehungsmethode und autoritäre Zurichtung 151
10.5 Radikale Mädchen und Frauen 159
10.6 Abenteuerbedürfnis, Erlebnisdefizite und Langeweile junger Männer als Antrieb für jugendlichen Fanatismus160
11. Die Bedeutung sozialer Netzwerke für fanatische Jugendkulturen: Das Internet als Medium narzisstischer Selbstinszenierung und Propaganda 166
12. Zusammenfassung: individual- und sozialpsychologischen Motive von Fanatisierungsprozessen 169
III. Fanatismus aus Sicht der Psychoanalyse: Eine Zusammenschau der Ursachen und Umstände individueller Radikalisierung nach Peter Conzen173
1. Fehlendes Urvertrauen und seine Kompensation durch ideologische Einheitserfahrungen 174
2. Fanatismus als Ausdruck erfahrener Beschämung 178
3. Fanatismus als radikalisierter Ödipuskomplex181
4. Jugendphase und Fanatismus185
5. Jugendliche Identitätsverwirrungen als Auslöser von Fanatismus191
IV. Religion als Entfaltungsfeld von Extremismus: Zur Attraktivität dogmatisch-religiöser Denkgebäude am Beispiel des Islam(ismus)202
1. Vorbemerkungen zu den Konstrukten „Kultur“ und „Religion“ 202
Gegen kulturalistische Verallgemeinerungen: Erziehung und Sozialisation vollzieht sich stets in konkreten sozialen und kulturellen Kontexten einer Lebenswelt 205
2. Soziale Ursachen für extrem religiöse Geistes- und Werthaltungen 208
Anmerkungen zur Integrationsdebatte zwischen stereotypen Vorurteilen und differenzierter Sozialisationsforschung 211
3. Dogmatische Religiosität als gewaltaffine Ideologie 213
4. Islamismus als Psychopathologie? 218
5. Religion und Identität 223 Selbstviktimisierung als Strategie sozioreligiöser Identitätsstiftung 223
Religiöser Chauvinismus als Identitätskrücke 228
6. Islamistischer Terrorismus: erlebnisorientierte Jugendrevolte oder politisch-religiöser Krieg gegen die Moderne? Die entgegengesetzten Positionen von Olivier Roy und Gilles Kepel 230
6.1 Die Position Olivier Roys: Religion als austauschbares Vehikel jugendlichen Aufbegehrens 230
Kritische Einwände gegen die These von Religion als bloßes Vehikel und Fassade jugendlichen Fanatismus 239
6.2 Die Position Gilles Kepels: Der konservative Islam als Katalysator von Fanatisierungen 241
6.3 Bassam Tibis vermittelnde Position zwischen Roy und Kepel244
7. Die Antwort auf religiösen Fanatismus: Religionskritik heißt Aufklärung! 247
Necla Keleks Plädoyer für einen zeitgemäßen Islam 247
8. Bedingungsgefüge religiösen und politischen Fanatismus: ein Resümée 251
V. Fazit: Pädagogische und gesellschaftliche Voraussetzungen gelingender Persönlichkeitsbildung: Forderungen und Vorschläge sowie abschließende Gedanken zu beiden Büchern257
VI. Literatur274
1. Ausgewählte Literatur zum Thema Islamismus, Rechtsextremismus, Verschwörungsglaube und allgemein zu Fanatismus, Terror und Amok 274
2. Ausgewählte Literatur zum Thema Jugendgewalt/Gewalt allgemein 284
3. Ausgewählte Literatur zum Thema gelingende Erziehung und Persönlichkeitsbildung 285
VII. Anmerkungen289
I. Motivationen extremistischer Jugendgewalt:
Die Entwicklung der fanatischen Persönlichkeit am Beispiel islamistischer und rechtsextremer Gewalttäter sowie von (Schul)Amokläufern: erste Annäherungen
1. Terrorismus als extremste Erscheinungsform des fanatischen Charakters
Die gegenwärtig zu diagnostizierende Radikalisierung und Verrohung des öffentlichen politischen Diskurses gipfelt, weit über menschenverachtendes „hate-speech“ in Sozialen Medien hinaus, in ganz realen Gewalttaten. Die rechtsextremen Morde
von Christchurch und Halle (2019) sowie Hanau (2020) sind „nur“ drei besonders erschreckende Beispiele aus jüngster Vergangenheit. Der globale Vormarsch rechtspopulistischer bis
rechtsextremer Bewegungen hat auch rechte und rechtsextreme Jugend- und
Subkulturen bestärkt. Sich öffentlich als Rechts, als National- oder Kulturchauvinist zu deklarieren, wird
immer weniger als Tabu erachtet. Der deutsche Verfassungsschutzbericht für 2019 etwa weist eine deutliche Zunahme jugendlichen politischen Extremismus
aus, sei dieser rechtsextrem oder islamistisch motiviert.1 Dabei handelt es sich, wie hier noch deutlich werden wird, letztlich ohnehin um
zwei Seiten desselben Phänomens, nämlich der autoritären bis fanatischen Persönlichkeitsstruktur. Eindeutige Feindbilder sorgen bei dergleichen oft volatilen,
selbstunsicheren Persönlichkeiten für ein eindeutiges Selbstbild, sie schaffen eine eindeutige Identität. Gerade ein Terrorismus, der gegen „weiche Ziele“ gerichtet ist, also gegen jede und jeden, die und der das Pech hat, zur
falschen Zeit am falschen Ort zu sein oder sich gegen unbewaffnete, wehrlose
Vertreter einer vom Täter verhassten Menschengruppe richtet, versetzt Menschen in höchste Angst. Angst indes ist die Währung des Terrors. Der Politikwissenschaftlerin Louise Richardson vom Center for European Studies der Harvard University zufolge handelt es sich bei Terrorismus um eine Art Theater, um eine infame
Inszenierung, die mit unseren Gefühlen und tiefsten Ängsten spielt. Diese würden als Waffe benutzt, um Macht über Herzen und Gehirne zu erlangen. Letztlich soll diese Macht in Entscheidungen
und Handlungen münden, die entweder zur Unterwerfung unter die Ideologie der Terroristen führt oder aber auch eine militante Gegenwehr provozieren, die dann in einem
epochalen, quasi eschatologischen Endkampf zur völligen Vernichtung des Gegners führt (im Falle des Islamismus: alle Andersgläubigen, egal ob Moslems oder nicht, im Falle des Rechtsextremismus: alle nicht
zur eigenen „Rasse“ gehörenden, als „minderwertig“ markierte Menschen und politische Gegner). In ihrem Buch „Was Terroristen wollen“ fasst Richardson deren primäre Motive am Beispiel von Islamisten in den „3 R“ zusammen:
Rache: Für das (angeblich) erlittene Leid der Moslems durch Ungläubige (v.a. Christen und Hindus).
Ruhm: Für die weltweite Gemeinschaft der Rechtgläubigen ist der Attentäter ein Star, ein Held, ein Märtyrer.
Reaktion: Der provozierte Gegenschlag der Angegriffenen stärkt Zusammenhalt und Attraktivität der Bewegung.2
In einem analogen Sinne benennt der international renommierte Terrorexperte
Peter R. Neumann von der London School of Economics fünf zentrale Elemente psychosozialer Art, die bei der Radikalisierung von
Menschen die entscheidende Rolle spielen und diese letztlich zu Amokläufern oder Terroristen werden lassen:3
• Frustration
• Tatendrang
• radikale Ideen
• soziales Umfeld (ideologisch bestärkend oder persönlichen Hass erweckend) und
• Gewaltakzeptanz
Der Psychologe Ahmad Mansour wiederum benennt in seinem Bestseller „Generation Allah“ die „vier M“, vier Risikofaktoren für migrantische Kriminalkarrieren:4
• Männlich
• Migrant
• Moslem
• Misserfolg
In Akten des Terrors bricht sich ein „Vitalismus des Todeskultes“ (Georg Seeßlen) Bahn, im Extremfall werden sadistische Tötungs-, Vergewaltigungs- und Rachephantasie ausgelebt, ohne dass ein Gewissen,
ein Freudsches „Über-Ich“, dem Einhalt geböte, im Gegenteil: Es ist diese Legitimierung des rauschhaften Exzesses im Namen
höherer Ideale und Ideologien, die die Attentäter fasziniert. Psychogrammatischer Quellgrund hierfür ist mitunter die innere Leere einer als sinnlos-stumpfsinnig empfundenen oder
aber, im scheinbaren Gegenteil, einer fehlgeleitet-überidealistischen Existenz. Hinzu kommen oft Erfahrungen von Ohnmacht gegenüber dem eigenen autoritären Vater (sofern vorhanden) und erfahrene Niederlagen und Kränkungen in der Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft mit ihren zugehörigen Institutionen (Schule, Arbeitsplatz). Dergleichen kann, ganz dem Diktum
des Jugend- und Gewaltforschers Wilhelm Heitmeyer gemäß, wonach die extremistische Motivation darin bestehe, „Ohnmacht in Macht zu verwandeln“, in sadistische Allmachtsgesten hinein kompensiert und übersteigert werden. Im Massenmord ist der Terrorist oder Amokläufer Herr über Leben und Tod, gottgleich, niemand lacht mehr über ihn, jetzt kann er sich für alle narzisstischen Kränkungen rächen. Bevor er nach seiner Tat in den meisten Fällen selber stirbt, darf er seine Macht über andere und deren Schicksal genießen. „Deine Entscheidung gegen das Leben macht dich unsterblich. Jetzt kannst du es
allen zeigen!“5 Bezüglich dieser individualpsychologischen Motive gleichfalls eng mit Terror bzw.
Amok verwandt bzw. identisch ist die Kategorie der sog. hate crimes, Hassverbrechen, bei denen nicht einzelne Personen, die als Andersdenkende oder
Seiende gelesen werden oder an einem bestimmten Ort erfahrener Kränkungen leicht identifizierbare und leicht zu tötende Ziele bilden (etwa Mitschüler oder Kollegen), sondern Gruppen von Menschen aufgrund eines verhassten
Merkmals (etwa Konfession, Ethnizität oder sexuelle Orientierung).6
Welche Erklärungen, über diese Kränkungskompensationen hinaus, haben die Wissenschaften vom Menschen, vornehmlich
die Soziologie, Psychologie und Pädagogik, bezüglich der Motive der Attentäter und ihre individual- und sozialpsychologischen Entstehungskontexte? Bei
einem intensiveren Blick in die einschlägige Fachliteratur wird stets die fundamentale Bedeutung sozialer menschlicher
Grundbedürfnisse und der Befriedigung oder eben Nicht-Befriedigung elementarer
Anerkennungsbedürfnisse für die Entwicklung devianter, destruktiver Persönlichkeitsmerkmale betont. Im ersten Buch dieser zweibändigen Analyse fanatischer Persönlichkeitsstrukturen (Lederer 2020) wurde bereits auf den elementaren
Stellenwert hingewiesen, den eine liebevolle, verlässliche Bindung zu den primären Bezugspersonen im Säuglings- und Kleinkindalter für die Entwicklung einer selbstbewussten, autonomen, widerstandsfähigen („resilienten“) und prosozialen Persönlichkeit hat. Gelingende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die darin gründende soziale Anerkennung und Wertschätzung, die Erkenntnis und das Empfinden, wertvoll zu sein und gebraucht zu
werden, seinen Platz zu haben, nicht zuletzt Geborgenheit und „Nestwärme“, Orientierung und Lebenssinn sind dann nahtlos anschließend an die Kindheit im gesamten weiteren Lebensverlauf von höchster Bedeutung.
Soziale Isolation hingegen wird individuell als Stress empfunden, als das wütend machende Gefühl, „zu kurz gekommen zu sein“, so etwa Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Soziale Akzeptanz und die Möglichkeit der Teilhabe seien elementare menschliche Grundbedürfnisse. Der Stressfaktor des empfundenen sozialen Ausschlusses vermag bereits
in alltäglichen Lebenssituationen negativ in Erscheinung zu treten. Mitunter sei es
bereits der Umzug in eine neue Stadt, der Gefühle sozialer Exklusion aufrufe. Eine Gruppe Ausgeschlossener, die sich stark
zueinander zugehörig fühlen, stellen dabei einen fruchtbaren Boden für radikales und fanatisches Gedankengut dar, so Heinz weiter.7 Speziell aus psychoanalytischer Sicht ist das Gefühl, ausgegrenzt und überflüssig zu sein, mit der Erfahrung von Liebesentzug gleichzusetzen und damit eine
Ursache für fehlendes Urvertrauen als einer wichtigen Voraussetzung für einen respekt- und freudvollen, dementsprechend empathischen Umgang mit seinen
Mitmenschen.8 Michel Wieviorka, Forschungsdirektor an der Ecole des Hautes Etudes in Paris, identifiziert in diesem Sinne die langwährenden Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen junger Migranten im
postkolonialen Frankreich als die Hauptursache für deren häufige Radikalisierung und Aggression. Die berüchtigten Banlieus, also die überwiegend von arabischen Einwanderern aus Nordafrika geprägten Vororte französischer Großstädte, sind soziale Brennpunkte mit hoher Arbeitslosigkeit und
Radikalisierungspotential und werden von Wieviorka entsprechend als
katastrophal gescheitertes Projekt der Integration bewertet.9 Überaus bemerkenswert sei dabei der Umstand, so Michel Wieviorka weiter, dass
religiöse Beweggründe hierbei als Motiv für Gewalt und Hass gegen die Mehrheitsgesellschaft kein zwingendes, vielmehr ein
relativ neues Phänomen seien: Khaled Kelkal, der Attentäter des ersten islamistischen Anschlags in Paris, der 1995 in der U-Bahn-Station
Saint-Michel eine Bombe zündete und damit acht Menschen tötete und mehr als hundert verletzte, wurde ca. drei Jahre vor dem Attentat von
einem Soziologen interviewt. Dabei erwähnte er den Islam mit keinem Wort, sagte aber mehrfach, er habe nie seinen Platz
in der französischen Gesellschaft gefunden. Das seien Jungs, so Wieviorka, die nichts von dem
hätten, was sie brauchen und wünschen und plötzlich verspreche ihnen einer das Paradies, Abenteuer und Heldentum. Sozusagen
einen Krieg gegen jene, die nie was von ihnen wissen wollten und ihren Bedürfnissen keine Aufmerksamkeit schenkten.10
Die Auswahl der Orte und Opfer der verheerenden Massaker vom 13. November 2015
in Paris, bei denen 130 überwiegend junge Menschen in Cafés, Bars und bei einem Konzert im hippen Ausgeh- und Szeneviertel des 10. und 11.
Arrondissement von islamistischen Terroristen mit Schnellfeuerwaffen und
Sprengstoffgürteln ermordet wurden, sei dementsprechend geradezu logisch: Dergleichen habe
sicherlich mit dem Hass und Neid der sich ausgeschlossen empfindenden
Vorstadtjugendlichen auf die hedonistische Spaßkultur der vergleichsweise wohlhabenden und smarten, urbanen und hippen Pariser
Jugendlichen der innerstädtischen Bezirke zu tun, so Wieviorkas Analyse der Motive des Hasses. Letztlich
gehe es aber gar um einen radikalen Widerstand gegen Frankreich selbst. Wäre den Selbstmordattentätern wie geplant der Selbstmordanschlag im Stade de France geglückt, würde man nicht nur über den Massenmord im Musikclub Bataclan und die Morde in den Cafés reden, dann hätte es wirklich alle Milieus der Bevölkerung getroffen: „Der eigentliche Feind sind der Westen und seine Kultur.“11 Der Journalist Christian Wernicke ergänzt in seinem Kommentar zum LKW-Massenmord in Nizza am 14. Juli 2016 mit 86
Toten und über 400 Verletzten ebenfalls mit Blick auf die fast schon klassisch zu nennenden
Motive und sozialen Abgründe des Amokfahrers: Es handelt sich um einen offenkundig verwirrt-religiös Ideologisierten und Indoktrinierten, gleichfalls ein Sohn maghrebinischer
Einwanderer, der in der sozial eher desolaten Lebenswelt einer Vorstadtsiedlung
sozialisiert wurde. Als jugendlicher Kleinkrimineller und später erwachsener Gewalttäter war er den Behörden bereits bestens bekannt.12 Die überwiegende Mehrzahl der europäischen „Dschihadisten“ (Kämpfer im selbst ernannten „heiligen Krieg“ gegen die Ungläubigen) entstammen diesem kriminellen Milieu sozialer Deprivation und
Perspektivlosigkeit (zumindest gemessen an ursprünglichen Lebensplanentwürfen), wohingegen die Terroristen in den arabischen Ländern zu fast der Hälfte Akademiker sind (siehe hierzu noch Kapitel II.7). Der Soziologe Farhad Khosrokhavar von der École des hautes Études en Sciences Sociales in Paris bezeichnet diese Looser als „negative Helden“: „Orientierungslose junge Männer, die per Radikalisierung ihren Hass auf die Gesellschaft zur Ideologie überhöhen. Sie töten, um am Ende ihres Lebens einmal zu triumphieren.“1314
Die Schriftstellerin und Kolumnistin Carolin Emcke wiederum hebt hervor, dass
Akte des Terrors immer auf ein Publikum gerichtet sind.15 Dabei gehe es nicht nur darum, den jeweils definierten Feind zu schockieren und
zu ängstigen, sondern genauso darum, die eigene Anhängerschaft und Sympathisantenszene zu beeindrucken: Die historische Erfahrung
des Terrors lehre, dass Gewalt erst dann nachlasse, wenn es kein begeistertes
und dankbares Publikum, wenn es keine Claqueure mehr gibt, wenn sozusagen der
Applaus verstummt. Erst dann, wenn es keine Anerkennung für die verübten Gewalttaten mehr gebe, kein nachgerade obszöner Ruhm mehr zu ernten sei, wenn der Terror nicht mehr als Eintrittskarte zu
einer Gemeinschaft Gleichgesinnter funktioniere, erst dann werde der Sog
nachlassen. Erst wenn die Sympathisanten der Gewalt ihren Zuspruch
verweigerten, verliere diese auch ihre symbolisch aufgeladene Macht. Gerade die
kollektive soziale Ausgrenzung von Muslimen, die weit verbreitete Praxis, diese
unter Generalverdacht zu stellen und sie für jedwedes Verbrechen, das Terroristen im Namen dieser Religion begehen, in
Kollektivhaftung zu nehmen, bestärke aber die Gefahr einer Radikalisierung. Letztlich, so Emcke weiter, werde es
darauf ankommen, ob es in Europa gelinge, die für Jugendliche attraktivere Erzählung, eine inklusivere, identitätsstiftendere Gemeinschaft, eine sinnstiftendere Utopie, letztlich das
gerechtere, gute Leben anzubieten. Wem sein eigenes Leben wertvoll ist, der
wird es nicht einfach mordend wegwerfen wollen.16
Amokläufe und Terror als extremste Form der
Selbstwirksamkeitserfahrung
Im Gegensatz zu gruppenförmigem Terror stellen Amokläufe sozusagen eine Form individuellen Terrors dar. Hinsichtlich grundlegender
Motive und Lebensumstände der Täter finden sich indes mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes zwischen diesen
Erscheinungsformen eliminatorischen Hasses gegenüber anderen. Mit Blick auf die jüngere Geschichte der Amokläufe in den USA betont der Journalist Johannes Simon jenseits
individualpsychologischer oder gar psychopathologisch-psychiatrischer Motive
zunächst deren gesellschaftspolitischen, genauer sozioökonomischen Ursachenkontext.17 Bezugnehmend auf den Amokforscher Mark Ames verortet er die Eskalation dieses „genuin amerikanischen Kulturprodukts“ in den sozialdarwinistischen Folgen der neoliberalen Revolution unter Ronald
Reagan: Im Zuge massiver Spar- und Privatisierungsprogramme bei der
US-amerikanischen Post kam es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zu
ersten Amokläufen am Arbeitsplatz, „going postal“ ist seitdem eine Chiffre für Amoktaten. Amok-Morde lassen sich in solchem Sinne als Exzesse der Gegengewalt
gegen erfahrene Erniedrigungen im zusehends verrohteren, kompetitiveren
Arbeitsgeschehen lesen. Individuelles Scheitern an und in der
Leistungsgesellschaft wird hierbei als Quelle individueller Frustration und Kränkung identifiziert, die dadurch aber keineswegs rationalisiert oder gar
nachvollziehbar gemacht werden könne. Ende der 90er ging die Entwicklung dann bekanntlich vom Arbeitsplatz auf
Schulen und Unis über. Amok, so Johannes Simon, sei dabei nur graduell von Terroranschlägen zu unterscheiden, das Gemeinsame scheint über dem Trennenden zu stehen, speziell bei Einzeltätern: Diese planten ihre Anschläge lange im Voraus und suchten sich sehr spezifische, meist symbolische Ziele.
Wie der Lone-wolf-Attentäter haben Amokläufer idealisierte Vorbilder und sehen sich als Teil einer Gemeinschaft
Gleichgesinnter, die ihre Taten auch postmortal würdigen und ihnen als Person einen Märtyrerstatus verleiht. Manifeste und Bekennervideos zeigen deutlich, dass es
Ihnen darum geht, der Gesellschaft etwas mitzuteilen und eine Botschaft zu
hinterlassen, die sie selbst zeitlich überlebt. Solche Motive machten Amoktaten als einen narzisstischen Gegenreflex
auf verweigerte Anerkennungsbedürfnisse interpretierbar, so Simon weiter.
Auch der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer hebt die Bedeutung (krankhafter)
narzisstischer Motive bei Amokläufen bzw. erweiterten Suiziden hervor: Die meisten Täter befördern sich durch ihre Tat aus ihrer realen, physischen Welt und hoffen auf
unsterblichen Ruhm im postmortalen Jenseits. Bei religiösen Suiziden erwarten sie den Ruhm im imaginierten Jenseits, ansonsten in der
Erinnerung der Zurückgebliebenen, sei diese Erinnerung nun eine des Grauens seitens der Opfer und
ihrer Angehörigen oder eine der Verehrung bei Gleichgesinnten. Einen tieferen motivationalen
Kontext bilde meist ein Zusammentreffen von Selbstgefühlskrisen einerseits mit dem als erlösend und ruhmreich vorgestellten Fanal des Massenmordes andererseits. Aus
psychologischer Sicht gehe es um die manische Abwehr einer drohenden Depression
durch die Rache an möglichst vielen, die sich nicht derart mit und an der Realität zu quälen hätten wie die Täter: „Das vorherrschende Gefühl in der Konsumgesellschaft, das sich immer schlechter kanalisieren lässt, ist der Neid auf die Glücklichen“, so Schmidbauer.18 Vor vierzig Jahren etwa seien in einer durchschnittlichen Oberschulklasse noch
90 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit ihrem Aussehen zufrieden gewesen. Heute hingegen gelte dies nur noch
etwa für die Hälfte. „Mobbing“ in Schule und Beruf sei als Begriff und Phänomen erst in den Neunzigerjahren richtig hochgekommen. Sich selber kränken und von anderen gekränkt und herabgewürdigt zu werden nehme derzeit stark zu, und zwar je intensiver uns die Medien,
speziell auch die sozialen Medien, eine heile Welt voller schöner Menschen vorgaukelten. Die Protagonisten dieser medialen Inszenierungen, man
denke an die zahllosen Telenovelas oder Soap Operas, insbesondere auch an die Selbstinszenierungen der Influencer auf Facebook, Instagram, TikTok usw. sind meist attraktiv und erfolgreich und
haben entsprechend interessante und statushohe Jobs. Schmidbauer unterstreicht
dabei den geänderten und in seiner gesellschaftlich vermittelten Bedeutung nochmals stark
gestiegenen Charakter narzisstischer Kränkungen in der heutigen Medien- und Leistungsgesellschaft. Symptome der
Depression unter jungen Menschen seien demzufolge heute auch andere, als jene,
die immer noch in den Lehrbüchern der Klinischen Psychologie zu finden seien. Hier werde nämlich allein die gegen das eigene Ich gerichtete Aggression als wichtigste
Dynamik dieses seelischen Leidens benannt. Inzwischen sei aber vielmehr auch
der Neid auf das Glück und die Beliebtheit Anderer unter Depressiven verbreitet. Ein Park voller glücklicher Paare könne zur depressiven Selbstbedauerung führen, und zwar in dem Sinne: „Die sind verliebt und glücklich, ich hingegen bin allein und unglücklich“, so die Aussage einer seiner Patientinnen. Dieses Gefühl von Leid wachse sich mitunter in ein Gefühl von Wut und Hass aus, da unterstellt wird, die anderen, die Glücklichen, seien nur deshalb so glücklich, weil sie dieses Glück einem selbst weggenommen hätten. Entsprechend wird es aus Sicht derart Zukurzgekommener als gerecht
erachtet, sich an diesen Glücklichen zu rächen. In diesem Sinne hängt der heimliche oder auch unverhohlene Neid auf die Glücklichen und Beliebten (man denke etwa an die sog. „jerks“, die attraktiven, sportlichen, bei Frauen reüssierenden College- und High-School-Boys) eng mit dem von Amoktätern wie auch von Terroristen geäußerten Wunsch zusammen, dieses Glück zu ruinieren. Eine feiernde, glückliche Welt, die sie und ihre Leiden ignoriert, soll aus dieser Feierstimmung
gerissen werden, koste es, was es auch wolle.19
Aus Sicht des renommierten Gerichtspsychiaters Reinhard Haller liegen den
Radikalisierungsprozessen von Fanatikern letztlich stets Kränkungserfahrungen zugrunde.20 Es sei es oft das Motiv der Rache an einer heilen Welt, von der man sich selbst
ausgeschlossen fühle, die Unerträglichkeit, das Glück und den Spaß anderer erfahren zu müssen, während man sein eigenes Dasein als kümmerlich und schmerzhaft empfindet, der Anlass für „erweiterten Suizid“: Für Selbstmord also, der zugleich mit dem Mord an anderen verbunden wird, denen
kein weiteres, zufriedenes Leben gegönnt wird. So lassen sich manche Geisterfahrer-Unfälle erklären oder auch der absichtliche Absturz der Germanwings-Maschine mit 150 toten
Passagieren durch einen im Cockpit verbarrikadierten Piloten am 24. März 2015.21
Es sei evident, so wiederum Wolfgang Schmidbauer mit tiefenpsychologischer
Perspektive, dass der Massenmord ein mit Bedeutung aufgeladener Akt von
Menschen ist, die keine andere Perspektive mehr sähen als durch ihre Tat der Welt mitzuteilen: Ich habe keine Zukunft in eurer
Gesellschaft, ich finde keinen Platz in ihr. „Das macht mich so wütend, dass ich möglichst viele von euch töten will, ehe ich selbst draufgehe.“22 In jeder suizidalen Fantasie junger Menschen werde der Tod gleichzeitig sowohl
gesucht als auch geleugnet. Es gehe darum, anderen etwas zu beweisen und berühmt zu werden, Aufmerksamkeit zu erlangen, die der eigenen, als weitgehend
bedeutungslos empfundenen Existenz in diesem Ausmaß noch nie zuteil geworden ist. Allerletztlich gehe es darum, durch den eigenen
Tod in der Erinnerung der Nachwelt unsterblich zu werden. Hinzu komme heute die
fatale Verfügbarkeit von Schuss- und Sprengwaffen (keineswegs nur in den USA, sondern, etwa
mit Hilfe des Darknet, längst auch in Europa), deren Herstellung und Gebrauch zudem oftmals am Computer
vorbereitet und erlernt und regelrecht trainiert werden kann. Gerade
Sprengstoffe und Distanzwaffen zersetzen aber soziale Disziplin und wecken die
Illusion einer aggressiven Allmacht über Leben und Tod. Der Mensch, so betont Schmidbauer, sei von seinem psychischen
Apparat her nicht dafür geschaffen, durch Druck auf einen Auslöser über Sein und Nicht-Sein anderer Menschen zu bestimmen.
Wichtige Präventionsmaßnahmen gegen Amoktaten sind somit der Schutz vor narzisstischen Kränkungen und Verletzungen des Selbstwertgefühls und dementsprechend die Öffnung emotionaler, sozialer und wirtschaftlicher Perspektiven nebst zugehöriger Quellen der Anerkennung und Wertschätzung. Für die Verhinderung dieses tödlichen, narzisstisch motivierten Suizids sei nicht zuletzt auch auf die
multimediale Multiplikation des Bekanntheitsgrades des Täters zu verzichten, ist das Erlangen von Berühmtheit doch ein Hauptmotiv der Massenmorde: Gewonnene Aufmerksamkeit in dieser
exzessiven Form wirke auf entsprechend narzisstisch gestörte Individuen geradezu wie ein Magnet. In der Konkurrenz-, Wettbewerbs- und
Konsumgesellschaft sind Medienpräsenz und öffentliche Aufmerksamkeit per se ein hohes Gut, eine höchst erstrebenswerte Option, jemand Besonderes zu sein und so dem deprimierenden
Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit und der Nicht-Zugehörigkeit zu attraktiven Gruppen zu entfliehen.23 Die Reaktion auf erlittenes Mobbing, das vielen Amoktaten vorangeht, wird stark
durch frühkindliche Prägungen und Bindungsqualitäten beeinflusst, werden doch (wie in Buch 1 dargelegt) bereits in jungen Jahren
der spätere Umgang mit solchen Erfahrungen und deren ge- oder misslingende Verarbeitung
grundgelegt: Ob ein Kind befriedigende soziale Beziehungen aufbauen kann oder
nicht, hängt von frühkindlichen psycho- und soziodynamischen Regelkreisen ab, die im späteren Leben wiederbelebt werden. Entsprechend bedeutsam ist es, wie die
Bindungsforschung lehrt, ob sich das Kind in seinen frühen Beziehungen erwünscht und wertgeschätzt fühlen konnte. In diesem günstigen Fall wird es sich später dann auch in der Schule für die anderen Kinder interessieren und prosozial auf diese zugehen.24
2. Terror und Geschlecht
Dabei sind es gerade auch nachhaltige Veränderungen im Umgang der Geschlechter miteinander, die heute vorhandene Kränkungserlebnisse männlicher Jugendlicher mitunter verstärken. Die sog. „Incels“ („Involuntary celibacy“, unfreiwilliges Zölibat), die sich in extremistischen Internetforen („4chan“, „8chan“) gegenseitig in ihrer Verachtung für Minderheiten aufstacheln und in ihrem Frauenhass, ihre Misogynie, bestärken, sind ein brandgefährliches Beispiel hierfür.25 Ein entscheidender Faktor für die Erklärung von Amokattentaten ist entsprechend das Geschlecht der praktisch stets männlichen Täter: Von den Schul-Amokläufern sind mehr als 90 Prozent der Täter (junge) Männer. Das habe, so wiederum der Jugend- und Gesundheitsforscher Klaus Hurrelmann
von der Hertie School of Governance, mit typisch männlichen Bearbeitungsstrategien von Störungen und Belastungen zu tun. Männer verlagern diese nicht nach innen, sondern explosiv nach außen. „Die Gewalt wird dann als Befreiungsschlag gegen die Umwelt erlebt – und gegen sich selbst. Denn meist töten die Täter am Ende sich selbst.“26 Auch der Rechtspsychologe Dietmar Heubrock vom Institut für Psychologie und Kognitionsforschung an der Uni Bremen unterstreicht diese
Tatsache, dass, von wenigen Ausnahmen wie der Attentäterin von San Bernardino 2015 oder den sog. „Schwarzen Witwen“ aus Tschetschenien in Russland (um 2002–2004) abgesehen, praktisch nur Männer zu Amokläufen und islamistischen Terroranschlägen neigen. (Beim politisch motivierten und intellektuell-ideologisch unterfütterten Linksterrorismus der 70er und 80er Jahre war dies aufgrund der
Unterschiede im Bildungsniveau der Attentäter/innen und wegen der den Organisationen grundlegenden Ideologeme noch anders.
Zur Rolle des Geschlechts der Terroristen und Terroristinnen siehe noch Kapitel II.10).27 Die Gründe finden sich in den unterschiedlichen Verarbeitungsweisen von Wut, Kränkung und Angst: Bei den Ursachen gelte es zunächst zwischen Attentätern und Amokläufern zu unterscheiden, so Heubrock. Die Amoktäter in Deutschland, von Erfurt bis Winnenden, seien praktisch alle psychisch
gestört gewesen. Jungen und Männer reagierten auf psychische Störungen indes auf andere Weise als Mädchen und Frauen. Tendierten letztere eher zu selbstschädigendem Verhalten, zu teils völligem sozialen Rückzug, zu Essensverzicht und bspw. zum Aufritzen der Arme, legten Jungs und Männer eher ein Verhalten an den Tag, welches Psychologen unter dem Begriff „externalisierende Handlungen“ subsumieren. Sie verletzen dabei nicht sich, sondern andere, neigen eher zu
Schlägereien, bis hin zu schwerer Körperverletzung und Morden, wobei ein Amoklauf diesbezüglich das ultimative Extrem darstellt. Die Hauptursache ist nach Heubrocks
Auffassung letztlich biologischer Natur: Bei Männern sei das Stresshormon Cortisol stark ausgeprägt, wie sich schon bei männlichen Neugeborenen gegenüber weiblichen zeige. Dies führe dazu, dass sie tendenziell mehr schreien und sich mehr bewegen, motorisch
aktiver sind. Vereinfacht könne man sagen, dass der Cortisol-Level mit dem Drang zu externalisierendem
Verhalten positiv korreliere, womit Heubrock den hormonellen und
genetisch-dispositiven Faktor unterstreicht und sich damit gegen jene Strömungen in den Gender-Studies wendet, die solche geschlechtsspezifischen
Unterschiede im Verhalten allein erlernten, gesellschaftlich vorgegebenen
Rollenmustern zuschreiben.28 Gerade psychisch labile, volatile und ungebildete Personen würden dabei von Organisationen wie dem „Islamischen Staat“ (IS) gezielt angesprochen und propagandistisch umworben. Von Anbeginn an habe
diese Organisation ihre Propaganda- und Rekrutierungs-Strategie auf junge und
psychisch labile Männer ausgerichtet, wie Heubrock an diesem Beispiel solche typischen
Radikalisierungsprozesse zum Fanatiker und Terroristen erläutert. Die PR-Videos sind mit martialischer, heroischer Musik unterlegt, zu
sehen sind bewaffnete Männer, die auf großen Jeeps durch die Wüste fahren. Frauen hingegen werden als Kriegsbeute und Belohnung präsentiert, denn wer als Mann für den IS kämpfe, habe geradezu Anspruch auf Sklavinnen oder treu ergebene Ehefrauen. Im
Falle des Märtyrertodes, so die durchaus von vielen ernst genommene religiöse Wahnidee, warteten ohnehin nicht weniger als 72 Jungfrauen im Paradies auf
die oft genug sexuell frustrierten Jungmänner.29
Einen weiteren wichtigen Aspekt bringt der Tiefenpsychologe Wolfgang Schmidbauer
mit in die Analyse ein: Die Zahl an unkonzentrierten, schnell beleidigten,
schnell aufgebenden, steten Zuspruch und stete Aufmerksamkeit bedürfenden Kindern sei empirisch belegbar im Steigen begriffen.30 Von der Grundschule bis hin zur Universität sei die mittlere, unauffällige Gruppe der einigermaßen angepassten, funktionierenden, weder herausragenden noch unfähigen Kinder und Jugendlichen am Schwinden, und zwar vor allem unter den jungen
Männern, dem oft empfundenen Selbstinszenierungs- und Leistungszwang und zugehörigem Gehabe entgegenlaufend. In den zentralen Lebenswelten und
Sozialisationsinstanzen Familie, Schule, Clique/Peer-group und soziale Medien würde es zudem immer schwerer, erlittene Kränkungen zu verarbeiten. Mobben und gemobbt werden, „Shitstorms“ zu initiieren oder deren Opfer zu werden, sei heute Teil des Alltags
Adoleszenter. Solche Kinder und Jugendlichen, die unglücklich und neidvoll auf jene schauen, die sich hingegen beliebt machen können und in ihren Cliquen Anerkennung und Wertschätzung ernten, ziehen sich oft in sie tröstende Medienwelten der sozialen Netzwerke und der Computergames zurück. Diese entlasten die gekränkte Seele, indem sie der verunsicherten Männlichkeit die Möglichkeit eröffnen, einen Heldentraum zu träumen. Gleichzeitig finden sie in den virtuellen Welten die Möglichkeit, sich an jenen zu rächen, die als die Verantwortlichen und Schuldigen für die erlittenen sozialen Ängste, die empfundene Perspektivlosigkeit und das Gefühl gesellschaftlichen Ausgeschlossenseins identifiziert werden.31
3. Amok und psychische Störungen
Im Gegensatz zur psychoanalytischen und psychologischen Sichtweise Wolfgang
Schmidbauers hebt der Psychologe Peter Langman weit stärker auf psychiatrische Begleitumstände solcher Taten im Sinne schwerwiegendster Persönlichkeitsstörungen ab: Er hat über fünf Jahre hinweg die Krankenakten, psychotherapeutischen Berichte und Verhörprotokolle zu über hundert „School Shootings“, also Amokläufen an Schulen, ausgewertet.32 Die zehn Fälle, zu denen das meiste Material existierte, wurden sodann einer eingehenderen
Analyse unterzogen. Das Ergebnis lautete, dass bei allen zehn Tätern eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostizierbar war. Alle befanden sich in Behandlung oder nahmen vor
ihren Attentaten gelegentlich therapeutische oder psychiatrische Hilfe in
Anspruch. Die psychischen Erkrankungen waren der gemeinsame Nenner für die sonst oft ganz unterschiedlich gelagerten Einzelfälle. Langman zählt diesbezüglich drei Idealtypen der Täter von Schulamokläufen auf: die Traumatisierten, die Psychotiker und die Psychopathen.
Traumatisierung bedeutet, dass der Täter selbst ein schweres Schockerlebnis zu verarbeiten hatte. Er war
beispielsweise selbst Opfer von Gewalt, hat massive Interventionen in seine
persönliche Autonomie erlebt oder war existenziellen Ängsten ausgesetzt. Neben der schizoiden (gespaltenen) Persönlichkeit rückt Langman die psychopathologische Persönlichkeit in den Mittelpunkt, weil er diese als die häufigste Typologie erachtet. Betroffene Menschen haben den Kontakt zu sich
selbst, zum eigenen Körper, der Psyche und auch zur personalen Umwelt völlig verloren. Sie leben in einem Wahnraum und halten sich für jemand anderen, als sie sind. Zwar sei der Faktor der Kränkung zentral, jedoch keineswegs alleinerklärend: In seinem Buch „Amok im Kopf“ zeigt Langman, dass es sich eben nicht so einfach verhalte: So gab und gibt es
auch Täter, die in ihrer Schule durchaus erfolgreich und beliebt waren. Die Persönlichkeitsstörung ist in diesem Fall somit offenkundig einem anderen Risikofaktor geschuldet.
Was sie alle eint, so Langman dezidiert, war, dass alle Täter zum Tatzeitpunkt in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung waren
oder sind.33
Den Stellenwert der Langmanschen Untersuchungen ist dem Jugendsoziologen und
Gesundheitsforscher Klaus Hurrelmann zufolge gar nicht hoch genug einzuschätzen: Es sei vorher einfach nicht klar gewesen, dass eine derart starke Persönlichkeitsstörung – Langman spricht sogar von Persönlichkeitszerstörung – all solchen Tätertypen gemein ist und eine derart schwerwiegende Rolle spielt. Aus
soziologischer Sicht, so Hurrelmann, seien primär Umweltbelastungen, also etwa gestörte Familienverhältnisse, schulische Belastungen, Konflikte im Freundeskreis etc., von primärer Bedeutung. Langman hingegen zeige auf, dass dies zwar eminent wichtige
Faktoren seien, die bei einer gestörten Persönlichkeit aber dazu führten, dass die jungen Männer in eine andere Welt abdrifteten. Eine gesunde Person könne oft selbst noch die schwersten Konflikte produktiv bewältigen. Und schließlich und nicht zuletzt muss ja jeweils noch der dritte Faktor als
Grundvoraussetzung gegeben sein: Der Täter muss Zugang zu einer Mordwaffe haben.34
Ein weiteres zentrales Wahnmotiv im Kontext Amok und Terror ist zudem die Überhöhung der Tat als sinnvoll und gerecht. Es ist dies ein Anliegen, das gerade in
Zeiten religiös verbrämten Terrors den Amokläufern und Suizidenten die Möglichkeit eröffnet, das eigene Verbrechen in einen größeren, politischen, ja sogar sakralen Kontext zu rücken und die Reichweite, Wahrnehmung und psychologische Schlagkraft solcherart
zu multiplizieren. Ein derartiges Motiv scheint etwa dem Massenmörder von Nizza zugrunde zu liegen, der am französischen Nationalfeiertag 2016 mit einem LKW 82 Menschen gezielt zu Tode fuhr und
sich zuvor in scheinbar aller kürzester Zeit religiös radikalisiert und mit der Ideologie des Islamischen Staats vertraut gemacht
hat. Der Täter, so Klaus Hurrelmann in seiner Interpretation, sei natürlich daran interessiert, seinem Massenmord eine höhere Sinnkomponente zu geben. Zum Beispiel, sich als Opfer der Gesellschaft zu
inszenieren oder sich als Kämpfer für Gerechtigkeit zu stilisieren. Deshalb sei es ja für viele Attentäter gerade auch so attraktiv, ihren Taten höhere Weihen zu verleihen, seien diese religiös, ideologisch oder politisch definiert oder alles zusammen.35
Der Amokforscher Christoph Paulus, Bildungswissenschaftler an der Universität des Saarlandes, benennt vier typische Faktoren für jeden Amoklauf: Amokläufer sind extrem von Waffen fasziniert, sie haben Zugang zu selbigen, sie neigen
zu stark aggressivem Verhalten und zeigen deutliche Anzeichen einer psychischen
Störung wie Narzissmus, Paranoia oder andere Psychopathien. Der Prozess der
Entstehung eines überzogenen, narzisstischen Selbstbildes vollziehe sich dabei über Jahre, so Paulus. Diese Personen reagierten bereits auf kleinste, alltägliche Kritik extrem empfindlich, häufig wähnten sie alle anderen gegen sich. Paulus Forschungsergebnisse lassen sich
dahingehend zusammenfassen, dass die Trauer über dieses Gefühl, nicht angemessen wertgeschätzt zu werden, sich langsam zu Ärger und dann in Wut wandele und diese Wut letztlich zum dringenden Ausbruch dränge.36 Amokläufer seien zwar meist aggressive, doch zugleich auch schüchterne Persönlichkeiten. Sie sähen oft keine andere Möglichkeit, als die Wut auf andere in sich selbst hineinzufressen, Fremdhass
werde so zu Selbsthass, der dann wiederum auf andere projiziert werde. Entgegen
weitläufiger Meinung gründe Amok aber keineswegs überwiegend in Mobbing und Erniedrigungserfahrungen. Dass Amokläufer immer gemobbt würden, sei entgegen der weitverbreiteten Meinung die absolute Ausnahme, so
Paulus. Sie isolierten sich vielmehr selbst von ihrer sozialen Umwelt und
wollten mit anderen nichts zu tun haben, sie denken, weit über anderen zu stehen. So gebe es etwa Amokläufer, die vorab ihrer Taten Sätze in ihr Tagebuch schreiben wie: „Ich bin viel besser als Gott. Ich entscheide, wer leben und wer sterben soll.“37 Kämen dann noch familiäre Umfeldbedingungen hinzu, die an den persönlichen Krisen wenig Interesse zeigen oder diese gar noch verstärken, seien alle Risikofaktoren beisammen. Aus einem Gefühl, andauernd ungerecht behandelt zu werden, entstehe so ein Feindbild, das gar
nicht an konkrete Personen geknüpft sei. Sie entwickeln vielmehr einen generalisierten Hass auf die Welt, auf
ihre Schule, auf Ausländer oder auf Frauen. Letztlich sind es somit Stellvertreter dieser verhassten
Gruppen, die bei einem Amoklauf zum Opfer werden. Sie sind so gesehen nicht
persönlich gemeint, sondern sind Opfer pars pro toto.38
Amokläufer wenden sich insbesondere auch gegen jene, von denen sie sich persönlich bedroht fühlen. Bei Jugendlichen ist das meist die Peergroup, bei Erwachsenen etwa der ehemalige Arbeitgeber oder ein Vertreter der
Staatsmacht wie Richter oder Polizisten. Bei erwachsenen Amokläufern, so die Ergebnisse von Paulus Studien, komme außerdem häufig eine Initialzündung als erschwerender Faktor hinzu: Oft tragen sie die Verantwortung für eine Familie und verlieren plötzlich jede Zukunftsperspektive, sei es durch Kündigung oder Scheidung. Während Jugendliche im Vorfeld ihres Amoklaufs diesen oftmals im Internet mehr
oder weniger deutlich ankündigten, sei dies bei Erwachsenen in aller Regel nicht der Fall.39 Auch Christoph Paulus hebt wiederum den Gender-Aspekt bei Amoktaten hervor: Es
gebe nur sehr wenige Fälle von weiblichen Amokläuferinnen. Männer legten typischerweise ein deutlich aggressiveres Verhalten an den Tag,
weibliche Aggression hingegen funktioniere subtiler, sie vollziehe sich oft auf
verbale und soziale Art. Mädchen werden meist auch dazu erzogen, Konflikte nicht mit Gewalt auszutragen, während dies bei Männern noch eher akzeptiert sei und im Extremfall in manchen Milieus sogar als männliches Attribut gewürdigt wird.
Ein authentischer, wertschätzender, stabiler Zugang zum Kind und das nicht erst in der Adoleszenz, sei, so
Christoph Paulus mit Blick auf die Interventionsebene, ein entscheidender Präventionsfaktor elementarpädagogischer Art. Im Gegensatz zu Serienmördern hätten Amokläufer normalerweise keine Misshandlungen oder Vernachlässigung er- und durchlebt. Die Kinder wurden zwar stets gefüttert und warm angezogen, doch erwies sich das Bindungsverhalten, die emotionale
Bindung zu ihren primären Bindungspersonen, als instabil. Manche hätten schon als Baby anhand ihrer Bindungsperson gelernt, dass auf eindeutige
Signale der Bedürftigkeit wie lautes Schreien oder Weinen, niemand reagiere. Das fehlende „Urvertrauen“ (Erik Erikson), sich auf jemanden verlassen zu können, ist dann die bleibende, tief in die Persönlichkeitsstruktur eingegrabene Erfahrung bleibender Art.40
Der Soziologe David Altheide hebt in seiner Studie „Creating Fear“ zudem einen diskussionswürdigen gesellschaftspolitischen Aspekt der Amokattentate hervor: Es seien die
Massenmedien, die seit Ende des Kalten Krieges und in Zeiten eines umfassenden ökonomischen Strukturwandels das Bild einer Welt zeichneten, die geradezu außer Kontrolle geraten sei. Damit aber würden Nachahmungstäter spektakulärer Massenmorde geradezu getriggert. Die primäre Botschaft sensationsheischender Medien sei Angst, ganz im Sinne von „Angst sells“. In einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft, so geht die These, herrsche kaum noch Angst vor Gott
und Göttern, sondern, neben wirtschaftlichen Niedergang, vor allem vor Verbrechen und
Gewalt.41 Extreme Gewalttaten wie Amokläufe und Terroranschläge lassen sich somit auch als Selbstermächtigungs- und Größenwahnfantasien deuten, gemäß dem Motiv, das denkbar schlimmste Verbrechen zu begehen und sich als der
Allergrößte wahrzunehmen oder von seinen ideologischen Anhängern entsprechend wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Der Täter, so wiederum Klaus Hurrelmann, steigere sich in seiner dekonstruierten Persönlichkeit in Wahnvorstellungen hinein, empfinde sich als allmächtig und erreiche durch seine Mordtaten etwas, das er nie zuvor in seinem Leben
wirklich erlangt hat, nämlich die totale, gottgleiche Herrschaft über andere Menschen. „Er katapultiert sich aus der Ohnmacht heraus in die brutale Machtausübung.“ Die Selbsttötung ist der Tat immanent. „Es handelt sich um einen Menschen, der nicht nur seine Umwelt hasst, sondern
auch sich selbst. Das fällt zusammen. Das macht sie ja auch so unverständlich.“42
Der Kinder- und Jugendpsychiater Patrick Frottier wiederum sieht die
tieferliegenden Ursachen für jugendlichen Amok in kleinkindlicher Indoktrination. Das sog. frühe „Priming“, die Prägung „von klein“ auf, sei in vielen Fällen von größter Wirkmächtigkeit. Viele Attentäter, so das Ergebnis vieler von ihm geführter Interviews, lernten von Kindheit an, dass es einen zu hassenden Feind
gibt, dessen Zerstörung moralisch legitim und sogar geboten ist. Selbstmordattentäter handelten oft aus einer inneren und biographiegeschichtlich begründbaren und nachvollziehbaren Logik heraus und seien im Moment der Tat
entsprechend auch von der Richtigkeit ihres Tuns überzeugt. Seit langem schon hegten sie Wut und Hass auf und gegen die Welt, auf
den erlernten Feind und alle, die als ursächlich verantwortlich für die eigene Unzufriedenheit erachtet werden. Die frühzeitige, in der Kindheit erfahrene Indoktrination vermag nun leider auch unter
ansonsten stabilen Lebensverhältnissen im Erwachsenenalter re-aktualisiert zu werden, sei es durch Kränkungen und Enttäuschungen oder durch Autoritäten, die an Stelle der kindlichen Indoktrineure treten. Solche „Vorbilder“ spielten hierbei eine wesentliche Rolle, so Frottier. Die Frage, wer einem
Individuum Halt gebe, an wem sich gerade junge Menschen orientieren können, sei dabei von zentraler Bedeutung, entsprechend einflussreich seien
role-models und Ersatzbrüder oder Vaterfiguren. Gerade Individuen mit eingeschränkten Handlungsoptionen und wenig Kontrolle über ihre Umwelt fühlten sich ohne Halt. Dies könne Lethargie oder Aggressionen auslösen, und zwar auch ohne psychische Störungen.43
Fanatismus lässt sich nicht einfach „wegpathologisieren“
Die Psychiaterin und Psychotherapeutin Nahlah Saimeh, Direktorin einer hoch
gesicherten forensischen Fachklinik, fasst ihre Erfahrungen, die sie auch als
Gutachterin von Schuldfähigkeits- und Gefährlichkeitsprognosen erwarb, in dem Buch „Jeder kann zum Mörder werden“ (2012) zusammen. Wie der reißerische Titel bereits andeutet, sind es oft profane Gründe, die im Falle ihres fatalen Zusammenwirkens mit anderen destabilisierenden
Umweltfaktoren sozialer und psychischer Art das Abrutschen in Aggression,
Gewalt und Fanatismus bedingen können. Solche individualpsychischen Risikofaktoren sind etwa Selbsthass,
Eifersucht, soziale Isolation und Ängste unterschiedlichster Art. Alle Faktoren eint, dass sie letztlich allesamt
Ergebnis individueller Prägung, Erziehung und Sozialisation sind. Gerade terroristische Gruppierungen, wie
sie bei organisierten Neonazis und im Kontext islamistischen Fanatismus zu
besichtigen sind, seien für dissoziale und psychopathische Persönlichkeiten natürlich höchst attraktiv. Sie seien geradezu ein Eldorado für hemmungslose, sadistische Gewaltausübung. Junge Männer könnten dort nach Lust und Laune morden und vergewaltigen und das mit
Heldenstatus, so Saimeh, im Falle des Islamismus auch noch mit religiöser Absolution. Zudem entsprächen exzessive Gewalt und Terror dem stereotypen Rollenbild von unerschrockener
Härte und Hypermaskulinität. Jedoch seien selbst diese Menschenfeinde keine Irren im umgangssprachlichen
oder gar psychiatrischen Sinne, denn es fehle meist der komplette Realitätsverlust, wie dies für echte Psychosen oder Schizophrenien typisch sei.44
Gewaltexzesse, wie sie in Form der religiösen Furors islamistischer Massenmörder oder in politischer Gestalt rechtsextremer Menschenverachtung eines Anders
Breivik, der Mitglieder des NSU oder auch am Beispiel erbarmungsloser Schul-
und sonstiger Amokläufer zu beobachten sind, seien eben nicht allein mit psychischen
Krankheitsbildern zu erklären. Dergleichen Anschläge und Kriegshandlungen erforderten komplexe Logistiken sowie taktisches und
strategisches Handeln seitens der Täter, die im psychotischen Zustand schwer möglich seien. Auch im Nationalsozialismus hätten aus psychiatrischer Sicht weitestgehend normale Menschen bestialische Gräuel begangen. Abgesehen von Persönlichkeitsstörungen wie etwa Borderline-Symptomen seien die Täter in aller Regel durchaus fähig, die Realität wahrzunehmen, wenn auch mitunter verzerrt. Kategorien der Medizin seien
demzufolge weitestgehend fehl am Platz, vielmehr bedürfe es der schwierigeren Suche nach sozialen und psychosozialen, nach persönlichen und individualpsychologischen Motiven, die allesamt wiederum in den je
persönlichen hochkomplexen Prägungs-, Erziehungs- und Sozialisationserfahrungen gründen.
Die Psychiatrisierung des Terrorismus bagatellisiere diesen vielmehr, so Saimeh,
weil er ihn auf die individuelle Pathologie reduziere. Außer Acht blieben dabei besagte soziologische, historische, religiöse und andere politisch-ideologische Motive. Außerdem impliziere die medizinische Pathologisierung des Terrors die Annahme, nur
psychisch kranke Menschen könnten zu Terroristen und Massenmördern werden, was indes nicht der Fall sei, wie Saimeh unterstreicht. Bisher sei
noch keine spezifische Persönlichkeitsstörung speziell für Terroristen diagnostiziert worden, jedoch gebe es strukturell benennbare Auffälligkeiten und Spezifika im Denken und in der Persönlichkeitsentwicklung der Gewalttäter, eben die individuelle Radikalisierung und Fanatisierung. Terror basiere auf
dem sozusagen nach außen verlagerten, inneren Feind. Am Anfang der Entwicklung steht, wie hier schon
ausgeführt, nahezu immer ein subjektives Empfinden massiver Ungerechtigkeit sowie ein
Gefühl der Unterlegenheit und Benachteiligung. Mit anderen Worten: ein Gefühl der persönlichen Kränkung. Die Ohnmachtsgefühle des einzelnen Individuums treffen dann oft mit dem Unterlegenheits- und
Benachteiligungsempfinden eines gesellschaftlichen, politischen oder eben auch
religiösen Kollektivs zusammen. Die jeweiligen Ursachen für diese vermeintliche oder auch tatsächliche Unterlegenheit werde dabei stets in einem Außen verortet, die Schuld wird auf eine andere, die überlegene Gruppe projiziert. Auch paranoid anmutende Verschwörungstheorien spielen hierbei eine Rolle, ebenso tradierte Feindbilder, seien
diese rassistisch oder religiös motiviert (man denke an den Hass von Nazis wie Islamisten auf Juden oder an
die innerislamische Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten). Die
destruktive Persönlichkeitsentwicklung hin zum blindwütigen Fanatismus kann anhand der Persönlichkeitsstörung des „malignen Narzissmus“ erklärt werden. Dieser trachtet danach, in eifernder Wut und eliminatorischem Hass
dasjenige und denjenigen zu vernichten, das und der als Ursache für die eigene Niederlage und tief empfundenen Kränkungen angesehen wird. Der selbsternannte Rächer steigert sich in Vernichtungs-, aber auch in Grandiositäts- und Triumphfantasien und wähnt sich im Besitz der absoluten Wahrheit. Nicht selten delegieren schweigende,
indes weltanschaulich sympathisierende Gruppen solche Wünsche der Genugtuung an radikale Einzelne und ausgewählte Gruppen, die dann stellvertretend den Rachedurst stillen helfen sollen, so
Saimeh in ihrer Analyse des eliminatorischen Fanatismus.45
Dabei sind es aber keinesfalls „nur“ die Marginalisierten, die „Modernisierungsverlierer“ (Wilhelm Heitmeyer) und sozial Benachteiligten der Klassen- und
Konkurrenzgesellschaft, die besonders anfällig und affin für Extremismus aller Arten seien. Schließlich drifteten ja auch Mittelschichtsjugendliche in die islamistische Szene oder
ins rechtsextreme Milieu oder versumpfen unter der „Obhut“ von Quasi-Sekten, unterwerfen sich Verschwörungsglauben (man denke an den „Q-Anon-Kult“) und nehmen an „konformistischen Rebellionen“ teil. Dergleichen Revolten haben nicht die Beseitigung der tatsächlichen Ursachen für Vereinsamung, Entsolidarisierung und Entfremdung zum Ziel, wie sie etwa in den
Eigentums-, Wohn- und Produktionsverhältnissen, in der Freizeit- und Konsumkultur zu finden sind. Dergleichen Umstände gesellschaftlichen Lebens bleiben vielmehr sogar weitgehend unreflektiert
und unangetastet, stattdessen werden Orientierung und Lebenssinn liefernde
Gemeinschaftsidentitäten im Kampf gegen (andere) Minderheiten und missliebige
Weltanschauungsgemeinschaften entwickelt. Die Bewegung der neuen
Rechtsradikalen („Alt-Right“), sexistische Hass-Sekten wie die „Incels“ („unfreiwilliges Zölibat“) oder militante Impfgegner können hier als Beispiele dienen. Man dürfe freilich die realen Sozialfaktoren auch nicht überschätzen, so Saimeh mit Verweis etwa auf Mohammed Atta: Er war einer der Anführer der Anschläge des 11. September 2001 und ein erfolgreicher Absolvent der TU
Hamburg-Harburg. Als Diplomingenieur für Stadtplanung stand ihm durchaus eine bürgerliche Karriere offen. Dergleichen Beispiele bezüglich Ausbildung, Beruf und sozialem Status keineswegs benachteiligter
Terroristen finden sich zuhauf, wie unter II.7 noch zu zeigen. Anfällig für Radikalisierung und Fanatismus seien gemäß Nahlah Saimeh in erster Linie solche Menschen, die mit der modernen
Gesellschaft und ihren Werten nicht zurechtkommen. Manche, die in sozialer
Hinsicht sogar in einem eher stabilen Umfeld sozialisiert wurden, seien von den
Erwartungen und potentiellen Möglichkeiten der modernen, individualisierten Konsum-, Leistungs-, und
Erlebnisgesellschaft überfordert.
Hier scheint erneut jenes Phänomen auf, das speziell im Kontext jugendlichen Fanatismus in westlich-liberalen
Industriestaaten immer wieder anzutreffen ist: Moderne Gesellschaften sind überaus komplex und widersprüchlich, sie bieten, zumindest optional, große individuelle Freiheiten hinsichtlich Selbstentfaltung und biografischer Entwürfe, sie erfordern jedoch zugleich auch biografisches Selbstmanagement, da die
Lebensentwürfe nicht mehr so starr durch Eltern und Umfeld vorgegeben sind wie noch vor
wenigen Jahrzehnten. Dieser ambivalente Charakter (post)moderner
Industriegesellschaften zwischen Freiheit und Zwang zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiger Hintergrund vieler Fanatisierungs- und
Radikalisierungsprozesse, denen sehr oft entsprechende Überforderungserfahrungen nebst zugehörigen Kränkungen zugrunde liegen: In modernen, „offenen“ Gesellschaften wird dem/der einzelnen nicht nur ein Optionsbüffet in Fragen der Berufswahl, der konsumistischen und hedonistischen
Selbstinszenierung, aber auch der Selbstentfaltung als komplexer Persönlichkeit offeriert, es wird zugleich auch vieles an selbständigen und selbstverantwortlichen Entscheidungen und Haltungen eingefordert. Dem/der einzelnen wird in modernen Leistungsgesellschaften somit ein hohes Maß an Entscheidungsfähigkeit bezüglich seiner Lebensplanung abverlangt. Auch auf dem gerade für junge Männer sensiblen Feld der Sexualität gibt es heute kaum noch die tradierte „Sitte“, an der sich Jugendliche verbindlich orientieren könnten, vielmehr steht auch hier wiederum oft der Primat der Selbstbestimmung und
nicht zuletzt der Selbstinszenierung im Vordergrund. Dergleichen
gesellschaftliche Libertinage stellt zweifellos eine große zivilisatorische Errungenschaft dar, wie auch Nahlah Saimeh zu Recht betont,
doch „manche Menschen kommen mit dieser Freiheit eben nicht zurecht.“46
Die pluralen, oft auch widersprüchlichen Normen und Werte bedürfen einer kritischen Reflexionsfähigkeit und eines hohen Maßes an Selbststeuerung seitens des/der einzelnen. Es kommt heute ganz besonders
darauf an, Widersprüche und individuelle Unzulänglichkeiten, auch und insbesondere Erfahrungen des Scheiterns, auszuhalten und
durch geeignete „Coping-Strategien“ zu bewältigen. Diese Anforderung bzw. die ihr entsprechende Persönlichkeitsdisposition fungiert meist unter dem Begriff der „Resilienz“ und wird gegenwärtig geradezu als ein Leitziel und Kriterium gelingender Erziehung und
Sozialisation postuliert. Eine solche Widerstandsfähigkeit gegenüber den Unbilden des Lebens: Ambivalenzen auszuhalten, Selbst- und Fremdkritik
zu ertragen, Niederlagen zu ertragen und seine Ziele realistisch einschätzen zu können, ungeachtet der ständigen Verlockungen und Anrufungen seitens der Konsum- und Kulturindustrie,
erfordert eine hohe „Ich-Stärke“, mit anderen Worten eine gefestigte Persönlichkeit und ein positives Selbstkonzept. Die moderne, teils permissive und
multioptionale „postmoderne“ und „postindustrielle“ Gesellschaft der Gegenwart verlange, wie Saimeh hervorhebt, heute mehr denn je
ein differenziertes Gefühl für sich selbst, man müsse seine inneren Zustände auch reflektieren und strukturieren können.47
Im gleichen Sinne wie Nahlah Saimeh betont auch die forensische Psychiaterin und
Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner, dass politisch und/oder religiös motivierte Terroristen in aller Regel keine Geisteskranken im psychiatrischen
Sinne, also medizinisch besehen, seien. Vielmehr hebe der Terror auf Handlungen
ab, die nicht zwingend Rückschlüsse auf eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur zuließen: Die Sammelkategorie „Terroristen“ sei zu inhomogen und lasse sich demnach nur sehr grob strukturieren. „Selbstherrlichkeit“ etwa könne als eine Voraussetzung dafür gelten, sich als omnipotentes Ego über andere zu stellen. Zum Teil seien es aber auch schlicht Verführte, die sich in ihrer Orientierungslosigkeit einer ideologischen Bewegung
anschließen, die sich über andere (Anschauungen) stellt und Anspruch auf die alleinige Wahrheit erhebt.
Wenn diese alleinige Wahrheit dann auch noch auf dem direkten Wege ins Jenseits
führe, wo die unendliche Herrlichkeit lockt, sei das für labile Geister natürlich kaum zu toppen. Da könne ein diesseitiges System kaum ein Gegengewicht bieten. Dass nachteilige
biografische Verhältnisse gewaltbereiter machen, sei aber kein Hinweis auf Geisteskrankheit. Immer
wieder gebe es außerdem auch Gewalttäter, die aus gutsituierten Familien und Milieus stammen.48 Auch der Kinder-, Jugend- und Gerichtspsychiater Patrick Frottier hebt hervor,
dass nicht nur zur Hochzeit der eschatologischen Terror-Sekte „Islamischer Staat“ jeder Amok-Täter mit entsprechender Affinität dazu neige, sein Morden in einen größeren Zusammenhang zu rücken. Das ideologische Aufblasen der Taten erhöht deren Reichweite und multipliziert den Impact: Die, im Grunde, Zufälligkeit der individuellen Radikalisierung, wie sie aus der
individualpsychologischen Entwicklung jedes Menschen resultiere, wird von einer
institutionellen Organisation letztlich „nur“ vereinnahmt und katalysiert: „Wäre ich Chef des IS“, so Frottier, „würde ich jede Bombe, die zurzeit hochgeht, für den IS reklamieren.“49 Das sei höchst öffentlichkeitswirksam und Medien sprängen meist naiv darauf an. Die Beliebigkeit der Opfer, das Wissen, es kann
jeden, überall treffen, nicht nur Vertreter „des Systems“ (wie dies noch eine typische Strategie des linksextremen Terrors der 70er und
80er Jahre des letzten Jahrhunderts war), löse eine weitflächige Destabilisierung der Gesellschaft aus, weil die Taten scheinbar jeden von
uns treffen können, und erreicht so das Ziel jeder Terror-Strategie, so Frottier weiter.
Zentral ist ihmzufolge deshalb letztlich dann doch der Aspekt der psychischen Störung, der Persönlichkeitszerrüttung: Forensische Psychiater stellen bei der Beurteilung einer kriminellen
Handlung stets die entscheidende Frage, ob dem Täter tatsächlich bewusst war, was er tut, welches Verbrechen mit welchen Folgen er beging.
Konnte er zwischen richtig und falsch unterscheiden und sich frei für oder gegen die Tat entscheiden? War er in der Lage, seiner jeweiligen
Entscheidung gemäß zu handeln? Der Ablauf des LKW-Attentats in Nizza am 14. Juli 2016 etwa, bei
der ein islamistischer Attentäter 86 Menschen mit einem LKW zu Tode brachte, beantwortete dies eindeutig, und
zwar angesichts dessen langer Vorbereitung und der gründlichen Planung, so Frottier. Eine psychische Krankheit kam daher kaum als
Ursache der Tat in Frage.50 Bei vielen Persönlichkeitsstörungen sei zwar die Realitätskontrolle weitgehend erhalten geblieben, die Faktoren Gefühlswahrnehmung, Impulskontrolle, Beziehungsgestaltung und Realitätsinterpretation jedoch unterscheiden sich doch deutlich von den meisten anderen
Menschen. Die Folge sei ein hoher individueller Leidensdruck oder, wenn sie
sich dessen selbst nicht bewusst seien, ein Leiden seitens des sozialen
Umfelds. Gerade unter Stressbedingungen wie belastenden sozialen Umständen könne psychische Stabilität durch Prozesse der Selbstreflexion und Selbstregulierung verlorengehen. Eine
klassische psychiatrische Erkrankung hingegen verläuft in aller Regel über Krankheitsbeginn, Krankheitsverlauf, definierte Therapie und (idealiter)
Heilung, bei chronischen Erkrankungen liegt das Ergebnis günstigenfalls bei einer Linderung der Symptome. Es sei zu akzeptieren, dass die
meisten Terror-Attentäter eben nicht krank sind und möglicherweise auch keine gestörte Persönlichkeit aufwiesen, zumindest nicht im
psychologisch-therapeutisch-diagnostischen Sinne: Die übergroße Mehrheit psychisch kranker und traumatisierter Menschen begeht schließlich keine Terroranschläge oder Amokläufe. Eine Traumatisierung sei ohnehin niemals eine hinreichende Begründung für ein solches Verbrechen, so Frottier weiter.51
Zentraler Auslöser für das Abgleiten in den Fanatismus seien vielmehr existenzielle Unsicherheiten
und Verzweiflung. Das Warten auf Erlösung von der empfundenen Trostlosigkeit löse Stress aus, wird dieser zu groß, wende man sich an den, der Sicherheit und Halt verspreche. Menschen unter
existenziellem Stress kämen mit ihren Ambivalenzen nicht zurecht und versuchten eine einseitige,
radikale Position einzunehmen, um die andere Position nicht zur Kenntnis
nehmen, nicht spüren zu müssen. Ambivalenzen halten diese vulnerablen Personen (als Antithese zu
resilienten Personen) nicht aus. Gerade viele Personen aus der soziologischen
Gruppe junger Flüchtlinge beispielsweise seien oft völlig anders sozialisiert, hätten Werte wie Freiheit, Toleranz und Demokratie in keinem Kindergarten und in
keiner Schule erlernt. Vielmehr waren in vielen Fällen Krieg und Angst ihre destruktiven Lehrmeister. Manchmal, so Frottier,
hegten sie Erwartungen, die zu hiesigen Normen und Werten der Erziehung konträr liefen: „Ein Afghane hat mir gesagt, die Sozialpädagogin sei viel zu nett zu ihm. Und dann schiebt er nach: ‚Wenn sie so nett ist, höre ich ihr nicht zu. Sie muss mich anbrüllen, sonst respektiere ich sie nicht!‘ Er hat die ersten 15 Jahre gelernt, dass man Autorität durch verbale Gewalt erlangt.“52 Patrick Frottier empfiehlt mit Blick auf dieses Dilemma, dergleichen
migrantische Jugendliche viel direkter anzusprechen und sie zu fragen, ob sie
wirklich hier bleiben wollen, oder ob wir statt dessen helfen sollten, sie auf
eine zukünftige Rückkehr vorzubereiten. In ersterem Falle stünde dann eine Ausbildung in Toleranz und Freiheit an, die Vermittlung von
Werten, „für die wir stehen“, und die, so sei hier hinzugefügt, auch genügend Jugendlichen ganz ohne jeden Migrationshintergrund vermittlungsbedürftig scheinen. Es sollte allen klar sein, dass Jugendliche aus weit autoritäreren Gesellschaften und Kulturräumen als der mitteleuropäischen in eine Lebenswelt kommen, die keine (oder weit weniger) der ihnen
vertrauten Zwänge und Gewalten ausübt, „und sie auf einmal eine nicht haltende Freiheit aushalten müssen.“ 53 Einigen gelinge dies nicht und sie fielen wieder in das Muster der früheren Erfahrungen und der erlebten Gewalt zurück. Hilfreich hierfür, so Frottier, wären Peer- bzw. Buddy-Projekte, also Teachings und Tutorien durch Gleichaltrige und/oder Vertreter
ihrer Community,